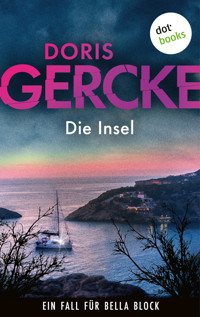11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: CulturBooks Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Die Berichterstatterin Karla Böhm wahrt gern ein wenig Distanz. Erst der plötzliche Tod des Fotojournalisten Kugler verlangt ihr eine intimere Rückschau ab. Sie durchforstet ihre Erinnerung, rekapituliert die gemeinsamen Taten. Ganz klar ist sein Tod ein Mord. Nur: Wer profitiert dabei? Und will sie dieses Gelände wirklich betreten? Doris Gercke, nüchterne und gnadenlose Chronistin im Spannungsgenre, fräst sich mit Die Nacht ist vorgedrungen einmal durch die letzten Jahrzehnte. Und fängt wie nebenbei Schieflagen und Lügen ein, die bis heute unsere Wahrnehmung von West und Ost, Männern und Frauen, Sieg und Niederlage, Vergangenheit und Gegenwart färben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 291
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Über das Buch
Die Berichterstatterin Karla Böhm wahrt gern ein wenig Distanz. Erst der plötzliche Tod des Fotojournalisten Kugler verlangt ihr eine intimere Rückschau ab. Sie durchforstet ihre Erinnerung, rekapituliert die gemeinsamen Taten. Ganz klar ist sein Tod ein Mord. Nur: Wer profitiert dabei? Und will sie dieses Gelände wirklich betreten?
Doris Gercke, nüchterne und gnadenlose Chronistin im Spannungsgenre, fräst sich mit Die Nacht ist vorgedrungen einmal durch die letzten Jahrzehnte. Und fängt wie nebenbei Schieflagen und Lügen ein, die bis heute unsere Wahrnehmung von West und Ost, Männern und Frauen, Sieg und Niederlage, Vergangenheit und Gegenwart färben.
Über die Autorin
Doris Gercke
Die Nacht ist vorgedrungen
Roman
Impressum
eBook-Ausgabe: © CulturBooks Verlag 2021
Gärtnerstr. 122, 20253 Hamburg
Tel. +4940 31108081, [email protected]
www.culturbooks.de
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Magdalena Gadaj
eBook-Herstellung: CulturBooks
Printausgabe: © Ariadne Verlag 2021
Lektorat: Else Laudan
Die Textauszüge auf den Seiten 226 –228 stammen aus:
Bertolt Brecht, Die Gedichte. Herausgegeben von Jan Knopf.
© Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2007.
Alle Rechte bei und vorbehalten durch Suhrkamp Verlag Berlin.
ISBN 978-3-95988-195-1
Vorwort von Else Laudan
»Völlig frei vom vermeintlichen Auflösungszwang des Kriminalromans«, schrieb Tobias Gohlis in der Zeit über die in Frisches Blut versammelten Geschichten von Doris Gercke (Ariadne im Print, bei CulturBoosk als Digitaledition). Auch ihr neuer Roman erteilt der Hoffnung auf Wiederherstellung einer geordneten Welt durch Aufklärung eines Verbrechens eine klare Absage. Die Nacht ist vorgedrungen lese und empfinde ich als radikale Erzählung aus der Wirklichkeit, die sich konsequent jeder Art von beschwichtigendem Fabulieren verweigert. Geschichtsbewusst und nie plakativ, eher im Vorbeigehen und zwischen den Zeilen legt sie bloß, wie im Schatten glitzernder Turboglücksversprechen Ungleichheit, Unrecht und menschenverachtende Praxen unbehelligt gedeihen.
Diese Schreibweise beeindruckt mich enorm, vor allem wegen dieser verblüffenden Balance zwischen schnörkelloser Nüchternheit und langem Nachschwingen noch der kleinsten Details, von denen jedes etwas Relevantes zum Gesamtbild beiträgt – wie es sich für exzellente Kriminalliteratur gehört. Doris Gercke leiht mir hier den Blick einer gefassten, skeptischen Beobachterin und Berichterstatterin. Wie sie in die Welt tritt, was sie sucht und was sie findet, wie sie sich positioniert und ihre Wahrnehmungen verarbeitet – ich finde das mitreißend wie einen Kinofilm und zum Denken anregend wie eine Zeitgeschehen-Ausstellung mit Alltagsfundament. Es ist erfrischend unerbittliche, kompromisslose Literatur, die als gegeben voraussetzt, dass wir etwas bewegen wollen und müssen, weil das Verbrechen in den Strukturen allzu gut aufgehoben ist. Und ich sehe, wie mutige (Kriminal-) Literatur den Enthüllungs- und Aufklärungsjob der vierten Gewalt übernimmt. Denn diese Geschichte muss erzählt werden.
I.
Eine Wohnung zu verwüsten bedeutet, die Menschen, die darin wohnen, absichtlich zu verletzen und ihnen klarzumachen, dass sie bedroht werden.
Wann hat sie angefangen, diese Geschichte, die beinahe ein Krimi ist, weil sie so viel Verbrechen enthält? Womit hat sie angefangen? Ich muss versuchen, ganz zum Anfang zurückzukehren, um ihr Ende zu verstehen.
1968
Von ihren Treffen erfahre ich aus der Zeitung. Später erzählte man mir, als ich dort auftauchte, hätten mich einige von ihnen für einen Spitzel gehalten.
Alles, was ich über sie weiß, ist mir durch Zeitungsartikel bekannt geworden. Sie wollten die Welt verändern, die eingefrorenen Verhältnisse zum Tanzen bringen (wie einige sagten) und den Krieg in Vietnam beenden helfen.
Was eingefrorene Verhältnisse sind, weiß ich, und das Pressefoto des nackten kleinen Mädchens auf einer leeren Straße, auf einer dunklen, drohenden Straße, man konnte die Bomben hören, wenn man auf das Gesicht des Mädchens blickte, habe ich gesehen. Es gibt keine andere Haltung, als gegen diesen Krieg zu sein; einer der Gründe, weshalb ich hingehe.
An einem der Abende, an denen ich dort bin, es muss am Anfang gewesen sein, denn ich erinnere mich nicht, dass ich schon Freunde unter ihnen habe, wird über eine Demonstration gegen den Vietnamkrieg gesprochen, und ich beschließe daran teilzunehmen. Ich hab noch nie an einer Demonstration teilgenommen. Darin bin ich sicher den allermeisten Westdeutschen gleich.
Ich gehe zum verabredeten Treffpunkt am Gänsemarkt, und als der dort versammelte Haufen sich in Bewegung setzt, laufe ich mit. Ein paar von den jungen Leuten, die meisten sind jünger als ich, erkenne ich wieder. Sie gehören zu der Gruppe, die ich regelmäßig besuche. Ich bleibe in ihrer Nähe, der eine oder andere winkt mir zu. Als wir (denke ich da schon wir?) in den Neuen Wall einbiegen, kommt die Polizei, viel Polizei, auch mit Pferden.
Um mich herum wird gelacht und behauptet, die Besitzer der Luxusläden fürchteten um ihre Schaufensterauslagen.
Die Polizisten versuchen, Einzelne aus dem Haufen herauszugreifen. Alle beginnen zu laufen, es wird Ho Chi Minh gerufen, rhythmisch, im Laufschritt, ich laufe mit, die Polizei greift immer noch zu, und ich bleibe stehen, bleib einfach vor einem der Luxusschaufenster stehen, so als betrachte ich die ausgestellten Handtaschen oder Kaschmirpullover, und in meinem Rücken rennt der Haufen, schlägt die Polizei auf Menschen ein, wird gerufen, geschrien, und ich gehe ruhig weiter zum nächsten Schaufenster und zum nächsten, bis der Tumult auf der Straße vorüber ist.
Es gibt ein Foto, ein oder zwei Jahre früher aufgenommen, auf dem der Mantel zu sehen ist, den ich damals trug: grober, heller Tweed, dunkle Knöpfe und ein beinahe weißer Pelzkragen, der bis zur Taille reicht, ein schöner, teurer Mantel, passend zu den Auslagen in den Schaufenstern, in deren Betrachtung ich versunken gewesen bin.
Es kann sein, dass diese Stunden, das Gewühl der Menschen, die prügelnde Polizei, Pferde, die Angst verbreiteten, die Situation, die neu für mich war und die ich nicht wirklich verstand, dazu beigetragen haben, Auslöser waren für meinen Wunsch, Journalistin zu werden. Herausfinden, was hinter den Dingen ist, das war es, was ich wollte.
Es gibt die Verabredung zu einem Treffen am Abend dieses Tages. Ich gehe hin und finde die anderen (hab ich da schon Genossen gedacht?) in einem kleinen Pavillon, der bis vor kurzem noch ein Blumenladen gewesen ist; eher ein Holzhäuschen, zu klein für die zwanzig oder dreißig Versammelten, die ihre Erfahrungen austauschen.
Viele wurden festgenommen. Einige sind gerade erst aus der Polizeihaft entlassen worden. Andere gleich nach ihrer Verhaftung. Einige wurden während der Demonstration geschlagen. In den Berichten der vorübergehend Festgenommenen liegt ein gewisser Stolz, und eine Zeitlang höre ich beschämt zu, weil ich versucht habe, mich nicht festnehmen zu lassen.
Zwei oder drei Männer gibt es, die älter sind als die anderen, etwa in meinem Alter. Sie führen das große Wort. Einen von ihnen, er hat mich bei den Treffen an den vergangenen Abenden sehr wohl wahrgenommen, aber nie mit mir gesprochen, rede ich am Ende der Versammlung an, obwohl ich ihn bei der Demonstration nicht gesehen habe.
Ich habe den Eindruck, ich hab etwas falsch gemacht, weil ich nicht verhaftet worden bin, sage ich. Er lacht.
Das ist Franz, und ich finde, dass er hässlich ist, ein blasser, rothaariger Typ, aber sein Lachen ist mir sympathisch. Wir haben uns dann näher kennengelernt. Wie sich unsere Wege wirklich verbinden werden, ist da nicht abzusehen.
Auf welche Weise in manchen Menschen der Wunsch entsteht, Schriftsteller zu werden, ist sicher schon untersucht worden. Was Rita betrifft, so habe ich bestimmte Vermutungen, die damit zusammenhängen, dass sie als Kind niemanden fand, dem sie ihre Gefühle bei der Entdeckung der Welt hätte mitteilen können. Wahrscheinlich gab es ein paar Versuche, die so ernüchternd für sie endeten, dass sie bald aufhörte, Erwachsene anzusprechen. Sie hat mir von einer Szene am Mittagstisch erzählt. Plötzlich war ihr bewusst geworden, dass das Leben gar nicht wirklich, sondern sehr wohl ein Traum sein könnte. Sicher eine verrückte Idee, aber eine kleine Nachfrage, ein einfaches »Warum, denkst du?« anstatt einer unwirschen Zurechtweisung, die sie beschämte, wäre vielleicht angebrachter gewesen. Mit anderen Kindern in ihrem Alter war sowieso nicht zu reden.
Ich glaube inzwischen, dass bei manchen Kindern Lesen und Schreiben Ausstiegsmöglichkeiten aus der Welt der Erwachsenen sind. Sie verdichten sich im Laufe der Jahre zu der Überzeugung, dass das wirkliche Leben in Büchern stattfindet. Es wunderte mich nicht, als Rita später ins Hamburger Schauspielhaus rannte, um ein Stück zu sehen mit dem Titel »Das Leben ein Traum«. Da hat sie mich mitgeschleppt. Ich glaube, wir haben beide nichts verstanden.
In den letzten Jahren vor dem Abitur sind wir sehr eng befreundet gewesen. Ich erinnere mich gut daran, mit welcher Begeisterung wir Goethes »Prometheus« lasen. Meine Lieblingszeile:
Ich kenne nichts Ärmeres
Unter der Sonne als euch, Götter!
Rita, schon damals sehr sicher, dass sie Schriftstellerin werden würde, liebte besonders den letzten Vers des Gedichts.
Hier sitz ich, forme Menschen
Nach meinem Bilde,
Ein Geschlecht, das mir gleich sei
Zu leiden, zu weinen,
Zu genießen und zu freuen sich.
Und dein nicht zu achten,
Wie ich!
Wir sind stolz darauf, das Kapitel Religion beendet zu haben. Und noch so jung und so naiv. Manchmal überlegen wir, ob der Verfasser des Gedichts daran gedacht hat, seine Verse auch für Frauen gelten zu lassen. Ich bin mir nicht sicher, Rita dagegen sehr. Sie ist bis zu ihrem zwölften Lebensjahr in der DDR aufgewachsen. Weibliche Ingenieure und Bauarbeiter sind ihr nicht fremd.
1978
Ich werde Journalistin. Meine erste Reportage schreibe ich über ein obdachloses Paar. Gar nicht gezielt, eher nebenbei werden dabei ein paar schwere Mängel in der Versorgung dieser Menschen aufgedeckt, fast entsteht ein Gesundheitsskandal. Und ich werde in Hamburg bekannt.
Es dauert nicht lange, bis eine große Illustrierte mich einlädt.
Die Herren möchten Sie gern kennenlernen.
Ich steh im Shirt am Telefon, rechts baumelt eine halb angezogene Socke am Fuß.
Gut, dass die Herren mich nicht sehen können, denke ich ziemlich albern, das macht wohl der Schock. Wer wird schon unverhofft von der größten Illustrierten des Landes angerufen und zum Nachmittag in die Chefetage bestellt.
Die Herren möchten mich persönlich kennenlernen. Ich setz mich auf die Sofalehne und beginne zu überlegen. Es wird so sein, dass man die Artikel gelesen hat, die ich gegen die Politik des Senats geschrieben habe. Die erscheinen in linken, eher bedeutungslosen Blättern. Jemand hat mir erzählt, dass Ausschnitte aus einer Reportage auf Flugblättern nachgedruckt wurden. Natürlich ohne mich zu fragen. Ich hätte gern zugestimmt.
Nun möchten die Herren mich kennenlernen …
Was zieh ich an?
Bist du verrückt?
Gut, also anziehen wie immer, ein Glück, dass ich gestern rechtzeitig ins Taxi gestiegen bin. Ein klarer Kopf ist jetzt wohl doch ganz praktisch.
Willst du überhaupt für die arbeiten?
Erst mal anhören, was sie wirklich wollen.
Der Raum ist zur Elbseite hin verglast bis zum Fußboden. Sehr leichte, sehr teure Stahlmöbel, auf dem Fußboden irgendetwas, das die Schritte verschluckt, aber mit Teppich falsch bezeichnet wäre. Das Gefühl, ich schwebe während des Gesprächs über der Elbe. Neben mir ein unglaublich teurer weiß-blauer Blumenstrauß in einer Bodenvase schwebt ebenfalls.
So kann man leben, denke ich, und die Umgebung könnte einschüchternd wirken. Aber ich bin nicht in der Lage, die Herren ernst zu nehmen. Im Gegenteil, ich habe Mühe, bei ihrem Anblick ernst zu bleiben. Alles an ihnen ist nach der Vorschrift »intellektueller, erfolgreicher Verleger« gestaltet, von der sorgfältig gebräunten Hautfarbe über die eleganten Bundfaltenhosen, Kord oder Leinen, bis zu den Budapester Schuhen.
Sie sind zu viert, nur einer von ihnen fällt aus der Rolle. Er trägt einen grauen Anzug und ich nehme an, dass er für die Finanzen verantwortlich ist. Meine Annahme stellt sich später als richtig heraus. Die Herren mir gegenüber kommen mir wie eine Neuauflage der Spiegel-Mannschaft von 1962 vor, die damals durch eine Auseinandersetzung mit Franz Josef Strauß eine Regierungskrise herbeigeführt hat. Vor ein paar Tagen habe ich im Fernsehen eine Dokumentation darüber gesehen. Die Bilder der Herren Augstein & Co vor Augen, sehe ich auf die Imitationen und habe Mühe, nicht zu lachen. Natürlich ist man nach der heutigen Mode gekleidet, aber sicher nicht mehr daran interessiert, Regierungskrisen auszulösen. Es geht hier um Auflage, mit welchen Mitteln auch immer.
Ist es eigentlich anrüchig, für solche Kasperpuppen zu arbeiten?
Nein. Ich werde zustimmen, wenn man mir einen Vertrag anbietet. Ich bin einzig und allein daran interessiert, meine Reportagen veröffentlicht zu sehen und einen Fotografen zu finden, mit dem ich zusammenarbeiten kann. Und diesen Fotografen bieten sie mir jetzt an. Er heißt Heiner Kugler, und ich habe seine Fotos in einer Ausstellung gesehen. Ich war beeindruckt und hatte die Bilder lange im Kopf.
Einige Tage später, ich schwebe noch immer auf Wolken durch meine Wohnung, klingelt das Telefon.
Ja?
Kugler. Wir sollten uns treffen. Doc Cheng, das Restaurant unten in den Vier Jahreszeiten.
Ich stimme zu und schwebe weiter durch meine Wohnung. Ich weiß jetzt, dass etwas Neues beginnt, etwas Unerhörtes, von dem ich noch nicht weiß, wie es endet. Aber das macht nichts, alles, nur nicht die Routine fortsetzen, die mir bevorstehen könnte: kleine Zeitungen, links, aber einflusslos, viel Arbeit, wenig Geld. Ich hab nichts gegen Arbeit, aber sie sollte sich lohnen. Mein Blick fällt auf den Schreibtischstuhl, der keiner ist, sondern ein übriggebliebener Küchenstuhl aus der Küche der Schwester meiner Großmutter, ein schönes Stück, handgefertigt, und bei längerem Sitzen garantiert Rückenschmerzen.
Doc Cheng. Als ich ankomme, sehe ich Franz. Das gefällt mir nicht. Bei einem so wichtigen Treffen möchte ich nicht gern beobachtet werden. Er sitzt an einem der hinteren Tische und winkt mir zu. Erst als er aufsteht und mir langsam und grinsend entgegenkommt, verstehe ich, dass er der Heiner Kugler ist, dessen Fotos ich bewundere.
Ich kann die Enttäuschung spüren, die meine Knie weich werden und meinen Atem langsamer gehen lässt. Ich muss mich zusammennehmen, mein Gesicht, ich werde lächeln.
Franz!
Er berührt leicht meinen Arm, und wir gehen gemeinsam an den Tisch zurück, an dem er gesessen hat.
Es ist zehn Jahre her oder noch länger, dass wir uns auf eine Affäre eingelassen hatten, eine kurze Affäre, Franz war verheiratet. Ich weiß nicht, was er seit damals gemacht hat. Wie ich jetzt erfahre, ist er nach Essen gegangen und hat an der Folkwangschule Fotografie studiert. Dort hielt man noch immer die Otto-Steinert-Tradition der subjektiven Fotografie in Ehren, was ihn zugleich angeregt, herausgefordert und wütend gemacht hat; eine gute Mischung, um einen eigenen Stil zu entwickeln.
Natürlich sind die Herren im Glaspalast irgendwann auf ihn aufmerksam geworden Er arbeitet schon eine Zeitlang für sie, und es ist ihnen eingefallen, dass man ihn noch besser verwerten könnte, wenn er jemanden zur Seite hätte, die ihm Inhalte liefert. Ihm hat man schon ein paar Tage vorher gesagt, mit wem er arbeiten soll. Anders als ich war er also auf unsere Begegnung vorbereitet.
Unsere erste gemeinsame Arbeit ist die Reportage über einen Polizeieinsatz in einem Heim für Asylanten. Wir sind dabei, als unter dem Vorwand, dass dort Drogengeschäfte abgewickelt würden, und nachdem die Polizisten alle schwarzen Bewohner festgenommen und weggefahren haben, die Baracke kurz und klein geschlagen wird.
Werden Drogen gefunden?
Wen interessiert das?
Mich und den Heimleiter, aber wir zählen nicht.
Franz macht beeindruckende Fotos von eingetretenen Türen, umgestürzten Doppelstockbetten, aufgehackten Fußböden und begeistertem Publikum aus der Nachbarschaft. Ich schreibe einen Text dazu, und wir werden in der Redaktion sehr gelobt. Die Ausgabe erscheint.
Ich sitze am Schreibtisch und betrachte die Seiten. Das Telefon klingelt: Franz.
Wir verabreden uns in einer Stunde bei Bobby Reich an der Alster. Seiner Stimme höre ich an, dass er beunruhigt ist.
Ich bin zuerst dort, sitze im Mantel auf der noch leeren Terrasse und betrachte die Boote am nahe gelegenen Anleger, sehe weit hinten einen Alsterdampfer am Ufer halten, die Zweige der Weiden sind aus der Entfernung hellgrün und fächeln eine Handbreit über dem Wasser. Es ist still.
Oben auf dem Gehweg höre ich ein Fahrrad heftig bremsen. Gleich darauf kommt Franz. Seine Schritte klingen hart und ungeduldig.
Du hast das gesehen, nehme ich an?
Ja, sage ich.
Und?
Tja, sage ich und sehe ihn abwartend an.
Er ist wütend, und ich bin erstaunt. Ich hab ihn unterschätzt, glaube ich.
Also, sagt er, es kann ja sein, dass du mit diesem Artikel zufrieden bist. Es kann ja sein, dass du findest, wir haben unsere Arbeit getan, wenn wir den Senat anpinkeln. Kann sein, aber mir reicht das nicht. Ich hab zufällig eine Ahnung davon, was sonst noch auf der Welt los ist. Wie viel Geld hast du auf dem Konto?
Was? Wieso Geld?
Begreifst du nicht? Wir kündigen unseren Vertrag. Wir machen uns selbständig. Den ersten Einsatz müssen wir vorfinanzieren.
Ich starre ihn an. Hab ich richtig verstanden?
Glotz nicht so blöd. Was ist, machst du mit oder willst du lieber weiter dafür sorgen, dass die Hamburger ein gutes Gewissen haben dürfen? Wir haben ja unsere Klara. Die sorgt schon dafür, dass nichts unter den Tisch gekehrt wird. Und wie gut sie schreibt. Und die Fotos! Als wären wir dabei gewesen. Jetzt sind dem Senat die Probleme bekannt. Man wird für Abhilfe …
Jetzt halt mal den Mund. Es ist nicht nötig, dass du dich weiter aufregst. Wir bekommen das Geld für diesen Auftrag. Ein bisschen hab ich noch auf dem Konto. Hast du einen konkreten Plan oder plusterst du dich nur auf?
Wir sehen uns an, schweigend und abschätzend.
Eine Kellnerin kommt an unseren Tisch. Wir hören ihre Schritte auf der Holzterrasse, leichter als die vorhin von Franz. Wir starren uns weiter an.
Sie sollten lieber nach drinnen kommen, sagt die Kellnerin. Hier draußen ist es doch noch ziemlich kalt. Um diese Jahreszeit kann man nicht vorsichtig genug sein.
Nicht vorsichtig genug, das ist unser Stichwort. Wir lachen so laut, dass die Kellnerin einen Schritt zurücktritt, aber sie geht nicht. Jetzt starrt sie uns an.
Wir bleiben draußen, sage ich endlich. Und wir könnten was zu trinken vertragen.
Wir, Franz und ich, haben von Anfang an mehr Aufträge, als wir zum Überleben brauchen. Vorerst bewegen wir uns noch innerhalb des Landes.
Ich weiß, dass es irgendwann auch um Kriegsreportagen gehen könnte. Franz denkt darüber nach. Mir ist bald klar, dass ich nicht die Absicht habe, eine zweite Lee Miller zu werden. Das Foto, auf dem sie sich am Ende des Zweiten Weltkriegs in Hitlers Badewanne abbilden ließ, hat mich abgestoßen. Vielleicht war es in einer Art von Siegesrausch entstanden. Aber was für ein Rausch ist das, der zuvor fünfzig Millionen Tote gefordert hat.
Sehr schnell können wir uns aussuchen, woran wir arbeiten wollen. Es versteht sich von selbst, dass unsere Einnahmen steigen.
Was Geld betrifft, so haben wir von Anfang an unterschiedliche Vorstellungen. Ich weiß immer, dass ich irgendwann einen Rückzugsort haben will. Deshalb versuche ich, mein Geld zusammenzuhalten. Franz gibt sein Geld aus, er ist eigentlich immer pleite. Was er genau mit dem Geld macht, interessiert mich nicht. Wir sehen uns in der Zeit, in der wir gemeinsam unterwegs sind. Manchmal schlafen wir miteinander, und zwar nicht, wie man annehmen könnte, um uns zu trösten oder die Dinge vergessen zu machen, die wir gesehen haben. Nein, wenn es etwas zu bewältigen gibt, dann macht jeder das mit sich allein aus. Wir schlafen miteinander, wenn es, was durchaus vorkommt, Leerlauf gibt, oder wenn wir an einem Thema arbeiten, das uns zwischendurch langweilt. Ich kann nicht sagen, dass Langeweile ein schlechter Grund wäre, miteinander ins Bett zu gehen. Man hat alle Zeit der Welt, um sich nicht-alltäglichen Vergnügungen hinzugeben.
Unsere Auftraggeber halten sich an Franz, wenn sie uns engagieren wollen. Das ist mir recht, denn wenn es darauf ankommt, verhandelt Franz hart, und er legt großen Wert darauf, vorher mit mir zu besprechen, ob wir den Auftrag annehmen sollen oder nicht. Es kommt vor, dass mir nicht recht klar ist, wer eigentlich unsere Auftraggeber sind, wenn es darum geht, politische Veranstaltungen, Parteitage zum Beispiel, zu begleiten. Hat die Partei uns beauftragt? Schwer zu glauben, dass die sich unser Honorar leisten können. Manchmal sehe ich unsere Arbeit im Fernsehen, dann ist der Auftraggeber klar. Aber nie sehe ich irgendwo eine ausführliche Reportage über einen Parteitag der Kommunisten. Für den halten wir uns drei Tage lang in einem Hotel auf. Zeit für Langeweile; allerdings auch ein paar interessante Momente. Einer der Redner, er kommt aus der DDR, beschwört in poetischen Worten das Ende des Kapitalismus. Ein kleiner, dicker Mann zitiert mit feierlicher Stimme eine Ballade von Richard Dehmel:
Es fegt der Sturm die Felder rein,
Es wird kein Mensch mehr Hunger schrein.
Mahle, Mühle, mahle!
Er reißt die Versammelten zu Begeisterungsstürmen hin, und ich denke einen Augenblick darüber nach, woran es liegt, dass eine Verbindung von Politik und Poesie so selten möglich ist. Ein anderer Redner spricht über seine Erfahrungen am Arbeitsplatz, er fasst seine Erkenntnisse in die Worte »der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen« und beschreibt das Wort Durchschnittslohn anschaulich mit einem Gefühl, das bei ihm entsteht, wenn er seine Beine in zwei Schüsseln stellt, die eine mit eiskaltem und die andere mit kochend heißem Wasser gefüllt; ein einfacher Mann, vielleicht Arbeiter oder Bauer, auf jeden Fall in der Lage, so zu sprechen, dass man ihm zuhört. Auch er erhält starken Applaus. Für uns, Franz und mich, ist das trotzdem nicht genug, um eine gewisse Langeweile zu bekämpfen, die uns bei solchen Veranstaltungen schnell befällt. Was dagegen zu tun ist, wissen wir.
Ich bin einen Augenblick eingeschlafen. Als ich aufwache, ist der Platz neben mir leer. Das empfinde ich als angenehm, aber als der Platz nach einer Stunde immer noch leer ist, stehe ich auf und begebe mich ins Bad. Ich sehe, dass Franz seine Ausrüstung dort abgestellt hat. Er wird also wiederkommen. Hab ich daran gezweifelt?
Ich setz mich auf den Rand der Badewanne, betrachte mich im Spiegel gegenüber und beginne über Franz nachzudenken.
Vor ein paar Tagen hat er mich um Geld gebeten, nur vorübergehend. Ich weiß, dass er das Geld zurückgeben wird. Soll ich trotzdem mit ihm darüber reden? Ich hab keine Lust, ihm dauernd aus der Klemme zu helfen. Oder stört es mich, dass ich nicht weiß, was er macht, wenn wir nicht zusammen sind?
Sei ehrlich!
Ich weiß, dass es mich nicht stört. Es ist etwas …
Ich höre, dass die Zimmertür geöffnet wird.
Hallo?
Franz ist zurück, steht gleich darauf vor mir und sieht auf mich herab. Es ist etwas in seinen Augen, das mir fremd ist. Er pfeift anerkennend durch die Zähne, grinst unverschämt und hebt abwehrend die Hände, als ich wütend werde.
Wir sollten uns da unten den Schluss der Veranstaltung ansehen, sagt er, es ist gleich so weit.
Er geht an mir vorüber, nicht ohne mein Knie zu berühren, greift nach den Kameras und verschwindet nach nebenan.
Beeil dich, hör ich ihn rufen.
Während wir kurz darauf im Fahrstuhl hinunterfahren, besprechen wir unsere Abreise.
Ach, übrigens, sagt Franz, als wir unten in der Halle angekommen sind, hier ist dein Geld zurück. Danke.
Er holt die Scheine aus der Hosentasche, und als ich ihn fragend ansehe, sagt er, ich hab Schulden bei dir, andere haben Schulden bei mir, ist doch normal, oder?
Er lacht und hält mir die Scheine hin, die ich lose in meine Jackentasche stecke. Vom Ende der Hotelhalle her, dort, wo die Türen in den großen Saal führen, hören wir Gesang.
Mist, ruft Franz und rennt los, nun sind sie fertig. Hoffentlich singen sie vom Trauermarsch alle Strophen.
Im Saal sind die Menschen aufgestanden, während sie die Internationale singen. Einige recken ihre Faust in die Höhe. Vor mir sehe ich einen alten Mann, groß und gebeugt. Ich beobachte sein Gesicht, stolz und traurig zugleich, und denke, dass ich seine Geschichte kennen möchte.
Welcher Trauermarsch, flüstere ich Franz zu, als ich ihn erreicht habe.
Das ist nicht von mir, flüstert er zurück, George Bernard Shaw, die Internationale – »Trauermarsch für einen gebratenen Aal«.
1989
Ich hab eine kleine Wohnung in Hamburg, vier Treppen hoch, in einem Viertel, das noch in den fünfziger Jahren ein Vergnügungsviertel für arme Männer gewesen ist, nicht für arme Leute, für arme Männer, die sich an armen Frauen vergnügten; kein Vergleich mit St. Pauli, sowohl was die Preise als auch was die bunten Lichter betraf. Ich wohn gern hier, aber ich bin wenig zu Hause, und wenn ich unterwegs bin, beginne ich von einem Haus auf dem Land zu träumen.
Hab ich doch immer gewusst, sagt Franz, als ich ihm in einer unvorsichtigen Stunde davon erzähle.
Was hast du gewusst?
Dass du nichts weiter bist als eine reaktionäre Spießbürgerin, fehlen nur noch Mann und Kinder.
Ich sehe ihn an und stelle fest, dass er tatsächlich wütend ist. Ich weiß, weshalb. Ich bin in meiner Wohnung immer allein geblieben. Es ist sicher so, dass er mich gern besucht hätte. Aber ich wollte ihn dort nicht haben, nicht ihn und keinen anderen Mann. Die Wohnung ist für mich allein. Darauf bestehe ich. Irgendwann hat er sein Drängen aufgegeben, aber er hat sich geärgert und ärgert sich noch, auch wenn er es nicht wahrhaben will.
Wie um meine Gedanken zu bestätigen, sagt er: Am besten du heiratest einen Bauern, der schon ein paar Kinder hat. Erste Frau im Kindbett gestorben …
Halt den Mund, wenn nicht deutlich werden soll, wer hier der Reaktionär ist, antworte ich, und er ist tatsächlich still.
Wir liegen nebeneinander im Bett, in einem Hotelzimmer, das so groß ist wie meine Wohnung samt Küche und Bad. Unser Verhältnis ist in den letzten Monaten enger geworden. Ich hab das zugelassen, auch weil ich ahne, dass sich bald etwas ändern wird. Die Zeit fühlt sich anders an als sonst. Das kann ich an verschiedenen Ereignissen festmachen. Seit Wochen reisen Menschen aus der DDR nach Ungarn und bleiben dort. Franz, immer ein aufmerksamer Beobachter der politischen Szene, reißt Witze über Gorbatschow.
Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben, und der Trottel weiß nicht, dass er über sich selbst spricht.
Manchmal fahre ich für ein paar Stunden aufs Land. Einmal treffe ich dort auf der Straße, nein auf einem Feldweg, eine alte Frau. Ich sehe sie schon von weitem, gehe langsam, um sie nicht zu erschrecken. Sie bleibt neben einem blühenden Holunderbusch stehen, biegt einen Zweig zu sich herab und atmet selbstvergessen den Duft der Blüten ein. Als ich sie erreicht habe, wendet sie sich lächelnd mir zu.
Das bleibt auf jeden Fall, sagt sie.
Ich lächle zurück, gehe weiter und bin von da an den ganzen Tag damit beschäftigt, darüber nachzudenken, was die alte Frau gemeint haben könnte. Auf den Feldweg bin ich geraten, weil ich auf der Suche nach meinem Haus bin.
Abends treffe ich mich mit Franz in einem Landgasthaus, wo ich für ein paar Tage ein Zimmer genommen habe. Wir wollen besprechen, welchen von den Aufträgen wir annehmen werden, die er für uns organisiert hat. Wir sitzen beim Abendessen, Bauernfrühstück, die Speisekarte ist begrenzt.
Wird Zeit, dass du hier wegkommst, sagt Franz. Du siehst schon aus wie ein Bauerntrampel.
Ich fühl mich wohl, antworte ich.
Wie du willst. Ich sag dir, wenn du dich tatsächlich hier irgendwo niederlässt, ist das das Ende.
Ich sehe ihn an, sehe die Tränensäcke unter seinen Augen, die deutlicher geworden sind, und den Dreitagebart, der die schlaffe Gesichtshaut verdecken soll. Ich vermute, er verbringt zurzeit die Nächte in seiner Lieblingskneipe, zwischen abgehalfterten Journalisten und ein paar Edelfedern, denen gemeinsam ist, dass der Alkohol sie im Griff hat. Diese Kneipe zeichnet sich dadurch aus, dass es dort still ist, keine Musikberieselung, nicht einmal eine Box, die man bedienen könnte, wenn man Musik hören wollte; die Stille und die elegante, schon leicht verwohnte Einrichtung, die man von außen durch die großen Scheiben undeutlich erkennen kann – das Licht innen ist nicht besonders hell –, hält gewöhnliche Kneipengänger davon ab, einzutreten. Ich bin einmal dort gewesen, um Franz abzuholen. Man saß einzeln in tiefen Sesseln an den Tischen. Franz behauptete, ich sei zu früh gekommen. Irgendwann in der Nacht würde geredet. Ich glaube, nur durch meine Anwesenheit war ihm plötzlich bewusst geworden, was für ein merkwürdiger Haufen sich Abend für Abend in der Bar einfand. Frauen gab es dort keine. Irgendwie passte er da nicht hin, es war ihm nur noch nicht aufgefallen.
An dem Abend im Landgasthaus streiten wir uns nicht weiter. Ich erzähle ihm von der alten Frau und von ihrem »Das bleibt auf jeden Fall«, das mich den Tag über beschäftigt hat. Ich spreche auch darüber, dass ich eine innere Unruhe spüre, das Gefühl, als würde etwas geschehen, aber ich weiß nicht, was das sein kann.
Es stellt sich heraus, dass er versteht, wovon ich rede. Ebenso wie ich ist er unruhig.
Irgendwas liegt in der Luft, sagt er. Ich hab keine Ahnung, was sich zusammenbraut. Andererseits, das Volk ist blöde wie eh und je – ich erzähl dir was. Ich war in Duisburg-Ruhrort, hat mit der Sache zu tun, von der ich dir noch erzählen muss. Morgens im Hotel. Ein alter Mann, hustend, schlappt an den Frühstückstisch. Seine Frau, ebenfalls verarbeitet, gleich alt, dick, schlappt hinterher. Er weist ihr ihren Platz am Tisch an. Sie hat sich schon einen anderen Stuhl ausgesucht, aber sie gehorcht. Er setzt sich, lässt rechts und links neben dem Stuhl die Arme herunterhängen wie gebrochene Flügel. Sie beginnt das Frühstück heranzuschleppen, aber nur für ihn. Sie macht ein Käsebrot, schneidet es in Stückchen, schiebt ihm den Teller hin, schenkt ihm Kaffee ein, dann holt sie Frühstück für sich selbst, setzt sich, füllt Milch in seine Tasse, Zucker, rührt den Kaffee um, seine Arme hängen immer noch herunter. Ich fange an ihn zu bedauern, weil ich ihn für gelähmt halte.
Da greift er nach der Zeitung, die sie neben sein Gedeck gelegt hat, und beginnt ihr vorzulesen. Er liest vor, laut genug, dass ich mithören kann, dass Alfonso von – keine Ahnung, hab ich vergessen – also Alfonso von Trallala hat sich beim Skifahren den Kopf abgeschnitten.
Sie, inzwischen dabei, für sich selbst ein Brötchen mit Marmelade zu bestreichen, sagt:
Ja, ja, die haben es auch nicht leicht.
Wir lachen beide und sind uns darin einig, dass das Volk, der große Lümmel, so unbeweglich ist wie immer. Was soll also sein? Aber ich weiß, dass unsere Beunruhigung nicht verschwunden ist, weder meine noch die von Franz.
Wir überlegen, wohin unsere nächste Reise gehen soll. Ich finde die Anfragen, die Franz gesammelt hat, diesmal nicht besonders attraktiv, und ich habe den Eindruck, dass er selbst nicht überzeugt ist.
Ich hab hier ein paar Ideen notiert, sagt Franz, aber ich kann noch nicht gleich loslegen. Ich hab noch eine private Sache zu erledigen.
Privat? Musst du eine deiner Freundinnen beruhigen, bevor wir reisen?
Red keinen Unsinn, ich hab … ach, vergiss es, wenn es nach mir ginge, ich würde am liebsten in die Sowjetunion reisen. Man müsste sich ansehen, wie es jetzt dort wirklich zugeht, die Provinz, meine ich, das Leben auf dem Land, die Nutten in Moskau; seit Gorbatschow ändert sich da viel. Niemand wird mich hindern zu fotografieren, du kannst Interviews machen, so viele du willst …
Ich spreche nicht Russisch.
Na und? Dolmetscher kann man mieten.
Wir haben keinen Auftraggeber. So eine Unternehmung ist teuer.
Wir machen ein Buch, was hältst du davon?
Für welchen Verlag?
Das lass mal meine Sorge sein.
Wir trinken Bier und hin und wieder einen Schnaps dazu. Die Wirtin, eine freundliche Frau in einer gestärkten Kittelschürze, stellt uns irgendwann unaufgefordert einen Teller mit kleingeschnittenem Schinkenbrot und Gewürzgurken hin.
Kleine Grundlage, sagt sie und lächelt uns zu.
Es ist für die Grundlage schon zu spät. Wir sind beide nicht mehr nüchtern und ziemlich bald wirklich betrunken. Wir haben Mühe, nicht allzu sehr zu schwanken, als wir nach oben gehen. Ich sehe aus den Augenwinkeln, dass Franz den Teller mit den Resten des Schinkenbrots balanciert. Hinter mir betritt er das Zimmer, ich falle auf das Bett und schlafe sofort ein.
Als ich aufwache, es muss gegen Mittag des nächsten Tages sein, bin ich allein. Die Schinkenstückchen drüben auf der Kommode haben sich gekrümmt. Sie haben die Sonne, die durch die geöffneten Vorhänge scheint, nicht vertragen. Der Platz neben mir ist so leer, als habe dort nie jemand gelegen.
Ich hab Lust auf Kaffee, versuche mich einigermaßen herzurichten und gehe hinunter in die Gaststube.
Die Wirtin sieht mir lächelnd entgegen. Der Raum ist leer. Sie sieht meine Blicke.
Der Herr lässt Ihnen ausrichten, er sei zu Fuß nach Frankreich, sagt sie, möchten Sie frühstücken?
Ich möchte.
Zu Fuß nach Frankreich ist eine Redewendung zwischen Franz und mir, verballhornter Schiller, Maria Stuart, glaube ich. Sie besagt, dass sich jemand aus dem Staub gemacht hat.
Ich bleibe noch ein paar Tage im Gasthaus. Franz vermisse ich nicht, im Gegenteil, ich bin sicher, dass er mir meine Fahrten durch das Land auf der Suche nach einem Haus nur verderben würde. Ich nehme Kontakt mit mehreren Maklern auf und fahre die Angebote nacheinander ab. Nichts ist darunter, was meinen Vorstellungen oder meinem Geldbeutel entspricht. Einmal stehe ich zwischen mindestens fünfzig Dalmatinern in einem Haus, das fürchterlich nach Hund riecht. Um den Geruch zu beseitigen, müsste man es abreißen.
Ich fahre zurück ins Gasthaus, zahle meine Rechnung und reise ab. Für diesmal hab ich genug vom Haussuchen.
Für die nächste Zeit habe ich ein paar Anfragen, kleinere Reportagen für linke Zeitschriften, bei denen es um das Leben von Frauen geht; Kassiererinnen, einmal soll es um Frauen gehen, die aus der Stadt aufs Land gezogen sind, um dort als Bäuerinnen zu leben. Ich mach diese Arbeiten gern, es ist geradezu unglaublich, auf wie viele verschiedene Weisen Frauen dazu beitragen, dass die Gesellschaft funktioniert, ohne dass sie dafür den entsprechenden Lohn bekommen. Die Landreportage nimmt mich länger in Anspruch, und irgendwann bin ich froh, wieder in der Stadt zu sein.
In der Wohnung in Hamburg stapeln sich die Zeitungen der vergangenen Wochen. Ich stürze mich mit Begeisterung darauf, sie durchzusehen. Vielleicht ist das Landleben doch nicht das, was ich brauche. Meine Begeisterung lässt irgendwann nach, als ich lese, dass das Oberlandesgericht Düsseldorf eine junge Frau, die ganz sicher keine Terroristin ist, zu einer hohen Gefängnisstrafe verurteilt hat. Am selben Tag bestätigt der Bundesgerichtshof den Freispruch für einen NS-Verbrecher.