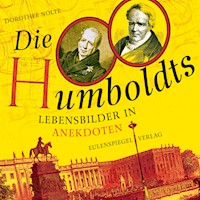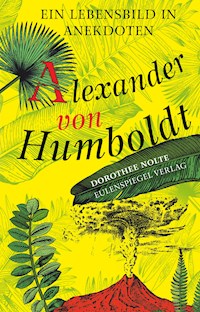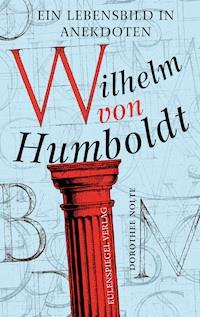3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Wenn doch alle Seminare so lebensnah wären wie das von Professor Knospe. Allen Teilnehmern des Intrige-Seminars an der Berliner Humboldt-Universität wird klar, daß dies ihr Leben verändern wird. Mit spielerischer Leichtigkeit und frechem Witz schickt Dorothee Nolte eine Gruppe Berliner Studenten auf eine Reise, bei der Dichtung und Wahrheit in einem völlig neuen Licht erscheinen. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 252
Ähnliche
Dorothee Nolte
Die Intrige
Ein Campus-Roman
FISCHER Digital
Inhalt
Für Otto
Abschied mit Paprikastreifen
Carlo der Ingenieur hatte Rotwein mitgebracht und Sigmund der Doktorand Paprikastreifen. An Gläser hatte niemand gedacht, also holte man Keramikbecher aus dem Studenten-Café »Keller« unten im Hof. »Bringt auch Teller mit!« schrie Britta den Davoneilenden hinterher. Sie hatte Kartoffelsalat im Rucksack und Wehmut im Herzen. Warum muß alles immer ein Ende haben, dachte sie. Ich finde Anfänge viel schöner.
Als Professor Knospe, wie immer etwas verspätet und mit einem grünlichen Sakko behängt, in der Tür des Hörsaals 413 erschien, war alles schon angerichtet: Die gesunden Paprikastreifen waren mit den Konservierungsstoffen des Kartoffelsalats eine innige Verbindung eingegangen, und der Kuchen vom Stehcafé am Eck krümelte auf die Tischdecke aus Zeitungspapier. Carlo der Ingenieur hatte seinem Rotwein bereits zugesprochen und strahlte unverhüllte Lebensfreude aus. Britta setzte sich aufrecht hin, um ihre überflüssigen Pfunde an Bauch und Hüfte zu disziplinieren, und Jonas der Jurist hörte auf, sein Handy zu streicheln. Nur Eva die Ethnologin feilte ungerührt weiter ihre Nägel und blickte dabei meditativ auf den blaßblauen Linoleumboden.
Der Professor zog eine seiner grauen Augenbrauen hoch. »Nanu«, sagte er streng, »welcher Intrige habe ich das zu verdanken?«
Alle lachten, obwohl die ewigen Anspielungen auf das Seminarthema eigentlich schon nicht mehr komisch waren. Sigmund der Doktorand gab sich als Ober-Intrigant zu erkennen und Britta als Mit-Verschwörerin. »Wir dachten, daß ein so ungewöhnliches Seminar wie dieses einen würdigen Abschluß finden muß«, erklärte Sigmund etwas umständlich und schob den würdigen Kartoffelsalat vorsichtig in Richtung Professor. »Eigentlich dürfte das Seminar noch gar nicht zu Ende sein«, ergänzte Britta. »Könnte es nicht im Wintersemester weitergehen?«
Der Professor fühlte sich geschmeichelt. Es lohnte also doch, sich in der Lehre zu engagieren! Bei all dem Ärger mit Einsparungen, hilflosen Gremien, sinnlosen Studienordnungen – es gab an der Universität doch noch jene Momente, deretwegen er seinerzeit Professor geworden war: das anregende Gespräch mit Menschen unterschiedlichen Hintergrunds, überraschende Ideen und Bezüge, die aufblitzen, die beinahe körperlich spürbare Befriedigung des Gehirns durch das Denken neuer Gedanken. Interdisziplinarität in der Lehre ist das Geheimrezept, dachte er und betrachtete gerührt Carlo den Ingenieur, der mit gesundem Appetit ein ungesundes Stück Kuchen verspeiste. Wie wäre es sonst möglich, daß ein Student der Ingenieurwissenschaft den Weg von der Technischen Universität ins Institut für Kulturwissenschaft der Humboldt-Universität, vom Charlottenburger Ernst-Reuter-Platz in die Sophienstraße in Mitte findet?
Als besonderes Verdienst rechnete Knospe es sich an, Jonas den Juristen über zwei volle Semester gefesselt zu haben; er kam sogar aus dem idyllischen Dahlem hierher, von der Freien Universität, und war von seinem Fachbereich ganz andere Kleidungssitten gewöhnt, als sie hier herrschten. Die kleine Britta hatte ein knallgelbes, lackartig glänzendes Hemdchen an, dessen Kragen fast so orange war wie ihre Haare, und Eva die Ethnologin trug eine Naturtextilie aus beigem Leinen ohne erkennbaren Schnitt, wie sie unter Juristen noch nie gesichtet worden war. Sie sah den Professor mit jenem seelenruhigen, rätselhaften Blick an, den er nie hatte entschlüsseln können. Als einzige Teilnehmerin hatte Eva keine Hausarbeit geschrieben, kein Referat gehalten, war niemals in seiner Sprechstunde gewesen und würde auch keinen Schein bekommen. Sie hatte lediglich hin und wieder ein paar anregende Bemerkungen zur Intrige auf Bali oder in der schleswig-holsteinischen Landjugend beigetragen. Schätzte sie ihn oder machte sie sich über ihn lustig?
Sheila die Geschlechterforscherin aus den USA brachte wieder Eindeutigkeit in die Gedanken des Professors. »Dieses Seminar war das beste, das ich in Deutschland bisher gemacht habe«, sagte sie und fuhr sich mit einem grünen Paprikastreifen durch die langen dunklen Haare. Da sie nicht als Kulturimperialistin auftreten wollte, verkniff sie sich zu sagen, was sie normalerweise an deutschen Seminaren störte: Die Studenten sahen ihre einzige Aufgabe darin, irgendwann im Semester ein ellenlanges, stockend vorgetragenes Referat zu halten, und die Professoren verfügten über das rhetorische Talent eines Maulwurfs und den Humor einer Bratpfanne. In Berkeley, wo sie herkam, war das alles ganz anders.
»Auch für mich war dieses Seminar sehr ungewöhnlich«, erklärte der Professor feierlich, während die Glocke der benachbarten Sophienkirche elf Uhr schlug. Die Julisonne warf einen energischen Strahl durch das Fenster des Hörsaals 413, der wie zur Bekräftigung auf dem Hinterkopf des Professors landete. »Am Beispiel der Intrige zeigt sich nicht zuletzt, wie notwendig unser Fach Kulturwissenschaft ist. Keine Einzeldisziplin hätte es vermocht, alle Aspekte der Intrige im Spannungsfeld von Mündlichkeit, Schriftlichkeit, Medialität bis hin zum Internet zu beleuchten.« Dies sagte der Professor an die Adresse seiner abwesenden Kritiker, die nicht müde wurden, das Fach Kulturwissenschaft als »Spielwiese« und die Fachvertreter als Dilettanten abzuqualifizieren – Fehlurteile, die Knospe regelmäßig auf Tagungen und in Publikationen korrigieren mußte. »Ich habe noch nie Studenten so unterschiedlicher Fachrichtungen in einem Kurs gehabt« – Carlo richtete sich auf und lächelte breit in die Runde, er wußte, daß er unter lauter Kultur- und Sozialwissenschaftlern der Exot war –, »und auch das bestätigt mich darin, daß ich das richtige Thema gewählt habe«. Die Studenten nickten wohlwollend; ein gewisses Maß an Eitelkeit mußte man einem Professor als unvermeidliche Berufskrankheit verzeihen. Schließlich war Knospe wirklich brillant.
»Vor allem aber ist das Seminar durch Ihre Mitarbeit so interessant geworden«, fuhr der Professor fort. Seine Karriere währte nun schon über zwanzig Jahre, und oft war er sich beim Versuch, aus einem Haufen nägelbeißender, walkmanhörender, häkelnder und schiffchenmalender Studenten einen Funken Enthusiasmus hervorzulocken, vorgekommen wie einer, der auf einem Nilpferd Dressur reiten möchte. Dieses Seminar hob sich wohltuend von den üblichen Dressurversuchen ab. Knospe war in Geberlaune, und sein grünliches Sakko begann im Sonnenlicht zu glänzen. »Ich habe ja gar nicht geahnt, aus wie vielen Blickrichtungen man das Thema ›Intrige‹ betrachten kann. ›Das Geschlecht der Intrige‹«, er goß sich Rotwein in einen giftgrünen Keramikbecher und prostete Sheila zu, »›Die Intrige: Authentizität und Kopie‹«, er schwang den Becher in Richtung Hans, »Die Intrige und ihre Leerstellen im Werk von Giuseppe Firenze‹«, Britta errötete, jedes Mal wenn Knospe sie so durchgeistigt ansah, wurde sie rot, »ja sogar die Intrige bei der Einwerbung von Drittmitteln für den Fachbereich Verfahrenstechnik der TU!« Carlo strahlte. Seine Hausarbeit für dieses Seminar barg so viel Sprengstoff, daß er sie erst nach seinem Diplom würde an die Öffentlichkeit bringen können. Mit frischem Appetit wuchtete er einen Schöpflöffel Kartoffelsalat auf seinen Pappteller.
»Ich kann gar nicht all die interessanten Themen aufzählen, die in den vergangenen beiden Semestern hier behandelt worden sind«, schloß der Professor mit einem entschuldigenden Lächeln an Frau Westermann, seine Sekretärin, Jonas den Juristen und Eva die Ethnologin. Eva blickte aus grauen Augen ruhig zurück, ihr demonstrativ ungeschminktes Gesicht verriet keinerlei Regung. »Aber zusammenfassend läßt sich sagen …«, hier stockte der Professor ein wenig, denn das Ordnen und Gliedern lag ihm nicht, er liebte das kreative Chaos mehr als nachprüfbare Ergebnisse.
»… zusammenfassend läßt sich sagen«, fiel Sigmund der Doktorand ein, der sich gänzlich übergangen fühlte, »daß wir in den letzten Wochen eigentlich nur über ein einziges Thema geredet haben und daß dieses Thema einige von uns auch während der Semesterferien nicht loslassen wird.«
»Stimmt«, sagte der Professor, und Britta bemerkte ein nervöses Zucken an seinem rechten Auge. Seine Stimme klang rauh, als er bestätigte: »Wir haben uns von einer der größten Intrigantinnen der englischen Literatur gefangen nehmen lassen: von Lydia Ottone.«
In Ekstase
»Guck mal. Bin ich hier besoffen oder die da unten?«
Britta stellte sich zu Carlo dem Ingenieur ans Fenster des kleinen Hörsaals im vierten Stock und blickte in den Hinterhof hinunter. Vor dem Eingang des »Kaffee Keller« standen etwa dreißig leicht bekleidete Studenten in zwei Kreisen und schwankten langsam erst nach rechts, dann alle nach links, wobei sie ihre Köpfe stets in die entgegengesetzte Richtung zum Oberkörper drehten. Von Zeit zu Zeit entströmte ihren Kehlen ein dunkles »Ra!«, das vielfach im Hof widerhallte.
»Oh Gott, die Nachbarn«, sagte Sigmund der Doktorand. Das Institut für Kulturwissenschaft der Humboldt-Universität lag im zweiten Hinterhof der Sophienstraße 22a, und der erste Hof, aus gelben Backsteinen und liebevoll mit Pflanzen begrünt, wurde von ganz normalen Menschen bewohnt. Sie klagten nicht nur über die Touristen, die sich scharenweise in die Sophienstraße ergossen und dort die frisch renovierten Fassaden, das städtische Idyll aus Kirche und Handwerksläden bewunderten. Noch häufiger beschwerten sie sich über Studenten, die laut redend zu ihren Seminaren in den zweiten Hof wandelten und dabei mitunter auch eine Zigarettenkippe in den Blumenkübeln vergaßen. Was würden sie erst zu Urwaldtänzen mit Urschreien sagen?
»Für dich muß das ein Kulturschock sein«, sagte Eva die Ethnologin mitleidig zu Carlo, der als Ingenieur ihrer Meinung nach einen beschränkten Horizont hatte. Das eindimensionale Weltbild eines Ingenieurs, das von Schrauben, Schwingungen, Chips und Drittmitteln begrenzt wird, kann die Vielfalt und die Relativität aller kulturellen Leistungen nicht erfassen, war Evas bei Feldstudien auf Bali gewachsene Überzeugung. »Das ist das Seminar Ekstase-Techniken, die hatten heute ja auch ihre letzte Sitzung. Offenbar machen sie zum Abschluß noch ein bißchen Praxis.«
Alle Teilnehmer des Hauptseminars Intrige – Professor Knospe hatte sich bereits verabschiedet – reihten sich am Fenster auf und betrachteten dankbar die Ekstatiker. Sie wußten, daß ihr eigenes, kleines, feines Seminar viel voller gewesen wäre, wenn nicht gleichzeitig Veranstaltungen zu den Themen Ekstasetechniken, Hanf, Techno und Multikulti stattgefunden hätten. Das war ja das Schöne an der Kulturwissenschaft: Es gab kein Thema auf der ganzen weiten Welt, das sie nicht behandeln konnte, eins war aufregender als das andere. Da gehörte man als Intrigen-Forscher schon zur seriösen Fraktion.
»Letztes Jahr hätten sie das wunderbar als Protestaktion verkaufen können«, sagte Jonas der Jurist, der über »Die Intrige als Straftatbestand« gearbeitet hatte. »Motto: Bildung macht uns high oder so ähnlich.«
Sheila schüttelte ihre frisch gewaschenen Haare. Sie glaubte nicht an ein politisches Bewußtsein unter deutschen Studenten.
Wenn es im Sommersemester 1996 da gewesen sein sollte, als die Kommilitonen aller Unis aus Protest gegen die 100-DM-Einschreibgebühr 24 Stunden lang um den Ernst-Reuter-Platz joggten, als die jungen Pharmazeuten der Humboldt-Universität den Passanten auf dem Alexanderplatz das Pillendrehen beibrachten, um vor der Abschaffung ihrer Fakultät zu warnen, als sogar die Literaturwissenschaftler auf dem Winterfeldtplatz Marathon-Lesungen abhielten, so war es jetzt jedenfalls weg. Sie kannte nur Leute, die sich auf ihr Studium oder ihren Job oder ihr Nachtleben oder ihre Liebesaffären konzentrierten. Genau wie in den USA, dachte sie. Immerhin traf man in Deutschland noch hin und wieder auf jene Schwundstufe des politischen Bewußtseins, die darin bestand, ein schlechtes Gewissen ob der eigenen Untätigkeit zu haben. Sie selbst war Feministin, aber das auf einem so hohen theoretischen Niveau, daß sich niemand davon ernstlich belästigt fühlen konnte.
Beim Anblick ihrer schwankenden und zuckenden Kommilitonen überkam Britta wieder ein Gefühl der Wehmut. Sommersemesterferien, klar, das war toll, Ausschlafen, Schwimmengehen, in Bibliotheken Stöbern – nicht mal Jobben brauchte sie diesmal, da sich ihre Eltern in Anbetracht des nahenden Examens großzügig zeigten. Aber Semesterferien, das hieß auch: keine Ausreden mehr. Keine festen Termine, die sie davon ablenkten, daß sie eine Magisterarbeit über »Lydia Ottone und Giuseppe Firenze: Intrigen und ihre Leerstellen« schreiben mußte. Daß ihr Studium unweigerlich zu Ende ging, obwohl sie das Gefühl hatte, erst jetzt begriffen zu haben, worum es ging. Und daß sie sich danach auf den Arbeitsmarkt wagen mußte, auf dem sie hundert anderen Brittas begegnen würde, die allesamt nicht gebraucht wurden. Traurig wiegte sie sich im Takt der Ekstatiker hin und her und wäre dabei fast von ihren Plateausohlen auf den Linoleumboden gefallen. Sie hielt sich an Carlo fest, der als Ingenieur jede fleischliche Begegnung mit einem weiblichen Wesen begrüßte. Er hatte Gefallen an den Ekstatikern gefunden und probte schon mit leiser Stimme ihr dunkles »Ra«.
»Na, ist dir auch schon schwindlig?« fragte er.
»Ach«, antwortete Britta nur. Sie stützte sich auf die Fensterbank und seufzte. In ihrem Kopf drehten sich düstere Gedanken im Kreise, ganz wie die Ekstatiker unten im Hof. Ihr Leben schien ihr in wesentlichen Punkten verfehlt. Sportlich müßte man sein, schlank müßte man sein und Akademiker-Eltern müßte man haben, dachte sie. Akademiker-Eltern bereiteten ihren Nachwuchs von Kindesbeinen an systematisch auf das Studium vor, sie erzählten beim Abendbrot von Chaostheorie und Shakespeare statt von Hans Meiser und Lohnsteuerberechnungen wie ihre Erzeuger in Salzgitter. Sonntags gingen Akademiker-Eltern mit ihren Kindern in Skulpturen-Ausstellungen und auf botanische Lehrpfade, und abends drückten sie ihnen ein Buch in die Hand. Bevor sie überhaupt mit dem Studium begannen, waren Akademiker-Kinder gebildet, eloquent und konnten systematisch denken – so wie Hans der Philosoph. Er nannte sie »die kleine Britta aus Salzgitta«, angeblich liebevoll, aber sie spürte darin einen Hauch von Herablassung.
Scheinbar ohne Absicht trat sie Hans, der neben ihr stand, mit ihrer rechten Plateausohle auf den Zeh. Er jaulte auf. Wenn ich noch einmal anfangen könnte, würde ich im Studium alles anders machen, dachte Britta. Ich würde ständig zur Studienberatung laufen, würde den Professoren auflauern, bis sie meine Arbeiten mit mir besprechen, würde mir ganz gezielt die Dozenten raussuchen, die den Stoff gut rüberbringen. Solche wie Professor Knospe. Und sie wurde rot, weil sie plötzlich wieder seinen durchgeistigten Blick auf sich spürte. Wie er alle Dinge dieser Welt zueinander in Beziehung setzen konnte! Wie er ihren, Brittas, Vorschlag akzeptiert hatte, auch über die Werke von Lydia Ottone zu sprechen! Obwohl die englische Autorin, diese in Italien geborene Abenteurerin mit dem stechenden Blick, nicht gerade eine von Professoren geschätzte Schriftstellerin war, wußte er doch erstaunlich viel über sie und kannte zahlreiche ihrer Romane. Mochte Hans der Philosoph noch so sehr über die »platte Symbolik« lachen: Knospe hatte in ihr etwas zum Blühen gebracht. Würde die zarte Pflanze in den Semesterferien nicht verdorren?
Unten im Hof entstand Unruhe. Zwei Studenten waren offenbar in eine echte Ekstase verfallen und begannen, sich die Kleider vom Leib zu reißen. Ein blonder Jüngling reckte seine Brust zum Himmel und quietschte wie ein Schwein, das in der Blüte seines Lebens abgeschlachtet wird. Dabei trommelte eine bis zur Hüfte entblößte Studentin weinend mit den Fäusten auf seine Schultern und warf ihre langen Haare in alle Richtungen, so daß sie wie Peitschenhiebe auf den Jünglingsrücken niederknallten. Die anderen Ekstatiker wußten offenbar nicht, ob sie die beiden um ihre Spontaneität beneiden oder einen Arzt holen sollten. Carlo der Ingenieur öffnete das Hörsaalfenster, um der entblößten Studentin näher zu sein. So etwas gab es an der TU einfach nicht! Die Geisteswissenschaftler hatten doch ein lustiges Leben.
Der Dozent, ein grauhaariger Mann mit Ziegenbart, versuchte, die Situation zu entschärfen, indem er die Teilnehmer dazu brachte, einen Kreis um die beiden zu bilden und dabei einen Urton zu summen.
»Auf diese Weise sollen die ruhigen Energien des Kreises auf die beiden übergehen«, erläuterte Eva, die Ähnliches schon auf Bali erlebt hatte.
»Die Energien des Kreises«, wiederholte Britta nachdenklich. War es nicht so, daß auch sie durch dieses Hauptseminar, durch die regelmäßigen Sitzungen jeden Donnerstag vormittag Energien erhalten hatte, die jetzt, mit dem Semesterende, ausblieben? Waren die anderen Teilnehmer des Seminars nicht wie ein Kreis gewesen, der sie stützte und in ihren Interessen bestärkte? Jetzt war sie auf sich allein gestellt, allein mit Lydia Ottone und Giuseppe Firenze, ohne die Sprüche und Witze ihrer Kommilitonen, ohne das perlende Lachen von Frau Westermann und ohne einen Professor Knospe, der sie so durchdringend anguckte, als vermutete er unter ihren orangefarbenen Haaren die Gedanken einer Nobelpreisträgerin.
Nach etwa fünf Minuten beruhigten sich die Nackten. Während sie sich wieder anzogen, ließ Jonas der Jurist ein ausgesucht spöttisches Lächeln um seine Mundwinkel spielen und sagte mit der ganzen Autorität eines zukünftigen Strafrichters: »Schluß mit High. High vorbei!« Sigmund der Doktorand erkannte am Horizont zwei wütend gestikulierende Mieter und schloß eilig das Fenster.
Hans der Philosoph begann damit, den Hörsaal von den Resten der Feier zu säubern und fegte die Krümel von den Tischen auf den Fußboden, wo sie eindeutig in den Zuständigkeitsbereich der Putzfrau fielen. Jonas der Jurist ließ sich auf ein erregtes Gespräch mit seinem Handy ein, und Eva die Ethnologin vertiefte sich in die Weleda-Nachrichten. Carlo der Ingenieur nahm noch einen Schluck Rotwein und erklärte, dies sei die beste Ekstase-Technik, alles andere sei zu laut. Britta tat es ihm nach. Eine kleine kalte Angst breitete sich in ihrem Herzen aus, während sie den Keim begoß, der einmal ihre Magisterarbeit werden sollte.
Wilde Kirsche, Grand Canyon
Der Mann stand direkt gegenüber vom Hofeingang der Sophienstraße 22a. Er lehnte sich an den hohen, schmiedeeisernen Zaun der Sophienkirchgemeinde, zwischen zwei Fahrrädern, lauernd und unbeweglich, als wollte er sagen: Meine Anwesenheit reicht, um diese dörfliche Idylle zu zerstören. Ihr studiert, aber ich bin. Ihr erhebt euch in geistige Höhen, aber ich hole euch wieder auf den Boden. Ihr wollt fliegen, aber ich mache euch Angst. Auf einem eher schmächtigen Körper trug er das Gesicht eines Profi-Boxers, mit einer Nase, auf der schon mehrere Konkurrenten ihre Stiefel erprobt zu haben schienen. Britta bemerkte ihn sofort, als sie aus dem Hofeingang trat. Da ist er, dachte sie. Der Vorbote.
Der Rotwein, den Carlo spendiert hatte, lähmte ihre Glieder. Anstatt ihr Fahrrad vom Zaun zu nehmen, wandte sie sich nach links und lief mit langsamen Schritten die Sophienstraße entlang, vorbei am Evangelischen Jungmännerverein und dem ziegelgeschmückten Hauseingang, in dessen Hof sich die Sophiensäle verbargen. Weiter unten, auf der gegenüberliegenden Straßenseite, sah sie Stroh-Sophie sitzen, eine lebensgroße Strohfigur, die die Touristen in ein Geschäft mit Handwerksarbeiten aus dem Erzgebirge locken sollte. Britta war noch nie in dem Laden gewesen, ging aber selten daran vorbei, ohne der steifen Sophie ein aufmunterndes Wort zuzurufen. Heute war ihr überhaupt nicht danach. Vor dem Schaufenster eines Geschäfts für Holzblasinstrumente blieb sie stehen. Ein schneller Blick über die Schulter zeigte ihr: Der Mann hatte sich nicht vom Fleck bewegt. Er hatte sich lediglich umgedreht und starrte ihr unverhohlen nach, einen Fuß auf die Mauer gestützt und die Hände in seiner schwarzen Lederjacke versteckt, die an der linken Seite einen Riß wie von einem Messerstich trug.
Seitdem Britta das Intrigen-Seminar von Professor Knospe besuchte und die Romane von Lydia Ottone las, sah sie häufig Vorboten. Überhaupt erschien ihr der studentische Alltag zwischen Vorlesungen, Bibliotheken, Mensa und Cafeterien weitaus bedeutsamer als zuvor. Eigentlich war er nämlich voller Zeichen, Symbole und Rituale, die man entschlüsseln und aus denen man Geschichten spinnen konnte. Woran lag es etwa, wenn sie ein bestimmtes Buch in keiner Bibliothek finden konnte? Doch nicht an der Politik des Berliner Senats, der den Unis die Zuschüsse so stark kürzte, daß sie keine neuen Bücher mehr kaufen konnten. Nein! Es war ein Zeichen. In ihrem höheren Lebensplan stand offenbar geschrieben, daß sie in dieser Phase ihrer intellektuellen Entwicklung von dem fraglichen Buch nur gestört werden würde. Britta nannte das einen »kreativen Umgang mit dem Mangel, mit Abwesenheiten und Leerstellen«. Daher interessierte sie sich auch so sehr für die Romane Lydia Ottones und des unbekannten italienischen Schriftstellers Giuseppe Firenze: Bei beiden gab Leerstellen, Erzählstränge, die angelegt, aber nicht weitergeführt wurden, Präsenzen, die auf Abwesendes verwiesen und umgekehrt. Genau wie der Mann mit der Knautsch-Nase.
Sie war ihm schon einmal auf dem Bahnsteig des U-Bahnhofs Weinmeisterstraße begegnet. Damals hatte er einen hungrig aussehenden Mischlingshund dabei, der Britta mit ebenso bösartigen Augen anblickte wie sein Herr. An jenem Nachmittag kam Britta gerade von einem überfüllten Seminar über die Geschichte des Scheunenviertels, in dem das Institut seinen Sitz hat. Auf diese Lage war man sehr stolz, denn wo sonst konnte man die Wiedergeburt von Berlins Zentrum, die Wandlung zur Metropole, das Zusammenwachsen von Ost und West besser kulturwissenschaftlich begleiten als hier? Hier, im Scheunenviertel, der Spandauer Vorstadt, in Mitte und Prenzlauer Berg, waren die neuen Galerien, Kneipen, Läden, Musiklokale und kleinen Theater, hier wohnten Studenten und Künstler, hier wurde gehämmert und gemeißelt, gebaut und saniert, bis spät in die Nacht hallten die Hackeschen Höfe mit Hoftheater und dem Varieté Chamäleon wider von dem Gelächter der Vergnügungssüchtigen, kurz: In diesen wenigen Quadratkilometern lag das El Dorado der Kulturwissenschaftler. Nirgendwo sonst in der Stadt verbanden sich Geschichte, Gegenwart und Zukunft auf so vielversprechende Art und Weise, coolere Straßenzüge gab es in ganz Deutschland nicht. Als Britta nach Berlin kam, war ihr klar, daß man als Studentin nur hier leben konnte.
Mit Geschichte konnte Britta eigentlich wenig anfangen, und die vielen Preußenkönige, die alle gleich hießen, warf sie hartnäckig durcheinander. Aber sie hatte noch allerhand Quellentexte und Fotos im Kopf über die beengten Wohnverhältnisse zu Beginn des Jahrhunderts, als bis zu acht Schlafburschen sich ein Zimmer teilten, als die Straßen voll waren von ambulanten Verkäufern, huttragenden Arbeitslosen und bieder aussehenden »Damen der Öffentlichkeit«. Das Scheunenviertel war in den zwanziger Jahren Zufluchtsort der Ostjuden mit ihren Betstuben, koscheren Lebensmittelläden und Kinderscharen. Gleichzeitig galt das Viertel als »Schlupfwinkel des Verbrechens«, des kleinen Verbrechens, von dem man nicht reich werden konnte, eines Verbrechens der muffigen Hauseingänge, der schlechten Zähne und verlausten Kopfhäute. Von all dem war heute, zwischen sanierten Fassaden, auf altmodisch getrimmten Handwerkerläden und Touristengruppen, nichts mehr zu ahnen. Nur der Mann mit der Knautsch-Nase trug etwas davon mit sich herum. Seine Anwesenheit füllte die historischen Leerstellen. Oder kündigte er ihr ein Unheil an, das sie in den Ferien ereilen sollte? War er gar – hier stockte ihr Atem – der Vorbote einer großen, wildromantischen Liebe?
Ach was. Die Liebe ist in meinem Leben die größte Leerstelle, dachte sie und betrachtete traurig ein thematisch passendes Holzblasinstrument im Schaufenster. Wer im Hauptfach Romanistik studierte, konnte auch gleich ins Kloster gehen: 80 Prozent Frauenanteil, wie sollte man da fündig werden? Ein ganzes Semester lang hatte sie an der TU ein stinklangweiliges Seminar über die »Schwingungsberechnung elastischer Kontinua« besucht, um sich unter dem dortigen 95prozentigen Männeranteil umzugucken. Eine Schnapsidee, ähnlich wie im ersten Semester, als sie ein kulturwissenschaftliches Seminar über »Das Verschwinden des Körpers« auswählte, weil sie es für eine Art Diät-Club hielt. Aus beiden Veranstaltungen war sie so mannlos und übergewichtig hervorgegangen, wie sie reingestolpert war. Die Uni und das Leben, das hat eben nichts miteinander zu tun, hatte sie daraufhin erkannt. Bis sie auf Professor Knospe und sein Intrigen-Seminar stieß.
Mit einem Seufzer fuhr sich Britta durch ihr Haar, auf dessen grell orangen Ton – eine Mischung aus Wild-Pflaume, Grand Canyon und einem Eßlöffel Tiramisu – sie stolz war.
»Was hältst du denn von meinem Vorschlag für die Semesterferien?« fragte jemand neben ihr. Britta fuhr zusammen. Vor ihr stand Sigmund, der staubtrockene Doktorand, und verströmte einen süßlichen Geruch nach Paprikastreifen und Kartoffelsalat.
»Klar, geht in Ordnung«, antwortete Britta langsam und, zur Bekräftigung: »Das fetzt.« Sie wußte, daß Sigmund diesen Ausdruck nicht ausstehen konnte. Hastig drehte sie sich noch einmal zur Sophienkirche um. Von dem Mann mit der Knautsch-Nase war nur eine Leerstelle geblieben.
OTTONE, LYDIA: geboren 1930 in Rom als Tochter eines Fabrikarbeiters und einer Näherin. 1956 verläßt Lydia Ottone Italien und geht nach Kalifornien. Dort arbeitet sie zunächst als Tänzerin und als Seelsorgerin für die italienische Gemeinde in San Francisco. Ihre ersten Romane (Das Rad der Fortuna,1959, Unter Häretikern,1961) erscheinen. Der Durchbruch gelingt mit dem Roman »Wir aus North Beach«, der in fünf Sprachen übersetzt wird und hohe Auflagen erreicht. Nachdem die Ehen mit dem Hausmeister Bill White und dem Hollywood-Schauspieler Raimond Bartlett zerbrochen sind, reist Lydia Ottone von 1965 bis 1969 durch Lateinamerika; die Romane dieser Zeit spielen dort und bedienen das Bedürfnis des Publikums nach Exotik. Sie veröffentlicht von nun an fast jedes Jahr einen Roman. 1971 findet sie ihre Wahlheimat London und publiziert künftig im dort beheimateten Verlag Clark and Clark Publishers. Eine zweite lange Reiseperiode durch die arabischen Staaten und Indien folgt von 1976 bis 1980. In diesen Jahren entsteht die Tetralogie Emma abroad, eine Mischung aus Reisetagebuch und Roman. Kurze Zeit nach ihrer Rückkehr nach London muß der Tory-Politiker Kenneth Jameson zurücktreten, weil eine Affäre mit Lydia Ottone bekannt wird. Eine Anklage wegen Steuerhinterziehung gegen Lydia Ottone wird 1985 zurückgezogen. 1988 Heirat mit dem Industriellen William Innkeeper, der 1992 stirbt.
Romane:Das Rad der Fortuna, Unter Häretikern, Verlebte Zeiten (hier folgte eine lange Liste, die Britta sorgfältig abgeschrieben hatte). Sekundärliteratur: keine.
Über Giuseppe Firenze hatte Britta weder in diesem noch in einem anderen Lexikon einen Hinweis gefunden.
Rom, Kalifornien, London
Es war keineswegs selbstverständlich, daß Sigmund und Britta halbnackt nebeneinander am Schlachtensee lagen. Eigentlich mochten sie sich nämlich nicht. Britta fand Sigmund staubtrocken, und Sigmund hatte ein hartnäckiges Vorurteil gegen pummelige Frauen mit orangefarbenen Haaren, denen es, wie er häufig beobachtet hatte, zwar nicht an Masse, wohl aber am für die Wissenschaft erforderlichen Sitzfleisch mangelte. Die Wissenschaft ist eine strenge Zuchtmeisterin, dachte er, sie verkürzt die Augäpfel und krümmt die Wirbelsäule, aber welche Wonnen hält sie bereit für den, der sich ihr geduldig nähert! Davon verstanden die meisten Studenten der Kulturwissenschaft nichts, und pummelige Frauen mit orangefarbenen Haaren sowieso nicht.
Umso überraschter war Sigmund gewesen zu sehen, mit welchem Eifer Britta sich an dem Seminar von Professor Knospe beteiligt hatte. Nicht nur hatte sie alle Lektürehinweise von Knospe gewissenhaft befolgt und den Referaten der anderen Teilnehmer mit zusammengepreßten Lippen gelauscht, ja sie hatte sich sogar als treibende Kraft erwiesen, indem sie vorschlug, auch die Werke ihrer Lieblingsautorin Lydia Ottone zu behandeln. Ganz entgegen den Absichten des Professors war Lydia Ottone dann zum wichtigsten Gesprächsgegenstand der letzten Wochen avanciert, weil in ihren Romanen all das enthalten zu sein schien, worüber sie zuvor diskutiert hatten. Sogar das Thema der Hausarbeit von Carlo dem Ingenieur – »Die Intrige bei der Einwerbung von Drittmitteln am Fachbereich Verfahrenstechnik der TU« – hatte Lydia Ottone in ihrem letzten Roman gewissermaßen vorweggenommen. Sigmund selbst war anfangs gar nicht begeistert davon gewesen, diese Romane zur Kenntnis nehmen zu müssen; schließlich steckten sie voller Klischees, wurden an Bahnhofskiosken verkauft und von Drogerieverkäuferinnen gelesen. Das sprach gegen sie. Für sie sprach eigentlich nur, mit welcher Virtuosität und Hartnäckigkeit Ottone das Thema »Intrige« immer weiter variierte, ohne sich ein einziges Mal zu wiederholen, wie gnadenlos sie die niederen Instinkte ihrer Figuren auslotete, wie findig sie darin war, jedes Buch mit einer Überraschung enden zu lassen. Interessant war auch – aber das hätte Sigmund nie in einer wissenschaftlichen Runde gesagt – das Bild der Autorin, immer dasselbe, das auf der Rückseite aller ihrer neueren Romane zu sehen war. Es zeigte eine Frau Mitte vierzig, mit dichtem schwarzen Haar und stechenden dunklen Augen, beides Hinweise auf ihre italienische Herkunft, mit hohen Wangenknochen, einer leicht schiefen, aber nicht häßlichen Nase und einem maliziösen Lächeln. Heute mußte sie über sechzig sein, vielleicht war ihr Haarschopf inzwischen weiß, aber so ein Foto hätte nicht zu ihren Romanen gepaßt. Sie war, wie Sheila sagte, eine Lady – oder, in den Worten von Jonas dem Juristen, ein »Marketing-Profi, absolut self-made«.
»Wie bist du eigentlich auf diesen Giuseppe Firenze gekommen?« fragte Sigmund Britta, die einen Grashalm zwischen den Lippen hatte. Ein Geruch von Kiefern und Sonnenmilch lag in der Luft, nicht unähnlich dem Duft des ätherischen Öls, das Eva die Ethnologin gerne vor den Seminarsitzungen im Hörsaal versprühte, zwecks Anregung der Gehirnfunktionen.
»Er wurde mal in einem Romanistik-Seminar erwähnt«, antwortete Britta etwas undeutlich, um den Grashalm nicht zu gefährden. »Die Dozentin sagte: ›Giuseppe Firenze, ein vergessener italienischer Romanautor‹. Das hat mich interessiert. Ich dachte mir: Wenn ich mich mit ihm beschäftige, dann ist er nicht vergessen. Ich habe mich wichtig gefühlt.« Sie sprach von zurückliegenden Phasen ihrer intellektuellen Entwicklung gern mit einer milden Verachtung. »Natürlich könnte ich meine Magisterarbeit auch über Dante schreiben«, fuhr sie fort. »Aber über den haben schon so viele Leute geschrieben. Das ist langweilig.«
Sigmund wollte ihr den nervigen Grashalm aus dem Mund nehmen, aber er traute sich nicht. Es hätte wie ein Annäherungsversuch aussehen können, dabei wollte er nichts als eine ungestörte Kommunikation zwischen AG-Partnern. Denn das waren sie ja: nicht etwa ein Pärchen, das sich in den letzten Julitagen am Schlachtensee zwischen Kiefernzapfen wälzt und den Schulkindern beim Planschen zusieht, sondern eine AG. Er selbst hatte Britta vorgeschlagen, eine Arbeitsgruppe zum Thema Lydia Ottone zu gründen, »damit uns der Impetus des Seminars nicht über die Semesterferien verlorengeht.« Britta hatte sofort zugestimmt, obwohl sie das Wort Impetus ebensowenig ausstehen konnte wie er ihren Lieblingsausdruck »das fetzt«. Hans der Philosoph, Sheila die Geschlechterforscherin und Knospes Sekretärin Frau Westermann, seit Jahren passionierte Ottone-Leserin, hatten angekündigt, gelegentlich dazuzustoßen. Der Schlachtensee war aber nicht der richtige Ort für eine solche AG, dachte Sigmund; hier wurde man doch sehr stark abgelenkt, von Grashalmen, Wespen und Frauen, die im Tanga mitgebrachten Erdbeerkuchen aßen. Von der benachbarten Liegewiese drang der Lärm von volleyballspielenden Halbstarken. Ein warmer Windstoß wirbelte den dünnen Flaum seiner Unterschenkel auf.
»Ich habe mir dann zwei Romane von Firenze besorgt, was gar nicht so einfach war, da sie nicht mehr aufgelegt werden. Per Fernleihe habe ich einen aus der Staatsbibliothek München und den anderen aus Frankfurt bekommen. Als ich sie las, wußte ich sofort: Er ist zu Unrecht vergessen.« Britta spuckte den Grashalm aus, voller Entrüstung über die Undankbarkeit der Welt. Ihr karierter Badeanzug bebte, und Sigmund kam sich auf einmal sehr mager vor.