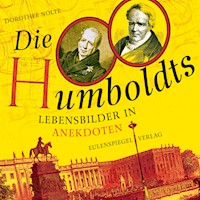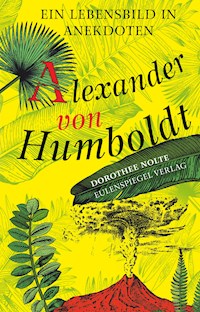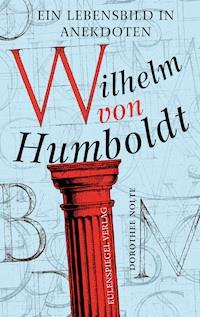
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Eulenspiegel Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
"Gelehrte zu dirigieren ist nicht viel besser, als eine Komödiantentruppe unter sich zu haben!" Mit diesen Worten lehnte Wilhelm von Humboldt seine Berufung ins preußische Kultusministerium ab - doch der König bestand auf seiner Wahl. Humboldt krempelte das Bildungswesen komplett um: Er entwarf das humanistische Gymnasium und strebte eine Hochschule an, die der freien Wissensaneignung als ganzheitlicher Menschenbildung dient. Doch der Mann, dessen offene Ehe für einiges Aufsehen sorgte, brachte längst nicht jede Arbeit zu Ende, denn der Spaß an der Sache war ihm wichtiger als das Gelingen. Sein Wirken in Klassik und Aufklärung, der liberale Lebenswandel und das gespaltene Verhältnis zu Bruder Alexander liefern reichlich Stoff für diesen Anekdotenband.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 118
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alle Rechte der Verbreitung vorbehalten.
Ohne ausdrückliche Genehmigung des Verlages ist nicht gestattet, dieses Werk oder Teile daraus
auf fotomechanischem Weg zu vervielfältigen oder in Datenbanken aufzunehmen.
ISBN E-Book: 978-3-359-50068-1
ISBN Buch: 978-3-359-01733-2
© 2017 Eulenspiegel Verlag, Berlin
Umschlaggestaltung: Verlag, Karoline Grunske
Die Bücher des Eulenspiegel Verlags
erscheinen in der Eulenspiegel Verlagsgruppe.
www.eulenspiegel.com
»Ich bin den Menschen immer ein Geheimnis gewesen und habe nie verlangt, ihnen zu gefallen.«
Wilhelm von Humboldt, oder: Blässe täuscht
Wilhelm von Humboldt, in Stein gemeißelt: Seit 1883 wacht er vor dem Hauptgebäude der von ihm gegründeten Universität am Prachtboulevard Unter den Linden, ernst, ein aufgeschlagenes Buch auf den Knien, ins Denken vertieft. Über drei Meter hoch ist der Sockel des Marmordenkmals, Wilhelm von Humboldt sitzt auf einer Art Thron und wirkt entrückt von dem Treiben um ihn herum. Vielleicht fragt er sich bisweilen, wie viele der vorbeiströmenden Touristen und Berliner ihn mit seinem Bruder Alexander verwechseln, der, ebenfalls als Denkmal, wenige Meter neben ihm sitzt – Wilhelm von Humboldt, war das nicht dieser Weltreisende, der mit Südamerika? So denken die Touristen vielleicht. Und wie viele der Studenten, die zwischen den Denkmälern der Brüder ins Hauptgebäude schlendern, könnten sagen, was das »Humboldtsche Bildungsideal« eigentlich bedeutet?
Auf zeitgenössischen Lithographien und Kreidezeichnungen wirkt Wilhelm ein bisschen verdrießlich, mit hängenden Gesichtszügen und leicht hervortretenden, wässrigen Augen. Fast so, als hätte er sich tatsächlich »totstudiert«. Alexander, der weniger intellektuelle Bruder, befürchtete genau das in der gemeinsamen Studienzeit in Göttingen. In der Tat ist die Liebe zum Studium, zum Lernen und Denken das hervorstechendste und dauerhafteste Element in Wilhelm von Humboldts Leben. Sie verließ ihn nie. Als Kind und Jugendlicher schon lernte er von seinen Hauslehrern alte und moderne Sprachen, Naturrecht und Philosophie, er begeisterte sich für das Altertum und die Lehren Immanuel Kants. In seiner Laufbahn als preußischer Gesandter und Bildungsreformer korrespondierte er mit den großen Geistern seiner Zeit, und die letzten fünfzehn Jahre seines Lebens verbrachte er auf Schloss Tegel mit Sprachstudien. Während es seinen Bruder Alexander in die Natur und in die Welt trieb, war Wilhelms Blick nach innen, in Bücher, auf Texte gerichtet.
Aber man unterschätze ihn nicht, er war weit mehr als ein Bücherwurm! Wilhelm war nicht nur Gelehrter, er interessierte sich leidenschaftlich für Menschen, Menschen in ihrer ganzen Verschiedenartigkeit. Er wollte das Leben in seiner Gesamtheit studieren, und dazu gehörten auch die Welt der Gefühle, der sinnlichen Eindrücke, das Körperliche, das Sexuelle. Alle Anlagen der eigenen Persönlichkeit entfalten, nicht nur das intellektuelle Potenzial: Das ist der Kern des »Humboldtschen Bildungsideals«, und das hat er gelebt.
So tritt uns Wilhelm von Humboldt in vielen Gestalten entgegen: der nach Jahrzehnten immer noch verliebte Gatte, der seine Frau Caroline dazu ermuntert, ihre Affären auszuleben – und sich dieselbe Freiheit nimmt. Der Gast in den Salons der Berliner Aufklärung, der für die schöne und geistreiche Henriette Herz schwärmt. Der unermüdliche Schriftsteller und Briefeschreiber – seine gesammelten Werke umfassen siebzehn Bände, dazu sieben Bände Briefwechsel mit seiner Frau. Der Freund von Goethe und Schiller. Der Vater, der den Tod seines Lieblingssohns betrauert. Der Bildungsreformer, der selbst nie eine Schule besuchte. Der Universitätsgründer, der sich über die schwer zu bändigenden Professoren beschwert. Der preußische Staatsdiener und Diplomat in Rom, Wien, London, der seine Posten ohne Zögern verlässt, wenn er sie nicht mehr seinem Anspruch gemäß ausfüllen kann. Der Wissenschaftler, der durch das Studium der Sprachen eine »Geschichte der menschlichen Empfindungen« schreiben möchte. Der Individualist, Freidenker, Aufklärer.
Kann man über einen solchen Menschen ein »Lebensbild in Anekdoten« schreiben? Humboldt selbst stand dem Genre skeptisch gegenüber. Als ihn ein Bekannter einmal um ein Journal mit Reiseerlebnissen bittet, lehnt er ab, denn er befürchtet, dass dieser Mensch keinen Wert auf »tieferes Raisonnement, feinere Bemerkungen oder hineinverwebte Gefühle« lege. »Es muss Witz, leichte, angenehme Erzählung, komischer Stoff und komische Einkleidung sein. Gerade darin habe ich fast gar keine Übung und überdies keine natürliche Anlage dazu.« Humboldt war auch kein Mensch, der durch exzentrisches Verhalten aufgefallen wäre. Und dennoch: Sein so reiches Leben und originelles Denken bieten mehr als genug Stoff für »angenehme Erzählung«, und oft genug offenbaren Humboldts eigene Aufzeichnungen und Briefe ebenjenen Witz, der die Anekdote auszeichnet. Der Widerspruch ist also nur ein scheinbarer.
Georg Christoph Lichtenberg jedenfalls, der Philosoph, Aphoristiker und Experimentalphysiker, lernte den jungen Humboldt in Göttingen kennen und schrieb über ihn an seinen Vetter: »Er ist einer der besten Köpfe, die mir je vorgekommen sind. Du kannst nicht glauben, was hinter dem etwas blassen Gesicht für ein Geist steckt.« Wilhelm von Humboldt: einer, dessen Blässe täuscht.
Teil I
Kindheit und Jugend1767–1787
Die Humpolts
Wilhelm von Humboldt: Das klingt vornehm, und vornehm war die Familie auch, in die der Junge 1767 hineingeboren wurde. Allerdings noch nicht sehr lange. Wilhelms Vorfahren väterlicherseits waren schlichte bürgerliche Humpolts, lebten in Pommern und arbeiteten als Handwerksmeister, Beamte und Offiziere. Erst der Großvater Johann Paul tat sich beim preußischen Militär hervor, wurde als Offizier verwundet und bat König Friedrich Wilhelm I., den Soldatenkönig, um ein Adelsprädikat. Ab 1738 durfte sich die Familie mit einem »von« schmücken. Der Titel war gerade dreißig Jahre alt, als Enkel Wilhelm das Licht der Welt erblickte. Kein alter Adel also – aber einer mit Zukunft.
Kammerherr in Potsdam
Schneidig sieht er aus auf einem zeitgenössischen Gemälde: Alexander Georg von Humboldt, der Vater der berühmten Brüder, mit Perücke, Rüschenhemd und reich verzierter Uniformjacke. Ein schöner Mann. In der preußischen Armee steigt er unter Friedrich dem Großen zum Major auf, bis er böse vom Pferd stürzt und ausscheiden muss.
Die Tätigkeit, die er danach ausübt, passt besser zu ihm als das Kämpfen und Kommandieren. Er wird königlicher Kammerherr der Prinzessin Elisabeth von Braunschweig-Wolfenbüttel, die mit ihrem Gemahl, Kronprinz Friedrich Wilhelm, in Potsdam lebt. Kammerherr, das heißt: Major von Humboldt begleitet die Prinzessin bei Ausfahrten und Reisen, steht ihr bei Zeremonien hilfreich zur Seite, überbringt in ihrem Auftrag Botschaften an andere Höfe, kurz, er führt ein angenehmes Leben. Seine Gewandtheit im Umgang mit hochstehenden Personen mag auf Sohn Wilhelm übergegangen sein und ihm in späteren diplomatischen Ämtern geholfen haben.
Doch der Kammerherrendienst ist womöglich nicht ganz unkompliziert: Denn der Kronprinz betrügt seine Frau, und die junge Prinzessin tröstet sich mit Offizieren der Potsdamer Garde. Nach der Scheidung der beiden bleibt Vater Humboldt Vertrauter des Prinzen. Allerdings ist es mit Potsdam und der Kammerherren-Herrlichkeit vorbei. Die Familie zieht, als Wilhelm zwei Jahre alt ist, nach Berlin.
Reiche Witwe
Dort, in der Jägerstraße 22, haben die Humboldts ein Haus. Was heißt hier Haus: ein Palais. Das Colombsche Palais am Gendarmenmarkt hat Marie Elisabeth von Holwede, geborene Colomb, mit in die Ehe gebracht. Die junge Witwe stammt von Hugenotten ab, die es nach der Flucht aus Frankreich in Neustadt an der Dosse mit einer Spiegelmanufaktur zu Reichtum gebracht hatten. Sie ist der vermögendere der beiden Ehepartner. Zum Beispiel besitzt Marie Elisabeth, aus dem Erbe ihres verstorbenen ersten Ehemanns, des Barons von Holwede, ein Schlösschen in Tegel, drei Kutschstunden von Berlin entfernt, schön gelegen in einer Wald- und Wiesenlandschaft am Tegeler See. Was ihr fehlt, sind menschliche Wärme, Lebendigkeit oder Lebensfreude. Darunter werden die Brüder – 1769 wird Alexander geboren – zu leiden haben.
Nie die Spur eines Affekts
Eine leidenschaftliche Liebe ist es vermutlich nicht, die den bereits sechsundvierzigjährigen Alexander Georg von Humboldt und die einundzwanzig Jahre jüngere Witwe zur Ehe bewogen hat, eher sind es Vermögens- und Standesüberlegungen. Aber das ist in dieser Zeit und diesen Kreisen üblich, die Liebesheirat kommt erst später in Mode. So wachsen die Brüder mit sehr unterschiedlichen Eltern auf. Gesellig, aufgeschlossen und vielseitig interessiert der Vater, kühl, verschlossen, wortkarg die Mutter. In den Arm nimmt Marie Elisabeth ihre Jungs offenbar selten, aber um ihre Ausbildung kümmert sie sich, sollen die Sprösslinge doch optimal auf den Staatsdienst vorbereitet werden.
Eine Bekannte, Frau von Briest, schreibt ihrer Schwester nach einem Besuch im Humboldtschen Haus am Gendarmenmarkt 1785: »Frau von Humboldt, ich versichere dich, sieht heute so aus, wie sie gestern aussah und morgen aussehen wird. Der Kopfputz wie vor zehn Jahren und länger; immer glatt, fest, bescheiden! Dabei das blasse, feine Gesicht, auf dem nie die Spur eines Affekts sichtbar wird.« Und auf dem Sofa, berichtet Frau von Briest weiter, liegt stets der alte Hund Belcastel und schnarcht.
Wilhelm ähnelt, so hat er es selbst empfunden, mehr der Mutter als dem Vater, ist eher unscheinbar, ernst und behält seine Gefühle bei sich.
Etwas krätzig
Die Familie von Humboldt verbringt die Sommer in Tegel, die Winter in der Stadt, denn das Schloss ist schwer zu beheizen. Zum Schlösschen gehört ein landwirtschaftlicher Gutshof mit Ziehbrunnen, Scheune, Stall und einem Weinmeisterhaus. Der Vater lädt oft Gäste ein und bemüht sich um die zuvor vernachlässigte Maulbeerbaumplantage. Auf den Hügeln in der Nähe wachsen Weinstöcke. Angeblich ist der Tegeler Wein sogar genießbar: »ein etwas krätziges Tischgetränk«, befindet der Berliner Aufklärer und Verleger Friedrich Nicolai, der bisweilen zu Gast im Schloss ist.
Wunderwerke
Kindheit bedeutet bei den Humboldts nicht Freiheit, Lachen, Toben, Streiche mit Freunden und zerrissene Hosen. Schulkameraden gibt es nicht, aus einem einfachen Grund: Die Sprösslinge des Adels werden nicht in die Schule geschickt. Für die umfassende Ausbildung der Söhne engagieren die Eltern vielmehr Hauslehrer, und zwar ausgewiesene Fachleute. Lesen und Schreiben und »etwas Geografie und Geschichte nach der damaligen Art, die Hauptstädte, die Wunderwerke der Welt« stehen bei dem späteren Verleger und Kinderbuchautor Joachim Heinrich Campe auf dem Lehrplan. Der hat, so Wilhelm, »eine sehr glückliche, natürliche Gabe, den Kinderverstand lebendig anzuregen«.
Vielleicht hat Campe bei dem kleinen Wilhelm auch den Keim zu seinen Sprachstudien gelegt: Campe betätigt sich selbst als Sprachforscher und hat später für Tausende Fremdwörter Verdeutschungen entwickelt, zum Beispiel »Erdgeschoss« für Parterre oder »Stelldichein« für Rendezvous. Andere seiner Schöpfungen – »Dörrleiche« für Mumie, »Schweißlöcher« für Poren, »Lotterbett« für Sofa – konnten sich nicht durchsetzen.
Erhobener Zeigefinger
Es bleibt nicht bei den Campeschen Lektionen. Als Wilhelm zehn Jahre alt ist, kommt Gottlob Johann Christian Kunth ins Haus, der die Familie über viele Jahre begleitet und die Erziehung der Jungen überwacht. Er neigt zum Kritteln und zum erhobenen Zeigefinger, ist pedantisch und schwer zufriedenzustellen. Zum Teil unterrichtet er die Jungen selbst, zum Teil engagiert er bekannte Gelehrte für den Fachunterricht. Einige zuckeln im Sommer mit der Kutsche bis nach Tegel.
Ein riesiges Programm haben die Brüder zu bewältigen: Englisch und Französisch, Latein und Griechisch, Geschichte, Geografie, die Literatur der großen europäischen Sprachen, Mathematik und Physik und viel Philosophie, besonders die Philosophie der Aufklärung. Wilhelm liegt das. Er entdeckt seine Liebe zum Altertum und identifiziert sich mit dessen Helden: »Ich las damals viel griechische Geschichte. Die Bilder der Vorzeit standen groß vor mir da, und ich sehnte mich, jenen Männern nachzuringen. Ich mied meine Gespielen und jede Gesellschaft.« Alexander dagegen hat keine Lust auf die ständige Lernerei, er sucht lieber in den Wäldern und Feldern nach Steinen, Käfern, Pflanzen. Die Familie schätzt das nicht etwa als frühe Anzeichen wissenschaftlicher Begabung: Man nennt ihn halb liebevoll, halb spöttisch den »kleinen Apotheker«.
Im Schrank eingesperrt
Der ältere Bruder so ernst und gelehrig, der jüngere naturverbunden und extravertiert: Das Zusammenleben ist sicher nicht immer konfliktfrei. Daniel Kehlmann schildert in seinem Roman »Die Vermessung der Welt« mehrere Kindheitsszenen, die Wilhelm in einem schlechten Licht erscheinen lassen: Er habe den jüngeren Bruder eine Nacht lang im Schrank eingeschlossen, ihm Rattengift aufs Essen gestreut und ihn einmal absichtlich im Eis einbrechen lassen. All diese Szenen sind der Fantasie des Autors entsprungen und nicht belegt.
In ihren Briefen äußern sich die Brüder lebenslang meist positiv übereinander, immer in dem Wissen, wie unterschiedlich, ja, gegensätzlich sie in ihrem Temperament und ihren Interessen sind. »Ich entwickelte mich unendlich viel langsamer als mein Bruder«, erinnert sich Alexander. Aber auch Wilhelm hat Grund, seinen Bruder zu beneiden: »Er trieb, wozu er Neigung hatte, er räsonnierte, durch keine Rücksicht gebunden, in zehnfach größerer innerer Freiheit.«
Dicke Marie
Am nördlichen Ufer des Tegeler Sees steht der älteste Baum Berlins, eine knorrige Traubeneiche, die angeblich neunhundert, vielleicht aber auch nur fünfhundert Jahre alt ist. Jedenfalls war der Baum schon lange da, als die Humboldt-Brüder durch den ausgedehnten Gutspark zogen, und dürfte sie beeindruckt haben. Fünf Männer sind nötig, um seinen Stamm zu umfangen. Diese Korpulenz hat die Jungs vielleicht an jemanden erinnert: ihre Köchin, die dicke Marie. Jedenfalls heißt es, die Brüder hätten dem Baum seinen Namen gegeben.
Noch ein berühmter, geschätzt fünfhundert Jahre alter Baum ist mit den Humboldts verknüpft: eine Eiche in unmittelbarer Nähe des Schlosses. Ob die Humboldt-Brüder auf die »Humboldt-Eiche« geklettert sind? Wir wissen es nicht.
Öde und freudenlos
Als Wilhelm elf Jahre alt ist, stirbt sein Vater überraschend – ein Schock für die beiden Jungs. Nur neunundfünfzig Jahre alt wird der Major von Humboldt. Mit ihm verschwindet die Wärme aus dem Haushalt, nun regieren die kühle Mutter und der strenge Kunth.
Seine Jugend sei »öde und freudenlos« verlaufen, schreibt Wilhelm in einem Brief an seine Frau Caroline. »Ich hatte so eine traurige frühe Jugend. Die Menschen quälten mich. Ich hatte keinen, der mir etwas war.« Alexander spricht, ähnlich verstört, von »tausendfältigem Zwange, entbehrender Einsamkeit, Verhältnissen, wo ich zu steter Verstellung, Aufopferungen gezwungen wurde«. Wilhelm flüchtet sich in Bücher, zu denen er eine »Anhänglichkeit« empfindet, »die aus Bitterkeit gegen die Menschen entsprang und oft nicht ohne Tränen war. Das empfand ich beim Griechischen am meisten, weil man immer schalt, dass ich zu viel Zeit darauf verwendete, und ich wirklich viel darum litt.« Das Griechische, die alten Griechen, sie werden ihm ein Leben lang als Ideal vorschweben.
Aber so sehr ihm von Natur aus das Studieren liegt: Damit allein wird er nicht glücklich. »Es war eine tötende Gleichgültigkeit in mir, so gar keine Erwartung und kein Bemühen, mir Freude zu machen, so ein bloßes Umtreiben und ein ewiges Studium. Denn die meisten Dinge und Menschen waren mir nur so weit lieb, als ich an ihnen lernen konnte.«