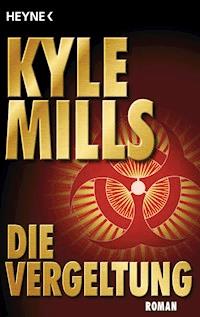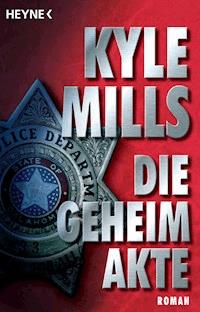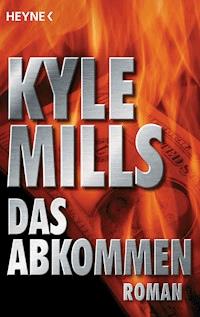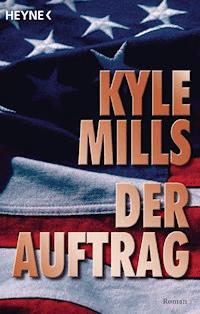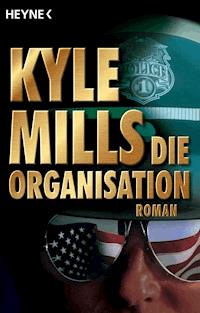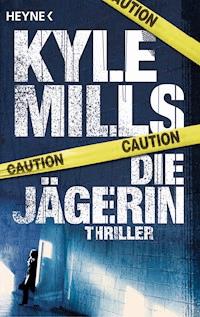
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein intelligenter Politthriller
Quinn Barry ist eine ehrgeizige junge Computerprogrammiererin, die eine neue Gen-Datenbank für das FBI erstellen soll. Dabei stößt sie auf eine mysteriöse DNA-Überschneidung in fünf grausamen Mordfällen, die vom FBI scheinbar absichtlich verheimlicht wurde. Barry ermittelt weiter und riskiert damit nicht nur ihren Job, sondern bald auch ihr Leben. Der bestialische Killer hat sie schon in seinem Visier.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 584
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
KYLE MILLS
DIE JÄGERIN
Roman
Das Buch
Quinn Barry ist eine ehrgeizige junge Computerprogrammiererin im Dienste des FBI. Insgeheim träumt sie jedoch von einer gefährlichen Mission, bei der sie ihren Wert als Agentin unter Beweis stellen kann. Als sie in der FBI-Datenbank auf eine mysteriöse DNA-Spur stößt, erfüllt sich ihr Wunsch schneller, als ihr lieb sein kann. Denn offenbar ist sie einem Serienmörder auf die Schliche gekommen, dessen grausame Morde von der Regierung absichtlich vertuscht wurden. Barry ermittelt weiter und riskiert damit nicht nur ihren Job, sondern bald auch ihr Leben. Der bestialische Killer, der immer noch sein Unwesen treibt, hat sie bereits im Visier.
»Die Spannung ist fast unerträglich.« Booklist
Der Autor
Titel der Originalausgabe BURN FACTOR
erschien bei HarperCollinsPublishers Inc, New York
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag weist ausdrücklich daraufhin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
1. Auflage
Wilhelm Heyne Verlag in der Verlagsgruppe Random House GmbH Copyright © 2001 by Kyle Mills Copyright © 20016 dieses E-Books by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Umschlagillustration: © shutterstock/Denis Babenko
Inhaltsverzeichnis
PROLOG
Der hohe Holzzaun und die Bäume, deren Äste über ihnen in den Himmel ragten, schluckten das Licht der Straßenlaternen, und alles wurde zu Schatten. Es war nicht so frostig, dass die Kälte Brad Lowells Jacke durchdringen konnte, während er geduldig wartend am Fuß der Treppe stand. Bis zu dem leisen Klicken, mit dem die Tür geöffnet wurde, und dem Schwall warmer Luft, der darauf folgte, war der Geruch von Tau bis jetzt der dominierende Eindruck gewesen.
Lowell sah sich noch einmal um, während sich seine Leute ins Haus schlichen und auf die einzelnen Räume verteilten. In dem kleinen Garten war es völlig ruhig. Es war kurz nach vier Uhr morgens, und der typische Vorort würde erst in gut zwei Stunden wieder zum Leben erwachen. Er hätte gern mehr Zeit gehabt, doch daran konnte er jetzt nichts mehr ändern.
Die einzige Lichtquelle im Innern des Hauses – im Wohnzimmer, wie er annahm – erlosch, als er durch die Tür trat und sie hinter sich zuzog. Er nahm eine kleine Lampe aus der Tasche und schaltete sie ein. Der Lichtstrahl fiel auf einen Mann, der auf Gummisohlen die Treppe heruntergerannt kam.
»Alles klar. Die Jalousien sind unten«, sagte eine Stimme aus dem winzigen Empfänger, der in Lowells rechtem Ohr steckte. Während er in den ersten Stock ging, legte er die Hand über die Augen, um sie vor dem grellen Licht zu schützen, das jetzt in allen Räumen des Hauses eingeschaltet wurde.
Im Schlafzimmer hatte sich einer seiner Männer, der natürlich Handschuhe trug, bereits an die Arbeit gemacht und durchsuchte mit geübten Bewegungen Schubladen und Regale. Der Raum hatte nichts Ungewöhnliches oder Verdächtiges an sich, was Lowell aber schon vorher klar gewesen war. Auf dem Bett in der Mitte des Zimmers lag eine gesteppte Decke mit Blumenmuster, die perfekt zur Husse an der Matratze passte. Diverse Plüschtiere schienen mit zunehmendem Alter der Bewohnerin aus dem Bett verbannt worden zu sein und saßen ordentlich aufgereiht auf einem in die Wand eingebauten Regal.
Der Mann, der das Schlafzimmer durchsuchte, nahm sich den Schrank vor. Vorsichtig zog er eine Schuhschachtel nach der anderen von einem Stapel auf dem Boden und nahm den Deckel ab. Als er kurz innehielt und einen Blick über die Schulter warf, setzte Lowell einen gleichgültigen Gesichtsausdruck auf und verbarg die Wut, die Frustration und die Angst, die ihn erfasst hatten. Solange er das Sagen hatte, musste er unberührt wirken und so tun, als hätte er alles unter Kontrolle.
»Ich glaube nicht, dass wir hier was finden werden.«
»Wir suchen trotzdem, klar?«, erwiderte Lowell.
»Ja, Sir.«
Lowell ging wieder nach unten, wo der Rest seines Teams das Wohnzimmer durchsuchte. Als die Männer bemerkten, dass er den Raum betrat, gab es eine kaum wahrnehmbare Unterbrechung im Rhythmus ihrer Bewegungen. Doch nachdem er zu einer Wand gegangen und sich dort hingestellt hatte, schien man ihn bereits wieder vergessen zu haben.
Die Leiche der Frau lag mit gespreizten Armen und Beinen auf einer großen Plastikplane mitten auf dem Boden neben einer blutigen Gummischürze und zwei gebrauchten Kondomen. Ihre Handgelenke waren mit Kleiderbügeln aus Draht an das Sofa gefesselt, die Fußknöchel auf die gleiche Weise an ein massiv aussehendes Bücherregal gebunden.
Sie war hübsch gewesen – Lowell konnte es ihrem unversehrten Gesicht immer noch ansehen. Der Mund mit den vollen Lippen stand gerade so weit offen, dass man ihre blendend weißen Zähne erkennen konnte, das lange, kastanienbraune Haar breitete sich fächerförmig unter ihrem Kopf aus, die blauen Augen starrten an die Decke des Zimmers. Er machte ein paar Schritte auf sie zu und ging in die Hocke. Wenn er nicht gewusst hätte, dass die Frau Mitte bis Ende zwanzig war, hätte er ihr Alter nicht schätzen können. Ihr nackter Körper hatte die sanften Kurven und die noch nicht völlig ausgebildete Muskulatur eines Teenagers. Doch der schlanke Körper wurde durch zahllose hauchdünne Schnitte entstellt, die sich kreuzweise über die Haut zogen. Einige der Wunden glänzten noch feucht und bildeten auffallend rote Streifen in dem matten Braun des eingetrockneten Blutes, das ihren Körper und den größten Teil der Plastikplane bedeckte, auf der sie lag. Das Fleisch in ihrem toten Gesicht schien etwas zu schlaff an den Knochen zu hängen, ein Hinweis darauf, dass es Stunden gedauert hatte, bis sie aufgegeben hatte und gestorben war.
Als Lowell wieder aufstand, fiel ihm auf, dass der junge Mann vor ihm erstarrt war. Er hielt einen Turbo-Staubsauger in der Hand, der für das Sammeln von Beweisen benutzt wurde, doch seine Hand krampfte sich so stark um den Griff, dass die Fingerknöchel weiß geworden waren. Sein Blick hing unverwandt an der Leiche.
»Mr Geller, gibt es ein Problem?« Lowells Stimme klang sachlich und nüchtern. Der Junge war neu und hatte so etwas mit Sicherheit noch nicht gesehen. Seine Reaktion war zwar verständlich, durfte aber nicht toleriert werden.
»Nein, Sir«, erwiderte Geller, der unverwandt auf das starrte, was von der jungen Frau zu seinen Füßen übrig war.
»Dann machen Sie weiter.«
Als das gedämpfte Brummen des Staubsaugers wieder einsetzte und der junge Mann das Gerät über den Teppich um die Leiche herum bewegte, spürte Lowell eine Hand auf seiner Schulter. Er drehte sich um und ging in die Diele, gefolgt von einem anderen seiner Männer.
»Wer war sie, John?«, sagte Lowell, als sie die Küche erreicht hatten.
»Ihr Name war Mary Dunnigan.« Sein Mitarbeiter legte eine Handtasche aus Leder und einen Terminkalender auf den Esstisch. »Sie war sechsundzwanzig und hat als eine Art Wirtschaftsanalystin bei einem privaten Unternehmen hier in Washington gearbeitet. In ihrem Kalender steht kein Termin für morgen oder das Wochenende. Ich habe ein paar Fotos von ihr gefunden, auf denen sie immer mit demselben jungen Mann zu sehen ist, allerdings über eine Zeitspanne von mehreren Jahren hinweg. Es ist vermutlich ein Verwandter, wahrscheinlich ihr Bruder. Keine Nachrichten auf dem Anrufbeantworter …« Offenbar hatte er nichts weiter zu sagen.
»Ist das alles?«
»Fürs Erste ja. Wir …«
Eine wütende Handbewegung von Lowell ließ ihn verstummen. »So etwas passiert, wenn Fehler gemacht werden. Stimmt’s?«
»Ja, Sir.«
Noch eine Handbewegung, und der Mann verließ fluchtartig die Küche in Richtung Wohnzimmer, um seinen Kollegen zu helfen.
Als Lowell seine Stirn berührte, wurden seine Finger nass vor Schweiß. Die Situation war beschissen. In zwei Stunden wurde es hell, und er stand in einem netten, ordentlichen Mittelklassehaus in einer netten, ordentlichen Mittelklassegegend und hatte es mit der zerfetzten Leiche einer intelligenten, berufstätigen jungen Frau zu tun. Es wurde immer schwieriger, sich zu vorstellen, dass es noch schlimmer kommen konnte.
Lowell wischte sich mit dem Ärmel den Schweiß von der Stirn und ging wieder ins Wohnzimmer, wo zwei seiner Männer gerade dabei waren, den Draht an den Fuß- und Handgelenken der Leiche mit Zangen durchzuschneiden.
»Seid ihr so weit?« Die Stimme einer Frau.
Lowell drehte sich um und sah, dass Susan Prescott das Zimmer betreten hatte. Sie trug eine Perücke mit langen dunklen Haaren und hatte eine Hose und eine Bluse aus dem Schrank des Opfers angezogen. Die Sachen saßen zwar nicht perfekt, aber es würde gehen. Lowell hatte Prescott nicht nur wegen ihrer Größe und ihrer Figur für diesen Auftrag ausgesucht, sondern auch, weil sie wie ein Roboter funktionierte.
»Ich habe so ziemlich alles aus dem Bad und so viel von ihrer Kleidung und ihren Schuhen eingepackt, dass es glaubwürdig aussieht«, fuhr sie fort, während sie den Koffer in ihrer rechten Hand hob. »Sie hatte Antibabypillen für drei Monate in ihrem Medizinschränkchen. Ich habe alle mitgenommen.«
Lowells Blick ging zu den beiden Männern, die auf dem Boden knieten. Sie hatten Hände und Füße des Opfers losgeschnitten und versuchten, die einsetzende Totenstarre zu überwinden, um die Beine der Frau zusammenzudrücken. »John, hast du noch andere Medikamente gefunden?«
Der Mann schüttelte den Kopf, während er einen Gurt um die Fußknöchel der Frau schlang und ihn festzog. »Ich habe die beiden anderen Badezimmer, den Nachttisch in ihrem Schlafzimmer und die Küche durchsucht. Nichts auf Rezept. Ich glaube, das können wir abhaken.«
Lowell sah wieder zu dem jungen Mann, der mithalf, die Leiche in die Plastikplane zu wickeln, auf der sie lag, wobei er darauf achten musste, dass nichts von dem feuchten Blut auf den Teppich geriet. Sein Gesicht war kreidebleich, und sein Unterkiefer zitterte heftig.
»Geller«, sagte Lowell.
Er schien ihn nicht zu hören.
»Geller!« Lowell sprach immer noch so leise, wie es aufgrund der Situation erforderlich war, doch die Dringlichkeit in seiner Stimme verfehlte ihre Wirkung nicht und zog die Aufmerksamkeit des jungen Mannes auf sich.
»Wird Ihnen schlecht?«
»Nein, Sir!« Geller richtete sich auf und begegnete Lowells forschendem Blick. Er sah aus, als würde er es schaffen, aber sicher war das nicht.
»Wir haben keine Zeit für ein Problem, Mr Geller. Wenn Sie den Raum verlassen müssen, tun Sie das. Wir werden keinen Ton darüber verlieren. Haben Sie das verstanden?«
»Mir geht’s gut.«
Lowell richtete seine Aufmerksamkeit wieder auf die Frau, die neben ihm stand, und musterte sie noch einmal von Kopf bis Fuß. »Okay, Susan. Sie können los.«
Sie nickte ihm kurz zu und ging dann in Richtung Garage.
Lowell blieb mitten im Wohnzimmer stehen und versuchte, sich zu konzentrieren. Hatten sie etwas übersehen? Sein Blick wanderte prüfend über den Teppich, während seine Männer Isolierband um die Plastikplane wickelten, in der die Leiche eingepackt war.
Der Teppich sah sauber aus. Er wusste, dass es keine Fingerabdrücke gab, und bei ihrer Säuberungsaktion hatten sie sämtliche physikalischen Spuren beseitigt, die bei einer genauen Untersuchung entdeckt worden wären. Zeugen? Das konnten sie zurzeit noch nicht wissen. Unvorhersehbare Probleme? Immer.
»Moment.« Er ließ sich auf die Knie fallen und sah sich die Unterseite der Plastikplane an, als die beiden Männer die Leiche vom Boden hoben. »Okay, alles klar. Los jetzt.«
Lowell folgte ihnen in die Garage, in der Susan Prescott bereits am Steuer eines Ford Taurus saß, der dem Opfer gehörte. Er sah, wie sie sich vorbeugte, und gleich darauf ging der Deckel des Kofferraums auf.
»Susan, wie sieht der Wagen aus?«
»Noch keine 30.000 Kilometer gefahren«, informierte sie ihn durch das offene Fenster. »Der Tank ist fast voll. Soweit ich das sehen kann, ist nichts kaputt. Alle Scheinwerfer und Blinker funktionieren.«
»Sir?«
Lowell drehte sich um und sah zur hinteren Wand der Garage, wo die beiden Männer versuchten, die zunehmend steifer werdende Leiche in den kleinen Kofferraum des Wagens zu bugsieren. Ihm war sofort klar, dass die Leiche so, wie sie jetzt war, nicht hineinpassen würde.
»Mr Geller, Sie werden ihr die Beine brechen müssen. Susan, steigen Sie aus, und helfen Sie ihm. John, Sie kommen mit mir.« Lowell drehte sich um und ging auf die Tür zu, die ins Haus führte, doch ihm war nicht entgangen, dass der junge Mann schon wieder die Gesichtsfarbe gewechselt hatte. Er konnte es sich nicht leisten, Mitgefühl zu zeigen oder Geller die Hand zu halten, bis dieser sich auf die Situation eingestellt hatte. Entweder der Mann kam damit zurecht oder nicht. Es war besser, wenn sie das jetzt gleich herausfanden.
Als Lowell das Wohnzimmer betrat, wies er auf den Bodenbelag. »Wir werden uns den Teppich noch einmal vornehmen müssen, bevor wir von hier verschwinden können. Und ich will bis zum späten Vormittag einen vorläufigen Bericht über diese Sache hier haben. Bis heute Abend will ich alles über die Frau wissen. Ist das klar?«
»Ja, Sir.«
»Und in dem Moment, in dem sich die Polizei einschaltet, informieren Sie mich. Und danach will ich täglich einen Bericht über den Stand der Ermittlungen.«
»Ich kümmere mich darum«, sagte John, der den Kopf leicht schief legte, als das Garagentor nach oben rollte. »Mit etwas Glück wird sie vor Montag niemand vermissen.«
»Glück interessiert mich nicht«, brummte Lowell. Seiner Stimme war ein Bruchteil der Wut anzuhören, die ihm ein Loch in den Magen fraß. »Es darf keine Fehler mehr geben, John. Haben Sie das verstanden? Keine Fehler mehr.«
EINS
Quinn Barry warf einen Blick auf ihre Uhr und verzog das Gesicht. Es war erst 11.30 Uhr, aber sie war schon bei ihrer vierten Tasse Tee und dem fünfzehnten Reiskuchen.
»Dann lassen Sie es heute laufen?«
Quinn zuckte zusammen und stieß den letzten der kleinen Kuchen mit Erdbeergeschmack von ihrem penibel aufgeräumten Schreibtisch. Er schien in Zeitlupe zu fallen und sich so zu drehen, dass er mit der Oberseite auf dem Boden aufkam.
»Quinn?«
»Louis, das habe ich nicht gesagt«, erwiderte Quinn, während sie sich auf ihrem Stuhl umdrehte. Sie konnte hören, wie sich ihr Südstaatenakzent in ihre Stimme schlich. Egal, wie sehr sie auch übte, er kam immer wieder, wenn sie unter Stress stand. Oder betrunken war.
Louis Crater beugte sich ein wenig vor, was dazu führte, dass sich das Licht der Deckenbeleuchtung auf seiner Glatze spiegelte, sah sie aber nicht an. Stattdessen starrte er auf den Bildschirm, mit jenem strengen Gesichtsausdruck, mit dem er auf alles und jeden reagierte.
»Morgen?«, fragte er, während sein Blick immer noch am Bildschirm hing, obwohl ihm der Code, der darauf zu sehen war, absolut nichts sagte.
»Ich habe Ihnen doch schon gesagt, dass ich heute einen umfangreichen Test mit dem forensischen Index laufen lasse und das Ganze ohne Probleme ablaufen dürfte …«
In ihrem letzten Leben als Programmiererin bei einem großen Unternehmen hatte Quinn ständig mit Leuten wie Louis zu tun gehabt. Das und die Tatsache, dass sie zahllose einsame Stunden in düsteren Büros mit zu viel Kaffee und zu viel Junkfood verbracht hatte, war der Grund dafür gewesen, warum sie eineinhalb Jahre nach ihrem Collegeabschluss mit dem Programmieren aufgehört hatte. Stattdessen hatte sie eine Stelle als Sachbearbeiterin beim FBI angenommen, in der Hoffnung, so ihre Chance auf eine Karriere als Ermittlungsbeamtin zu erhöhen.
»Dann also morgen. Habe ich das richtig verstanden, Quinn?«
Etwa zur gleichen Zeit hatte Louis – der Mann, der für CODIS, die DNA-Profil-Datenbank des FBI, verantwortlich war und jetzt wie ein Geier im Aufwind über ihrem Schreibtisch hing – angesichts strikter Sparmaßnahmen das Subunternehmen gefeuert, von dem das System gepflegt wurde. Und dann, zweifellos nur wenige Sekunden danach, hatte er jene verhängnisvollen Worte von sich gegeben, mit denen Abteilungsleiter überall auf der Welt ihre Chefs überzeugen: »Wenn wir das Ganze intern erledigen lassen, können wir das besser und billiger machen.«
»Ja, Louis. Das ist alles kein Problem.« Quinn seufzte.
Und daher war sie jetzt eigentlich wieder genau da, wo sie angefangen hatte – sie schlug sich mit der Umprogrammierung einer riesigen, unübersichtlichen Datenbank herum, allerdings im Auftrag einer Regierungsbehörde und für ein Gehalt, das nur etwa die Hälfte dessen betrug, was sie früher als Programmiererin in der Privatwirtschaft verdient hatte.
»Ich bin wirklich froh, dass wir den Terminplan einhalten können«, sagte Louis, während er sich zu seinen vollen Einsdreiundachtzig aufrichtete und Quinn auf dem herumknabberte, was von dem Radiergummi am oberen Ende ihres Bleistifts noch übrig war. »Quinn, was halten Sie davon, wenn wir uns nach der Arbeit noch auf einen Drink treffen? Dann können Sie mir erklären, was Sie mit der Datenbank gemacht haben.«
Das klang alles andere als verlockend. Und da für die Umschaltung der Datenbank natürlich Murphys Gesetz galt, würde es während ihres Tests mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu einem systemweiten Crash kommen.
»Ich würde ja gern, Louis, aber ich kann nicht. Ich habe heute Abend schon etwas vor.«
»Mittagessen?«
»Ich habe einer Freundin versprochen, dass ich schnell etwas mit ihr essen gehe«, antwortete Quinn wahrheitsgemäß. »Sie können gern mitkommen. Es wird sicher lustig …«
Er schüttelte den Kopf – leicht verärgert, wie sie dachte – und ging ohne ein weiteres Wort wieder in sein Büro.
Schlecht. Ganz schlecht. Jedes Mal, wenn er ihren Schreibtisch verließ, schien er noch eingeschnappter und mürrischer zu sein. Soweit Quinn das beurteilen konnte, hatten alle, für die sie bis jetzt gearbeitet hatte, etwas gemein: Zum einen hörten sie nur das, was sie hören wollten, und zum anderen machten sie ihren Chefs Versprechungen, die unmöglich zu halten waren. Louis Craters Chancen auf eine Beförderung wurden zumindest zum Teil davon bestimmt, ob dieses Projekt termingerecht und erfolgreich zum Abschluss gebracht werden konnte, während ihre Karriereaussichten ausschließlich von seiner Laune abhingen. Und die war alles andere als gut.
Quinn rückte ihren Stuhl wieder vor die Tastatur und holte tief Luft. Bis zur Mittagspause waren es noch fünfzehn Minuten. Wenn sie sich beeilte, konnte sie die Testroutine starten, bevor sie das Gebäude verließ.
»Rate mal, wer da ist.«
Fast auf die Sekunde genau fünfzehn Minuten später legten sich zwei mit zahlreichen Ringen geschmückte Hände auf Quinns Augen, sodass ihr für kurze Zeit die Sicht auf die Codezeilen, die über den Bildschirm huschten, versperrt war.
»Hallo, Katie.«
Quinn konnte erst wieder etwas sehen, als sich ihre Freundin auf einen leeren Stuhl fallen ließ.
»Was ist mit Mittagessen? Gehen wir?«, fragte Katie, während sie einen Briefbeschwerer aus Messing vom Schreibtisch nahm und ihn mit geheucheltem Interesse untersuchte.
»Ja, klar gehen wir. Ich muss nur schnell was fertig machen.«
Katie beugte sich vor und versuchte, einen Blick auf den Computerbildschirm zu erhaschen. »Pac-Man?«
Quinn verzog das Gesicht und begann, wieder Befehle in den Computer einzugeben, während sich ihre Freundin wie ein hyperaktives Kind auf dem Bürostuhl drehte. »Dieses fensterlose Büro hat was«, sagte Katie, während sie auf die Wände deutete. »Ich war noch nie so tief unter dem J.-Edgar-Hoover-Gebäude. Eigentlich dachte ich ja, dass sie hier die gefolterten Verdächtigen einsperren.«
Quinn schüttelte den Kopf, während sie weiter auf den Bildschirm starrte. »Die sind weiter den Gang runter. Hier werden nur die Mitarbeiter gefoltert.«
»Wenn du glaubst, dass es im dritten Stock oben besser ist, hast du dich geirrt.« Katie beugte sich noch ein Stück vor. »Bist du fertig? Ich bin am Verhungern.«
»Ich muss nur noch eine Suche beginnen, damit sie fertig ist, wenn ich wiederkomme.«
»Was suchst du denn?«
»Einen guten Menschen.«
»Hör auf. Ich komme um vor Neugier. Im Ernst.«
»Phantome.«
»Oh – du darfst es mir nicht sagen, stimmt’s? Es ist streng geheim.«
Quinn drückte die Eingabetaste und rollte mit ihrem Stuhl einen halben Meter nach hinten, während der Computer die Suchparameter verarbeitete. »Eigentlich nicht. Das habe ich ernst gemeint. Weißt du, was der forensische Index ist?«
»Ein Teil der DNA-Datenbank, richtig?«
»Ich bin beeindruckt. Genau genommen handelt es sich bei diesem Index um den Systembereich, in dem Daten zu ungelösten Fällen gespeichert sind. Wenn also irgendein Kerl in Michigan ein Verbrechen begeht und Blut oder Speichel oder was auch immer am Tatort zurücklässt, wird seine DNA-Signatur in die Datenbank der Polizei von Michigan eingegeben, die dann in unseren Zentralcomputer hochgeladen wird. Nehmen wir einmal an, jemand hat bei einem Verbrechen in Kalifornien die gleiche DNA hinterlassen. Dann würde der forensische Index die Übereinstimmung finden und die Polizei beider Staaten darüber informieren, dass die Fälle etwas miteinander zu tun haben.«
»Und nach welchem Phantom suchst du jetzt?«
»Nach mir. Wir mussten Teile der Systemhardware aufrüsten, und ich habe den Code so umgeschrieben, dass er sie akzeptiert. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe eine fiktive DNA-Signatur in die Datenbanken aller fünfzig Staaten eingegeben. Und jetzt werde ich die Suchroutine starten, die ich geschrieben habe, und herausfinden, ob mein Datensatz gefunden wird. Mit etwas Glück kann ich meinen Job behalten.«
»Das nennst du Glück?«, sagte Katie, die sich wieder umsah. »Dann war das also das Problem.«
»Was meinst du damit? Was für ein Problem?«
»Warum du die ganze letzte Woche so ausgesehen hast, als hätte jemand deine Katze mit dem Rasenmäher überfahren.«
Quinn wandte ihre Aufmerksamkeit wieder dem Bildschirm zu und tat so, als würde sie Befehle eingeben, während sie gleichzeitig versuchte, den forschenden Blick ihrer Freundin zu ignorieren.
»Nein, das war’s nicht«, sagte Katie schließlich. »Es geht um David, stimmt’s?«
»Ich weiß nicht, wovon du redest.«
Katie täuschte eine Bewegung nach links vor und schnappte sich den Terminkalender, der neben dem Computerbildschirm lag. Quinn war zu langsam und konnte sie nicht aufhalten.
»Katie, gib das her!«
»Das hättest du wohl gern.« Katie rollte außer Reichweite und fing an, in dem Terminkalender zu blättern.
»Katie, das meine ich ernst …«
»16. Juni«, las ihre Freundin. »Mit David Schluss machen.« Sie blätterte einige Seiten weiter. »10. August. David den Laufpass geben. 2. September. David ist ein Idiot.«
Quinn stand auf und riss ihrer Freundin den Terminkalender aus der Hand. »Du hast ja recht. Ich bin ein Feigling. Das brauchst du mir nicht unter die Nase zu reiben.«
»Großer Gott, Quinn, was hält dich eigentlich bei ihm? Mir ist ja klar, dass ein gut aussehender, weltgewandter CIA-Agent mit perfektem Hintern ein Geschenk Gottes für ein Landei wie dich sein muss, aber …«
»He, ich bin kein Landei. Ich komme aus dem Süden. Das ist alles.«
»Ah, ja. Tut mir leid. Jedenfalls ist der Kerl ein Trottel. Was für eine Ausrede hat er denn dieses Mal?«
Quinn seufzte und ließ sich wieder auf ihren Stuhl fallen. »Schon wieder eine Party mit seinen Arbeitskollegen. Du weißt doch, wie sie sind – ein paar Kerle mit langweiligen Haarschnitten, deren Job es ist, den Leuten in Langley Kaffee zu bringen, tun so, als würden sie die Welt regieren. Und immer wenn David mit ihnen zusammen ist, spielt er den Angeber und redet mit mir, als wäre ich geistig minderbemittelt.«
»Erzähl mir was Neues.«
Quinns Blick ging an ihrer Freundin vorbei und blieb an den Männern und Frauen in dem Raum hängen, in dem fast alle Computeranlagen des FBI standen. »Dieses Wochenende wollten wir eigentlich Fallschirmspringen gehen.«
»Fallschirmspringen? Soll das etwa heißen, du wolltest dich aus einem Flugzeug werfen?«
Quinn nickte. »Ich habe einen ganz tollen Kurs gefunden – man macht einen Tag Theorie, und dann lassen sie einen springen. Zwei Leute springen mit, und einer von ihnen filmt dich. Ich habe Monate gebraucht, um David dazu zu bringen, den Kurs mit mir zusammen zu machen, und er hat versprochen, dass wir dieses Wochenende hingehen. Aber jetzt sagt er, dass wir zu dieser Party müssen und dass er sowieso zu viel zu tun hat.«
»Wenn Gott gewollt hätte, dass wir aus Flugzeugen springen, hätte Er uns Flügel gegeben.«
Quinn zuckte mit den Schultern. »Ich dachte, es wäre mal was Neues. Etwas Aufregendes.«
»Dann musst du jetzt also auf diese Party gehen, dich betrinken und etwas essen, für das du nichts bezahlen musst, anstatt in deinen Tod zu springen.«
»Das ist noch nicht alles.«
»Raus damit.«
»David möchte, dass ich das Kleid trage.«
Katie schlug entsetzt die Hände vors Gesicht. »O mein Gott! Nicht das Kleid!« Sie kreischte so laut, dass alle im Büro stehen blieben und den Kopf in ihre Richtung drehten.
Die beiden Frauen beugten sich zueinander, versteckten sich, so gut es ging, hinter Quinns Schreibtisch und versuchten, einen Lachanfall zu unterdrücken. Als Katie sich wieder einigermaßen unter Kontrolle hatte, drückte sie Quinn mitleidig die Hand. »Nicht das Kleid!«, wiederholte sie, dieses Mal mit Flüsterstimme. »Himmel, alles, nur das nicht.«
ZWEI
Brad Lowell spürte die Augen der Sekretärin auf sich, doch das reichte nicht, um ihn dazu zu bringen, die Tür zu öffnen und hindurchzugehen. Er holte tief Luft und sah sich in dem geräumigen Vorzimmer um, während er sich bemühte, ihrem neugierigen Blick auszuweichen. Die wenigen Möbel sahen teuer und viel zu funktionell aus. Die Wände waren etwas zu weiß und völlig ohne Bilder, was den Eindruck hervorrief, dass der Raum noch nicht ganz fertig war. Doch er wusste, dass dem nicht so war. Die Büroetage hatte sich schon seit Jahren nicht mehr verändert. Genau wie der Mann, für den sie eingerichtet worden war.
»Sie können gleich reingehen«, forderte ihn die Sekretärin auf.
Lowell warf ihr einen Blick zu, und sie lächelte ihm aufmunternd zu. Sie wusste zwar nicht, weshalb er hier war, aber es war klar, dass er nicht der Erste war, der sich nervös vor dem Büro ihres Chefs herumgedrückt hatte.
Lowell drückte den Rücken durch und knöpfte sein Jackett zu, dann stieß er die Tür auf, ging hindurch und zog sie hinter sich zu. Die Luft in dem Raum, in dem er jetzt stand, schien anders zu sein – irgendwie dichter. Er wusste, dass er sich das nur einbildete, doch das beklemmende Gefühl, das ihn überfiel, konnte er trotzdem nicht abschütteln.
Richard Price reagierte auf sein Kommen mit einem kurzen Nicken – nicht mehr und nicht weniger, als die Höflichkeit gebot – und fuhr fort, etwas auf den Block zu schreiben, der genau in der Mitte seines Schreibtisches lag.
Die Lesebrille auf seiner Nase gehörte noch nicht lange zum Inventar, doch nun, da Price auf Ende sechzig zuging, kam sie immer häufiger zum Einsatz. Bis auf die Brille und die an den Schläfen grau werdenden Haare sah er noch genauso aus wie vor fünfzehn Jahren, als Lowell ihn kennengelernt hatte. Unter dem akribisch gebügelten Anzughemd waren breite Schultern zu erkennen, und ein abrupt schmaler werdender Oberkörper, der in einer steinharten Taille endete. Die Kombination aus diesem beeindruckenden Körperbau und der breiten, flachen Nase, auf der die Brille saß, ließ ihn aussehen wie eine Mischung aus pensioniertem Boxer und Intellektuellem – was im Grunde genommen gar nicht einmal so falsch war.
»Was ist passiert, Brad?«, sagte Price, der immer noch nicht den Kopf hob. Lowell starrte auf den vergoldeten Kugelschreiber in der faltigen Hand, der sich über das Papier bewegte.
»Wir hatten ein Problem, Sir.«
»Das habe ich mir schon gedacht. Eigentlich bin ich davon ausgegangen, dass die Operation perfekt vorbereitet war.«
»Die Zielperson hat nicht kooperiert.«
Lowell widerstand der Versuchung, an seiner Krawatte zu zerren, die mit einem Mal etwas zu eng saß. Auch nach all den Jahren konnte Price ihn noch problemlos einschüchtern.
»Wollen Sie noch eine Weile um den heißen Brei herumreden, oder erzählen Sie mir endlich, was passiert ist?«
»Er ist nicht aufgetaucht. Er hat sich ein anderes Opfer und einen anderen Ort gesucht.«
»Was für ein ›anderes Opfer‹?«
Lowell zog ein kleines Notizbuch aus der Tasche seines Jacketts und las daraus vor, obwohl sich ihm der Inhalt unauslöschlich ins Gedächtnis gebrannt hatte. Er wusste, dass er keinen Fehler machen durfte. Price hatte eine schon fast unheimliche Begabung dafür, sich auf den kleinsten Fehltritt zu stürzen. Und er vergaß nie etwas.
»Mary Dunnigan. Sechsundzwanzig Jahre alt, Wirtschaftswissenschaftlerin, angestellt bei einem Thinktank in Washington. Sie hat dort seit etwas mehr als einem Jahr gearbeitet – die Stelle hat sie direkt nach ihrer Promotion an der Georgetown University angenommen.«
Lowell hob für einen Moment den Kopf, als Price seine Brille absetzte und auf den Schreibtisch legte. Sein Gesichtsausdruck war nicht zu deuten. »Sie hatte seit drei Monaten einen Freund – ein junger Rechtsanwalt, keine Vorstrafen. Die Beziehung scheint nicht sehr eng gewesen zu sein, aber wir haben keinen Hinweis darauf, dass es noch einen anderen Mann in ihrem Leben gab. Bis jetzt hat er zwei Nachrichten auf ihrem Anrufbeantworter hinterlassen, aber er scheint noch nicht sonderlich besorgt zu sein …«
»Was ist mit ihrem Arbeitgeber?«
»Jemand aus der Firma hat eine Nachricht auf ihren Anrufbeantworter gesprochen, nachdem sie heute Morgen nicht zur Arbeit erschienen ist, aber sie haben lediglich um Rückruf gebeten, anstatt sich Sorgen wegen ihrer Abwesenheit zu machen. Anscheinend hat sie manchmal von zu Hause aus gearbeitet und keine festen Arbeitszeiten eingehalten.«
»Die Polizei?«
»Befasst sich noch nicht damit. Es dürfte wohl Montag, vielleicht sogar Dienstag werden, bis sie als vermisst gemeldet wird. Wenn die Polizei dann erst eingeschaltet wird, wird es so aussehen, als wäre sie gerade erst verschwunden. Irgendwann werden die Beamten mit den Ermittlungen beginnen, aber ich glaube, wir können davon ausgehen, dass sie sich auf ihren aktuellen Freund und ein paar frühere Beziehungen konzentrieren werden. Sie werden kein sehr enges Zeitfenster für ihr Verschwinden ausmachen können, sodass Alibis nur schwer zu ermitteln sein werden. Wir werden die offiziellen Ermittlungen jedenfalls sehr genau beobachten.«
»Es ist also noch einmal gut gegangen.«
»Ich glaube, ja.«
»Dann haben wir Glück gehabt.«
»Ja, Sir. Da ist noch etwas. Aus ihrer Krankengeschichte geht hervor, dass sie als Studentin wegen Depressionen behandelt wurde. Eine der Ursachen war Überarbeitung, es ging aber auch um eine gescheiterte Beziehung. Das dürfte allzu ehrgeizige Ermittlungen der Polizei sehr unwahrscheinlich machen. Man wird wohl einfach annehmen, dass sie …
Price wies auf einen Stuhl vor seinem Schreibtisch. »Sie wissen, was ich von Glück halte …«
»Ja, Sir«, erwiderte Lowell, während er sich setzte. Aus irgendeinem Grund fühlte er sich jetzt noch unwohler. »So denke ich auch. Aber in diesem Fall …«
»Familie?«
»Beide Elternteile sind noch am Leben und miteinander verheiratet, außerdem hat sie einen jüngeren Bruder. Die ganze Familie lebt in Texas, keine erkennbaren Verbindungen in die Politik oder zur Polizei, kein größeres Vermögen.«
Das Gesicht von Price wurde starr. Er presste die Faust auf die Lippen und schien sich auf den dicken Teppich unter seinen Füßen zu konzentrieren. Lowell kannte diese Angewohnheit und wusste, dass er kein Wort sagen durfte, während Price über das Problem nachdachte. Er nutzte die Zeit, um in Gedanken noch einmal den Rest dessen, was er zu sagen hatte, durchzugehen. Es dauerte fast eine Minute, bis Price sich aus seiner Starre löste.
»Wie ist das passiert, Brad? Wie konnten wir ihn aus den Augen verlieren?«
Mit dieser Frage hatte Lowell gerechnet, und er wusste, dass er seine Antwort vorsichtig formulieren musste. Erklärungen akzeptierte Price, Ausreden dagegen nicht. Dazwischen lag ein schmaler Grat, der manchmal gefährlich sein konnte.
»Sir, ich habe zurzeit nur drei Männer, mit denen ich arbeiten kann. Einer von ihnen ist neu. Ich habe einfach nicht genug Personal, und das bedeutet, dass ich mich fast ausschließlich auf elektronische Überwachungsmöglichkeiten verlassen muss …«
»Und warum ist das ein Problem?«
»Er findet unsere Wanzen und Ortungsgeräte fast schneller, als wir sie installieren können. Und ich glaube, das ist schon die ganze Zeit so gewesen.«
Price rollte seinen Stuhl zurück und konzentrierte sich wieder auf den Teppich, doch dieses Mal ging Lowell das Risiko ein und unterbrach seinen Gedankengang. »Sir, ich glaube, wir verlieren die Kontrolle.«
Price bewegte nur die Augen. Sein Blick ging für einen Moment nach oben und kehrte dann sofort wieder zum Boden zurück. »Die Situation ist zwar ernst, Brad, aber es ist keine neue Situation. Es besteht kein Anlass dazu, übertrieben zu reagieren.«
»Dieses Mal war es anders.« Lowell stellte überrascht fest, dass er laut geworden war. Er sprach leiser, respektvoller weiter, aber er wollte nicht schweigen. Dieses Mal nicht.
»Bis jetzt gab es immer einen Vektor. Wir haben es kommen sehen. Aber dieses Mal war es anders. Zufällig. Willkürlich. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll … Es war wie ein Spiel. Sir, ich weiß nicht, wo das hinführen wird. Ich glaube, es wird Zeit, dass wir unsere Position noch einmal überdenken …« Lowell brach ab, und ein langes Schweigen begann. Er hatte noch mehr zu sagen – nach zehn Jahren hatte sich bei ihm eine Menge Frustration aufgestaut. Doch dafür war jetzt nicht der richtige Zeitpunkt.
»Wir stehlen inzwischen nur noch Zeit, Brad. Und das wissen wir beide«, sagte Price schließlich. »Wir müssen diese Sache so lange wie nur irgend möglich geheim halten.«
»Ja, Sir. Ich verstehe.« Lowell hatte gewusst, dass er nichts ändern konnte. Aber er hatte endlich einmal seine Meinung sagen müssen.
»Und wenn wir das Team verdoppeln? Wäre das eine Lösung?«
Lowell rutschte unruhig auf seinem Stuhl hin und her. Er wusste, was Price hören wollte, aber er war nicht bereit, das Unbehagen zu unterdrücken, das ihn angesichts dieses Vorschlags beschlich. »Ich weiß nicht, Sir. Ich weiß es wirklich nicht. Es ist ein Risiko, noch mehr Leute ins Boot zu holen. Und ich kann nicht garantieren, dass der Nutzen das Risiko wert ist.«
»Ich glaube nicht, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt eine Alternative haben.« Price kritzelte etwas in seinen Terminkalender. »Machen Sie mir eine Liste mit Kandidaten, Brad. Wir treffen uns heute Nachmittag um vier Uhr, um die Leute auszusuchen.«
DREI
Quinn Barry lächelte immer noch, als sie das Computerzentrum des FBI wieder betrat. Selbst das depressive Grau des riesigen Raums und die ernsten Mienen der Leute, die dort arbeiteten, schafften es nicht, das Lächeln aus ihrem Gesicht zu vertreiben. Nach knapp einer Stunde mit Katie und ihrer fast schon manischen Energie, ihren unausgegorenen Theorien und ihrem schamlosen Flirt mit dem zugegebenermaßen hinreißend aussehenden Kellner brauchte es schon etwas mehr als den allgegenwärtigen Geist von J. Edgar Hoover, um ihr die Laune zu verderben. Und wenn der Test mit dem forensischen Index funktioniert hatte, war sie vielleicht sogar in der Lage, Davids Party am Abend ohne ihr übliches Dutzend mit Wasser verdünnten Wodka Tonics durchzustehen.
Sie warf nicht einmal einen flüchtigen Blick auf den Bildschirm, als sie sich auf ihren Stuhl fallen ließ. Stattdessen griff sie sich ihre Tasse und sah sich verstohlen um. Als sie einigermaßen sicher sein konnte, dass sie gerade unbeobachtet war, drehte sie die Tasse genau einmal herum und klopfte dann zweimal damit auf ihren Schreibtisch. Es war ein Ritual, das sie sich in ihrer Zeit als Programmiererin angewöhnt hatte. Okay, es war ausgesprochen albern, aber nicht annähernd so kompliziert wie manche der Zwangshandlungen, die andere Programmierer entwickelt hatten.
Quinn nahm einen Kugelschreiber und stupste damit ihre Maus an. Einen Moment später erwachte der Bildschirm zum Leben, und sie konnte zusehen, wie sich einige Worte bildeten.
SUCHE 1 ABGESCHLOSSEN
SUCHE 2 ABGESCHLOSSEN
Nachdem sie einen tiefen Seufzer der Erleichterung ausgestoßen hatte, gab sie ein paar Befehle in das System ein und vergewisserte sich, dass die beiden getrennten Suchmaschinen ihre Aufgaben tatsächlich abgearbeitet hatten. Und – was noch wichtiger war –, dass die zweite Suchmaschine, die sie geschrieben hatte, nicht gecrasht, explodiert, abgebrochen oder in eine Schleife gegangen war. Quinn startete einen Druckjob und sah sich noch ein paar kleinere Details an, während die Suchergebnisse auf dem Drucker an der Wand hinter ihr ausgegeben wurden, den sie sich mit ihren Kollegen teilte. Als sie die Programmstatistiken durchsah, wurde ihr Lächeln noch breiter. Ihre Suchmaschine war ganze 75 Prozent schneller gelaufen als die andere und hatte erheblich weniger Bandbreite benutzt.
»Schätzchen, du bist genial«, flüsterte sie, während sie sich mit den Füßen vom Boden abstieß und den Bürostuhl zum Drehen brachte. Als er zum Stehen kam, sprang sie auf und lief zum Drucker. Die Ergebnisse des ersten Programmlaufs – die Suchmaschine, die ursprünglich für CODIS programmiert worden war – lagen bereits im Ausgabefach des Druckers. Wie erwartet, hatte die Suchmaschine einwandfrei, aber fantasielos funktioniert und jede der fünfzig erfundenen DNA-Signaturen, die sie in die Datenbanken der Bundesstaaten eingestellt hatte, richtig zugeordnet und den Standort des kriminaltechnischen Labors sowie die entsprechenden Fallnummern ausgespuckt. Als die Ergebnisse ihrer eigenen Suchmaschine aus dem Drucker kamen, schnappte sie sich das Papier und überflog das Ergebnis.
Die beiden Berichte sahen identisch aus.
»Ja!«, rief sie triumphierend, während sie mit der Faust auf den Drucker schlug. Dann sah sie die pikierten, leicht verärgerten Mienen ihrer Kollegen. »Entschuldigung«, murmelte sie. Sie bemühte sich, einen ernsten Gesichtsausdruck aufzusetzen und nicht zu lachen, als sie wieder zu ihrem Schreibtisch ging.
Sie setzte sich auf ihren Stuhl und fuhr mit dem Finger über die Datenspalten auf dem Ausdruck. Es war alles da – ihre erfundene DNA-Signatur mitsamt Fallnummer, die Standorte der Labors, beginnend mit Alabama – Nummer eins – und endend mit Wyoming, Nummer … Als sie die Zahl sah, die auf den Eintrag für Wyoming folgte, blieb ihr ein weiterer triumphierender Ausruf in der Kehle stecken. Fünfundfünfzig.
Unwillkürlich runzelte sie die Stirn und schob die Brille auf ihrer Nase zurecht, um sich besser auf den Ausdruck konzentrieren zu können. Fünfundfünfzig?
Sie fuhr mit dem Finger auf der Seite nach oben und fand den ersten Übeltäter fast sofort. Für das Labor in Pennsylvania waren zwei Treffer aufgeführt. Einer mit ihrer erfundenen DNA-Signatur und ein zweiter mit einer Signatur, die ihr unbekannt war. Sie zog einen Kugelschreiber aus der Tasche und malte einen Kreis um die rätselhaften Daten. Dann suchte sie nach dem Rest.
Zwei Minuten später hatte sie alle Treffer markiert. Für Pennsylvania, Oregon, Oklahoma, Maryland und New York war die gleiche unbekannte DNA ausgegeben worden. Aber es ergab keinen Sinn – es hätte funktionieren müssen. Sie starrte mit leicht geöffnetem Mund auf den Ausdruck und versuchte herauszufinden, wo sie einen Fehler gemacht hatte.
Ihre Suchmaschine hatte genau das getan, wozu sie programmiert worden war – sie hatte zwischen den erfundenen DNA-Signaturen, die von Quinn in den Computer jedes einzelnen Bundesstaates eingegeben worden waren, eine Verbindung hergestellt und diese als Serie von Verbrechen dargestellt, die von ein und demselben, nichtexistenten Täter in allen amerikanischen Bundesstaaten begangen worden waren. Aber was zum Teufel hatte die anderen fünf Treffer ausgelöst? Die DNA-Signatur war in allen fünf Fällen die gleiche, von CODIS aber noch nie als Übereinstimmung identifiziert worden. Quinn legte den Kopf in die Hände, schloss die Augen und sperrte die Daten vor sich aus. Wo hatte sie Mist gebaut? Sie hatte fast denselben Algorithmus wie vorher benutzt, da die meisten Änderungen mit der Hardwarekompatibilität zu tun hatten.
Nachdem sie fünf Minuten lang angestrengt nachgedacht hatte, ergab es immer noch keinen Sinn. Sie wäre nicht überrascht gewesen, wenn das gesamte System gecrasht wäre. Oder wenn ihr Programm überhaupt keine Verbindungen gefunden hätte. Sie hätte sich selbst dann nicht gewundert, wenn es eine unendliche Anzahl von Verbindungen gefunden hätte. Aber fünf?
Als sich eine Hand auf ihre Schulter legte, erschrak Quinn so sehr, dass sie ihren Kugelschreiber gegen den Bildschirm warf. Sie drehte den Kopf nach hinten und stellte fest, dass ihr Chef, der fast immer mit todernstem Gesicht durch das Büro ging, zur Abwechslung einmal amüsiert aussah.
»Louis. Tun Sie das nie wieder.«
»Sie sind doch nicht etwa nervös? Vielleicht würde es helfen, wenn Sie nicht mehr so viel von diesem Tee trinken würden.«
»Wenn etwas in einem Karton steckt, der mit fröhlichen Hippie-Motiven bedruckt ist, kann es nicht schlecht für mich sein«, erwiderte Quinn, während sie sich krampfhaft um einen lockeren Ton bemühte.
»Ich habe Sie bis in mein Büro brüllen hören. Es klang, als hätten Sie mir etwas zu sagen. Und ich hoffe, es ist etwas Gutes.«
Quinn erstarrte für einen Moment, fing sich dann aber gleich wieder und zwang sich zu einem Lächeln. »Etwas Gutes. Oh, ja, natürlich. Mit Sicherheit etwas Gutes.«
»Dann läuft das System?«
»Der Suchmaschinentest für den forensischen Index hat hervorragend funktioniert«, log sie. »Er war erheblich schneller als das alte System.«
Louis schlug mit der flachen Hand auf die Rückenlehne von Quinns Bürostuhl, und sie zuckte schon wieder zusammen. »Großartig! Das ist großartig, Quinn. Kann ich das so weitergeben?«
»Ähm, ja, natürlich. Aber Sie wissen, dass ich noch nicht fertig bin, ja? Ich habe ja schon gesagt, dass es noch ein paar Details gibt, die ausgebügelt werden müssen, und beim Betatesten werden mit Sicherheit noch ein paar Fehler auftreten …«
»Ja, natürlich«, erwiderte Louis, aber es schien, als würde er ihr gar nicht zuhören. »Gute Arbeit, Quinn. Gute Arbeit.«
Sie sah zu, wie er davoneilte, und spürte, wie ihr Lebenswille abrupt auf null sank. Das eben gehörte nicht gerade zu den intellektuellen Höchstleistungen in ihrem Leben. Louis war in Gedanken sicher schon dabei, seinen Chef anzurufen und ihm zu erzählen, dass das neue System »voll funktionsfähig« sei. Computerlaien liebten diesen Ausdruck – »voll funktionsfähig«. Morgen würde sie von alten Knackern in Anzügen umgeben sein, die alle eine Demonstration wollten.
Und was konnte sie ihnen zeigen? Ein System, das unsinnige Daten ausgab, was von einem Programmfehler verursacht wurde, von dem sie nicht einmal wusste, wo sie ihn suchen sollte. Die Herren in den Anzügen würden sie mit Sicherheit umgehend nach Quantico zur Ausbildung als FBI-Beamtin schicken. Nachdem Weihnachten und Ostern auf denselben Tag gefallen waren.
Quinn sah auf die Uhr. Sie hatte noch fünf Stunden, bevor David sie von zu Hause abholen würde, um mit ihr zu der Party zu gehen. Zwar spielte sie kurz mit dem Gedanken, ihn anzurufen und abzusagen, doch das wäre das vierte Mal hintereinander, und sie hatte einfach keine Kraft mehr für einen Streit mit ihm.
Sie ließ noch einen Teebeutel in die Tasse fallen, die nicht länger ihre Glückstasse war, und ging zur Kaffeemaschine, um sich heißes Wasser zu holen. Dann musste sie es eben an diesem Nachmittag schaffen.
VIER
»Steigen Sie aus.«
Geller tat, wie ihm geheißen wurde. Er stieß die Tür des Vans auf, stieg aus und versank sofort in knöcheltiefem Schlamm.
Dem Wetterbericht im Radio zufolge war der Hurrikan Bart zu einem Tropensturm herabgestuft worden, doch der Unterschied schien rein theoretisch zu sein, da Geller sich gegen Windgeschwindigkeiten von 80 km/h stemmen musste. Der in Strömen fallende Regen durchnässte ihn innerhalb von Sekundenbruchteilen bis auf die Haut und verstärkte das Gefühl der Kälte, das er nicht mehr abschütteln konnte, selbst nachts nicht, wenn er in seinem Bett lag.
Geller versuchte, im Licht der Autoscheinwerfer zu bleiben, stellte jedoch fest, dass sie den Regen reflektierten und ihn blendeten. Er drehte sich zum Van hin und fuhr sich mit dem Finger über die Kehle. Einen Moment später wurde das Licht abgeschaltet, und er war allein mit der Dunkelheit und dem Brüllen des Sturms.
Vorsichtig ging er weiter. Den Maschendrahtzaun vor sich sah er erst, als er nur noch wenige Schritte davon entfernt war. Es dauerte ein paar Sekunden, bis er den richtigen Schlüssel am Bund gefunden hatte, doch nach einigen Versuchen gelang es ihm, das schwere Vorhängeschloss aufzusperren und die Kette abzuziehen, mit der das Tor verschlossen war.
»Los!«, brüllte er, während er gegen den Wind ankämpfte und das Tor aufmachte. Der Van rollte darauf zu, ein dunkler Schatten, der langsam durch die Pfützen an ihm vorbeifuhr.
»Haben Sie das Tor wieder abgeschlossen?«
Geller fuhr sich mit der Hand durch seine kurzen Haare und versuchte, so viel Wasser wie möglich aus ihnen herauszubekommen, während er sich auf den Beifahrersitz schob. »Nein, Sir. Ich habe die Kette durch das Tor geschoben und das Schloss eingehängt, es aber nicht einschnappen lassen. So, wie Sie es angeordnet haben.«
Brad Lowell reagierte auf die Antwort lediglich, indem er das Gaspedal durchtrat und den Van mit einem kräftigen Ruck in Bewegung setzte. Die Dunkelheit, der Regen und die beschlagenen Fenster schienen ihm nichts auszumachen, während er mit zunehmender Geschwindigkeit durch die teilweise überfluteten Straßen fuhr. Geller fragte sich, wie oft er wohl schon durch den aufgelassenen Armeestützpunkt gefahren sein musste, um unter diesen Wetterbedingungen so präzise manövrieren zu können. Nachdem er kurz überlegt hatte, kam er allerdings zu dem Schluss, dass er es gar nicht wissen wollte.
»Wie weit noch?«, fragte Geller, nicht so sehr aus Interesse, sondern eher, um dem Schweigen im Wagen ein Ende zu machen. Lowell hatte dieses Bedürfnis offenbar nicht.
Schließlich lehnte Geller den Kopf ans Fenster und starrte in die Dunkelheit hinaus. Die meiste Zeit über sah er nur den unablässig fallenden Regen, doch alle paar Sekunden tat sich eine Lücke in dem dichten Vorhang aus Wasser auf, die ihm einen Blick auf die Umgebung gestattete. Dann tauchten wie geisterhafte Schemen quadratische, eng beieinanderstehende Gebäude aus der Dunkelheit auf, die genauso schnell wieder in dem Gewitter verschwanden. Alles sah tot aus. Wie das, was hinter ihnen lag.
Er streckte die Hand aus und stützte sich ab, als Lowell das Steuer des Vans nach rechts riss, den Rückwärtsgang einlegte und nach ein paar Sekunden abrupt zum Stehen kam. »Los«, sagte er, während er die Tür neben sich aufstieß und aus dem Wagen sprang. Geller saß wie erstarrt da, die Hand auf das Armaturenbrett gestützt. Er hörte, wie die hinteren Türen des Vans aufgerissen wurden.
»Geller! Setzen Sie endlich Ihren Arsch in Bewegung. Sofort!«
Er holte tief Luft und zwängte sich zwischen den beiden Sitzen hindurch, um in den hinteren Teil des Vans zu gelangen. Die Innenraumbeleuchtung war ausgeschaltet worden, sodass er sich nur am Licht der Scheinwerfer orientieren konnte, das durch die Windschutzscheibe reflektiert wurde.
»Haben Sie’s?«
Geller beugte sich vor und packte sein Ende des in eine Plastikplane eingewickelten Pakets. Dann wuchtete er es hoch und ging mit kleinen Schritten in Richtung Ausstieg, während Lowell das andere Ende aus dem Van bugsierte.
Geller schaffte es, das Paket nicht fallen zu lassen, als er die sechzig Zentimeter von der Ladefläche bis zum Boden sprang, doch im Regen wurde die Kunststoffplane immer glatter, als sie sich auf eine zweiflügelige Tür in einem verfallenen Lagerhaus zubewegten. Drei Meter vor dem Gebäude rutschte ihm die Plane aus den Händen, und sein Ende fiel in das Wasser, das ihm um die Knöchel floss.
»Großer Gott, Geller!«
»Tut mir leid«, sagte Geller leise, der spürte, wie ihm trotz des kühlen Regens, der über sein Gesicht lief, die Hitze in die Wangen stieg. »Ich …«
»Heben Sie’s auf!«
Geller ging in die Hocke und versuchte vergeblich, die nasse Plane zu packen, doch sie rutschte ihm immer wieder aus den Händen. Dieses Mal sprach Lowell langsamer als sonst und betonte jedes einzelne Wort. Seine fast schon mechanische Gelassenheit war verschwunden, und Geller hörte die Wut in seiner Stimme. »Wenn Sie das jetzt nicht sofort aufheben …«
Geller schloss die Augen und zwang sich dazu, die Arme um sein Ende des Pakets zu schlingen und die Hände darunter zu verschränken. Jetzt konnte er alles spüren. Jeden Knochen, jede Rundung des Körpers. Die Leichenstarre war inzwischen vollständig ausgebildet, und das Paket fühlte sich an wie eine Statue. Die Statue einer toten Frau, die ein paar Jahre jünger gewesen war als er.
Plötzlich wurde ihm flau im Magen, doch er unterdrückte das Gefühl und weigerte sich, seinem sich sträubenden Verstand die Kontrolle über seinen Körper zu überlassen. Wenigstens hatte er nicht die andere Seite des Pakets bekommen, sagte er zu sich, während sie das Paket durch die Tür wuchteten und einen Korridor hinuntergingen. Das wäre noch schlimmer gewesen. Er wusste nicht, ob er es ertragen hätte, ihre gebrochenen, zusammengezerrten Beine unter seinen Händen zu spüren.
»Hier rauf.«
Nachdem Geller ihm geholfen hatte, die Leiche der Frau auf ein Förderband aus Stahl in dem ansonsten völlig leeren Raum zu schwingen, trat er einen Schritt zurück. »Sir, es tut mir leid, dass ich …«
»Sie haben das ganz gut gemacht.« Lowell hatte seine Fassung wiedergewonnen und schien das Missgeschick schon vergessen zu haben, als er einen der Knöpfe drückte, die in die Wand aus Beton eingelassen waren. Mit einem Mal übertönten knarrende Metallräder und zischendes Gas das Brüllen des Sturms, das bis in das baufällige Gebäude drang.
Geller starrte das Paket – die Frau – an, während es sich auf eine kleine Öffnung in der Wand zubewegte, die links und rechts von schweren Türen aus Metall flankiert wurde. In der schwarzen Kunststoffplane und dem Isolierband spiegelten sich matt die Stichflammen, die aus Rohren in dem Loch am Ende des Förderbands schossen.
»Wie lange wird es dauern?«, hörte sich Geller sagen.
Als die Leiche in dem Loch verschwunden war, schlug Lowell die Türen zu und verriegelte sie.
»Nicht lange. Eine Stunde. Vielleicht etwas länger.«
Geller nickte stumm. Er konnte seinen Blick nicht von den kleinen Türen abwenden, durch die hörbar zischend das Gas entwich. Als er die Hitze auf seiner Haut spürte, versuchte er, ihr zu entkommen, und machte ein paar Schritte rückwärts.
FÜNF
»Ich verstehe nichts!«, rief Quinn aus dem Bad, während sie sich so weit vorbeugte, dass ihre Nase nur noch ein paar Zentimeter vom Boden des Waschbeckens entfernt war. Die Kontaktlinse, die sie hatte fallen lassen, schien sich mit Absicht vor ihr zu verstecken.
»Ich habe gesagt, dass der Alte stocksauer gewesen ist!« David war im Wohnzimmer und führte die Unterhaltung brüllend weiter, weil er sich nicht vom Fernseher wegbewegen wollte. »Ich weiß nicht, was Bob sich dabei gedacht hat, aber er hat eindeutig Mist gebaut.«
Endlich sah Quinn die Kontaktlinse und schaffte es, sie auf ihren Finger zu bugsieren. Nachdem sie sie abgewaschen hatte, schob sie die Lider ihres stark geröteten Auges auseinander und versuchte zum dritten Mal, die Linse einzusetzen. Es war nicht normal, dass man mit den Fingern in den eigenen Augen herumstochern musste, um besser sehen zu können. Dazu war der Mensch einfach nicht geschaffen.
»Ich glaube nicht, dass er den Job jetzt noch bekommt. Und du weißt, was das bedeutet.«
Die Kontaktlinse verfing sich in Quinns Wimpern, und ein unwillkürliches Blinzeln schickte sie wieder ins Waschbecken. Die widerspenstige Kontaktlinse, die Schadenfreude in Davids Stimme und die Tatsache, dass sie immer noch keinen blassen Schimmer hatte, an welcher Stelle sie das Suchprogramm für CODIS vermurkst hatte, gaben ihr den Rest. »Himmel, David. Bob ist dein Freund!«
»Ich wünsche ihm doch nichts Böses«, brüllte David zurück. Sie hörte, wie er durch die Fernsehprogramme zappte. »Aber wenn er den Job nicht bekommt, könnte es gut sein, dass ich ihn kriege.«
Quinns Hand ging zum Wasserhahn und drehte ihn mit einer einzigen, wütenden Bewegung auf. Als die störrische Kontaktlinse im Abfluss verschwand, huschte ein zufriedenes Lächeln über ihr Gesicht.
»Vermutlich«, erwiderte sie, während sie die Brille mit dem breiten schwarzen Rahmen aufsetzte und ins Schlafzimmer ging. Da sie keinen Standspiegel hatte, musste sie auf das Bett steigen, um in dem Spiegel auf der Kommode mehr als nur ihren Oberkörper sehen zu können.
Quinn starrte ihr Spiegelbild einige Sekunden lang an und holt dann tief Luft, um einen Seufzer ausstoßen zu können. Dabei rutschte das ultrakurze Kleid, das David ihr gekauft hatte, ein Stück höher und ließ ein Stück weiße Unterwäsche hervorblitzen. Sie verzog das Gesicht und zerrte den Saum mit einem kräftigen Ruck nach unten, während sie auf der weichen Matratze einen Schritt nach hinten machte, um sich ganz im Spiegel sehen zu können.