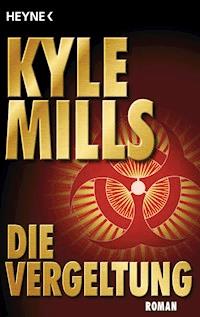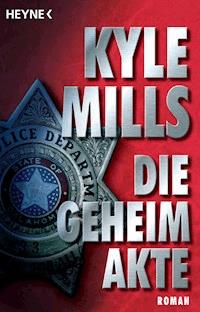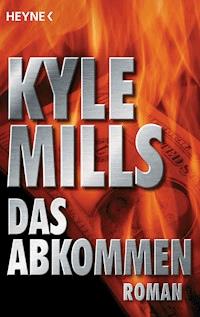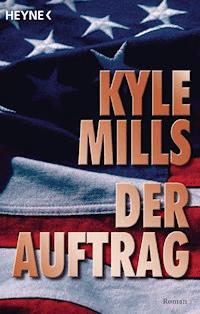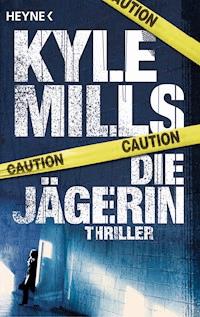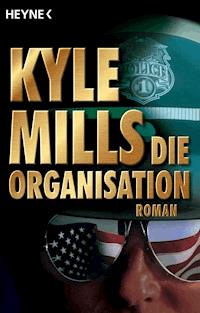
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Amerika in Angst und Schrecken
Ein teuflischer Plan bedroht die Vereinigten Staaten von Amerika: Terroristen wollen das Land mithilfe des organisierten Verbrechens mit afghanischem Heroin überschwemmen. Ein blutiger Drogenkrieg mit Tausenden von Opfern wäre die Folge. Kann FBI-Agent Mark Beamon die Bedrohung aufhalten?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 665
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Das Buch
Mark Beamon, den das FBI nach Phoenix strafversetzt hat, wird von seiner früheren Kollegin Laura Vilechi, die jetzt dem FBI vorsteht, zur Hilfe gerufen: Ein Foto mit zugehöriger Erklärung von Al-Kaida-Terroristen weist auf die Präsenz eines Raketenwerfers samt Raketen auf amerikanischem Boden hin. Hinter der Drohung steckt Musafa Yasin, der Bin Laden als Kopf der Al-Kaida abgelöst hat. Sein Ziel ist es, den amerikanischen Markt mit afghanischem Heroin zu überfluten, was einen blutigen Drogenkrieg mit tausenden von Opfern zur Folge hätte. Dabei benötigt er die Hilfe von Christian Volkow, einem in großem Stil international operierenden Drogen- und Waffenhändler, der den Heroinhandel über stabile Lieferanten aus Asien betreiben will, während die Afghanen versuchen, ihr Heroin über den Gangster Carlo Gasta zu verkaufen. Mark Beamon schleust sich unter dem Decknamen Nicolai, einem vom FBI erfundenen Auftragskiller, bei Gasta ein und findet sich plötzlich in der schillernden Welt der Hochkriminalität wieder. Doch dann fliegt Beamons wahre Identität auf und sein Leben gerät in höchste Gefahr.
Der Autor
Kyle Mills, Jahrgang 1966, lebt in Jackson Hole, Wyoming, wo er sich neben dem Schreiben von Thrillern dem Skifahren und Bergsteigen widmet. In den USA ist Kyle Mills mit seinen Romanen regelmäßig in den Bestsellerlisten zu finden und gilt neben Tom Clancy, Frederick Forsyth und David Badacci als Erneuerer des intelligenten Politthrillers.
KYLE MILLS
DIE ORGANISATION
Roman
Aus dem Amerikanischen von Norbert Jakober
Titel der Originalausgabe SPHERE OF INFLUENCE erschien bei G.P. Putnam’s Sons, New York
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2002 by Kyle Mills
Copyright © 2016 dieser Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Umschlagillustration: © Marvy!/corbis
Umschlaggestaltung: Nele Schütz Design, München
ISBN: 978-3-641-19865-7V002
www.heyne.de
Inhaltsverzeichnis
Das Einzige, wovor wir Angst haben müssen, ist die Angst selbst.
Franklin D. Roosevelt, 4. März 1933
Prolog
»Wie viele von Ihnen sind der Ansicht, dass die Regierung wirklich effizient arbeitet?«
Charles Russell blickte von seinem Rednerpult argwöhnisch zu seinem Kontrahenten hinüber. Dr. Terry Gale, ein populärer Professor für Kriminologie und Strafrecht in Harvard, war ein gut aussehender Mann mit langem braunen Haar, das er zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden hatte, dem obligatorischen Tweedsakko und den ausgebleichten Jeans.
Gale war hinter seinem Rednerpult hervorgetreten und schritt auf dem Podium auf und ab, während er mit Nachdruck zu dem großen Publikum sprach. Er hatte schon die Hälfte einer überaus erfolgreichen Zehn-Städte-Promotion-Tour für sein neuestes Buch hinter sich und wusste genau, wie er seine Argumente präsentieren musste, um die größte Wirkung zu erzielen. Das Buch mit dem Titel »Verbrechen lohnt sich – Amerikas aussichtsloser Kampf gegen das Verbrechen« hatte bereits den Sprung auf die Bestsellerliste der New York Times geschafft und würde wohl bald auf einen Top-Five-Platz klettern.
»Nicht so schüchtern, bitte. Wer findet, dass die Regierung effizient arbeitet?« Er zeigte auf Russell. »Mein Diskussionspartner hat mir versichert, dass er keine Überwachungskameras hier im Saal installiert hat – Sie können Ihre Meinung also ganz frei zum Ausdruck bringen.«
Russell hätte beinahe ein finsteres Gesicht gemacht, doch er fing sich rechtzeitig und lachte nur. Als Leiter des mächtigen Heimatschutzministeriums war er schon öfter von Gale mit bissigem Spott bedacht geworden. Es war wohl am besten, sich davon nicht aus der Ruhe bringen zu lassen.
»Okay, ich sehe ein paar Hände oben«, sagte Gale schließlich.
Es waren nicht viele – fünf vielleicht, die alle ganz vorne saßen. Russell schaute kurz auf sie hinunter und ließ seinen Blick dann über all die jungen Menschen schweifen, die dicht gedrängt im großen Hörsaal der American University saßen. Nachdem keine Fernsehkameras im Saal waren, worauf er selbst bestanden hatte, ehe er sich zu dem Streitgespräch bereit erklärt hatte, war das Licht im Raum etwas weicher und akademischer, sodass er trotz seiner nicht mehr ganz jungen Augen auch Details gut erkennen konnte. Was er sah, war vor allem Ablehnung – junge Intellektuelle aus wohlhabenden Familien, die gekommen waren, weil sie Gales regierungskritischen Fatalismus teilten, junge Menschen, die mit der wirklichen Welt noch nicht in allzu engen Kontakt gekommen waren. Ihre Eltern glaubten bestimmt an dieselben traditionellen Werte wie er selbst, doch ihre Söhne und Töchter steckten noch in der rebellischen Phase. In diesem Alter konnten sie sich dank der Kreditkarten ihrer Eltern noch den Luxus idealistischer Ansichten leisten. In zehn Jahren würden sie schon ganz anders denken. Sie würden dafür eintreten, dass ihnen die Steuerbehörden nur ja nicht zu viel von ihrem hart verdienten Geld abknöpften, dass es sich in ihrer noblen Wohngegend ruhig und sicher leben ließ, dass ihre Kinder eine drogenfreie Schule besuchen konnten, in der es gesittet zuging, und dass sie keine Angst vor Bomben legenden Fanatikern zu haben brauchten …
»Okay«, sagte Gale, »es scheinen nicht gerade viele unter uns zu sein, die von der Arbeit der Regierung überzeugt sind. Das überrascht mich, ehrlich gesagt, nicht wirklich. Ich möchte Ihnen noch eine Frage stellen: Wie viele von Ihnen finden, dass in der Privatwirtschaft effizient gearbeitet wird?«
Fast alle Anwesenden hoben die Hand.
»Ich möchte noch einen Schritt weiter gehen. Es gibt gewiss auch Ineffizienz in der Privatwirtschaft, aber ich behaupte, dass sehr oft übermäßige staatliche Regulierung daran schuld ist. Vergleichen Sie doch Post Office mit Federal Express, dann wissen Sie, was ich meine.«
»Würden Sie also vorschlagen, dass sich die Regierung nicht in die Privatwirtschaft einmischen darf?«, wandte Russell ein. »Sie klingen schon wie ein Republikaner, Dr. Gale.«
Die Bemerkung rief leises Gelächter unter den Zuhörern hervor, was Russell an diesem Punkt der Debatte dringend gebrauchen konnte.
»Natürlich nicht, Sir«, erwiderte Gale. »Was ich sagen will, ist, dass das organisierte Verbrechen durch keinerlei Regulierung eingeschränkt ist und dadurch extrem effizient arbeiten kann. Wenn man dann noch sieht, dass die Regierung keinerlei umfassende Strategie gegen das Verbrechen verfolgt, dann kommt man zu dem Schluss, dass der Kampf gegen diese Auswüchse im Grunde aussichtslos ist.«
Russell überlegte, ob er ebenfalls sein Rednerpult verlassen sollte, doch er schob den Gedanken rasch beiseite. Es würde möglicherweise lächerlich wirken, wenn er versuchte, sich besonders in Szene zu setzen.
»Dieses Urteil erscheint mir nicht gerechtfertigt, Professor. In den vergangenen Jahren haben wir die Polizeipräsenz auf den Straßen verstärkt, wir haben Drogen im Wert von Hunderten Millionen Dollar beschlagnahmt, die in unser Land eingeschmuggelt wurden, wir haben jene Länder, in denen Drogen hergestellt werden, überzeugen können, drastischere Maßnahmen gegen die Produzenten zu ergreifen, wir haben den Kampf gegen den Terrorismus verschärft … und ich könnte noch einiges mehr aufzählen. Und wir sehen auch schon Ergebnisse all dieser Maßnahmen: Der Konsum bestimmter Drogen ist deutlich zurückgegangen, und auch einige Gewaltdelikte sind rückläufig …«
»Aber was sind die Ursachen dieser Entwicklung, Sir? Mehr Festnahmen, Verurteilungen und Haftstrafen? Die Statistiken sagen etwas anderes. Die Drogenpreise gehen nach unten, während die Qualität steigt, was darauf hindeutet, dass die Ware im Überfluss vorhanden ist. Sicherlich, manche Drogen kommen aus der Mode und werden durch andere abgelöst, aber der Konsum geht alles in allem nicht zurück. Es ist typisch für die Regierung, dass jede Menge Initiativen und Programme gestartet werden, die man für erfolgreich erklärt, nur weil man sie eingeführt hat – das Ganze ist ein einziger großer Werbegag. Die Tragödie vom elften September hat sich bisher nicht wiederholt, aber glauben Sie allen Ernstes, dass das darauf zurückzuführen ist, dass ich jetzt keinen Nagelknipser mehr ins Flugzeug mitnehmen darf? Wir erfahren aus dem Fernsehen, dass die amerikanische Regierung Bolivien gezwungen hat, die Kokainherstellung zu bekämpfen, aber niemand spricht über die Tatsache, dass Kolumbien seine Exporte drastisch erhöht hat.«
Russells Augen verengten sich angesichts des offensichtlichen persönlichen Angriffs. »Und was schlagen Sie vor? Dass wir uns in unser Schicksal fügen und alle tun lassen, was sie wollen? Mein lieber Freund, ich nehme an, Sie sind in einer netten Gegend aufgewachsen, umgeben von wohlhabenden und glücklichen Leuten« – in Wahrheit wusste Russell, dass es so war – »aber ich bin in einer ziemlich üblen Gegend von Detroit groß geworden. Ich hatte jedes Mal Angst, wenn ich aus dem Haus ging …«
»Mein Vorschlag wäre«, erwiderte Gale, »dass die verantwortlichen Politiker sich endlich konkrete Ziele setzen und Strategien entwickeln, um diese Ziele zu erreichen, anstatt publikumswirksame Maßnahmen zu ergreifen, die keinen wirklichen Zweck erfüllen. Sie kennen doch die Schätzungen Ihrer eigenen Experten genauso gut wie ich, Mr. Russell. Demnach macht der internationale Drogenhandel zwei Prozent des weltweiten Bruttosozialprodukts aus. In seinen besten Zeiten kam das Cali-Kartell auf geschätzte Gewinne von sieben Milliarden Dollar pro Jahr. Das ist dreimal so viel wie General Motors. Um seine Auslieferung an die USA zu verhindern, bot Pablo Escobar Kolumbien an, die gesamten Staatsschulden zu begleichen, wenn sie sich weigerten, ihn herauszugeben.«
»Pablo Escobar ist tot«, merkte Russell trocken an.
»Na und? Sein Tod hat die Kokainlieferungen in die USA nicht im Geringsten beeinträchtigt. Was ich sagen will, ist, dass Amerika die Entwicklung von äußerst raffiniert agierenden internationalen Verbrechersyndikaten begünstigt. Wir machen im Grunde die gleichen Fehler wie in unserer Vergangenheit. Die Prohibition hat zu einem immensen Aufschwung der Mafia geführt, und heute haben wir es mit einem Phänomen zu tun, das die Prohibition bei weitem übertrifft. Es gibt Leute mit einem Vermögen, das dem von Bill Gates kaum nachstehen dürfte – Leute, über die wir überhaupt nichts wissen. Sie verfügen über eine enorme politische und finanzielle Macht, sie mischen sich in die Angelegenheiten von souveränen Staaten ein und schüren militärische Konflikte, sie kaufen Rohopium von irgendwelchen Terrororganisationen, die mit dem Drogengeld Kriege gegen uns führen. Sie zahlen keine Steuern und halten sich an keine Gesetze …«
»Ich muss gestehen, ich habe die betreffenden Kapitel in Ihrem Buch sehr unterhaltsam gefunden«, warf Russell mit einem sarkastischen Lächeln ein. »Wer sind denn diese geheimnisvollen Könige des Drogenhandels? Ich habe noch nie einen von ihnen gesehen oder auch nur von ihm gehört. Es erscheint mir ein bisschen paranoid, immer davon auszugehen, dass es einen solchen ›Mann im Hintergrund‹ gibt, der alle Fäden in der Hand hält und alle illegalen Aktivitäten in der Welt kontrolliert. Sie haben in Ihrem Buch jedenfalls keine Hinweise gegeben, wo wir einen von diesen großen Unbekannten finden könnten. Sie haben auch keine Strukturen im internationalen Verbrechen aufgezeigt, die auf eine solche zentrale Kontrolle schließen lassen. Die Verbrecher, mit denen ich bis jetzt zu tun hatte, sind bei weitem nicht so intelligent und gut organisiert – und da schließe ich einen Pablo Escobar mit ein.«
»Aber das ist es ja gerade, Mr. Russell. Diese Leute bleiben bewusst im Hintergrund. Sie halten sich in keinem Land lange auf, sie besitzen zahlreiche Pässe, sie liefern Geld und Waffen an verschiedene Staaten und verfügen dadurch über eine Reihe von Orten, wohin sie sich jederzeit zurückziehen können. Mit Hilfe von Auslandskonten und -firmen transferieren sie ihr Geld so, dass es nicht aufgespürt werden kann …«
Russell lachte ins Mikrofon. »Also, wenn ich Ihre Logik recht verstehe, Professor, dann meinen Sie wohl, dass es diese Leute geben muss, gerade weil
Eins
Er war schon über eine Stunde dort, doch der Staub, den der Helikopter aufgewirbelt hatte, wurde vom Wind immer noch in alle Richtungen geblasen.
Mit zusammengekniffenen Augen kletterte der Mann, der sich Christian Wolkow nannte, geschickt über die zerklüfteten Felsen, direkt auf eine steile Klippe zu. Er senkte den Kopf, um sich vor dem Wind zu schützen, und setzte sich schließlich auf die Felsklippe, die ihm ein bisschen wie das Ende der Welt vorkam. Unter ihm schien absolut nichts zu sein; es war, als blickte man in einen tiefen Brunnen. Der Mond war genau richtig für das, was heute Nacht passieren würde; er spendete hinreichend Licht, dass man die schneebedeckten Gipfel der fernen Berge ausmachen konnte, aber nicht genug, um irgendwelche Details unten im Tal erkennen zu lassen.
Er suchte nach der kleinen Siedlung, die sich dort unten befinden musste. Nach etwa einer Minute glaubte er sie gefunden zu haben – ein kaum zu erkennendes Leuchten, dessen unnatürliche Gleichmäßigkeit auf menschlichen Ursprung schließen ließ.
Er saß am Rand der Klippe, ließ die Beine hinunterbaumeln und genoss die Leere unter ihm. Er hatte den Hubschrauber selbst gesteuert und niemandem gesagt, wohin er fliegen würde. Niemandem außer Pascal natürlich. Pascal hatte ihm nahe gelegt, nicht hierher zu kommen, oder wenigstens einen Trupp Männer mitzunehmen, denen er vertraute.
Wolkow hatte jedoch auf seinem Entschluss beharrt. Er hatte von solchen Sicherheitsmaßnahmen noch nie so viel gehalten wie Pascal. Die einzige echte Sicherheit war die Anonymität – die Fähigkeit, zu sterben und wieder zum Leben zu erwachen, in viele verschiedene Rollen zu schlüpfen und nur in Form von Tinte auf Papier oder von elektronischen Impulsen in fernen Computern zu existieren. Was die Leute sehen konnten, das konnten sie fürchten und hassen. Und was sie fürchten und hassen konnten, das konnten sie auch zerstören.
Diese kurzen Augenblicke des Friedens waren so selten geworden. Es war Monate her, seit er zum letzten Mal wirklich allein gewesen war – seit er ein paar Minuten für sich gehabt hatte, in denen er etwas Abstand von dem endlosen Schachspiel gewann, zu dem er sich selbst verurteilt hatte. Ein paar Minuten, in denen er die Illusion von Sicherheit und Ruhe genießen konnte.
Als es schließlich losging, begann es mit einem Lichtblitz, der trotz der Entfernung grell aufleuchtete. Wolkow beobachtete, wie die Feuersäule hochstieg und das Lager erleuchtete, das eben noch unsichtbar gewesen war. Es dauerte einige Sekunden, bis auch das Geräusch zu ihm drang – ein dumpfes Grollen, das so gar nicht in diesen nahezu unbewohnten Winkel der Erde passte.
Jahrelang war es in diesem Teil Afghanistans ungewöhnlich ruhig gewesen, nachdem die Taliban dem Land ihren »Frieden« aufgezwungen hatten, der nun von dem Regime überwacht wurde, das die Amerikaner installiert hatten. Seit kurzem wurde die Region jedoch von gezielten, lokal begrenzten Gewaltakten heimgesucht. Diese Angriffe, die von der neu organisierten Al-Kaida durchgeführt wurden, liefen immer auf die gleiche Weise ab – schnell, brutal und wirkungsvoll. Soweit Wolkow wusste, hatte noch nie irgendjemand – egal, ob Mann, Frau oder Kind – einen solchen Ansturm dieser kampferprobten Fanatiker überlebt.
Die Angriffe waren für hiesige Verhältnisse außergewöhnlich sorgfältig geplant und wurden präzise durchgeführt. Die Männer Al-Kaidas verfügten über modernste Hightech-Ausrüstung, und auch die Aufklärung vor den Operationen funktionierte einwandfrei. Kaum jemand wusste, dass Christian Wolkow für die ausgeklügelte Planungsarbeit der Organisation verantwortlich war.
Die Explosionen hörten abrupt auf und wurden von stakkatoartigem Gewehrfeuer abgelöst. Wolkow beugte sich etwas weiter vor und konzentrierte sich auf das wenige, das er von den Aktivitäten unten im Tal erkennen konnte. Das immer wieder aufblitzende Gewehrfeuer, das sich auf eine Gruppe brennender Häuser zubewegte, war zuerst deutlich zu erkennen, verschwamm dann aber in dem ungleichmäßigen Licht, das von den brennenden Gebäuden ausging.
Wenngleich dieser Teil des Hindukusch-Gebirges eine gewisse karge Schönheit ausstrahlte, so war es doch erstaunlich, dass diese öde Landschaft in der Geschichte immer wieder Begehrlichkeiten geweckt hatte. Brutale Stammeskriege, die Makedonier unter Alexander dem Großen, die arabischen Heere, die im siebten Jahrhundert den Islam in die Region brachten, die Mongolen und schließlich die Sowjets und die Amerikaner. Wolkow fragte sich, was sich die Bauern, die in den kleinen Oasen ein ärmliches Dasein fristeten, gedacht hatten, als sie zum ersten Mal die Reiterhorden Dschingis Khans sahen.
Ein trauriges Lächeln trat auf Wolkows Lippen, als ihm bewusst wurde, wie unangebracht seine romantischen Vorstellungen waren. Was jene armen Bauern einst gesehen hatten, war das Gleiche, was die heutigen Afghanen unten im Tal in den aggressiven Fanatikern sahen, von denen sie gerade angegriffen wurden: Sklaverei und Tod.
Er fragte sich unwillkürlich, was in den Menschen da unten in der brennenden Ansiedlung in ihren letzten Augenblicken vorgehen mochte. Sie konnten zwar nicht wissen, wer sie letztlich zum Tod verurteilt hatte, doch sie sahen den Tod gewiss kommen. Kamen ihnen vielleicht Zweifel an den Mythen, an die sie immer geglaubt hatten? Fürchteten sie sich davor, dieses Leben aufzugeben, weil sie nun doch nicht recht glauben konnten, dass ein Leben danach auf sie wartete?
Er hielt es für gut möglich, dass er selbst bald Gelegenheit haben würde, diese extreme Erfahrung zu machen. Heute, mit dreiundvierzig Jahren, war er klüger, als er es mit fünfunddreißig gewesen war. Was er vielleicht an gedanklicher und körperlicher Schnelligkeit eingebüßt hatte, machte er mit Erfahrung wett. Doch es würde der Punkt kommen, an dem ihm auch seine Erfahrung nicht mehr helfen konnte. Er spürte bereits, dass er müde wurde und die feinen Details, die man beachten musste, um zu überleben, bisweilen aus den Augen verlor. Die immer wiederkehrenden Depressionen, die ihn seit der Kindheit heimsuchten, ließen sich nicht mehr durch bloße Willenskraft beherrschen – er war mittlerweile auf Medikamente angewiesen. Es würde nicht mehr lange dauern, bis ihm einmal ein gravierender Fehler unterlief. Und wenn es so weit war, würde er Gelegenheit haben, in die Rolle des Opfers zu schlüpfen.
Zwei
Mark Beamon wich etwas ungeschickt dem Bus aus, der ihn beinahe streifte, während er über die verkehrsreiche Straße lief. Als er den Bürgersteig erreichte, brannte ihm der Schweiß in den Augen, und sein Herz pochte beängstigend. Er ließ sich von seinem Schwung ein Stück weitertragen und lief die dicht nebeneinander stehenden Bürogebäude entlang, um in ihrem Schatten zu bleiben, in dem es immer noch rund vierzig Grad hatte.
Seine Sekretärin hatte ihn um neun Uhr vormittags in seiner Wohnung angerufen und ihn geweckt. Jetzt war es kurz nach elf, und er war immer noch einen knappen Kilometer von seinem Büro entfernt. Nachdem es schon so spät und so unerträglich heiß war, hätte es durchaus Sinn gemacht, den Parkplatz beim Büro zu benutzen, der ihm als leitendem Special Agent des FBI-Büros Phoenix zustand. Aber letztlich war ihm seine gewohnte Wanderung durch den Glutofen der Stadt doch reizvoller erschienen.
Er erzählte jedem, der es hören wollte, dass er gern ein, zwei Kilometer vom Büro entfernt parkte, um sich ein bisschen Bewegung zu verschaffen. Das war jedoch nicht der wahre Grund, sondern nur ein willkommener Nebeneffekt. In Wirklichkeit handelte es sich nur um eine Verzögerungstaktik, die ihm zwanzig Minuten verschaffte – oder auch dreißig, wenn er noch irgendwo stehen blieb, um ein Eis zu kaufen.
Als Beamon schließlich beim neuen FBI-Gebäude ankam, atmete er erst einmal tief durch und trat zu dem Brunnen, der auf dem Platz davor stand. Er setzte sich auf den Rand des Brunnens und ließ sich die Wassertröpfchen ins Gesicht sprühen. Nach einigen Minuten fühlte er sich genügend abgekühlt, um eine Zigarette zu rauchen, als sein Handy klingelte. Er lächelte, als der Anrufer aufgab, doch sein Lächeln schwand, als das Klingeln Sekunden später wieder einsetzte. Er kramte das Handy aus der Hosentasche hervor und meldete sich.
»Hallo, D.«
»Wenn ich jetzt zum Fenster gehe, sehe ich Sie dann unten am Brunnen sitzen und rauchen?«, fragte seine Sekretärin.
Beamon warf die Zigarette auf den Boden und trat sie mit der Schuhspitze aus. »Ich bin im Verkehr stecken geblieben.«
»Wann sind Sie oben?«
»In drei Minuten.«
»Ist Ihnen klar, dass es kurz vor der Mittagspause ist?«
»Bis später, D.«
Beamon schritt mit gesenktem Kopf zwischen den engen Kabinen hindurch, in denen die Büros der FBI-Dienststelle Phoenix untergebracht waren, und tat so, als sähe er die Agenten nicht, die sich beeilten, ihm aus dem Weg zu gehen. Einige besonders Mutige nickten und lächelten, doch die meisten schienen sich damit zu begnügen, rasch das Weite zu suchen. Beamon war sich dessen bewusst, dass sein Arbeitseifer in den vergangenen Jahren spürbar nachgelassen hatte, und er wusste, dass er Gefahr lief, einer von vielen ausgebrannten, unausstehlichen Bürokraten zu werden. Aber er wusste nicht, wie er diesen Abstieg hätte aufhalten können.
»Wieder mal in letzter Minute eingetrudelt«, bemerkte D., die hinter einer Kunststoffpflanze hervortrat und ihm in sein Büro folgte, in dem man sich wie in einem Goldfischglas fühlte. Sie blickte auf die Uhr. »Elf Uhr fünfundzwanzig. Sie haben für elf Uhr dreißig ein Treffen mit Bill vereinbart … Moment mal. Sie sind ja ganz nass im Gesicht.«
Beamon ließ sich in seinen Ledersessel sinken und blickte zwischen den Papierstapeln, die sich auf dem Schreibtisch angehäuft hatten, zu ihr auf. »Draußen hat es achtzig Grad im Schatten, D.«
»Dann ist das also Schweiß, und nicht Wasser vom Brunnen?«
»Wissen Sie es denn nicht?«
»Ich werde gleich morgen Überwachungskameras vor dem Haus installieren lassen. Sie schulden mir übrigens noch ein Mittagessen.«
»Suchen Sie sich ein Restaurant aus.«
»Ich habe Bill gesagt, dass Sie im Konferenzzimmer auf ihn warten«, sagte sie, drehte sich um und verschwand aus seinem Büro.
Wie er so dasaß, kam ihm der Gedanke, dass fast alles Schlimme in seinem Leben in irgendeinem Konferenzzimmer begonnen hatte. Er war auch von so mancher Frau nicht gerade sanft behandelt worden – sie hatten auf ihn geschossen, ihn verprügelt und sitzen lassen, aber der daraus resultierende Schmerz war immer von eher kurzer Dauer gewesen. Die gleiche statistische Logik, derzufolge man ewig leben könnte, wenn man nie ein Krankenhaus betrat, schien auch nahe zu legen, dass man sich eine Menge Ungemach ersparen würde, wenn man einen großen Bogen um jedes Konferenzzimmer machte.
Er starrte auf den Tisch und die leeren Sessel und erinnerte sich an den Tag, als er erfahren hatte, dass er zum Leiter einer FBI-Dienststelle, zum Special Agent in Charge (SAC), ernannt wurde. Er hatte die Sitzung in Hochstimmung verlassen und die Beförderung als das gesehen, was sie war: ein Wunder, das durchaus mit der Teilung des Roten Meeres zu vergleichen war.
Vor dreizehn Monaten war seine Karriere – und damit sein Leben – auf einem absoluten Tiefpunkt angelangt. Er hatte sich einen Großteil des Kongresses zum Feind gemacht, indem er einen Fall von politischer Korruption ans Licht brachte – eine Ermittlung, der er eigentlich aus dem Weg hatte gehen wollen. Und nachdem er die politische Elite Washingtons vor den Kopf gestoßen hatte, musste er feststellen, dass ihn auch noch seine Vorgesetzten im Regen stehen ließen. Das FBI beschloss wenig später, ihn als Bauernopfer ans Messer zu liefern.
Und als es schon fast sicher erschien, dass er aufgrund irgendeiner an den Haaren herbeigezogenen Anklage im Gefängnis landen würde, änderte sich das politische Klima plötzlich grundlegend. Ein neuer Präsident wurde gewählt, und Beamons bester Freund wurde Stabschef im Weißen Haus. Und praktisch über Nacht mutierte er vom Sündenbock zum Helden. Damals hatte es so ausgesehen, als würde ihm endlich einmal das Glück hold sein. Heute war er sich da nicht mehr so sicher.
»Mark?«
Beamon wirbelte in seinem Sessel herum und sah einen etwa dreiunddreißig Jahre alten Mann mit typischem FBI-Haarschnitt und Anzug. Er steckte den Kopf zur Tür herein, zögerte aber, einzutreten. Wahrscheinlich ein schlechtes Zeichen.
»Bill. Freut mich, Sie zu sehen«, log Beamon. »Kommen Sie doch rein.«
Immer noch zögernd trat der Mann ein. Beamon beobachtete, wie der jüngere Mann die Tür schloss und langsam durch das Zimmer schritt, ehe er sich setzte und eine dicke Mappe mitten auf den Tisch legte.
»Haben Sie Ihre schwarze Kapuze und eine Sense da drin?«, scherzte Beamon. Zumindest hoffte er, dass es als Scherz verstanden wurde.
Keine Antwort. Wieder ein schlechtes Zeichen.
Ungefähr alle zwei Jahre wurde den verschiedenen FBI-Dienststellen vom Hauptquartier ein Team ins Haus geschickt, das alle Ermittlungen, das Budget, die entsprechenden Berichte sowie die Entscheidungen der Verantwortlichen unter die Lupe nahm. Diesmal war eben Phoenix an der Reihe. Bill Laskin war der Leiter des Untersuchungsteams, das Beamons Büro zwei Wochen lang überprüft hatte. Und man musste ihm zugestehen, dass er seine Arbeit sehr gründlich machte.
»Wir kommen gerade zum Abschluss, Mark«, sagte Laskin und zog ein dickes Dokument aus der Mappe. »Der Rohbericht ist gestern fertig geworden.« Sein Ton ließ vermuten, dass er nicht nur Positives gefunden hatte. »Ich dachte mir, wir könnten ein paar Punkte zusammen durchgehen, und danach könnten Sie sich den Bericht ansehen und … darüber nachdenken.«
Beamon nahm die Mappe und blätterte sie durch, während der Autor des Berichts unruhig auf seinem Sessel hin und her rutschte. Mit jedem Kritikpunkt, der ihm aus dem Papier entgegenschlug, fühlte Beamon, wie seine letzten Energien schwanden.
»Wissen Sie, Mark, gestern Abend saß ich in meinem Büro und habe mir den Bericht angesehen, den Sie über Ihre Ermittlungen wegen der vergifteten Drogen verfasst haben.«
Beamon blickte nicht von dem sauber verfassten Bericht auf. Vielleicht ließ sich noch ein passendes Zitat für seinen Grabstein finden, bevor ihn ein gewiss wohlverdienter Schlaganfall von seinen Qualen erlöste.
»Warum?«, fragte er.
»Weil das ein wirklich unglaublicher Fall war. Ich meine, da sind Tausende Menschen gestorben. Der Druck muss unerträglich gewesen sein. Es ist mir ein Rätsel, wie Sie es geschafft haben, den Fall so schnell zu lösen.«
Der Fall, auf den Laskin anspielte, hatte ein enormes Echo in der Öffentlichkeit ausgelöst. Ein ehemaliger Agent der Anti-Drogenbehörde DEA hatte beschlossen, vergiftete Drogen in Umlauf zu bringen, um den Konsum illegaler Drogen einzudämmen. Es hatte tatsächlich funktioniert.
»So was musste wahrscheinlich mal passieren. Der Job bei der DEA ist frustrierend«, merkte Beamon an, und sein Mund fühlte sich immer trockener an, während er die Mappe durchblätterte.
»Der Bericht ist aber sehr nüchtern«, fuhr Laskin fort.
Beamon blätterte ein paar Seiten weiter. »Nüchtern?«
»Na ja, ich hätte gern gewusst …«
»Sagen Sie’s ruhig.«
Laskin räusperte sich. »Was ist damals in Ihnen vorgegangen?«
Die Frage ließ Beamon schließlich aufblicken. »Wie meinen Sie das?«
»Nun ja, der Drogenkonsum ging damals stark zurück. Sicher, es sind Menschen gestorben, aber der Konsum hat extrem nachgelassen. Wenn Sie diese Kerle nicht geschnappt hätten – wer weiß, vielleicht hätten viele für immer mit dem Zeug aufgehört? Man fragt sich, ob damit letztlich nicht Menschenleben gerettet worden wären.«
Beamon starrte auf die weiße Wand. Es war verlockend, über seine alten Fälle und seine Erfolge zu sprechen. Aber diese Dinge waren Vergangenheit. Er war nicht mehr der Jungstar des FBI. Er war mittlerweile erwachsen und Leiter einer FBI-Dienststelle.
»Ich habe nur Befehle ausgeführt«, sagte Beamon mit betont deutschem Akzent. Der Versuch eines Scherzes klang selbst in seinen Ohren etwas gezwungen.
»Nein, im Ernst, Mark.«
»Das ist mein Ernst«, erwiderte Beamon leise und klappte den Bericht zu.
Der junge Mann verstand den Hinweis und nickte, den Blick auf die Mappe geheftet, die auf dem Schreibtisch lag.
Laskin war eindeutig ein Fan von ihm, das hatte er in den vergangenen beiden Wochen deutlich unter Beweis gestellt. Es hatte sich nämlich gezeigt, dass er mehr über Beamons vergangene Fälle wusste, als ihm selbst noch in Erinnerung war. Die jüngeren Agenten machten gern Witze über Leute aus Beamons Generation und kritisierten sie wegen ihrer manchmal groben Methoden, während sie sie insgeheim verehrten.
In den Augen vieler jüngerer Agenten war Beamon der letzte Vertreter der alten Schule – der letzte jener unmäßig trinkenden, kettenrauchenden, bisweilen arroganten Ermittler, die den Mythos des FBI-Agenten begründet hatten. Die Wahrheit sah weit weniger romantisch aus. Beamon hatte immer mehr das Gefühl, dass das heute nicht mehr sein FBI war, dass er nicht mehr wirklich dazugehörte.
»Sehen Sie sich den Bericht einfach mal an, Mark. Es würde mich wirklich interessieren, was Sie dazu zu sagen haben. Das ist sicher noch nicht die Endfassung. Ich denke, es gibt einige Bereiche, in denen Ihre Assistenten Sie mehr unterstützen könnten …«
Beamon griff nach einer Zigarette und zündete sie sich trotz des strikten Rauchverbots im Haus an. »Nein«, erwiderte er.
»Was?«
»Wenn in diesem Büro irgendetwas nicht in Ordnung ist, dann bin ich dafür verantwortlich.«
Als Beamon von dem Inspektionsbericht aufblickte, den er im Schoß liegen hatte, sah das Büro ziemlich verlassen aus. Das Sonnenlicht flutete immer noch durch das Fenster hinter ihm herein und wurde von einer Uhr reflektiert, die sechs Uhr anzeigte. Er nahm seine Lesebrille ab und blickte durch die Glaswand an der Vorderseite seines Büros. Es war niemand zu sehen.
Er zuckte die Achseln und setzte die Brille wieder auf. Normalerweise hätte ihn die vollständige Abwesenheit seiner Leute durchaus bewogen, der Sache auf den Grund zu gehen, doch nachdem er sich den Großteil des Tages mit diesem Inspektionsbericht beschäftigt hatte, war so ziemlich alles in ihm erloschen – sogar seine ansonsten leicht anzustachelnde Neugier.
Er griff nach dem Buttergebäck mit Mandeln, das D. ihm gebracht hatte, und begutachtete es einige Augenblicke. Früher hatte er diese Dinger mit Appetit verschlungen, doch heute drehte sich ihm bei dem bloßen Gedanken der Magen um.
Er warf das Gebäck in den Abfalleimer und blätterte zur nächsten Seite in dem Bericht weiter, die hoffentlich etwas Erfreulicheres bereithielt. Rasch überblickte er die Seite und stellte fest, dass sie eine scharfe Kritik an seinem Stellvertreter enthielt, die völlig unbegründet war. Beamon griff nach dem Rotstift und strich die Passage durch. Am Rand merkte er an, dass der Missstand, der bei der Inspektion zutage getreten sei, in Wirklichkeit seine Schuld war.
Er stieß einen leisen Seufzer aus und blätterte in dem Bericht zurück zu den vielen ähnlichen Kommentaren, die er auf fast jede Seite gekritzelt hatte. Unwillkürlich stellte er sich die Frage, ob er gerade im Begriff war, sich um seinen Job zu bringen.
»Mark?«
Beamon blickte zu der jungen Frau auf, die nervös in der Tür seines Büros stand.
»Sorry, Mark, ich wollte nicht stören, aber es gibt da etwas, das Sie interessieren dürfte.«
Beamon warf den Inspektionsbericht auf den Schreibtisch. Genug für heute; noch zehn Seiten, und er wäre so weit, das Trauerspiel mit einem Sprung aus dem Fenster zu beenden. »Wovon sprechen Sie? Und wo stecken denn plötzlich alle?«
»Wir sind alle hinten und sehen uns die Nachrichten an. Wissen Sie denn nicht, was passiert ist?«
Beamon zuckte mit den Achseln, und sie zeigte mit einer Kopfbewegung auf den Fernseher an der Wand. Er holte eine Fernbedienung aus einer Schublade hervor und schaltete das Gerät ein. Als er sich wieder der Tür zuwandte, sah er, dass sich die Frau wieder davongemacht hatte. Forest Sawyer vom Nachrichtensender MSNBC sah etwas besorgt aus, wie er nach vorn gebeugt an seinem Schreibtisch saß. Ganz unten am Bildschirm waren die Worte »Die jüngste Bedrohung« eingeblendet.
»Ich glaube, wir haben noch genug Zeit, um das Bild noch einmal zu zeigen und das Band abzuspielen, bevor wir zum Weißen Haus schalten.« Im nächsten Augenblick wurde ein Bild eingeblendet, das auf dem Fernsehschirm leicht flimmerte. Das Foto war ein wenig unterbelichtet; die Aufnahme war offenbar an einem stark bewölkten Tag vor dem Hintergrund einer fernen Gebirgskette angefertigt worden.
»Bei dem Gebirge handelt es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um die Wind River Range in Wyoming«, ertönte Sawyers Stimme aus dem Off. »MSNBC und viele andere Sender haben dieses Foto erhalten und lassen es von Experten untersuchen. Bisher deutet alles darauf hin, dass es echt ist …«
Beamon ging um den Schreibtisch herum und sprang auf einen Sessel, um den Bildschirm aus der Nähe zu betrachten.
Das Foto zeigte etwas, das wie eine einfach gebaute Artilleriekanone aussah. Es handelte sich im Wesentlichen um ein großes Metallrohr auf einer zweirädrigen Lafette. Ein Mann in traditioneller arabischer Kleidung, dessen Gesicht von einem weißen Tuch verdeckt war, das von der Kopfbedeckung herabhing, stand zwischen der Waffe und einer offenen Kiste, in der allem Anschein nach eine etwa drei Meter lange Rakete lag.
Ein Zischen tönte aus den Lautsprechern des Fernsehers, gefolgt von einer stark akzentuierten männlichen Stimme. »Wir haben viele Ziele: Einkaufszentren, Bürogebäude, Schulen … Wir haben auch Stinger-Raketen, die eure CIA uns verkauft hat und mit denen wir Zivilflugzeuge abschießen können …«
Damit war die Botschaft auch schon wieder zu Ende. Offenbar nicht ein Mann vieler Worte. Das Foto wurde ausgeblendet, und Forest Sawyer erschien wieder auf dem Bildschirm.
»Wir schalten nun zur Pressekonferenz im Weißen Haus«, verkündete er, und wenige Augenblicke später war Charles Russell an einem Rednerpult zu sehen, auf dem das Siegel des Präsidenten prangte.
»Wir haben im Moment noch kaum Informationen. Ich werde mich deshalb kurz fassen«, begann Russell.
Beamon ignorierte ihn und konzentrierte sich auf die Reihe von ernst dreinblickenden Leuten im Hintergrund des Podiums. Sein Blick fiel schließlich auf eine Frau mit blondem Haar, das zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden war. Die Frau blickte pflichtbewusst zu dem Politiker hinüber, doch Beamon nahm an, dass sie ihm überhaupt nicht zuhörte. Er wusste aus persönlicher Erfahrung, dass sie wahrscheinlich überlegte, wie lange sie noch hier stehen und ihre Zeit vergeuden musste.
»Wir haben das Foto und das Band, das den Medien zugespielt wurde, ebenfalls erhalten, und beides wird zur Zeit untersucht. Das FBI leitet die Ermittlungen und kooperiert mit anderen Behörden im In- und Ausland, um so schnell wie möglich zu einem Ergebnis zu gelangen. Wie ich schon sagte, wir haben noch nicht sehr viele Informationen. Wir haben das Material erst vor ein paar Stunden bekommen. Meine Botschaft an das amerikanische Volk ist vor allem, die Ruhe zu bewahren. Alles, was wir hier haben, ist ein Foto, nicht mehr. Wir brauchen …«
Beamon stellte den Ton ab und sprang vom Sessel hinunter. Langsam trat er vom Fernseher zurück, während er Russell beobachtete, wie er lautlos seine Ansprache fortsetzte. Sein Blick war weiter auf den Bildschirm gerichtet, während seine Gedanken um das Foto kreisten. Warum schickten diese Leute nur ein Foto? Warum setzten sie nicht einfach die Rakete ein und töteten damit ein paar gottlose Amerikaner? Funktionierte sie etwa nicht? War es die Einzige, die sie zur Verfügung hatten? Waren diese arabischen Spinner vielleicht in Wahrheit besonders schlau? Wenn ja, dann war die Rakete noch das geringste von Amerikas Problemen.
Als Russell und sein Gefolge schließlich die Bühne verließen, drehte sich Beamon um und begann in den Papieren auf seinem Schreibtisch zu wühlen. Er brauchte eine Weile, bis er seinen Rolodex gefunden hatte und die gewünschte Telefonnummer anrufen konnte.
»Laura Vilechi.«
Nachdem er nun karrieremäßig die Treppe hinaufgefallen war, hatte Laura seine Rolle als FBI-Starermittler eingenommen. Er selbst hatte einigen Anteil an ihrem Aufstieg, indem er in der immer noch stark männerdominierten Organisation für sie eingetreten war. Sie war eine unglaublich effiziente Ermittlerin, wenngleich ihr Stil ganz anders war als der seine. Sie war eine wahre Meisterin in der Kunst, kein noch so kleines Detail zu übersehen. Während Beamon sich eher an die Täter heranpirschte und aus dem Hinterhalt zuschlug, pflegte Laura sie mit ihrer Akribie zu zermürben.
»Du machst eine gute Figur im Fernsehen. Genau der nötige Respekt, den man gegenüber einem Typen wie Russell zeigen muss.«
»Mark?«
»Höchstpersönlich. Ich habe lange nichts von dir gehört. Was gibt es Neues?«
»Nichts, worüber ich reden kann.«
»Ach, komm schon, Laura. Ein kleiner Hinweis. Haben sie dir den Fall gegeben?«
»Es will ihn ja kein anderer.«
Beamon unterdrückte einen Anflug von Neid. »Also, wie seht ihr die Sache? Das Foto ist echt, nicht wahr?«
»Wir sind noch dabei, es zu über …«
»Ach, hör schon auf …«
Sie seufzte ins Telefon. »Okay, Mark. Okay. Zu neunzig Prozent, ja.«
»Ich hab’s gewusst. Erzähl mir mehr.«
»He, sind wir hier beim Telefonsex oder was?«
»Ich bin jetzt ein viel beschäftigter Manager, Laura. Da muss man jede Gelegenheit nützen, um mal ein bisschen Spaß zu haben.«
»Ich wünschte, ich könnte dir mehr sagen. Die Waffe ist ein umgebauter Mehrfach-Raketenwerfer. Normalerweise wird ein Werfer mit nebeneinander montierten Abschussschienen mit solchen Raketen bestückt.«
Beamon versuchte es sich vorzustellen. Was er über militärisches Gerät wusste, war nicht gerade viel. »So wie die Dinger, mit denen die Japaner auf Godzilla geschossen haben?«
»Komischer Vergleich, aber nicht ganz daneben. Nur dass man in diesem Fall ein Rohr herausgelöst und auf eine Lafette montiert hat. Die Zerstörungskraft ist zwar geringer, dafür ist man mobiler und kann die Waffe leichter verbergen.«
»Wer hat das Ding hergestellt?«
»Das wissen wir nicht. Die Rakete weist Ähnlichkeit mit vielen verschiedenen Modellen auf, entspricht aber keinem exakt. Und wie ich schon sagte, der Werfer ist stark modifiziert.«
»Wisst ihr schon, was man damit anrichten kann?«
»Wir vermuten, dass die Reichweite etwa zwölf Meilen beträgt, und wir sind uns ziemlich sicher, dass es kein nennenswertes Lenksystem hat.«
»Wie sieht es mit der Zerstörungskraft aus?«
»Ich weiß nicht. Aber sicher sehr hoch.«
»Konventionell, oder könnte man damit auch eine biologische Waffe oder einen Atomsprengkopf abfeuern?«
»Na ja, nicht im Sinne einer Atombombe, aber es wäre schon möglich, dass das Ding radioaktives Material enthält, das durch die Explosion freigesetzt wird. An biologische Waffen glauben wir eher nicht – so etwas kann man auf einfachere Weise einsetzen.«
»Nun, wahrscheinlich ist es sowieso egal.«
»Was meinst du damit?«
»Nichts.«
»Komm schon, Mark, spuck’s aus.«
»Sie sehen mir nicht so aus, als würden sie das Ding einsetzen. Überleg doch mal, Laura – als Al-Kaida die Zwillingstürme zum Einsturz brachte, da hat sich gezeigt, dass die amerikanische Wirtschaft von ein paar Kerlen mit Teppichmessern zum Stillstand gebracht werden kann. Wie hat es doch auf dem Band geheißen – sie wollen Einkaufszentren, Bürogebäude und Flugzeuge angreifen … und indem sie auch Schulen aufs Korn nehmen, bringen sie die Eltern dazu, dass sie nicht mehr zur Arbeit gehen und mit ihren Kindern zu Hause bleiben. Sie sprechen Drohungen aus, um ein Klima der Angst zu verbreiten. Erst wenn das nicht mehr funktioniert und die Leute wieder zur Arbeit gehen, jagen sie irgendetwas in die Luft. Und dann machen sie mit ihren Drohungen weiter und profitieren von dem einen Anschlag, bis sie wieder etwas unternehmen müssen. Wie lange würde es dauern, bis die Wirtschaft zusammenbricht?«
»An diese Möglichkeit haben wir auch schon gedacht. Das würde die Regierung in eine schwierige Situation bringen. Soll man den Leuten nahe legen, zu Hause zu bleiben, und damit den Schaden für die Wirtschaft in Kauf nehmen, oder soll man versuchen, die Sache herunterzuspielen und das Risiko eines Raketenangriffs eingehen?«
»Habt ihr irgendeine Ahnung, wer diese Leute sein könnten?«
»Vielleicht die Volksfront von Judäa?«
Beamon lachte – zum ersten Mal an diesem Tag. Die Terrororganisation dieses Namens existierte lediglich in einem alten Monty-Python-Film. Er hatte die Bezeichnung immer als Synonym für die vielen Verrückten dieser Welt verwendet. »Was hört man von …«
»Oh, Scheiße!«
»Was ist denn, Laura?«
»Dave kommt gerade. Er bringt mich um, wenn er mitbekommt, dass ich mit dir rede.«
Laura sprach von Dave Iverson, ihrem Chef – ein Mann, der Beamon aus tiefstem Herzen hasste.
»Verdammt, Laura, wann wird er die Sache endlich vergessen? Ich habe doch gesagt, dass es mir Leid tut.«
»Mark, du hast ihm auf einer Konferenz einen BH in den Koffer gesteckt, und seine Frau hat ihn gefunden und ihn verlassen. Das lässt sich mit einem ›Sorry‹ nicht so einfach wieder gutmachen.«
»Es war doch nur ein harmloser Scherz. Ich konnte ja nicht wissen, dass er wirklich eine Affäre hatte – noch dazu mit einer Frau, die genau diese Körbchengröße hatte.«
»Hör zu, Mark, ruf mich bitte nicht mehr an. Ich meine es ernst, okay? Ich habe hier schon genug um die Ohren, und ich kann zusätzlichen Ärger nicht gebrauchen.«
Beamon hörte sehr wohl, dass es ihr nicht leicht fiel, das zu sagen. Sie waren immerhin seit Jahren befreundet. Andererseits hatte sie mitbekommen, wie er immer wieder ins Fettnäpfchen getreten war – und sie hatte offensichtlich nicht vor, dieselben Fehler zu machen.
Beamon legte den Hörer auf und setzte sich an seinen Schreibtisch.
Nicht dein Fall.
Er wiederholte den Satz ungefähr zehnmal, um es sich auch wirklich einzuhämmern. Nein, mit dieser Sache würde er ganz bestimmt nichts zu tun haben. Er war schließlich Leiter einer FBI-Dienststelle, gut tausend Meilen vom Hauptquartier entfernt. Außerdem waren Terrorfälle ohnehin die schlimmsten, die man sich wünschen konnte. Auch wenn man noch so gute Arbeit leistete, konnte man unmöglich verhindern, dass schon bald der nächste Verrückte daherkam und die Welt in Angst und Schrecken versetzte.
Drei
Einige Meilen von L.A. entfernt, mitten in einer kargen Wüstenlandschaft, war es um einiges kühler als in der Stadt. Dennoch schwitzte Chet aus allen Poren.
Er konzentrierte sich darauf, langsam und gleichmäßig zu atmen und darauf zu achten, dass man das übermäßige Heben und Senken seiner Brust unter dem schweißnassen Hemd nicht bemerkte. Es handelte sich um seine Version einer Atemtechnik, die er in irgendeiner abgedroschenen Yoga-Sendung gesehen hatte, die von einer äußerst attraktiven Ex-Schauspielerin moderiert wurde. Wer hätte gedacht, dass ihm ihre Tipps noch einmal von Nutzen sein würden?
Tatsächlich fühlte sich Chet bald ein wenig ruhiger und blickte sich weiter in der Gegend um. Die einzige Beleuchtung kam von den Scheinwerfern eines Autos, das im Leerlauf lief. Er konnte etwa zwanzig Meter weit sehen, ehe der Lichtkegel sich in der Dunkelheit verlor, die erst in der Ferne von den Lichtern von L.A. wieder erhellt wurde.
»Sind Sie Mohammed?«, fragte Carlo Gasta neben ihm und trat ein paar Schritte auf einen arabisch aussehenden Mann in schmutziger Arbeitskleidung zu. Chet nützte die Gelegenheit, um ein paar Schritte nach links zu treten, sodass die Scheinwerfer direkt hinter ihm waren. Hatte nicht John Wayne einst gesagt, dass man darauf achten solle, die Sonne immer im Rücken zu haben? Und der Duke irrte sich nur selten in solchen Dingen.
Obwohl er nur drei Meter entfernt war, hätte Chet Mohammeds Alter unmöglich schätzen können. Seine braunen Augen hatten eine jugendliche Klarheit, aber das wenige, das hinter dem langen schwarzen Bart von seinem Gesicht zu sehen war, sah müde und verhärmt aus.
»Sind Sie Mohammed?«, fragte Gasta noch einmal, in einem Ton, der schon ein wenig gereizt klang. Mit seinem New Yorker Akzent und dem schicken Anzug wirkte er in dieser Umgebung absolut fehl am Platz. Der Mann, zu dem er sprach, schien hingegen in dieser Einöde geradezu zu Hause zu sein.
»Ich bin Mohammed«, antwortete der Mann schließlich mit ausgeprägtem Akzent, was seine Erscheinung aus irgendeinem Grund noch eindrucksvoller machte. Chet blickte an ihm vorbei in die Dunkelheit hinaus. Dieser Kerl war ganz sicher nicht allein hier. Die Frage war nicht, ob er seine Männer irgendwo da draußen hatte, sondern wie viele es waren. Wie viele lauerten da draußen in der Dunkelheit?
Der Mann sagte sonst nichts, und Chet sah, dass Gasta mit dem Kopf zu nicken begann, wie er es immer tat, wenn er zornig wurde.
»Was ist? Soll ich Ihnen vielleicht Tee servieren? Wo zum Teufel haben Sie es?«
Chet versuchte mit der Kraft seiner Gedanken Gasta dazu zu bewegen, ruhig zu bleiben. Es hatte noch nie funktioniert, aber man konnte nie wissen. Wenn man etwas wirklich wollte …
»Wir haben es nicht«, sagte Mohammed.
»Scheiße!«
Es war wie im Film. Die Zeit schien sich zu verlangsamen, als Gasta mit einer ruckartigen Bewegung nach seiner Waffe griff. Chet hielt den Atem an und griff seinerseits nach der Pistole. Er versuchte die Panik zurückzudrängen, die in ihm hochstieg, und nicht an seine Frau zu denken, mit der er erst seit kurzem verheiratet war, als er die Beretta aus dem Holster zog. Von einem Augenblick zum anderen hatte ein zunächst ganz zivilisiertes Treffen eine katastrophale Wendung genommen.
Chets Hand schloss sich etwas fester um den Pistolengriff, als er auf Mohammeds Brust zielte. Seine Hand begann zu schwitzen; er war sich sicher, dass er sterben würde. Dieser dämliche Maulheld würde ihn mit in den Abgrund ziehen.
»Du legst dich mit dem Falschen an«, brüllte Gasta und trat langsam zurück, die Waffe ausgestreckt in der Hand haltend. »Ich weiß nicht, für wen du dich hältst, aber du wirst gleich tot sein!«
Chet versuchte erneut verzweifelt, seinen Chef durch die schiere Kraft seiner Gedanken zur Ruhe zu bringen, indem er immer wieder dachte: Halt’s Maul, du verdammter Idiot. Er wusste, was Gasta dachte: dass er fünf schwer bewaffnete Männer mitgebracht hatte, die nur etwa einen Kilometer entfernt warteten. Er schien sich für den Einzigen zu halten, der so clever war, eine Kampftruppe mitzubringen. Und es schien ihm völlig entgangen zu sein, dass mit Ausnahme von Chet die Männer, die er mitgebracht hatte, fette Klugscheißer waren, die von einem Ruf zehrten, den sie sich vor vielen Jahren erworben hatten. Die Frage war, ob diese Leute heute noch jemanden einschüchtern konnten. Dieser Mohammed jedenfalls wirkte kein bisschen eingeschüchtert. Ja, er machte sogar einen leicht gelangweilten Eindruck.
Chet wusste, dass der Mann aus Afghanistan stammte, und demnach hatte er es schon mit weitaus furchterregenderen Leuten zu tun gehabt als einem Mafiaboss im mittleren Alter und seinem sommersprossigen, rothaarigen Assistenten.
»Mr. Gasta, bitte«, sagte Mohammed und breitete seine leeren Hände weit aus. »Sie verstehen mich falsch. Wir sind sehr froh, mit Ihnen Geschäfte machen zu können. Die Lieferung verzögert sich nur ein wenig.«
Chet fragte sich, was hier vor sich ging. Sagte dieses Arschloch tatsächlich die Wahrheit, oder versuchte der Kerl bloß Zeit zu schinden, bis seine Leute da waren? Er spähte in die Dunkelheit hinaus, nach einer Gruppe staubiger Afghanen Ausschau haltend, die sich, so stellte er sich vor, mit Messern zwischen den Zähnen heranpirschten. Dann wirbelte er herum, um sich zu vergewissern, dass sich auch von hinten niemand anschlich.
»Was zum Teufel soll das heißen – die Lieferung verzögert sich?«, brüllte Gasta. »Wir haben ein Geschäft vereinbart, du verdammter Scheißkerl!«
Chet zuckte zusammen. Er hatte sich im vergangenen Jahr den Arsch aufgerissen, um in Gastas Organisation nach oben zu kommen, nachdem er als Bote angefangen hatte und dann zum Fahrer und schließlich zum Soldaten befördert worden war. Und jetzt, wo er es mit Einsatz, Köpfchen und etwas Glück geschafft hatte, Gastas rechte Hand zu werden, brachte ihn der verdammte Idiot wahrscheinlich ins Grab.
»Ich muss mich entschuldigen«, sagte Mohammed ruhig. »Ich habe gerade erfahren …«
»Dass eins von deinen Kamelen gestorben ist?«
Gasta fühlte sich offenbar in einer sehr sicheren Position, nachdem er und Chet ihre Pistolen auf einen Unbewaffneten richteten. Er fand offenbar, dass er es sich leisten konnte, Druck auszuüben, doch Mohammed blieb völlig gelassen.
»Der Grund spielt keine Rolle. Was zählt ist, dass Sie Ihre Lieferung in einer Woche bekommen.«
»Das ist vielleicht die Art, wie ihr Wüstennigger Geschäfte macht, aber hier sind wir in einem Land, wo man sich an seine Vereinbarungen hält«, schrie Gasta und fuchtelte drohend mit seiner Pistole.
Chets Finger krümmte sich etwas fester um den Abzug, als Mohammed den Rucksack, den er umgeschnallt hatte, abnahm, und ein kleines Päckchen hervorholte, das mit Klebeband umwickelt war.
»Ich habe eine Probe. Hier, das ist für Sie«, sagte er und hielt es dem Mann, der ihn mit der Waffe bedrohte, hin. Gasta ging auf Mohammed zu, und als er in Reichweite war, schlug er ihm das Päckchen aus der Hand und trat sofort wieder zwei Schritte zurück. »Ich bin gekommen, um eine ganze Lastwagenladung von dem Zeug zu kaufen, und du beleidigst mich mit dem hier? Ich werde dir zeigen, was ich von deiner verdammten Probe halte.« Chet zuckte zusammen, als Gasta drei Kugeln auf das Päckchen abfeuerte, worauf eine kleine Heroinwolke daraus emporstieg.
Gasta drehte sich kurz zu Chet um und ließ dann einen ganzen Schwall von rassistischen Schimpfwörtern vom Stapel. Chet wusste, was sein Chef ihm soeben bedeutet hatte, und war nur zu gern bereit, der Anweisung nachzukommen.
»Bitte, Carlo, bleib ruhig«, redete Chet ihm zu und hielt seinen Chef von hinten fest. »Bleib ruhig, das lohnt sich doch gar nicht.«
»Du kommst in mein
Vier
»Bonjour, Christian. Ça va?«
Durch die fünf Meter hohen Fenster hinter seinem Schreibtisch konnte Wolkow ein tiefes Leuchten am Horizont ausmachen. In einigen Minuten würde Farbe in die Dunkelheit vor ihm kommen, und man würde das Meer und die bewaldeten Klippen erkennen, an die sein Haus grenzte. Er fragte sich, ob er sich jemals an diesem Schauspiel würde satt sehen können.
»Christian?«
Wolkow antwortete auf Französisch. Pascal war zwar ein brillanter Organisator und Verwalter, hatte aber nicht das geringste Talent für Sprachen. »Mir geht’s gut, und dir?«, fragte er, weiter in das Schauspiel der Morgendämmerung vertieft.
»Ich bin sehr froh, dass du gesund aus Afghanistan heimgekehrt bist.«
»Du machst dir zu viele Sorgen, Pascal.«
»Du gibst mir allen Grund dazu.«
Wolkow lächelte traurig. »Ich weiß, und das tut mir Leid. Also, was gibt es Neues, mein Freund?«
Er hörte, wie die Fernsehgeräte hinter ihm zum Leben erwachten, und betrachtete ihr Spiegelbild im Fenster. Er konnte den Berichten sofort ohne Schwierigkeit folgen – eine von vielen geistigen Fähigkeiten, die er über die Jahre geschult hatte.
Euronews, Fox und CNN berichteten immer noch über das Raketenwerfer-Foto, das in Amerika aufgetaucht war, während BBC einen kurzen Bericht über einen Staatsstreich in Laos einschob. Wolkow verfolgte für einige Sekunden den BBC-Beitrag und sah das Spiegelbild eines Asiaten in Militäruniform, der energisch in die Mikrofone vor ihm sprach.
»Wie du siehst, Christian, gibt es eine Menge Neuigkeiten.«
Wolkow blickte weiter in die kubanische Landschaft hinaus, die sich vor seinem abgelegenen Haus erstreckte. Der rote Kalkstein der Klippen, die sein Anwesen im Westen begrenzten, begann wie aus eigener Kraft zu leuchten. Der spektakuläre Anblick verblasste bereits nach einigen Augenblicken wieder. »Gibt es schon eine offizielle Stellungnahme der Amerikaner zur Echtheit des Fotos?«
»Nein, nichts Offizielles. Unabhängige Experten haben das Foto aber im Auftrag der großen Sender überprüft und sind übereinstimmend zu dem Schluss gekommen, dass es authentisch ist. Die amerikanische Regierung wird letztlich auch zu keinem anderen Ergebnis kommen.«
Wolkow atmete tief ein und langsam wieder aus, ohne aber etwas zu sagen.
»Vielleicht haben sich die Amerikaner zu früh gefreut, als sie meinten, dass Osama bin Laden tot und Al-Kaida nachhaltig geschwächt wäre, was, Christian?«
Wolkow nickte schweigend. Bevor bin Laden von der Bildfläche verschwand, hatte er offenbar noch Mustafa Yasin zu seinem Nachfolger ernannt. Yasin, ein ausgebildeter Wirtschaftsexperte, hatte Al-Kaida kleiner und schlagkräftiger gemacht und sich dabei auf Prinzipien gestützt, die erstmals von Sondereinsatzkräften des Militärs und dem organisierten Verbrechen angewandt worden waren. Die weniger als tausend Kämpfer der erneuerten Organisation waren in jeder Hinsicht gut ausgebildet und hoch motiviert. Es war heute eher wahrscheinlich, dass ein Al-Kaida-Mann auf einer ausländischen Universität Technik studierte, als dass er sich in einem staubigen Ausbildungslager in Somalia mit der Konstruktion von Bomben beschäftigte. Zumindest war es noch vor einem Jahr so gewesen. Nun wurden immer mehr dieser hochqualifizierten Leute dazu eingesetzt, die von Yasin angestrebte Übernahme des Heroinhandels im Nahen und Mittleren Osten umzusetzen.
»Haben sie die Waffe schon identifiziert, Pascal?«
»Nein. Offensichtlich entspricht sie keinem bekannten Modell. Sie gehen richtigerweise davon aus, dass es sich um ein sehr einfaches System handelt, das vom organisierten Verbrechen in der ehemaligen Sowjetunion gebaut wurde. In den Medien wird auch spekuliert, dass damit radioaktives oder biologisches Material eingesetzt werden könnte.«
»Und wie reagiert Amerika?«
»Die Streitkräfte werden mobilisiert, obwohl wahrscheinlich niemand recht weiß, wozu. Das FBI hat …«
»Okay, aber wie reagiert Amerika?«
Pascal nickte verstehend. »Angst. Der Luftverkehr ist nahezu zum Erliegen gekommen, obwohl man eigentlich annehmen könnte, dass die Terroristen ihre Stinger-Raketen auf dem Bild gezeigt hätten, wenn sie tatsächlich welche besitzen würden. Die Schulen werden nur noch spärlich besucht, und immer mehr Firmen sperren zumindest vorübergehend zu.«
Wolkow lehnte sich in seinem Stuhl zurück und faltete die Hände über dem Kopf. »Die Al-Kaida hat sich immer schon eingebildet, für den Fall der Sowjetunion verantwortlich zu sein, und jetzt denken sie, dass sie mit den Vereinigten Staaten das Gleiche machen können.« Er lachte kurz auf. »Jetzt, da Mustafa Yasin sie anführt, ist das nicht einmal ausgeschlossen.«
»Aber diese Waffen haben wohl kaum die Zerstörungskraft, wie man sie beim Anschlag auf das World Trade Center entfaltet hat …«
»Oh, das ist noch viel schlimmer. Warum ist Amerika heute die einzige Supermacht der Welt, Pascal? An den Streitkräften liegt es bestimmt nicht. Lenkwaffen kann man nicht gegen Freunde einsetzen, und auch nicht gegen Staaten, die mit gleicher Münze zurückzahlen können. Genauso wenig gegen schwache Staaten mit starken Führern oder gegen Länder, die etwas haben, das die Amerikaner brauchen. Gewiss können sie die wenigen Staaten bombardieren, die nicht in diese Kategorien fallen, aber kontrollieren können sie sie trotzdem nicht, weil sie nämlich davor zurückschrecken, ihre Söhne in fremden Ländern in den Tod zu schicken. Also können ihre Armeen im Grunde recht wenig ausrichten. Nein, Amerikas Stärke beruht auf seiner Wirtschaft – seiner Fähigkeit, andere Staaten finanziell zu beherrschen. Yasin weiß genau, dass er Amerika nur dann nachhaltig schwächen kann, wenn er diese enorme Wirtschaftskraft zerstört.«
Wolkow schloss kurz die Augen, um sich zu konzentrieren. Seine Situation war ohnehin schon sehr kompliziert gewesen – jetzt war sie unmöglich zu überblicken.
»Die Ermittlungen werden vom FBI durchgeführt«, berichtete Pascal. »Sie werden natürlich von anderen amerikanischen und ausländischen Behörden unterstützt. Offiziell wird David Iverson, der für die Antiterror-Abteilung verantwortlich ist, die Sache leiten. Unsere Quellen lassen aber vermuten, dass die treibende Kraft hinter den Ermittlungen in Wirklichkeit Laura Vilechi sein wird – offenbar eine Frau von außergewöhnlicher Intelligenz und Zähigkeit.«
»Und was hat sie bisher herausgefunden?«
»Unseren Gewährsleuten zufolge sehr wenig. Nachdem sie nichts Konkretes in der Hand haben, können sie nichts anderes tun, als arabische Einwanderer zu überprüfen, um irgendwelche Anhaltspunkte zu finden …«
»Sind sie hinsichtlich der Herkunft der Rakete schon einen Schritt weitergekommen?«
»Nein. Sie versuchen sich die Hilfe der Russen zu sichern, aber solange sie die Waffe nicht in der Hand haben und die einzelnen Teile in ihre Herkunftsländer aus der ehemaligen Sowjetunion zurückverfolgen können, werden die Russen wohl kaum in nennenswerter Weise mitarbeiten, auch wenn wir uns nicht einmischen.«
»Und wir werden uns auch nicht einmischen«, stellte Wolkow klar. »Wir werden in der Angelegenheit in keiner Weise aktiv werden, verstehst du?«
»Natürlich.«
Wolkow versuchte das beängstigende Gefühl zu unterdrücken, dass seine sorgfältig gewahrte Anonymität unwiederbringlich verloren gehen könnte. »Und die CIA?«
»Wir haben gehört, dass Laura Vilechi bereits Kontakt mit der Agency aufgenommen hat. Man kann aber davon ausgehen, dass das FBI aus verständlichen Gründen nur sehr wenige brauchbare Informationen von der CIA bekommen wird.«
Wolkow nickte. »Was ist mit unseren Verbindungsleuten? Was haben sie herausgefunden?«
»Nichts, was nicht auch in den Medien erwähnt worden wäre. Um mehr zu erfahren, müsste ich direkte Nachforschungen anstellen. Willst du, dass ich das tue?«
»Nein … Wir müssen darauf achten, dass wir so unauffällig wie möglich bleiben. Irgendwann wird der Moment kommen, wo das nicht mehr geht, aber vorerst müssen wir uns im Hintergrund halten.«
»Wolkow drehte sich mit seinem Sessel um und sah Pascal zum ersten Mal an diesem Morgen an. »Gibt es sonst noch etwas?«
Sein Assistent stand nur da und blickte schweigend auf den Boden.
»Pascal? Ist alles in Ordnung?«
Schließlich blickte Pascal zu ihm auf. »Was hat es für Folgen, Christian?«, fragte er besorgt.
Wolkow blickte zu den Fernsehgeräten hinüber. »Für uns? Ich weiß es nicht. Aber wir können im Moment nichts tun, als den unmittelbaren Gefahren aus dem Weg zu gehen.« Er überlegte einige Augenblicke. »Wir werden so schnell wie möglich unser Haus in Chile aufsuchen. Wir sind schon zu lange hier. Fang aber erst im letzten Moment mit den Vorbereitungen an. Und informiere nur die Leute, die es unbedingt wissen müssen.«
»Darf ich das Haus auf den Seychellen vorschlagen? Wir haben gute Leute dort, und unsere Ankunft wäre unauffälliger.«
»Gut. Wann können wir aufbrechen?«
»Elizabeth und Joseph kümmern sich darum. Wärst du in zwei Stunden zum Abflug bereit?«
Wolkow nickte, und sein Assistent ging zur Tür.
»Pascal?«
Der Mann blieb stehen und drehte sich um.
Fünf
»Willst du eigentlich essen oder nur damit spielen?«
Beamon spießte zwei Tortellini mit der Gabel auf und steckte sie in den Mund. Er musste seine ganze Willenskraft aufbringen, um den Bissen zu kauen und zu schlucken.
»Komm schon, Mark. Sei doch nicht so zugeknöpft.«
»Ich bin nur ein ehrlicher, hart arbeitender SAC, Carrie. Mir erzählt niemand mehr etwas.«
Carrie Johnstone runzelte ungläubig die Stirn. Sie trug ihr schulterlanges rotbraunes Haar heute offen, sodass die Locken ihr Gesicht umspielten und sie perfekt aussehen ließen, wenngleich er wusste, dass das nicht geplant war.
So wie er selbst trug sie ihre Brille jetzt immer. Der Unterschied zwischen ihnen war, dass die Brille bei ihm ein Zeichen seines fortschreitenden Alters war, während ihre kleinen runden Gläser ihre Gesichtszüge noch zu betonen schienen.
»Da laufen Terroristen mit einem Raketenwerfer in Amerika herum, und du erzählst mir, dass du nichts darüber weißt«, beharrte sie.
Beamon blickte sich in dem fast leeren Restaurant um, auf der Suche nach ihrer nervösen Kellnerin. »Ich habe gar nicht so viel davon mitbekommen«, entgegnete er.
Erneut sah sie ihn ungläubig an. »Ich habe Laura im Fernsehen gehört, aber sie hat im Grunde nur das gesagt, was ihr Leute immer sagt: ›Wir haben viele Spuren und verfolgen jede einzelne konsequent.‹«
»Laura hat konsequent gesagt?«
»Sie hat vielleicht nicht dieses Wort gebraucht, aber sinngemäß hat sie es so ausgedrückt. Hast du mit ihr gesprochen?«
Nicht, seit sie ihm deutlich zu verstehen gegeben hatte, dass er sich verpissen solle.
»Nein.«
Carrie wandte sich ihrem fade aussehenden vegetarischen Gericht zu und blickte sich in dem düsteren Raum um. »Hätten wir nicht einfach bei dir zu Hause essen können? Hier ist es irgendwie unheimlich.«
»Was ist denn los?«
»Soll das ein Witz sein? Tatsache ist, dass uns jeden Augenblick irgendein Fanatiker in die Luft jagen könnte.«
»Ich glaube kaum, dass jemand eine Rakete an ein mittelmäßiges italienisches Restaurant in Phoenix verschwenden würde.«
»Aber sicher kannst du dir nicht sein.«
Beamon zuckte die Achseln. Er würde sich ganz sicher nicht von irgendeinem durchgeknallten Fanatiker mit einer alten Sowjet-Rakete daran hindern lassen, zu tun, was er wollte. »Tausende Leute werden jedes Jahr von betrunkenen Autofahrern getötet, und alles, wovor die Leute Angst haben, sind Terroristen und Flugzeugabstürze. Da ist es fast noch wahrscheinlicher, dass du in deiner Badewanne von einem Hai angegriffen wirst.«
»Ich weiß, es ist irrational, aber die Angst ist nun mal da. Wenn man daran denkt, dass plötzlich etwas aus dem Nichts kommen könnte … während man vielleicht gerade mit einem Bekannten plaudert – und dass man im nächsten Augenblick tot sein könnte …« Die Vorstellung jagte ihr einen kalten Schauer über den Rücken.
Das Bild vom World Trade Center blitzte kurz in seinen Gedanken auf. Er blinzelte und sah zu, wie Carrie sich etwas in den Mund schob, das nach einem Stück Aubergine aussah. Was wäre, wenn sie damals in dem Gebäude gewesen wäre, als es einstürzte?
Nach über zwanzig Jahren beim FBI fiel es ihm nicht mehr schwer – ja, es war für seine geistige Gesundheit, soweit man davon noch sprechen konnte, absolut notwendig, dass er Verbrechen so nüchtern und distanziert wie möglich betrachtete. Aber was wäre gewesen, wenn sie an jenem Tag im September bei dem Anschlag ums Leben gekommen wäre? Was wäre gewesen, wenn er sie verloren hätte, weil irgendwelche verrückten Moslems glaubten, den Zorn Gottes über Amerika bringen zu müssen?
»Bist du noch da, Mark? Was denkst du gerade?«
»Ach, nichts.«
Er strich mit dem Finger geistesabwesend über den Rand des Tellers, während sie weiteraß. Sie waren nun schon so lange zusammen – zumindest kam es ihm so vor. Jedenfalls war es die längste Beziehung, seit er erwachsen war, wenn man optimistischerweise davon ausging, dass sie noch eine Beziehung hatten.