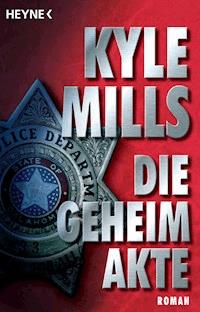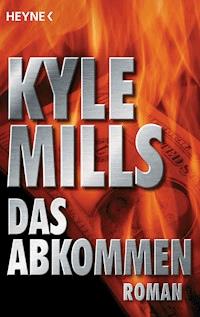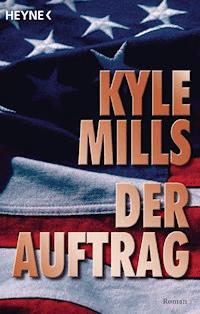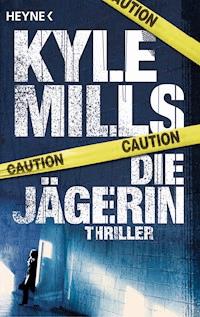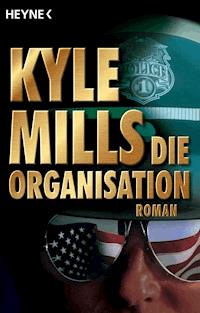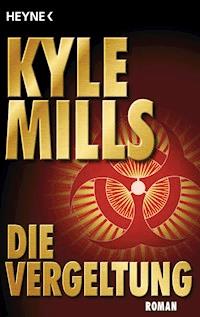
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Der größte Coup des Jahrhunderts
Brandon Vale, ein berüchtigter Meisterdieb, wird vom FBI-Agenten Scanlon für eine knifflige Mission aus dem Gefängnis befreit: Er soll die gesamten Einnahmen der Casinos von Las Vegas stehlen. Scanlon will damit Atomsprengköpfe kaufen, die ukrainische Gangster an den Meistbietenden versteigern wollen. Doch der geniale Raubzug ist erst der Anfang einer mörderischen Hetzjagd.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 492
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
KYLE MILLS
DIE VERGELTUNG
Roman
Aus dem Amerikanischen von Norbert Jakober
Das Buch
Brandon Vale, ehemaliges Special-Forces-Mitglied und hochtalentierter Meisterdieb, sitzt für ein Verbrechen, das er nicht begangen hat, im Gefängnis. Da bietet sich ihm unverhofft die Chance zur Flucht. Hinter dem Ausbruch steckt eine Firma, die mit höchsten Regierungsstellen zusammenarbeitet und ihn im Gegenzug auf eine heikle Mission schickt. Vale soll einen mit zweihundert Millionen Dollar gefüllten Geldtransport aus Las Vegas in seine Gewalt bringen und mit dem Geld zwölf Atomsprengköpfe in der Ukraine kaufen, damit diese nicht in die Hände von Terroristen fallen. Doch bald muss Brandon erkennen, dass er nur eine Schachfigur in einem doppelten Spiel ist, bei dem es letztlich um das Schicksal der gesamten Welt geht.
Von Las Vegas über die Ukraine und die Minenfelder des Nahen Ostens schickt Kyle Mills in seinem neuen Thriller den Helden Brandon Vale in ein nur allzu realistisches, bedrohliches Szenario. Gespickt mit überraschenden Wendungen und hochspannender Action ist dieser Roman ein Beweis dafür, dass Kyle Mills seinem Ruf gerecht wird, zur ersten Garde der Thrillerautoren zu gehören.
Der Autor
Titel der Originalausgabe THE SECOND HORSEMAN erschien bei St. Martin’s Press, New York
1. Auflage
Wilhelm Heyne Verlag in der Verlagsgruppe Random House GmbH Copyright © 2006 by Kyle Mills Copyright © 2016 dieses E-Books by Wilhelm Heyne Verlag, München in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München Umschlagillustration: © Digital Art / Corbis
Inhaltsverzeichnis
EINS
»Five Card Draw, Gentlemen. Also, alles aufgepasst!«
Brandon Vale feuerte die Karten aus dem Stapel, um sie an die fünf nervös dreinblickenden Männer auszuteilen, die um den Tisch saßen. Nach einem kurzen Blick auf sein Blatt legte er die Karten neben die Beute, die er inzwischen angehäuft hatte, und musterte die Gesichter der Mitspieler. Alle starrten sie auf ihre Karten, als wäre der ganze Sinn des Lebens darin enthalten, und er wusste aus Erfahrung, dass sie ihr Blatt noch eine ganze Weile studieren würden.
Von der anderen Seite des Zimmers kam das Knattern von Maschinengewehrfeuer, und er drehte sich um und blickte auf den Fernseher an der Wand, während er auf die Reaktion der anderen wartete. Seine Brillengläser waren erst zwei Wochen alt, doch sie hatten von Anfang an nicht richtig gepasst. Gefängnisse gehörten nun einmal nicht zu den Orten, an denen Spitzenkräfte arbeiteten, und die Tatsache, dass der Optiker, der ihm die Brille angepasst hatte, selbst halb blind war, sprach sicher auch nicht für seine Qualifikation.
Die Brille war immerhin gut genug, um ihn die unverkennbaren Umrisse von Panzern und laufenden Männern erkennen zu lassen, begleitet von den allzu vertrauten Kriegsgeräuschen. Sudan, Israel, Irak, Afghanistan – irgendeine von diesen Wüstengegenden, wo die Leute sich die Schädel einschlugen wegen irgendeinem Unsinn, der vor tausend Jahren passiert war, oder weil sie den anderen beweisen wollten, dass ihr Gott der Bessere war. Er kannte das alles zur Genüge. In seinem Geschäft begegnete man den selbstzerstörerischen, den gewalttätigen und abartigen Typen auf Schritt und Tritt. Man musste schon verdammt wachsam sein und die nötige Portion Glück haben, um solchen Leuten aus dem Weg zu gehen. Wenn man jedoch in Bagdad lebte, war das wohl nicht so einfach.
Die Männer, die auf ihren Stühlen vor dem Fernseher saßen, waren nach Hautfarben getrennt – schwarz, braun und auch einige Weiße, die sich von ihm selbst vor allem dadurch unterschieden, dass sie kräftiger, gemeiner und auffälliger tätowiert waren. Die Gewaltszenen schienen sie sichtlich aufzuheitern.
Der Bericht aus dem Krisengebiet war jedoch bald wieder zu Ende, und die Anwesenden verfolgten enttäuscht, wie der Sprecher irgendetwas über die Bundeszentralbank erzählte. Im Grunde saßen sie nur vor dem Fernseher, um Ann Coulter oder irgendeine andere flotte Reporterin zu Gesicht zu bekommen.
Brandon Vale wandte sich wieder dem Tisch zu und musterte den Mann, der für die eher trüben Fernsehgewohnheiten hier im Knast verantwortlich war. Er wog ungefähr so viel wie ein italienischer Sportwagen und war in etwa so stark und so schnell. Seine Haut war außergewöhnlich dunkel, sodass das Weiße in seinen Augen noch kräftiger leuchtete und das Tattoo, das einen gehängten Ku-Klux-Klan-Mann darstellte, nur teilweise zu sehen war.
Als einer der vielen zum Islam übergetretenen Häftlinge interessierte sich Kassem stets für den »Kampf seiner Glaubensbrüder«, wenn er im Aufenthaltsraum saß. Und nach dem, was mit jenem Neonazi-Gewichtheber passiert war, gab es nicht viele hier, die ihm widersprochen hätten.
Nachdem die Spieler eher zurückhaltend ihre Einsätze getätigt hatten, schob Kassem seine abgelegten Karten über den Tisch. »Drei«, befahl er.
Brandon hatte ihm gerade die erste Karte gegeben, als der Hüne so plötzlich von seinem Platz aufsprang, dass der Boden unter ihm erzitterte.
»Du teilst von unten aus, du verdammter Mistkerl!«, rief er.
Brandon schüttelte gelassen den Kopf. »Das tu ich nicht«, erwiderte er ruhig.
»Oh«, sagte Kassem sichtlich enttäuscht und setzte sich wieder, während die anderen höflich lachten.
Brandon war wegen eines größeren Diamantenraubs im Gefängnis gelandet, dessen Beute nie gefunden werden konnte. Zusammen mit der Tatsache, dass er noch keinen seiner Komplizen verraten hatte, verschaffte ihm das einiges Ansehen unter den Mithäftlingen und umgab ihn sogar mit einer Aura des Geheimnisvollen. Dies änderte jedoch nichts daran, dass er ein schmächtiger dreiunddreißig Jahre alter Mann war, der sich in der Grundschule zum letzten Mal mit jemandem geprügelt hatte – und das Mädchen, mit dem er damals aneinandergeraten war, hatte ihm ordentlich in den Hintern getreten.
Er war erst ein paar Tage hier gewesen, als ihn Kassem »bat«, der Pokerrunde beizutreten. Nachdem Brandon immer schon an gewinnträchtigen Unternehmungen interessiert gewesen war, hatte er die Spiele aus sicherer Entfernung beobachtet und dabei einige ungewöhnliche Details bemerkt. Es wurde stets hart und erbittert gespielt – aber nur bis etwa eine Viertelstunde vor dem Ende der Sitzung. An diesem Punkt begannen die Spieler ihre besten Karten wegzuwerfen und ließen Kassem alles gewinnen, was auf dem Tisch lag – meistens Zigaretten und Schuldscheine für nicht näher benannte Dienste, die zu einem späteren Zeitpunkt zu leisten waren.
Da Brandon nicht rauchte und wenig Lust hatte, irgendwelche geheimnisvollen Dienste zu leisten, die hier im Knast gefragt waren, beschloss er, sich aus der Sache herauszuhalten. Es kam jedoch nicht infrage, Kassems Einladung auszuschlagen, und so sah er sich in der unangenehmen Position, die Wahrheit sagen zu müssen – dass er ein professioneller Kartenhai und ein brillanter Falschspieler war.
Aus irgendeinem unerfindlichen Grund war Kassem des ewigen Gewinnens überdrüssig, wenngleich er es immer noch nicht leiden konnte, zu verlieren – und so betrachtete er Brandon als willkommene Abwechslung. Schließlich einigten sie sich darauf, dass die übrigen Mitspieler Brandon einen kleinen Teil ihres Einsatzes überließen, wofür er ihnen ein paar Tricks beibrachte und ihnen zeigte, wie man einem Falschspieler auf die Schliche kam. Am Ende des Spiels wurde sein Gewinn dann nach einem bestimmten Schlüssel aufgeteilt – und zwar weniger danach, wie gut jemand spielte, sondern eher, wie gefährlich jemand war. Ein gutes Abbild des Lebens hinter Gittern, von dessen Härte er nun jedoch befreit war. Seine enge Beziehung zu Kassem hatte ihn schlagartig unantastbar und allgemein beliebt gemacht.
»Ich glaube, das ist die letzte Runde«, verkündete Brandon – eine indirekte Ermahnung an alle, dass es Zeit war, alle vielversprechenden Karten abzulegen und alles zu verlieren, was sie hatten. Die Spieler, die bis dahin noch vorsichtig agiert hatten, setzten nun buchstäblich alles auf eine Karte.
»Du bist dran, Kassem«, sagte Brandon.
»Zwei Pärchen. Zweien und Dreien.«
Jene, die ihre Karten noch nicht weggelegt hatten, taten es nun mit einem gehorsamen Stöhnen. Alle außer Brandon.
»Na, was hast du?«, forderte ihn Kassem auf.
»Willst du wirklich sehen, was ich in der Hand habe?«
»Genau das will ich.«
»Glaubst du, dass du es mit meinem Blatt aufnehmen kannst?«
»Leg die verdammten Karten auf den Tisch, sonst breche ich dir deinen dünnen Hals«, forderte Kassem ihn lachend auf.
Brandon knallte seine Karten auf den Tisch. »Fünf Asse, Pik Straße.«
Diesmal war das Stöhnen der Mitspieler schon etwas echter.
»Ich weiß wirklich nicht, was ich mit euch machen soll«, sagte Brandon, als der Wärter das Signal gab, den Saal zu räumen. Kassem streckte ihm die Hand entgegen, und als Brandon seine Hand aus der des Mithäftlings löste, hatte er einen dicken Joint darin.
»Damit du besser schlafen kannst«, sagte Kassem.
»Hey, danke, Kas.«
Diese großzügigen kleinen Geschenke gab Brandon stets an seinen durchgeknallten Zellengenossen weiter, der sich auf diese Weise so weit beruhigte, dass Brandon sich seinerseits entspannen und ein wenig lesen konnte. Die Joints halfen ihm, seiner Leseleidenschaft zu frönen – wenngleich er zugeben musste, dass er »Moby Dick« und »Tess von den D’Urbervilles« nur als Comic gelesen hatte.
Er nahm seinen Platz in der Reihe ein und schlurfte langsam zur Tür hinaus – eingezwängt zwischen zwei stark schwitzenden und ziemlich bedrohlich aussehenden Fleischbergen. Doch solche kleinen Irritationen konnten seine momentane Stimmung nicht beeinträchtigen; in einer Stunde würde sein Zellengenosse völlig high auf seiner Pritsche liegen, während Brandon selbst sich in die inneren Mechanismen der Samurai-Gesellschaft versenken konnte. Es war nicht gerade das, was sich die meisten Leute unter einem herausragenden Abend vorstellten, aber unter den momentanen Umständen war es das Beste, was er mit seinen Abenden anfangen konnte.
»Vale!«
Er beugte sich aus der Reihe, rümpfte die Nase, als er der Achselhöhle hinter ihm zu nahe kam, und blickte zu dem Wärter hinüber, der mit seinem Schlagstock auf ihn zeigte.
»Vortreten!«
Brandon sprang aus der Reihe, lief in die Richtung, aus der er gekommen war, und blieb vor dem Mann stehen. »Ja, Sergeant Daly?«
Angus Daly galt allgemein als der zweitsadistischste und der drittkorrupteste von allen Wärtern, vor allem aber als derjenige, der sich mit Abstand am wichtigsten nahm. Seine Uniform war stets so gestärkt, dass sie wie aus Pappe wirkte, und seine Bürstenschnittfrisur lief in der Mitte der Stirn zu einer scharfen Spitze zusammen.
Das Bemerkenswerteste an Daly war jedoch, dass er zu den wenigen Menschen zu gehören schien, die Brandon aus tiefstem Herzen hassten. Für ihn war Brandon offenbar eine Art Intellektueller, der auf einfache Arbeiter wie ihn heruntersah und der nach seiner Zeit im Knast die versteckten Diamanten abholen würde, um sich an der Costa del Sol mit irgendwelchen Supermodels ein schönes Leben zu machen. Und deshalb hatte sich Daly offenbar vorgenommen, ihm seinen Aufenthalt im Gefängnis so unangenehm wie möglich zu machen.
Nicht dass er ihn in nennenswerter Weise körperlich misshandelt hätte. Nein, man musste Daly immerhin zugutehalten, dass er schon etwas einfallsreicher vorging. War irgendwo ein Klo verstopft, wandte er sich an Brandon. Und das dazu nötige Werkzeug und die Handschuhe schienen immer gerade unauffindbar zu sein. Steckte das Auto eines Wärters im Dreck fest, so wurde stets Brandon zum Anschieben abkommandiert.
»Sir? Was kann ich für Sie tun?«
Daly stand schweigend da und wartete, bis der letzte in der langen Reihe der Männer hinter der Ecke verschwunden war. »Komm mit«, sagte er schließlich.
Brandon kam der Aufforderung nach und folgte dem Wärter in einem Respektsabstand von einigen Schritten. Er steckte die Hände in die Hosentaschen, weil ihm plötzlich kalt wurde, obwohl er wusste, dass er sich das bestimmt nur einbildete. Seltsamerweise fühlte er sich umso unsicherer, je weniger Leute um ihn herum waren. Es hatte wohl mit dem grauen Stein zu tun, aus dem dieses Gebäude erbaut war, von dessen Wänden der Putz bröckelte. Er neigte im Allgemeinen nicht zum Aberglauben, aber er war sich sicher, dass es in diesem Haus von Geistern wimmelte. Und Dalys Anwesenheit war auch nicht unbedingt beruhigend. Manchmal dachte Brandon, dass er der Obergeist hier im Knast sein musste. Eines Tages, so fürchtete er, würde der Kerl vor ihm stehen und ihn aus einem halb verwesten Totenschädel angrinsen.
Daly blieb schließlich stehen und sperrte eine massive Stahltür auf, die Brandon noch nie offen gesehen hatte. Sie war in demselben Grau bemalt wie die Wände, so als hätte man sie bewusst tarnen wollen. Wahrscheinlich erreichte man bei den meisten Häftlingen den gewünschten Effekt, doch auf Brandon hatte das die gegenteilige Wirkung. Er hatte immer schon wissen wollen, was sich hinter der Tür verbarg. Bis jetzt.
»Mr. Daly?«, fragte er zögernd. »Wohin gehen wir?«
Daly schob Brandon durch die Tür, folgte ihm und sperrte wieder zu.
Der Korridor, in dem sie standen, war nur schwach beleuchtet und endete nach nur drei Metern an einer ähnlichen Tür. Irgendetwas stimmte hier nicht. »Verzeihung, Sir, aber …«
»Halt dein verdammtes Maul!«
Daly drückte auf einen rostigen Knopf an der Wand, und im nächsten Augenblick ertönte ein lautes Summen von der Tür am anderen Ende des Korridors. Er zeigte auf die Tür, und Brandon ging darauf zu. Er musste die Schulter einsetzen, um die Tür aufzudrücken – und als sie schließlich aufging, drang ein Schwall kalter feuchter Luft herein. Ein Brummen im Befehlston hinter ihm wies ihn an weiterzugehen.
Er hatte den kleinen Hof noch nie gesehen – es war einer der vielen Bereiche des Gefängnisses, die man absperrte, weil man sich die Kosten für die notwendige Renovierung sparen wollte. Der Boden war nach dem beständigen Nieselregen der letzten Tage tief und schlammig, sodass Brandon achtgeben musste, nicht die Schuhe zu verlieren.
»Hier lang«, befahl Daly und schritt zielstrebig über den Hof. Die Lichter der Wachtürme ließen den Stacheldraht auf den Steinmauern bedrohlich aufleuchten, doch hier unten im Hof war es dunkel, kalt und nass.
Brandon folgte dem Wärter und überlegte, was ihn wohl heute erwarten mochte. Wahrscheinlich musste er sich um irgendein Problem in der Kläranlage kümmern, und Daly hatte darauf gewartet, dass der Boden besonders schlammig war, damit die Sache noch unangenehmer wurde.
Natürlich hatte Brandon schon daran gedacht, auszubrechen. Des Öfteren sogar. Vor allem, als er einmal die toten Küchenschaben aus der Küche entfernen musste, nachdem die Kammerjäger ihr Werk erledigt hatten. Das Problem war jedoch weniger, die Gefängnismauern zu überwinden, als sich durch die ausgedehnte Wildnis durchzuschlagen, die die Anstalt umgab. Tatsache war, dass die Diamanten, von denen jeder glaubte, dass er sie besaß, gar nicht existierten – und seine Strafe war nicht so lang, dass er sie gegen ein Leben auf der Flucht eintauschen wollte. Der beste Weg, die Sache zu bewältigen, war eindeutig, sich aus jedem Ärger herauszuhalten, laut von Jesus zu reden, wenn irgendwo ein Wärter in Hörweite war, und auf eine frühere Haftentlassung auf Bewährung zu hoffen.
Er schirmte die Augen mit der Hand ab und blickte zum nächstgelegenen Wachturm hinauf. Er war leer. Brandon verlangsamte seine Schritte und suchte einen anderen Turm – ebenso vergeblich – nach irgendeiner menschlichen Gestalt ab. Welchen Grund mochte es haben, dass niemand auf den Türmen war? Die Frage beschäftigte ihn so sehr, dass ihn Dalys Schlagstock völlig überraschend in der Magengrube traf. Der Stoß war nicht so wuchtig, dass er zu Boden ging, aber immerhin kräftig genug, dass er sich vor Schmerz krümmte und nach Luft rang.
»Weitergehen!«, herrschte ihn Daly mit ungewöhnlich leiser Stimme an.
Als Brandon weiter vornübergebeugt dastand, unfähig, sich zu bewegen, schlug ihm der Wärter den Knüppel gegen die Beine. Brandon spürte einen jähen Schmerz, der ihn zwar nicht umwarf, aber immerhin ausreichte, um ihn zum Weitergehen anzutreiben.
Er wankte auf ein schmales Metalltor zu, das wahrscheinlich früher als Lieferanteneingang diente. Als sie vor dem Tor standen, wandte er sich Daly zu, von dem er im Licht der Scheinwerfer nur die Umrisse erkennen konnte. Der schattenhafte Arm des Mannes hob sich, und Brandon zuckte zusammen, doch der Wärter hielt ihm nur etwas hin.
»Was …«, stieß Brandon keuchend hervor, »ist das …«
»Nimm es«, befahl Daly und drückte ihm das Ding in die Hand – ein Handy, wie sich nun zeigte. Das große Display war dunkel, doch als er eine Taste drückte, begann es zu leuchten. Was hatte das nur zu bedeuten? Daly hatte ihn nie richtig geschlagen – niemand hatte das getan. Und das Telefon …
Er wirbelte herum, als er das metallische Geräusch eines Schlüssels hörte, der in einem alten Schloss umgedreht wurde, und sah, wie Daly das Tor öffnete und einen Schritt zur Seite trat.
»Sir? Was tun Sie …«
»Raus mit dir.«
»Was?«
»Geh durch das Tor, Brandon.«
»Ich glaube nicht, dass das … Sir, wenn ich irgendetwas getan habe …«
»Hau schon ab, verdammt noch mal!« Auch diesmal schrie ihn der Mann nicht an, sondern zischte ihm den Befehl nur zu, so als wolle er nicht, dass es jemand hörte.
Brandon rührte sich nicht von der Stelle. Genügte es Daly nicht mehr, ihn mit kleinen Erniedrigungen zu traktieren? Hatte er sich jetzt etwas Drastischeres einfallen lassen? Zwang er ihn etwa, das Gefängnis zu verlassen, um dann Alarm zu schlagen?
»Sir, ich denke nicht, dass …«
Dalys Hand schoss hervor und schloss sich so fest um Brandons Kehle, dass er nicht mehr atmen konnte.
»Was denkst du nicht, Junge?«
Brandon griff nach dem Handgelenk des Wärters, das sich wie feuchter Stein anfühlte.
»Das ist es eben! Du denkst überhaupt nicht. Du bist nur ein kleiner Scheißganove, der so dumm war, sich schnappen zu lassen.«
Daly trat auf ihn zu und gab ihm einen Stoß. Brandon ließ das Handgelenk des Mannes los und streckte die Hand aus – doch statt des Tores bekam er nur ein Stück abbröckelnde Mauer zu fassen. Ein letzter Stoß, und er landete mit dem Rücken in dem weichen Schlamm. Er sprang sofort wieder auf, um zum Tor zu gelangen, doch Daly knallte es ihm vor der Nase zu, sodass er erneut das Gleichgewicht verlor. Er rappelte sich auf die Knie hoch und griff nach den Gitterstäben, doch der Wärter trat bereits ein paar Schritte zurück.
»Mr. Daly«, rief er ihm zu, während schwere Regentropfen rings um ihn auf den Boden klatschten. »Machen Sie das Tor auf! Lassen Sie mich rein!«
Der Wärter entfernte sich langsam rückwärtsgehend, und seine Zähne blitzten kurz auf, als er in den Lichtkegel des Wachturms trat. Es war das erste Mal, dass Brandon ihn lächeln sah.
Daly blieb schließlich stehen, den Blick immer noch auf Brandon gerichtet, als er plötzlich mit seinem Schlagstock ausholte und ihn mitten auf seine spitz zulaufenden Geheimratsecken niedersausen ließ. Er taumelte erst nach rechts, dann nach links und sank schließlich zu Boden.
Brandon kniete sprachlos am Boden, und seine feuchten Hände an den Gitterstäben wurden allmählich taub. Was hier passierte, gefiel ihm überhaupt nicht. Er war durch und durch nass und voller Schlamm, er befand sich auf der falschen Seite des Gefängnistors, und er war so verwirrt, dass er keinen klaren Gedanken fassen konnte. Schließlich blickte er sich um und versuchte irgendetwas zu erkennen, während das Wasser über seine Brillengläser lief. Die schwachen Lichter des Gefängnisses verloren sich im Regen und in der Dunkelheit, doch er wusste, dass irgendwo da draußen der Wald begann. Er hatte keine Ahnung, wie groß und wie dicht der Wald war, und er hatte sich auch nie die Mühe gemacht, es herauszufinden. Wozu auch, nachdem er ohnehin beschlossen hatte, seine Strafe abzusitzen.
Schließlich rappelte er sich hoch und riss energisch an den Gitterstäben, um sich zu vergewissern, dass das Tor wirklich verschlossen war. Verständnislos starrte er auf den benommenen Wärter und atmete einige Male tief durch, um sich zu beruhigen. Er konnte sich einfach nicht erklären, was soeben vorgefallen war. Er wusste nur, dass ihm kalt war und dass er Angst hatte. Und dass alle denken würden, er hätte Daly angegriffen und wäre geflohen …
Das Telefon!
Er wirbelte herum, ließ sich auf die Knie fallen und kroch im Schlamm herum, bis er es schließlich fand. Es steckte teilweise im Dreck, doch das Display leuchtete immer noch grün. Brandon wischte das Handy ab und begann sich durch das Menü zu arbeiten, um nach irgendeiner Telefonnummer zu suchen – doch da war nichts. Warum hatte ihm Daly das Telefon gegeben? Wenn sie ihn damit erwischten, würden sie wissen wollen, woher er es hatte. Er drückte auf die Wiederwahltaste. Nichts.
»Scheiße!«
Der Regen wurde immer stärker, und er hörte Donnergrollen. Bei seinem Glück würden auch bald die ersten Blitze über ihm niedergehen.
Man konnte es drehen und wenden, wie man wollte – er steckte mächtig in der Scheiße. Wenn er versuchte zu türmen, würden sie ihn schnell wieder schnappen, und was ihm dann bevorstand, war sicher nicht lustig. Wenn er aufgab, ging es ihm eben schon ein paar Stunden früher an den Kragen. Vielleicht wäre es gar nicht mal das Schlimmste, von einem Blitz getroffen zu werden.
»Scheiße! Scheiße! Scheiße!«
Seine Mutter hatte einmal zu ihm gesagt, dass es immer einen Ausweg gab – es kam nur darauf an, dass man schlau genug war, ihn zu erkennen. Auf eine solche Weisheit, so dachte er sich, konnte man aber auch nur kommen, wenn man sich nie auf der falschen Seite einer Gefängnismauer befunden hatte – und das noch dazu bei sintflutartigem Regen.
Brandon rappelte sich erneut auf die Beine und wich langsam von dem Tor zurück, den Blick auf die Wachtürme gerichtet. Er war nicht wirklich überrascht zu sehen, dass die Wächter ihre Posten wieder eingenommen hatten.
»Hey!«, rief er und riss die Hände in die Höhe. Er trat noch einen Schritt zurück, sodass er mitten im Lichtkegel eines Scheinwerfers stand, und schirmte seine Augen mit dem Handy ab, das er immer noch in der Hand hielt. »Hey! Ich gebe auf! Ich will nicht ausbrechen! Das Ganze ist ein Missver –«
Das Krachen eines Gewehrschusses und das Pfeifen einer Kugel, die an seinem Ohr vorbeisauste, ließ ihn zusammenzucken, doch er behielt die Hände oben.
»Verdammt!«, rief er so laut er konnte, um sich bei dem Regen verständlich zu machen. »Hört auf zu schießen! Ich bin’s – Brandon! Ich …«
Die zweite Kugel jagte an seinem anderen Ohr vorbei, und er hörte, wie sich das Geschoss mit einem klatschenden Geräusch hinter ihm in den Schlamm bohrte.
Er drehte sich um und lief los.
ZWEI
»Es ist ein bisschen spät, um noch umzukehren. In jeder Hinsicht.«
Edwin Hamdi war sichtlich nervös. Sein maßgeschneiderter europäischer Anzug verlieh ihm eine stille Würde, konnte aber nicht über die unruhigen Hände und die angespannten Gesichtszüge hinwegtäuschen. Richard Scanlon füllte zwei Gläser mit Scotch und reichte eines davon Hamdi, ehe er quer durch das geräumige Büro zu einer Sitzgruppe aus Ledersesseln und Sofas schritt.
Außerhalb der geschlossenen Tür war das ganze Gebäude dunkel. Scanlon hatte alle nötigen Sicherheitsvorkehrungen getroffen, um nicht die Fehler anderer für die Regierung arbeitender Organisationen und Firmen zu wiederholen, die in die Schlagzeilen geraten waren, nachdem brisante Speichermedien und Dokumente gefunden worden waren. Der gesamte Gebäudekomplex hatte um sieben Uhr abends leer und abgesperrt zu sein. Außer ihm und einigen wenigen Leuten, die direkt mit ihm zusammenarbeiteten, war niemand befugt, länger zu bleiben.
»Wie geht es ihm?«, fragte Hamdi.
Scanlon blickte auf seine Uhr. »Es hat gerade erst angefangen. Ich bin sicher, es ist alles in Ordnung.«
»Wissen Sie es nicht genau? Bekommen Sie denn nicht laufend aktuelle Informationen?«
Scanlon schüttelte ruhig den Kopf. »Ich habe mit der Durchführung der Operation nichts zu tun, Edwin. Ich habe grünes Licht für den Plan gegeben und überlasse die Sache den Leuten, die mit so etwas Erfahrung haben.« Er zeigte auf das Telefon auf seinem Schreibtisch. »Sie rufen mich sicher an, wenn es irgendein Problem gibt oder wenn sie den Plan ändern müssen.«
Hamdi nahm einen Schluck von seinem Drink und kniff die Lippen zusammen, was entweder auf den Whisky oder auf sein Missfallen an der ganzen Sache zurückzuführen war. Wahrscheinlich war Letzteres der Fall.
»Das gefällt mir nicht, Richard – der Kerl ist unberechenbar. Die Situation war schon vorher ziemlich schwer einzuschätzen. Ich frage mich, ob wir überhaupt noch eine gute Chance haben, unser Ziel zu erreichen.«
Scanlon nickte nachdenklich und starrte in das Glas in seiner Hand. Hamdi war ein Mann von nahezu unergründlichen Widersprüchen. Einerseits ein Mann von brillantem, kühlem Intellekt, der sich jedoch so sehr in ein Problem verbeißen konnte, dass er nichts anderes mehr sah. Nach außen hin stets würdevoll, aber in seinem Inneren voller Leidenschaft.
Hamdis ägyptischer Vater hatte eine Firma geleitet, die Baumwolle in die Vereinigten Staaten exportierte; durch diese Geschäftsbeziehung hatte er die amerikanische Frau kennengelernt, die er später heiratete. In seiner Kindheit war Edwin stets zwischen den beiden Kulturen hin und her gependelt, ehe er schließlich in einer Privatschule in New England landete. Danach ging er nach Harvard, später nach Oxford, wo er seinen Doktor in Orientalistik machte.
Obwohl er seine Ausbildung schon in Amerika absolviert hatte und obwohl er nicht allzu religiös war, spürte man etwas Fremdes an ihm – etwas, das nur schwer fassbar war. Da lauerte etwas Unberechenbares unter der Oberfläche, das nur selten zum Vorschein kam. Scanlon fragte sich, ob die Menschen im Westen und im Osten einander je wirklich verstehen und mit Vertrauen begegnen würden, wenn er selbst es nicht schaffte, diesem Mann, den er schon so viele Jahre kannte, ganz zu vertrauen. Andererseits war er selbst kein Mensch, der leicht Vertrauen zu anderen fasste.
»Ich will ganz ehrlich zu Ihnen sein, Richard. Ich bereue es fast schon, dass ich meine Zustimmung gegeben habe. Es ist Ihnen wirklich unwahrscheinlich gut gelungen, die fähigsten Leute mit diesem … Projekt zu befassen. Aber wie passt er zu den Männern, die schon an der Sache arbeiten?«
Hamdi hatte die unheimliche Gabe, jede Situation genau analysieren zu können – doch er war unfähig, hinter die Fassade eines Menschen zu blicken. Für ihn maß sich Kompetenz an den Titeln, die jemand besaß, am Haarschnitt und daran, ob jemand ein leuchtend weißes Hemd trug oder nicht. Wer nicht diese äußeren Erfolgsmerkmale zeigte, musste in seinen Augen irgendeinen Makel haben.
In diesem Fall lag er natürlich richtig. Brandon Vale war alles andere als makellos.
»Sie haben recht, Edwin. Sie werden wahrscheinlich nicht gut zusammenarbeiten.«
Hamdi beugte sich vor und erhob seine Stimme für einen Augenblick, ehe es ihm selbst bewusst wurde. »Obwohl wir hier eine Riesenverantwortung tragen und eine Mission verfolgen, die ganz einfach nicht scheitern darf, machen Sie sich einen Spaß daraus, mich zu provozieren, nicht wahr, Richard?«
Scanlon lächelte und nahm einen Schluck von seinem Scotch. Das Problem mit solchen gelehrten Köpfen war, dass sie leicht nervös wurden, wenn sie es mit Situationen zu tun bekamen, wie sie in dieser Art noch nie vorgekommen waren. Andererseits musste Scanlon anerkennen, dass Hamdi viel Fantasie und Mut bewies, sich auf eine solche Operation einzulassen, und er war außerdem in einer Position, in der er Dinge bewirken konnte, die ihm, Scanlon, unmöglich waren.
»Wenn Sie einen besseren Vorschlag haben, Edwin, dann verraten Sie ihn mir bitte.«
Hamdi gab keine Antwort, sondern drehte sich um und starrte auf die Wand. Es war ihm durchaus bewusst, dass es einer seiner seltenen Misserfolge gewesen war, der sie in diese gefährliche Situation gebracht hatte.
Er hatte Scanlon versprochen, dass seine Firma einen Zweihundert-Millionen-Dollar-Auftrag vom Heimatschutzministerium erhalten würde – aber das war vor dem Terroranschlag auf die Mall of America, das größte Einkaufszentrum der USA, gewesen. Die schockierenden Bilder von schwer verletzten und getöteten Kindern hatten die verantwortlichen Politiker bewogen, fürs Erste alle Aufträge des Heimatschutzministeriums an Privatfirmen auf Eis zu legen. Es folgten jetzt erst einmal langwierige Untersuchungen, die letztlich zu einer weiteren Aufblähung der Bürokratie führen würden.
Und so standen er und Hamdi praktisch mit dem Rücken zur Wand – und Brandon war das Beste, ja, das Einzige, was ihnen zur Lösung ihrer Probleme eingefallen war.
»Sie haben doch noch nie lange über eine Sache nachgegrübelt, wenn Sie einmal eine Entscheidung getroffen haben, Edwin. Warum verraten Sie mir nicht, was Sie so beschäftigt?«
Hamdi wandte sich wieder Scanlon zu, doch sein Blick war in die Ferne gerichtet. »Ich glaube, Sie wissen ganz genau, was mich beschäftigt, Richard.«
»Glauben Sie?«
»Ich möchte sichergehen, dass wir zwei dieselbe Auffassung davon haben, inwiefern uns Brandon Vale nützlich ist.«
»Ja?«
»Er ist ein Werkzeug, nicht mehr. Nein, das stimmt auch nicht ganz. Er ist ungefähr so wie eine Spritze. Wenn man sie präzise einsetzt, ist sie effektiv und sicher – sofern man nicht vergisst, sie nach dem Gebrauch zu entsorgen.«
Hamdis Englisch war akzentfrei, doch er hatte eine eigentümliche Sprechmelodie, die seine Jahre in Ägypten, den USA und England widerspiegelte, und die allem, was er sagte, zusätzliches Gewicht verlieh. Seine eindringliche Art, zu sprechen, und sein natürliches Charisma machten es einem bisweilen schwer, nicht von dem Mann fasziniert zu sein. Schwer, aber nicht unmöglich.
»Müssen wir jetzt wirklich darüber reden, Edwin?«
»Besser jetzt, solange wir die Situation noch einigermaßen unter Kontrolle haben. Und Sie wissen genauso gut wie ich, dass sich die Dinge noch dramatisch zuspitzen werden.«
»Ich möchte Ihnen da auch gar nicht widersprechen, aber wir sollten Brandon wirklich eine Chance geben. Warten wir doch mal ab, was er ausrichten kann, bevor wir uns Gedanken machen, wie er von der Bildfläche verschwinden könnte. Okay?«
Sie schwiegen beide fast eine Minute, ehe Hamdi schließlich sein Glas auf den Tisch stellte und aufstand. »Ich werde Ihnen einen gewissen Spielraum für eigene Entscheidungen lassen. Aber mit dem Thema Brandon Vale sind wir noch nicht durch.«
Scanlon nickte. »Ich weiß.«
DREI
Die Tatsache, dass das Krachen und Zischen des Gewehrfeuers vom dumpfen Heulen des Alarms abgelöst worden war, konnte man wahrscheinlich als positive Entwicklung betrachten – aber »positiv« war in diesem Zusammenhang wohl ein sehr relativer Begriff. Brandon hatte den beleuchteten Bereich rund um die Gefängnismauern verlassen und watete nun durch den tiefen Schlamm. Immer weiter entfernte er sich von dem Licht, ohne noch einmal zurückzublicken – zum Teil, weil es seine Sicht im Dunkeln beeinträchtigt hätte, wenn er ins grelle Licht geschaut hätte, hauptsächlich aber aus Angst vor dem, was er da sehen könnte.
Er stolperte schon wieder und landete mit dem Gesicht voraus im Dreck. Der Regen war noch stärker geworden, und er atmete so schwer, dass er das Gefühl hatte, an den Tropfen zu ersticken. Er musste sich fast übergeben, schaffte es aber doch noch, das Cornedbeef mit Erbsen unten zu behalten, das es zum Abendessen gegeben hatte.
Wieder rappelte er sich hoch und taumelte mit zittrigen Beinen auf den Waldrand zu, der irgendwo vor ihm sein musste, auch wenn er ihn nicht sehen konnte.
Es gab immer noch keine Anzeichen, dass er verfolgt wurde, aber das besagte nicht viel, weil er bei dem Regen kaum etwas hörte und weil er es immer noch unterließ, zurückzublicken. Vielleicht waren sie ihm längst auf den Fersen. Vielleicht wollten sie es Daly überlassen, ihn zur Strecke zu bringen, und warteten darauf, dass er sich so weit erholt hatte, dass er ihn mit einem gezielten Schuss erledigen konnte. Vielleicht hatte er schon den Finger am Abzug.
Brandon duckte sich unwillkürlich, um diesem sadistischen Möchtegern-James-Dean ein kleineres Ziel zu bieten, wodurch er noch etwas langsamer vorankam. Nein, Brandon würde sich von diesem Wahnsinnigen nicht den Kopf wegpusten lassen. Allerdings erschien ihm die Alternative, eine Kugel in den Arsch zu bekommen und irgendwann an Altersschwäche in seiner Gefängniszelle zu sterben, auch kein bisschen verlockender. Es war einfach ungerecht. Er hatte doch nichts getan. Jedenfalls nicht Daly, und auch sonst niemandem in diesem Gefängnis.
Er erreichte schließlich die ersten Bäume. Mehrere Zweige peitschten ihm ins Gesicht, bevor er den Arm hob, um sich zu schützen. Schließlich blieb er stehen und lehnte sich keuchend an einen dicken Baumstamm. Etwas zu spät, wie sich herausstellte, denn die Anstrengung war so groß gewesen, dass er sein Cornedbeef nun doch noch von sich gab und über sein Hosenbein ergoss.
Er hatte sich immer wieder vorgenommen, die Fitnessgeräte im Gefängnishof zu nutzen, anstatt nur dazusitzen und Karten zu spielen. Aber er hatte ja nicht wissen können, dass es damit so dringend war. Wie hätte er vorhersehen sollen, dass Daly sich solche miesen Spielchen einfallen lassen würde? Er schien doch ganz zufrieden damit zu sein, Brandon die Toiletten putzen zu lassen. Was hatte der Kerl bloß vor? Nun, es lag auf der Hand – er würde Brandon eine Kugel in den Arsch jagen und dafür sorgen, dass ihm sein Lieblingsopfer für den Rest seines Lebens erhalten blieb.
Brandons Atmung beruhigte sich so weit, dass er einige Male ausspucken konnte und das Seitenstechen allmählich nachließ. Er beugte sich ein Stück zur Seite, um zurückzublicken, hielt dann aber inne. Was gab es denn schon zu sehen? Er wusste auch so, dass sie hinter ihm her waren. Egal, was da hinter ihm passierte – es würde nichts an dem ändern, was er tun würde.
Welche Möglichkeiten blieben ihm?
Nun, nicht viele, das stand fest.
Er konnte versuchen, in einem weiten Bogen zum Gefängnis zurückzukehren und in dem allgemeinen Durcheinander in den Hof zu schleichen. Er wäre dann wohl der Erste, der je heimlich in ein Gefängnis eindrang. Die Erfolgsaussichten? Etwa zehn Prozent. Die Überlebenschancen? Vielleicht doppelt so hoch, wenn er Glück hatte.
Brandon schlang die Arme um sich und versuchte den kalten Regen zu ignorieren, der seine Kleider durchnässt hatte. Wenn er hier stehen blieb, würde er wahrscheinlich erfrieren. Wie lange würde das dauern? Woher sollte er das wissen, verdammt noch mal? War er vielleicht ein Förster?
Was war, wenn er einfach hierblieb und versuchte, sich einigermaßen warm zu halten? Vielleicht konnte er auf eine günstige Gelegenheit warten, um sich zu stellen und alles zu erklären, bevor ihn jemand abknallen konnte. Andererseits konnte Daly die Dunkelheit und das allgemeine Durcheinander als Vorwand benutzen, um auf ihn zu schießen, bevor er irgendetwas sagen konnte. Wer würde schon an den Worten eines gottesfürchtigen Gefängniswärters zweifeln, den man so hinterhältig angegriffen hatte, wenn er behauptete, dass er geglaubt habe, eine Waffe bei dem Flüchtigen gesehen zu haben?
Natürlich konnte er auch einfach weiterlaufen. Aber welche Aussichten hatte er? Wahrscheinlich würde er sich schon auf den nächsten hundert Metern ein Bein brechen oder ein Auge ausstechen – und selbst wenn ihm das nicht passierte, hatte er keine Ahnung, wie er zur Straße gelangen sollte oder wohin die Straße führte, wenn er sie tatsächlich erreichen sollte. Außerdem hatte er niemanden, von dem er Hilfe erwarten konnte. Und was das Ganze noch schlimmer machte – er war nicht gerade ein begnadeter Läufer und trug außerdem eine Gefängnisuniform.
Der Regen traf ihn zwar nicht mehr direkt, dafür strömte er von dem Baum hinter ihm auf ihn herab wie ein Wasserfall. Das Donnern wurde immer stärker und bildete mit dem Alarmgeheul aus dem Gefängnis ein konstantes Hintergrundgeräusch. Das alles war der Konzentration nicht gerade förderlich.
Nach einigen weiteren Sekunden des Nachdenkens kam er zu dem Schluss, dass seine einzige Hoffnung die Rückkehr ins Gefängnis war. Niemand würde ihn sehen, wenn er sich an die Mauer drückte und auf eine Gelegenheit wartete, sich hineinzuschleichen. Und wenn er erst einmal drinnen war, würde man nicht mehr so einfach unter irgendeinem Vorwand auf ihn schießen können. Es gab einfach zu viele Zeugen. Der Haken an der Sache war, dass sie seine Strafe bis zum Jüngsten Tag verlängern würden und dass er überdies als der dümmste Verbrecher aller Zeiten in die Geschichte eingehen würde. Wenn er Pech hatte, würden sie ihn in der Führung durch das J. Edgar Hoover Building verewigen – direkt neben dem Kerl, der bei einem Banküberfall die Aufforderung, das Geld herauszugeben, auf die Rückseite seines personalisierten Schecks geschrieben hatte. Nun, darauf konnte man wirklich stolz sein.
Brandon wischte sich die Brillengläser mit dem schmutzigen Ärmel ab und trat hinter dem Baum hervor. Vorsichtig arbeitete er sich durch das dichte Laub auf den Waldrand zu. Nach etwa drei Metern blieb er abrupt stehen. Das Telefon in seiner Hosentasche hatte zu vibrieren begonnen.
Das Ding hatte er ganz vergessen. Konnte es sein, dass ihn Daly damit verfolgte? Manche dieser Handys hatten schon GPS-Sender eingebaut. Rief er vielleicht an, um ihm mitzuteilen, dass er nur drei Meter von ihm entfernt war?
Brandon nahm das Handy mit seiner schmutzigen Hand heraus und wollte es schon wegwerfen, überlegte es sich dann aber anders. Das Ganze ergab einfach keinen Sinn. Die Flucht, das Handy, Dalys Verhalten. Seine stark ausgeprägte Neugier war ihm schon einige Male im Leben hilfreich gewesen, aber er erinnerte sich andererseits noch gut an die mahnenden Worte seines Vaters, dass er sich mit seiner Neugier eines Tages großen Ärger einhandeln würde.
Er blickte auf das Handy hinunter und sah jetzt erst, dass an der Rückseite ein kabelloser Ohrhörer angeklebt war.
Nun, was hatte er schon zu verlieren? Schlimmer konnte es ja kaum noch werden.
Er steckte sich den winzigen Knopf ins Ohr und drückte die Anruftaste.
»Hallo?«, meldete er sich.
»Gehen sie weiter, Brandon. Weg von der Lichtung, und weiter nach links.«
»Wer spricht da? Daly? Warum machen Sie das mit mir? Ich …«
»Halten Sie den Mund! Da sind zwölf Männer mit Hunden und Pistolen zum Wald unterwegs. Sie wollen Sie nicht einfangen. Sie wollen Sie töten. Haben Sie den Ohrhörer mit dem Klebestreifen befestigt?«
Die Stimme klang intelligent und entschlossen – es konnte also unmöglich Daly oder einer seiner Kumpels sein. Brandon öffnete den Mund, um dem Kerl seine Meinung zu sagen, als er feststellte, dass er nichts zu sagen wusste. Stattdessen griff er an den Ohrhörer und bestätigte, dass er befestigt war.
»Dann machen Sie endlich, dass Sie von hier wegkommen«, forderte ihn die Stimme auf.
Er blieb, wo er war. »Woher soll ich wissen, dass Sie nicht bloß deshalb wollen, dass ich weitergehe, damit es so aussieht, als würde ich fliehen?«
»Ach, und was glauben Sie, wie es jetzt aussieht? Hören Sie mir mal gut zu, Brandon. Sie sind ein cleverer Bursche, das wissen wir beide. Aber im Moment sind Sie erschöpft, Sie frieren und sind völlig durcheinander. Also, Sie können jetzt tun, was ich Ihnen sage, damit ich Sie hier rausholen kann, oder Sie stehen weiter sinnlos herum und stellen dumme Fragen, bis irgendjemand Sie erschießt.«
Brandon zögerte. »Ich kann hier im Wald keine zwei Schritte weit sehen, und die Kerle hinter mir haben Taschenlampen …«
»Hören Sie endlich auf zu jammern und nehmen Sie die Beine in die Hand, verdammt noch mal!«
Die Wahrheit war, dass der beste Plan, der ihm bisher eingefallen war, dazu führen würde, dass er die nächsten fünfundzwanzig Jahre hinter Gittern verbringen würde. Es war ihm im Gefängnis zwar nicht so schlecht gegangen wie manch anderem, aber er hatte trotzdem nicht unbedingt vor, dort drinnen alt zu werden. Da war es vielleicht noch besser, wenn sie ihn erschossen.
Im nächsten Augenblick war er unterwegs. Die Zweige schlugen ihm ins Gesicht, und er rutschte steile Abhänge hinunter, immer der mysteriösen Stimme in seinem Ohr folgend.
»Halten Sie sich ein Stückchen weiter links – ungefähr auf elf Uhr.«
Brandon knallte mit dem Schienbein gegen einen scharfkantigen Felsen und blieb stehen. Er krümmte sich und würgte, doch aus seinem Magen wollte nichts mehr hochkommen.
»Warum bleiben Sie stehen? Sie sollen laufen!«
»Ich bin stehen geblieben, weil ich erschöpft und durch und durch nass bin. Außerdem friere ich mir hier den Arsch ab, und dabei wartet ja wahrscheinlich doch nur irgendein Hinterhalt auf mich …« Er glaubte, hinter sich wütendes Hundegebell zu hören, und wirbelte herum, um in der Dunkelheit irgendetwas zu erkennen.
»Na schön«, sagte die Stimme in gleichgültigem Ton, »dann viel Glück.«
»Warten Sie!«, rief Brandon. »Ich gehe ja weiter, okay?«
Er setzte sich wieder in Bewegung und hielt sich etwas weiter links.
»Okay, gut so, Brandon. Nicht langsamer werden. Sie müssen nur noch eine Minute durchhalten.«
»Und was ist dann?«
Die Frage blieb unbeantwortet. »Sehen Sie das Licht direkt vor Ihnen?«
»Nein.«
»Gehen Sie weiter.«
Er folgte der Anweisung und stolperte vorwärts, um irgendetwas Ungewöhnliches vor sich zu erspähen. Nach etwa einer halben Minute sah er tatsächlich ein schwaches Leuchten.
»Ich glaube, ich sehe etwas. Es ist grünlich …«
»Gehen Sie darauf zu! Schnell!«
»Okay, ich …«
Die Verbindung brach ab.
Brandon blieb stehen. »Hallo? Hallo?«
Er hatte dem Kerl am Telefon zwar nicht getraut, aber es war wenigstens eine menschliche Stimme gewesen. Jetzt war er nicht nur völlig erschöpft, halb erfroren und auf der Flucht – er war auch noch allein. Seine Zähne begannen zu klappern, als er das Handy hervorholte und sah, dass die Verbindung tatsächlich beendet war.
»Scheiße!«
Er blickte sich um, konnte aber in der Dunkelheit nichts erkennen. Sie waren bestimmt nicht mehr weit hinter ihm. Der Wald war so dicht, dass er ihre Lichter wahrscheinlich erst sehen würde, wenn sie direkt hinter ihm standen.
Er wandte sich wieder dem grünlichen Leuchten zu und lief los, bis er mit wild pochendem Herzen eine kleine Lichtung erreichte. Fast hätte er erwartet, Daly mit einer Vierundvierziger Magnum vor sich zu sehen, von einem Ohr zum anderen grinsend.
Doch so war es nicht.
Das Licht kam von einem Leuchtstab, der an einem Baum hing. Doch das war nicht alles. Daneben baumelte ein dicker Seesack. Brandon nahm ihn herunter und durchsuchte ihn rasch. Drinnen fand er ein Paar Schuhe, Unterwäsche, ein Handtuch und einen leichten, wasserundurchlässigen schwarzen Overall.
Er trat an den Stamm des Baumes, um einigermaßen vom Regen geschützt zu sein, und zog sich aus. Er trocknete sich, so gut es ging, ab und schlüpfte rasch in die neuen Kleider, die, wie er feststellte, perfekt passten. Einen Moment lang genoss er das Gefühl der Wärme, die sich in dem Anzug ausbreitete.
Der Seesack enthielt außerdem einen kleinen Rucksack mit verschiedenen nützlichen Dingen: einige Energieriegel, ein Trinkgefäß mit einem Schlauch, der es ihm ermöglichte, jederzeit unterwegs zu trinken, und sogar eine Nachtsichtbrille, wie er sie zum Glück schon einmal bei einem Job vor mehreren Jahren verwendet hatte.
Er schnallte sich den Rucksack um und stand auf. Jetzt erst bemerkte er neben dem Leuchtstab ein Polaroidfoto, auf dem die Ausrüstung abgebildet war, die er sich soeben angeeignet hatte – mit einer kleinen Abweichung: das Foto zeigte auch ein gefährlich wirkendes Jagdgewehr.
Er schaltete die Nachtsichtbrille ein und blickte sich um, doch er konnte nirgends ein Gewehr finden. Die Männer aus dem Gefängnis würden ihm hierher folgen und von dem Leuchtstab zu dem Foto am Baum gelockt werden. Nichts verdarb einem schlecht bezahlten Gefängniswärter die Lust an einer Verfolgung so gründlich wie die Vorstellung, dass der Kerl, den er verfolgte, ihn aus hundert Metern Entfernung aufs Korn nahm. Da spielte es überhaupt keine Rolle, dass das Gewehr gar nicht existierte – im Gegenteil, wenn er tatsächlich gefeuert hätte, wäre die Sache für ihn vorbei gewesen.
Das Handy begann erneut zu vibrieren, und er hob es vom Boden auf.
»Sind Sie so weit?«
Einige Sekunden verstrichen, ehe Brandon antwortete. »Ja.«
VIER
»Du wolltest mich sprechen, Richard?«
Catherine Juarez stand mitten im Büro, die Hände hinter dem Rücken verschränkt, und tippte mit einem Fuß auf den Teppich. Als sie noch ein Kind war, hatte er ihr mehr Aufmerksamkeit geschenkt – er hatte verfolgt, wie sie aufwuchs und sich entwickelte, und er hatte mitbekommen, wie sie all das durchmachte, was man heutzutage »Phasen« nannte. Doch jetzt, wo sie eine erwachsene Frau war, stellte er fest, dass er sie kaum noch richtig ansah.
Sie runzelte die Stirn, und das Tippen ihres Fußes auf dem Teppich wurde ein bisschen ungeduldiger, während Richard Scanlon sich die feineren Veränderungen bewusst machte, die sie in den vergangenen Jahren durchgemacht hatte.
Ihr dunkles, fast schwarzes Haar fiel auf ihre Schultern herab, wodurch sie sich von den anderen Frauen in der Firma mit ihren seriösen Business-Haarschnitten unterschied. Die braune Hautfarbe deutete einerseits auf den genetischen Einfluss ihres Vaters, andererseits auf ihren Lebensstil hin, der sich auch in ihrem athletischen Körperbau ausdrückte. Vielleicht war es auch nur so, dass ihm diese jungen Leute in den Dreißigern immer fitter vorkamen, je älter er selbst wurde.
Er hatte sie aus verschiedenen Gründen in seine Firma geholt; sie besaß eine ungewöhnliche Kombination aus hoher Intelligenz und menschlichen Qualitäten, sie war kreativ und couragiert, und er wusste aufgrund ihrer gemeinsamen Vergangenheit, dass er sich auf sie verlassen konnte. Interessanterweise hatte ihr Aussehen dabei überhaupt keine Rolle gespielt. Umso bemerkenswerter erschien es ihm, dass ihr Äußeres sich nun als überaus nützlich erwies.
»Richard? Ist alles in Ordnung? Wofür brauchst du mich?«
Scanlon lehnte sich in seinem Stuhl zurück und betrachtete sie weiter aufmerksam. »Was machst du nach der Arbeit?«, fragte er schließlich.
»Hast du ein neues Projekt? Ich kann länger bleiben, wenn du …«
Er schüttelte den Kopf. »Nein, ich meine, ganz allgemein. Gibt es jemanden, mit dem du ausgehst und so?«
»Wie bitte?«
»Ein so schönes Mädchen wie du hat doch sicher eine Menge Verehrer.«
»›Verehrer‹ ist ein etwas altmodisches Wort, Richard. Geht’s dir wirklich gut?«
»Was ist mit diesem Musiker? Wie hieß er doch gleich? Adrien? Allen?«
Sie sah ihn ziemlich verwirrt, aber auch ein wenig misstrauisch an. »Adam. Das war im College, Richard. Vor zehn Jahren. Es wundert mich, dass du dich noch an ihn erinnerst.«
Catherine war fast so etwas wie eine Tochter für ihn; er hatte zwar nie versucht, sich in ihr Leben einzumischen, aber er hatte doch mehr Anteil daran genommen, als sie vermutet hätte. Es hatte immer junge Männer in ihrem Leben gegeben, aber sie schienen nie lange zu bleiben. Er hatte sich manchmal gefragt, warum das so war.
»Was ist mit dem Profiskifahrer? Den hattest du doch gern, oder?«
Ihr Gesichtsausdruck blieb so unverändert, dass Absicht dahinterstecken musste. Der Junge hatte ihr etwas bedeutet – das war selbst ihm nicht verborgen geblieben.
»Ich nehme an, du willst auf irgendwas hinaus«, sagte sie schließlich, ohne auf seine Frage einzugehen. »Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich überhaupt wissen will, worum es dir geht.«
Er zeigte auf die Tür, und sie ging hinüber und schloss sie.