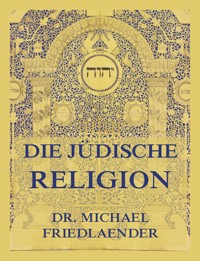
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
"Die jüdische Religion" von Dr. Michael Friedländer ist eine umfassende, lange Zeit nicht mehr erhältliche Untersuchung des Judentums, die ursprünglich im späten 19. Jahrhundert verfasst wurde. Dieses wissenschaftliche Werk zielt darauf ab, die Kernüberzeugungen und -praktiken des jüdischen Glaubens zu erläutern, wobei es sich auf biblische Texte und rabbinische Tradition stützt. Der Autor versucht, die jüdischen religiösen Prinzipien und die Grundlagen, auf denen diese Überzeugungen beruhen, darzustellen und eine Interpretation zu bieten, die für alle zugänglich ist, die sich Wissen über ihren Glauben aneignen möchten. Zu Beginn des Textes reflektiert der Autor über die Bedeutung des Glaubens im Judentum und führt das Konzept ein, dass Religion sowohl den Glauben an eine höhere Macht als auch die Pflichten, die sich aus diesem Glauben ergeben, umfasst. Friedländer betont die Notwendigkeit, den eigenen Glauben sowohl durch die Brille der Vernunft als auch der Tradition zu verstehen, und hebt hervor, wie wichtig es ist, die göttlichen Lehren auf eine Weise zu interpretieren, die sowohl intellektuelle Neugier als auch spirituelles Engagement anspricht. Er skizziert, dass dieses Werk als Leitfaden für diejenigen dienen soll, die ihr Verständnis des Judentums sowohl in philosophischer als auch in praktischer Hinsicht vertiefen möchten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 575
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Die
jüdische Religion
DR. MICHAEL FRIEDLAENDER
Die jüdische Religion, Dr. Michael Friedlaender
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN: 9783988681324
Übersetzer: Josua Friedlaender
www.jazzybee-verlag.de
INHALT:
Geleitwort des Herausgebers. 1
Aus der Vorrede des Verfassers. 6
Einleitung. 7
I. UNSER GLAUBE.. 10
Einleitung. 10
Die dreizehn Grundsätze unseres Glaubens19
1. Existenz Gottes מציאותהבורא. 22
2. Offenbarung תורהמןהשמים. 37
Die Bücher der Bibel, תנ "ך. 44
1. תורה Gesetz.45
2. Die Propheten. 48
3. Hesekiel (יחזקאל).57
4. Die zwölf kleinen Propheten, תר, עשר.60
3. Die Hagiographen (כתובים).66
Hiob, איוב. 79
Daniel, דניאל.84
Esra, עזרא.89
Nehemia, נחמיה.90
Die Chroniken, דבריהימים.91
Anmerkungen. 116
II. UNSERE PFLICHTEN... 165
Einleitung. 165
I. Die Zehn Gebote. עשרתהדברות. 174
II. Allgemeine sittliche Grundsätze. 191
III. ÄUSSERE ERINNERUNGSZEICHEN AN GOTTES GEGENWART.226
IV. SABBAT UND FESTTAGE.233
DER JÜDISCHE KALENDER.246
DIE FESTTAGE.251
HISTORISCHE FESTE UND FASTTAGE.. 269
V. GOTTESDIENST, עבודה. 273
VI. SPEISEGESETZE.300
VII. JÜDISCHES LEBEN.308
Geleitwort des Herausgebers
Was mein Onkel, Michael Friedlaender, זצ "לmit seinem Buche "The Jewish Religion" beabsichtigte, hat er in seiner Vorrede (Seite XIII) mit der ihm eigenen Bescheidenheit, dem Grundzuge seines Wesens, zum Ausdruck gebracht. Aus dem Gefühl inniger Dankbarkeit gegenüber diesem Buche und seinem Verfasser, sowie gegenüber denen, die seine Geschwister waren auch in ihrer Gesinnung und deren Lebensinhalt der Inhalt dieses Buches war, habe ich die Arbeit der Übersetzung übernommen. Die eine ruhige und sachliche Darstellung des traditionellen Judentums suchen, werden sie hier finden.
Das Buch erschien 1890 in erster, 1900 in zweiter Auflage. Eine deutsche Ausgabe wurde bald von meinem Freunde und Vetter Moses Friedlaender und mir in Angriff genommen. Leider hat sich die Herausgabe verzögert, da sich kein Verleger fand, trotzdem sein Erscheinen in den Kreisen von Rabbinern, Lehrern und auch Laien wiederholt gewünscht wurde, da es an einem Buche dieser Art fehlte. Der Inhalt des Buches ist unverändert geblieben; es ist nichts hinzugefügt und nichts fortgelassen. Nur in den bibliographischen Nachweisen ist einiges ergänzt oder verbessert worden. Der Mitarbeit meines teuren Freundes Moses ע "ה, (er fiel für sein Vaterland am 21. Januar 1917) gedenke ich bei dieser Gelegenheit in unauslöschlichem Schmerze. Die Seiten 17—55 lagen mir in seiner Handschrift vor und konnten so gut wie unverändert übernommen werden. Seien sie seinem Andenken dauernd geweiht!
Einige Angaben über das Leben und Wirken des Verfassers dürften hier von Interesse sein.
Michael Friedlaender ist in Jutroschin (Posen) am 27. April 1853 geboren. Er besuchte die katholische Elementarschule seiner Vaterstadt und lernte Hebräisch bei seinem Vater, Josua Falk Friedlaender, der ein hervorragender Talmudist, ein guter Kenner der hebräischen Grammatik war und auch gut hebräisch schrieb. Seine Mutter Lea war eine Tochter von Raphael Benzian, Rabbiner in Margonin, der hochbetagt in Berlin gestorben ist und auf dem alten Friedhof in der Schönhauser Allee seine Ruhestätte fand. Michael konnte schon frühzeitig ein Lehrer anderer Kinder sein. Im Jahre 1850 ging er nach Berlin, wo er am Gymnasium "zum grauen Kloster" die Reifeprüfung ablegte. Auch lernte er bei Jacob Joseph Ottinger und Elchanan Rosenstein. Von 1856 ab studierte er orientalische und klassische Sprachen, sowie Mathematik an der Berliner Universität und beschloss seine Studien mit dem Examen pro facultate docendi in den alten Sprachen und in der Mathematik. Er promovierte in Halle am 2. Juni 1862 mit einer Dissertation, "De veteribus Persarum regibus", der folgende, recht bezeichnende Thesen angefügt waren: I. Das Wort סלהkann kein musikalischer Terminus technicus sein. II. Diejenigen irren sehr, die behaupten, die Geschichte der ersten Menschen sei nur für Kinder geschrieben. III. Mit Unrecht behaupten einige Gelehrte, das Kap. 13 und 14 des Buches Jesaja habe vor dem Exil nicht geschrieben werden können. IV. Die Ansicht ist falsch, dass in den Heiligen Schriften der Hebräer sich nichts von der Unsterblichkeit der Seele finde. Er hat wohl später seine Ansicht nicht geändert. Von 1861 bis 1864 leitete er die Talmud-UnterrichtsAnstalt des Talmudvereins in Berlin, wo er zusammen mit Dr. Apolant, Roth, Dr. Unger, Weinbaum und Zomber Bibel, Mischna und Talmud lehrte. Die Schule hatte fünf Klassen, von denen die erste und zweite noch geteilt waren. Auch eine "Unterrichtsanstalt für israelitische Knaben" eröffnete er im Oktober 1863 in Berlin, Adlerstr. 7, deren Aufgabe sein sollte, "für eine zeitgemäße Bildung der ihr anvertrauten Jugend und für eine den Anforderungen des religiösen Lebens genügende Kenntnis der hebräischen Sprache und Literatur Sorge zu tragen". Die Anstalt sollte aus einer Unter, Mittel und Oberstufe bestehen und schließlich für die Obertertia einer höheren Schule vorbereiten. Den religiösen Sinn zu wecken und religiöses Interesse zu finden, war vor allem sein Bemühen. Den Jahresberichten der Talmud-Unterrichts-Anstalt gab er stets ernste Worte der Mahnung mit auf den Weg. Mit unentwegtem Idealismus wollte er einen Bau errichten, der sicherlich gelungen wäre, wenn er genügende finanzielle Unterstützung gefunden hätte. Einem Rufe nach Halberstadt oder Fürth glaubte er nicht folgen zu sollen. Als aber im Anfang des Jahres 1865 das junge Jews’ College in London einen Leiter suchte, war seine Lebensaufgabe endlich gefunden. Am 1. Mai 1865 trat er sein Amt in Finsbury Square in London an und führte bald darauf seine Braut Bertha geb. Benzian in sein Heim.
Zweiundvierzig Jahre lang hat er dort gewirkt und viele Generationen von jüdischen "Ministers", Dienern im Hause Gottes, herangebildet, die alle dankerfüllt in ihm ihren Meister und Lehrer sahen. Sie sind überall zu finden im britischen Reiche und in den Kolonien. Gerne schließen sich ihnen alle die an, die aus seiner deutschen Heimat Studien halber nach London kamen und in seinem gastlichen Hause Belehrung und Anregung fanden, zumal als von 1880 an das College unweit des British Museums sein Heim aufschlug, zuerst in dem früher von Dickens bewohnten Hause Tavistock House Tavistock Square, von 1900 ab in Queen’s Square House. Wer ein Bild von seiner segensreichen Tätigkeit am College gewinnen will, lese den Jubiläumsband des Jews’ College aus dem Jahre 1906; er wird erkennen, welch stolzer Bau aus kleinen Anfängen durch das rastlose und ideale Schaffen dieses unermüdlich lehrenden und lernenden Mannes erstand, der neben seiner ausgedehnten unterrichtlichen Tätigkeit noch Musse und Kraft hatte, der Wissenschaft in reichem Maße zu dienen und für das Wohl der jüdischen Gemeinde im allgemeinen zu wirken. Das möge statt vieler Worte die folgende Liste seiner wissenschaftlichen Arbeiten dartun, wobei ich die zahlreichen gelegentlichen Vorträge (vgl. Jews’ College Jubilee Volume p. LXXff.) und die Artikel in der Jewish Encyclopaedia und im Dictionary of National Biography nicht besonders aufführe.
De veteribus regibus Persarum. Diss. Halle 1862.
Uber Talmud-Studium. Erster, zweiter und dritter Jahresbericht der Talmud-Unterrichtsanstalt. Berlin 1861, 1862, 1864.
Das Hohelied übersetzt und erklärt. Berlin 1867.
On the life of Ibn Ezra (Jewish Association for the Diffusion of Religious knowledge). London 1872.
Essays on the Writings of Abraham Ibn Ezra with a Hebrew Appendix. London 1877.
The Commentary of Ibn Ezra on Isaiah: ed. from MSS and translated, with Notes, Introductions, and Indexes 3 vol. London 1873 — 1877.
The Guide of the Perplexed of Maimonides translated from the original Text and annotated Vol I 1881; Vol II und III 1885;
כתבי הקדש The Jewish Family Bible. London 1884.
Spinoza, His life and Philosophy. London 1888.
The design and Contents of Ecclesiastes JQR 1889.
The Age and Authorship of Ecclesiastes. Ibid.
The Late Chief Rabbi Dr. N. M. Adler. JQR. July 1890.
The Jewish Religion. London 1891, 1902.
Notes in Reply to my Critic. JQR. 1892.
Text Book of Jewish Religion. London 1891 ff.
Life and Works of Saadia. JQR. Jan. 1893.
Die beiden Systeme der hebräischen Vokalund Akzentzeichen. Fränkels Monatsschrift 1894, p 311.
Isaia, a paper read before the Joung Zion Institute. Jewish World 8. 6. and 15. 6. 1894.
Ibn Esra in England (אגרת השבת). Transactions of the Jewish Historical Society of England 1894/5, auch JQR. 1895/6.
The Plot of the Song of Songs. JQR. 1894.
Deutsch in "Israelitische Monatsschrift", Wissensch. Beilage der Jüdischen Presse 1894.
The Hebrew Bible in Shorthand. JQR. 1895.
Some Fragments of the Hebrew Bible with Peculiar Abbreviations and Peculiar Signs for Vowels and Accents. (Proceedings of the Society of Biblical Archaeology, March 1896.)
A fragment of a Shorthand Hagadah. JQR. 1897.
Some Notes on the Prophecy of Malachi. (Jews’ College Jubilee
Volume, London 1906.)
An seinem 70. Geburtstage im Jahre 1903 hatte Michael Friedlaender die Freude, eine große Schar von Schülern und Freunden um sich versammelt zu sehen, die ihm ihre Dankbarkeit bezeugten. Einige Worte, die er damals sprach, charakterisieren am besten seines Wesens edlen Kern: "Wenn man den Baum des Lebens bis zu einer gewissen Höhe erklommen hat, so möchte man bei einer solchen Gelegenheit ein wenig anhalten und sich umschauen und die Strecke Weges betrachten, die noch vor uns liegt — wenigstens in unseren Hoffnungen und Wünschen. Was immer die Vorsehung für uns bereit hat, wollen wir dankbar annehmen und willig bei der Erfüllung unserer Pflichten verwenden. Manche denken, unsere Lebensaufgabe sei schwer und freudlos. Dem ist nicht so, wie ich aus langer Erfahrung erkannt. Trotz Mühen, Sorgen und schwerer Arbeit ,ist mein Los lieblich ausgefallen‘; ich teile mein Glück mit meiner Gattin, unserer Tochter, unserem gelehrten Schwiegersohn und einem munteren Kreise hoffnungsvoller Enkelkinder. So ermutigt mich die Vergangenheit, mit Vertrauen in die noch verhüllte Zukunft zu schauen. Unsere Lebensaufgabe wird uns im Ganzen verhältnismäßig leicht und angenehm gemacht. Er, der uns den Baum des Lebens erklimmen lässt, hat uns auch den Baum der Erkenntnis in unserer Nähe gepflanzt und wir können die köstlichsten Früchte für uns und unsere Mitmenschen pflücken. Vielleicht denkt da mancher, der Mensch wurde doch gewarnt, von der Frucht jenes Baumes zu nehmen; gewiss, unter besonderen Umständen: im Paradies, ohne Mühe, ohne Arbeit. So konnte der Mensch nur unreife, schädliche Früchte erhalten, die allzu leicht vom Baume fielen. Fern vom Paradiese, mit Sorgen und schwerer Arbeit, da der Mensch im Schweiße seines Angesichts sein Brot isst, da gibt es für den Menschen keine verbotene Frucht am Baume der Erkenntnis, ohne den der Baum des Lebens in der Tat nutzlos und unerwünscht wäre; den einen festhalten und von dem anderen nicht lassen, das ist die heilige Aufgabe des Menschen. Nach der Ansicht meiner Freunde habe ich immer diese Aufgabe nach besten Kräften zu erfüllen versucht. Es ist nicht der geeignete Augenblick, jetzt die Ansicht meiner Freunde zu kritisieren; das muss ich meinem eigenen Gewissen überlassen und dem, der ,das Herz des Menschen formt und alle seine Taten kennt‘. Alles, was ich sagen kann, ist, dass es stets mein Bestreben war denen zu nützen, die meiner Obhut anvertraut waren. Dass dieses mein Bemühen nicht vergebens gewesen ist, ist in reichem Maße der willigen Mitarbeit meiner Kollegen zu danken und — wenn ich ein altes Wort der Rabbinen umformen darf: ,vieles verdanke ich meinen Lehrern, mehr meinen Kollegen, und das meiste meinen Schülern‘ — dem Verhalten meiner Schüler und ihrem Vertrauen zu mir, ihrer Liebe und Achtung für ihren Lehrer, deren ich mich von Anfang an bis auf diesen Tag erfreute."
Drei Jahre später zog er sich vom Amte zurück und lebte einige Zeit in seiner alten Heimat. Als er Ende 1910 nach London zurückkehrte, ging er bald heim zu seinen Vätern זקן ושבע ימים; am 6. Dezember ist er verschieden. J. Elbogen schrieb von ihm damals: "Er war milde und duldsam gegen jedermann, er vertrat seinen konservativen Standpunkt fest und sicher, hat aber niemals die Meinungen anderer bekämpft oder gar Andersdenkende persönlich angegriffen. Er war ein Vorbild tiefster Frömmigkeit, lautersten Wandels. Seinen Schülern war er nicht nur ein Meister und Muster, sondern auch ein väterlicher Freund, Förderer und Berater." Auch denen, die nicht mehr den "theologischen Pfad wandelten", den er sie geführt. So möge über das Grab hinaus sein Wirken ein Segen sein!
Mit dem Gruße aber, mit dem der Verfasser schließt, freue ich mich, seiner betagten Lebensgefährtin, die noch schaffensfreudig an der Stätte seiner Arbeit tätig ist, das Buch in unserer Muttersprache überreichen zu können: ברה יאיר ihr Licht leuchte noch lange!
Eine angenehme Pflicht erfülle ich, meinen Brüdern dafür zu danken, dass sie den Druck dieses Buches ermöglichten. Bei der Korrektur haben meine Freunde Direktor Dr. Oscar Götz und Rabbiner Dr. Max Weyl bereitwilligst geholfen; auch ihnen sei an dieser Stelle herzlichst gedankt.
Berlin, 50. November 1921
Josua Friedlaender
Aus der Vorrede des Verfassers
Indem der Verfasser dieses Buch der Öffentlichkeit übergibt, ist er sich vollauf bewusst, keine großen Ansprüche auf Originalität machen zu dürfen. Er will nur die von seinen Eltern ז "לihm ins Herz gesenkten religiösen Grundsätze, die von den großen Lehrern Israels — den Propheten, den Soferim und ihren Nachfolgern — verkündet worden sind, hier wiedergeben, damit der Segen, den er selbst aus diesen Grundsätzen gewonnen hat, auch seinen Glaubensgenossen zuteilwerde. Die ursprünglichen Quellen religiöser Erkenntnis, die heiligen Schriften und die nachbiblische Literatur, sind natürlich allen zugänglich, und ein jeder kann zu Füßen unserer großen Lehrer sitzen und ihrer Belehrung lauschen. Aber viele bedürfen der Hilfe und der Erläuterung. Das vorliegende Buch soll diese Hilfe und diese Erläuterung bieten. Der Verfasser wendet sich deshalb an seine Glaubensgenossen und besonders an seine Schüler mit den Worten eines alten Lehrers der Mischna (Abot 5,22): "Lies es immer und immer wieder"; und wenn er auch nicht hinzufügen kann "denn alles ist darin", so hofft er, dass das, was darin ist, denen sich nützlich erweisen wird, welche religiöse Erkenntnis suchen, und dass es vielen ein Sporn sein wird, "zu lernen und zu lehren, zu wahren und in Liebe zu erfüllen alle Worte der Belehrung des göttlichen Gesetzes".
Einleitung
Sehr bevorzugt ist der Mensch unter den Geschöpfen: er ist im Ebenbilde Gottes erschaffen. Der Vorzug wird noch erhöht durch die Tatsache, dass er von dieser seiner Auszeichnung Kenntnis erhält " (Abot 5, 18). Der Mensch besitzt das Bewusstsein oder die Empfindung einer gewissen Beziehung seiner selbst zu einem höheren Wesen, von dessen Willen seine eigene Existenz abhängt. Dieses Bewusstsein ist die Grundlage der Religion, aber nicht die Religion selbst. Erst der Einfluss, den diese Empfindung auf die Handlungen des Menschen und seine Lebensführung ausübt, bildet das Wesen der Religion. Sobald der Mensch zu empfinden beginnt, dass er für seine Handlungen einem höheren Wesen verantwortlich ist, und seine Handlungen mit dieser Empfindung in Einklang bringt, kann man ihn religiös nennen. Man muss deshalb zwei Elemente in der Religion unterscheiden: den Begriff der Abhängigkeit des Menschen von einem höheren Wesen und seine Verantwortlichkeit diesem gegenüber sowie den Einfluss dieses Begriffs auf seine Handlungen: religiöse Überzeugung und religiöses Handeln, oder Glaube und Pflicht. Religiöser Glaube in der einfachsten und allgemeinsten Form ist wohl fast der ganzen Menschheit gemein, und trotz der großen Verschiedenheit der Glaubensbekenntnisse, wie sie durch die mannigfaltigsten äußeren Umstände und Erfahrungen entstanden sind, kann diese einfache Idee leicht als das Grundprinzip aller Religionen erkannt werden. Ebenso verhält es sich mit der religiösen Praxis. Es gibt gewisse Grundprinzipien der Pflicht, die von den verschiedensten religiösen Sekten anerkannt und angenommen werden; sie bilden sozusagen den gemeinsamen Stamm, von dem eine große Anzahl Zweige nach allen Richtungen hin ausgehen. Diese Zweige gehen umso weiter auseinander, je mehr sie sich ausbreiten und je zahlreicher sie werden.
Das Judentum ist eine unter diesen verschiedenen Religionen. Sie ist die Quelle der meisten Religionen der zivilisierten Welt und hat die Bestimmung, in ihren einfachsten Prinzipien die Weltreligion zu werden.
Was ist Judentum? oder was lehrt das Judentum seine Anhänger glauben und was schreibt es ihnen vor zu tun? Die Antworten auf diese beiden Fragen bilden den Hauptinhalt eines jeden Buches über unsere heilige Religion. Die Antwort auf die erste Frage muss unsere Lehre über Gott, seine Attribute und seine Beziehungen zur irdischen Welt und besonders zum Menschen, die Aufgabe des Menschen, seine Hoffnungen und seine Befürchtungen enthalten; die Antwort aus die zweite Frage unsere Pflichten gegen Gott, gegen unsere Mitmenschen und gegen uns selbst. Beide Antworten müssen auf dem beruhen, was uns in der Heiligen Schrift und besonders in der Tora gelehrt wird. Philosophische Betrachtungen sind besonders bei der ersten Frage nicht zu vermeiden, doch muss das Resultat durch die Lehre der Tora berichtigt werden. In Übereinstimmung mit dem Grundsatz, "das Verborgene gehört dem Ewigen, unserem Gotte; aber das, was uns offenbart ist, gehört uns und unseren Kindern für immer, damit wir alle Worte des Gesetzes erfüllen", werden verwickelte metaphysische Erörterungen über Wesen und Attribute des göttlichen Wesens im vorliegenden Werk vermieden werden, wie auch jeglicher Versuch, philosophisch oder mathematisch Wahrheiten zu beweisen, die uns auf übernatürlichem Wege geoffenbart wurden. Aber die einfachen Wahrheiten, wie sie in der Heiligen Schrift gelehrt werden und von unseren Weisen erklärt worden sind, werden dargelegt, die verschiedenen Ansichten über sie werden geprüft, und es wird dargetan werden, dass diese Wahrheiten dem gesunden Menschenverstand oder den Resultaten der wissenschaftlichen Forschung nicht widersprechen.
Die zweite Frage indessen: Was lehrt uns das Judentum zu tun? bezieht sich auf "das, was offenbart ist", und muss ausführlicher behandelt werden. Es wird möglichst sorgfältig darauf geachtet werden, dass nichts ausgelassen wird, was zum richtigen Verständnis und zur gebührenden Würdigung unserer religiösen Pflichten erforderlich ist.
Die Religion schließt also zwei Elemente in sich: Glauben und Tun. Im religiösen Leben sowohl wie in der Religionslehre sind beide Elemente gleich wesentlich; Glauben ohne die Ausführung der religiösen Pflichten genügt ebenso wenig wie die letztere ohne den Glauben. Wir sind nun allerdings gewohnt, gewisse Dogmen als grundlegend und gewisse Handlungen als wesentlich anzusehen, und sind deshalb geneigt, Glaubenssätze, die in unseren Augen nicht grundlegend sind, zurückzuweisen, und religiöse Handlungen, die uns weniger wesentlich erscheinen, zu unterlassen. Daher die so oft aufgeworfene Frage nach dem Minimum des Glaubens und dem Minimum der Erfüllung des Gesetzes, das das Judentum verlangt. Aber in Wirklichkeit kann es kein Kompromiss in Religionssachen geben, sei es in Sachen des Glaubens oder der Ausführung religiöser Pflichten. Sind wir einmal überzeugt von einer gewissen Anzahl von Wahrheiten, so ist es uns unmöglich, einige von ihnen zu ignorieren, ohne gegen uns selbst falsch zu sein; sind wir überzeugt von dem verpflichtenden Charakter gewisser religiöser Gebote und Verbote, so würde es widersinnig sein, zugleich einen Teil derselben für überflüssig zu erklären. Das Judentum, also heißt das Festhalten an den in der Heiligen Lehre verkündeten Wahrheiten und das gewissenhafte Beobachten ihrer Vorschriften.
Die hauptsächlichen hebräischen Ausdrücke für den modernen Ausdruck "Religion" אמונה und תורה " bestätigen diese Ansicht. In der Bibel bezeichnet תורה "Belehrung" und wird auf die Belehrung sowohl über religiöse Wahrheiten wie über religiöse Vorschriften angewandt. Dasselbe gilt von dem zweiten Ausdrucke אמונה, der "Festigkeit", "Beharrlichkeit" oder "Ausdauer" bezeichnet und von der Beständigkeit im Glauben gebraucht wird wie auch von der Gewissenhaftigkeit in der Ausführung der göttlichen Vorschriften!
UNSER GLAUBE
Einleitung
Der Glaube ist das unbedingte und absolute Vertrauen auf die Wahrheit der Mitteilung, die uns ward, und auf die Glaubwürdigkeit dessen, von dem sie uns ward. Das Kind hat das Vertrauen zu seinen Eltern, dass ihre Wünsche und Befehle zu seinem Besten sind; der Schüler zu seinen Lehrern, dass sie ihm richtige Kenntnisse mitteilen; wir haben Vertrauen zu unseren Freunden, dass sie uns nicht betrügen werden; wir haben Vertrauen zu den Männern der Wissenschaft, dass die Ergebnisse ihrer Forschungen als wohl begründete angenommen werden können. In allen diesen Fällen ist das Vertrauen nur unvollkommen, relativ und nur an eine gewisse Zeit gebunden. Die Zeit, die weitere Forschung, ausgedehnte Beobachtung und Erkenntnis können entweder den Inhalt unseres Vertrauens bestätigen oder uns eines Besseren belehren. Doch mit dem religiösen Glauben verhält es sich anders. Dieser hält sich in den Grenzen seines Gebietes und greift nicht über in das der Sinne und der Vernunft. Alles, was mit Hilfe wissenschaftlicher Forschung und eingehender Untersuchung erkannt werden kann, braucht nicht auf Grund des Glaubens angenommen zu werden. Die Religion — ich habe natürlich unsere eigene, die jüdische, im Auge — verbietet nicht nur solche Untersuchungen nicht, sondern regt sogar dazu an. So lesen wir im Buche der Sprüche: "Ein Tor glaubt jedes Wort, aber der Kluge achtet auf seinen Schritt" (14, 15) Dazu hat uns Gott geistige Fähigkeiten gegeben, dass wir sie auf die Erforschung der Wahrheit anwenden. Zugleich jedoch setzte er unseren Fähigkeiten Grenzen; es gibt Dinge, die über diese Grenzen hinausgehen, sie sind nistarot, "verborgene Dinge", Dinge, die für unsere Sinne nicht fassbar sind, deren Dasein aber durch Gottes Gnade uns kund wurde auf Wegen, wie er sie in seiner unendlichen Weisheit vorgesehen hatte. Wir forschen und untersuchen, prüfen und beweisen innerhalb der Sphäre unserer Sinne; aber alles, was jenseits ihres Beweises liegt, gehört zu den nistarot, nur durch den Allmächtigen selbst kann es zu unserer Kenntnis gelangen oder indirekt durch diejenigen, denen es von ihm mitgeteilt worden ist. Unser Glaube betreffs dieser nistarot mag durch philosophische oder dialektische Argumente unterstützt oder gefestigt werden, aber niemals kann er durch mathematische oder logische Darlegung bewiesen werden.
Die Quellen, aus denen wir die Kenntnis dieser nistarot herleiten, sind die Offenbarung und die Tradition. Dinge, die sonst den Menschen nicht bekannt sind, offenbart Gott einzelnen Personen oder Generationen nach seiner Weisheit und, von den so bevorzugten ausgehend, verbreitet sich die Kenntnis unter den Menschen auf dem Wege der Tradition. Zu diesen beiden Quellen kommt noch eine dritte, die in uns selbst liegt: Gott pflanzte in unsere Seele gewisse Ideen, die uns allen gemeinsam sind als die wesentlichen Elemente unseres Innenlebens, und diese Ideen bilden bis zu einem gewissen Grade die Grundlage unseres Glaubens. Derart ist z. B. die Idee eines allmächtigen Wesens, Gott, der die Quelle und der Ursprung alles Seienden ist.
In Wirklichkeit besteht kein Konflikt zwischen Glauben und Vernunft. Manchmal scheint es jedoch, als ob ein solcher bestehe; und wir beginnen dann natürlich zu zweifeln. In solchen Fällen kann die Wahrheit unseres Glaubens in Zweifel gezogen werden, aber die Richtigkeit unseres vernunftmäßigen Denkens unterliegt nicht weniger dem Zweifel. Haben wir irrtümlich Glaubenssätze in unseren Glauben aufgenommen, die tatsächlich nicht dazu gehören, so lassen wir sie beiseite, ohne dass auch nur im Geringsten unser Glaube darunter leidet. Andererseits ist unser Verstand keineswegs vollkommen; wir entdecken häufig Fehler in unseren Beweisen und Schlüssen und verwerfen Ansichten, die bisher als durchaus gerechtfertigte angesehen wurden.
Durch eine geduldige und eingehende Untersuchung unserer Zweifel, ohne Überschätzung unserer Denkfähigkeiten, werden wir imstande sein, den scheinbaren Widerstreit zwischen Vernunft und Glauben in befriedigender Weise zu lösen. Die Prüfung unserer Zweifel wird zeigen, dass keine von den Wahrheiten, die der Menschheit vom Allmächtigen offenbart sind, der Vernunft zuwider ist.
So werden wir in den Stand gesetzt, aus unserem Glauben alle die Elemente auszuscheiden, die ihm in Wirklichkeit fremd sind; wir werden zwischen Glauben und Aberglauben unterscheiden können. Letzterer zeigt sich in irrtümlichen Begriffen und Vorstellungen, die erprobt werden können und den gewöhnlichen Mitteln der Untersuchung unterworfen sind. Aberglauben wird von der wahren Religion nicht geduldet; strenges Festhalten an den Lehren unserer heiligen Religion ist der beste Schild gegen abergläubische Vorstellungen.
Die Bibel legt auf den unbedingten Glauben an Gott und an sein Wort großen Wert, wie man aus folgenden Stellen entnehmen mag:
"Und er (Abraham) glaubte an den Ewigen, und er rechnete es ihm als Frömmigkeit an " (Gen. 15,6). Das hebräische Wort für "Frömmigkeit " ist im Original צדקה, ein Wort, das in der Bibel den Inbegriff alles dessen bezeichnet, was im menschlichen Leben gut und edel ist.
Als die Israeliten das Rote Meer durchschritten hatten, heißt es von ihnen: "Und Israel sah das große Werk, welches der Ewige an den Ägyptern getan, und das Volk fürchtete den Ewigen, und sie glaubten an den Ewigen und an Moses, seinen Diener" (Exodus 14,31).
Als Moses und Aron beim Haderwasser gesündigt hatten, indem sie den Felsen schlugen, statt zu ihm zu sprechen, da wurden sie getadelt wegen des Mangels an " אמונהGlauben " mit folgenden Worten: "Weil Ihr nicht an mich glaubtet" (לאהאמנתםבי), mich vor den Augen der Kinder Israel zu heiligen, deshalb sollt ihr diese Gemeinde nicht in das Land bringen, welches ich ihnen gegeben habe " (Numeri 20,12).
Als Moses in seinem Liede האזינו die Israeliten ob ihrer bösen Handlungen tadelte, nannte er sie "Kinder, in denen kein Glaube ist" אמון (Deuter. 32, 20).
König Josaphat redete das Heer vor der Schlacht mit den Worten an: "Glaubet an den Ewigen, und ihr werdet sicher sein; habet Vertrauen auf seine Propheten, und ihr werdet Glück haben. " Chron. 20, 20).
In gleichem Sinne sagt Jesaja zum König Ahas: "Wenn ihr nicht glaubet, so werdet ihr fürwahr nicht sicher sein " (Jesaja 7, 9).
Auch Jeremia ruft aus, da er von Israels Ungehorsam gegen Gottes Wort spricht: "Der Glaube האמונה ist dahin und ist aus ihrem Munde gebannt" (Jer. 7,28).
Der Prophet Habakuk bittet Gott um eine Erklärung, warum Übeltäter Glück haben, und erhält die göttliche Antwort: "Der Rechtschaffene wird durch seinen Glauben leben " וצדיקבאמונתויחיה (Hab. 2,4); und wenn Hosea die künftige Erlösung Israels im voraus verkündet, sagte er ihnen im Namen Gottes, "Und ich gelobe dich mir an durch den Glauben" וארשתיךליבאמונה (Hos. 2,22).
Unsere Lehrer, die Weisen und Rabbiner, die den Propheten folgten, haben mit gleichem Nachdrucke den religiösen Glauben empfohlen. Folgendes sind einige ihrer Aussprüche über den Glauben.
"Groß ist das Verdienst des Glaubens. Durch ihren Glauben an den Schöpfer des Weltalls wurden die Israeliten voll des Geistes der Heiligkeit und konnten dem Ewigen Loblieder singen. " "Der Glaube an Gott war die Quelle aller weltlichen und ewigen Segnungen, deren Abraham teilhaftig wurde; er gab ihm die Freude an dieser Welt und an der zukünftigen. " "Wenn der Psalmist sagt: ,Dieses Tor führt zum Ewigen; Fromme treten hier ein‘, so bezeichnet er mit dem Ausdruck ‘Fromme, (צדיקים) diejenigen, welche an Gott glauben" (Jalkut zu Exod. 14,31).
Wenn nun tatsächlich auch die Tora und die Propheten mit dem größten Nachdrucke den Glauben als ein sehr wesentliches Element der jüdischen Religion darstellen, so scheinen doch die jüdischen Theologen und Philosophen in ihren Schriften dem Glauben nicht dieselbe Wichtigkeit beizulegen; denn einige von ihnen haben es versucht, Vernunftbeweise und logische Argumente für den einfachen Glauben einzusetzen und das auf der Grundlage des Glaubens aufgebaute Religionsgebäude von neuem auf wissenschaftliche Forschung zu gründen. Folgendes sind die Äußerungen der hauptsächlichen jüdischen Theologen seit dem Abschluss des Talmuds über die Beziehung zwischen Glauben und Vernunft:
Der Gaon Saadja aus Fajum hat ein Buch über Glaubensbekenntnisse und religiöse Vorstellungen ("אמאנאתואעתקאדאמונותודעות) geschrieben. In der Einleitung zu diesem Werk beschreibt der Philosoph die Ursachen menschlichen Irrtums und Zweifels und teilt die Menschen ihrem Glaubensstandpunkt nach in vier Klassen ein. Erstens gibt es Leute, die die Wahrheit, die sie gefunden haben, anerkennen, sie festhalten und mit ihr glücklich sind. Zur zweiten Klasse gehören diejenigen, die das wahre Prinzip vor Augen haben, es aber nicht anerkennen, sondern seine Richtigkeit bezweifeln und es wieder aufgeben. Zur dritten Klasse gehören die, welche eine Ansicht annehmen, ohne von ihrer Wahrheit überzeugt zu sein, sie sehen Unwahrheit als Wahrheit an. Die letzte Klasse schließlich besteht aus denen, die keine bestimmte Ansicht haben, sondern geistig beständig unsicher hin und her schwanken. Saadja möchte seine Glaubensgenossen in der ersten Klasse wissen, und sein Werk sollte ihnen dazu verhelfen.
Nach Saadja hat die Religion oder der Glaube einen wesentlichen Platz in unserer Seele einzunehmen; die mannigfachen Wahrheiten, die den Glauben bilden, liegen in der Seele wie in einer Vorratskammer, vollkommen bereit zum Gebrauche, sobald man ihrer bedarf. Es kann indessen vorkommen, dass wir Ansichten als richtig annehmen, die tatsächlich falsch sind. Man muss jede Ansicht prüfen, um ihren wahren Charakter festzustellen. Drei Prüfungen, die wir anstellen können, sind allgemeiner Natur, doch die vierte hat nur Geltung für uns, die wir an die Wahrheit der Heiligen Schrift glauben. Die ersten drei Prüfungen werden uns zeigen, ob eine gewisse Ansicht von unseren Sinnen, von unseren angeborenen Ideen oder von unserer logischen Überlegung bestätigt oder verworfen wird. Außerdem besitzen wir einen vierten Prüfstein in der glaubwürdigen Offenbarung (הגדההנאמנת), d. i. in dem Inhalt der Heiligen Schrift und der Überlieferung. Die Heilige Schrift erkennt die Notwendigkeit der drei allgemeinen Prüfungen an und fordert uns häufig zu ihrer Anwendung auf. Andererseits ist Saadja überzeugt, dass der Inhalt der Heiligen Schrift und die Tradition niemals durch diese Proben widerlegt, sondern vielmehr in vielen Fällen durch sie bestätigt werden. Solche Bestätigung ist in Wirklichkeit überflüssig; aber das menschliche Gemüt fühlt sich erleichtert, wenn es die Lehre der Heiligen Schrift durch andere Beweise bestätigt findet. Außerdem gehen Angriffe gegen die Bibel häufig von diesen Untersuchungen aus, und es ist deshalb nützlich zu lernen, wie man ihnen zu begegnen hat. Nach Saadja kann die Wahrheit, die in der Bibel gelehrt wird, nie durch die Resultate wissenschaftlicher oder philosophischer Forschung widerlegt werden.
Für Saadja sind also Philosophie und Wissenschaft reiner Luxus und können nicht als Hilfsmittel für das Studium der Tora angesehen werden. Man beschäftigt sich mit ihnen nicht um ihres inneren Wertes willen oder als Mittel zum Verständnis der Heiligen Schrift, sondern einzig und allein zu dem Zwecke, um sich geeignete Waffen für einen theologischen Kampf zu verschaffen, oder auch, um sich davon zu überzeugen, dass das, was uns aus der glaubwürdigsten Quelle bekannt ist, auch aus anderen weniger sicheren Quellen bestätigt wird.
Der Dichter und Philosoph Salomon ibn Gabirol, der mit Begeisterung die menschlichen Seelenkräfte betrachtet, bekennt demütig, dass es sein Glaube war, der ihn vor dem Sturze rettete; da, wo er in seiner "Königskroneכתרמלכות " von der Fähigkeit des Menschen, Kenntnisse zu erwerben, spricht, sagt er: "Wer erreicht deine Weisheit, die der Seele die Kraft der Erkenntnis verliehen, die in ihr wurzelt, ihres Wesens Stamm und Urgrund? Drum wird sie nimmermehr zerstört, wie ihres Daseins Urgrund sich stets bewährt!) Doch wenn er über die menschliche Schwäche nachdenkt, spricht er dem Schöpfer seine Dankbarkeit aus für seine Führung: "Noch Größeres hast du für mich getan. Du hast meinem Herzen einen vollkommenen Glauben eingepflanzt, zu glauben, dass du, o Gott, wahr, dass deine Lehre wahr und deine Propheten wahr; du hast mich nicht deinen Feinden gesellt, die sich gegen dich empören, die Unwürdigen, die deinen Namen entweihen, dein Gesetz verachten, deine Knechte angreifen und an deine Propheten nicht glauben". Wissen — Philosophie und Wissenschaft — ist gerade das Wesen, das unsterbliche Element der menschlichen Seele; doch ohne das Wort Gottes würde der Mensch auf Abwege geraten und verloren sein.
Die Grenzen zwischen Vernunft und Religion sind in dem Kommentar zu dem Sefer Jezira von Dunasch ben Tamim (ed. L. Dukes in den Schire Schelomoh I, S. Vlf) klarer dargelegt: Alle Wesen in der Höhe und in der Tiefe hat Gott geschaffen; dem Menschen gab er die Fähigkeit, sie alle zu erforschen und zu untersuchen; doch nicht darf er die Grenzen seines Wirkungskreises überschreiten, um nach dem Wesen Gottes zu forschen; "denn in der Stadt seiner Zuflucht soll er wohnen", und "wenn er seinen Platz verlässt und der Rächer des Blutes tötet ihn, so gibt es keine Hilfe für ihn". Außerdem gibt alle Wissenschaft zu, dass der Mensch nicht imstande ist, irgendetwas mit seinem Verstände zu begreifen, was nicht im Bereich der geschaffenen Welt liegt.
R. Bachja, der Sohn Josephs des Sephardi, der im elften Jahrhundert lebte, spricht in der Einleitung zu seinen "Herzenspflichten" von den drei Quellen menschlicher Erkenntnis — der Heiligen Schrift, der Tradition und der Vernunft. Bachja ist völlig davon überzeugt, dass das Wissen, welches wir aus den ersten zwei Quellen gewinnen, vollkommen und korrekt ist. "Bist du ein Mensch, begabt mit Erkenntnis und Vernunft, und fähig, die Grundsätze deines Glaubens und deiner religiösen Handlungen zu beweisen, wie sie dir von den Weisen im Namen der Propheten gelehrt sind, so ist es deine Pflicht, es zu tun, damit die Vernunft bestätige, was die Überlieferung lehrt. Unterlässt du den Versuch dieser Untersuchung, so vernachlässigst du deine Pflicht gegen deinen Schöpfer."
Noch nachdrücklicher verlangt Schemtob ibn Palquera das Recht freier Forschung für alles, was durch die Offenbarung und die Tradition gelehrt worden ist. In einem Dialoge zwischen dem Gläubigen und dem Forscher wird ersterer als unwissend cargestellt in allem, was unser Geist zu wissen verlangt, während der Weise, der festen Glauben an die Tradition mit dem richtigen Gebrauche seiner Vernunft vereinigt, den Forscher zu befriedigen weiß und die Regel aufstellt: "Lass das Studium der Tora die Grundlage sein, das Studium anderer Dinge nachfolgen; glaube nichts, was nicht durch die Vernunft oder durch Gott (d. h. durch das Wort der Offenbarung) bewiesen ist. "
R. Abraham ben David sagt in Emunah rama: "Weil drei von vier Gelehrten (R. Akiba, Ben-Asai, Ben-Soma und Elischa) in ihren philosophischen Forschungen keinen Erfolg hatten, deshalb wenden viele der Wissenschaft den Rücken zu und erkennen infolge dieser Vernachlässigung die Hauptprinzipien unserer Religion nicht." Der Zweck seines Buches ist, Religion und Wissenschaft in Einklang zu bringen.
R. Juda hallevi bemüht sich in seinem "Kusari ", den König der Kosaren durch philosophische Beweise von der Wahrheit der jüdischen Religion zu überzeugen, zieht aber trotzdem unumwunden die göttliche Offenbarung vor und erkennt ihr die höhere Autorität zu. Er ist überzeugt, dass weder die Vernunft noch die philosophische Beweisführung jemals einen im Gesetze aufgestellten Grundsatz verwerfen kann. Er sagt: "Prophetie ist sicherlich stärker als logische Schlussfolgerung. "
R. Abraham ibn Esra glaubt, dass die geistigen Fähigkeiten des Menschen nicht ausreichend sind, um alle transzendentalen Probleme zu lösen; so ist z. B. die Natur des menschlichen Geistes den meisten unbekannt und nur dem verständlich, "dessen Gedanken auf der Wage menschlicher Vernunft gewogen sind und sich aufbauen auf den vier Elementen des Wissens, als da sind Lesen, Schreiben und Rechnen und auf dem göttlichen Gesetz." Ibn Esra empfiehlt das Studium der Wissenschaften, wo es mit dem Glauben an die göttliche Offenbarung sich verbindet. "Die Tora", so bemerkt Ibn Esra in seiner Erklärung zu Psalm 19, 8, "ist vollkommen an sich; sie verlangt von außen für die Wahrheiten, die sie lehrt, keinen Wahrheitsbeweis."
"Der Führer der Verirrten" von Maimonides ist ganz und gar der Lösung des Problems gewidmet, wie die Heilige Schrift mit der Vernunft in Einklang zu bringen sei. Die Schrift kann nichts enthalten, was der Vernunft widerspricht; auch kann das Resultat wissenschaftlicher Forschung und philosophischer Spekulation nicht als der Vernunft widersprechend angesehen werden, da diese ja gerade ihre Grundlage bildet. Doch wo sich ein solcher Fehler bemerkbar macht, da haben wir einen Fehler gemacht entweder in unserer Darlegung oder in der Auslegung der Heiligen Schrift. Die Unkörperlichkeit und die Einheit Gottes sind Lehren, die durchaus bewiesen sind, und die Schrift kann nichts lehren, was ihnen widerspräche. Wo nach unserer Meinung ein Widerspruch sich in der Heiligen Schrift findet, da ist er nur scheinbar und wird durch Annahme eines allegorischen Gebrauchs von Worten und Redensarten beseitigt.
R. Joseph Albo sagt in dem Vorworte zu seinem Buch über die Grundlehren der jüdischen Religion wie folgt: "Da der menschliche Verstand nicht zu erkennen imstande ist, was wahr und was gut ist, so muss es ein höheres Wesen geben, das uns in der Bestimmung dessen, was gut ist, anleitet und zum Verständnis dessen, was wahr ist, führt. Es ist daher vor allem nötig, das göttliche Gesetz, welches dem Menschen über diese Probleme Aufschluss gibt, zu studieren und zu kennen.
R. Elia del Medigo sagt in seinem "Bechinath haddath" (Prüfung der Religion):
"Wir wollen zuerst untersuchen, ob das Studium der Philosophie den Anhängern unserer Religion erlaubt ist oder nicht; und dann, wenn es erlaubt ist, ob es als Pflicht und lobenswerte Handlung zu betrachten ist. Der rechtschaffene Jude zweifelt nicht daran, dass das Gesetz den Zweck hat, uns zu einer gesitteten Lebensführung anzuleiten, zu guten Taten und wahrhafter Erkenntnis, das gewöhnliche Volk seiner Fähigkeit angemessen und die Begabteren gemäß ihrer Veranlagung. Gewisse grundlegende Wahrheiten werden deshalb im Gesetz und den Propheten in einen autoritativen, poetischen oder dialektischen Stil eingekleidet; doch höher strebende Geister werden angeregt, nach geeigneten Beweisen zu forschen. So wird von Jesaja die ganze Nation mit den Worten angeredet: ,Erhebe deine Augen hoch und siehe, wer diese Dinge geschaffen hat‘, und dergleichen. Auch der erste unter allen Propheten verkündet den Israeliten: ,Höre, Israel, der Ewige ist unser Gott; der Ewige ist einzig.‘ Diejenigen, welche höher begabt sind als ihre Mitmenschen, werden direkt oder indirekt aufgefordert, der Bahn zu folgen, die ihnen passend erscheint. Die direkte Aufforderung zu philosophischer Forschung ist in den Worten enthalten: ,Erkenne heute und nimm es dir zu Herzen, dass der Ewige Gott ist‘, usw.; die indirekte Aufforderung liegt in dem Gebote, Gott zu lieben und zu fürchten, wie es von R. Moses Maimonides erklärt worden ist. — Das Studium der Wissenschaften wird sicherlich dem Gelehrten dienlich sein; es führt zur Erkenntnis der geschaffenen Welt und dadurch zur Erkenntnis des Schöpfers. Ein solches Studium ist wohl notwendig für den jüdischen Gelehrten, wenn auch nicht für den gewöhnlichen Juden. Der Gelehrte darf sich indessen auf seine Forschung nicht ganz verlassen, wohl aber auf das, was im Gesetze gelehrt wird. Hierin sind also Gelehrte und gewöhnliche Menschen gleich, dass sie die Lehre der Tora als unfehlbar ansehen; nur mit dem Unterschiede, dass der Gelehrte außerdem noch seinen Wissensdurst befriedigen und durch wissenschaftlichen Beweis die Wahrheit dessen festigen kann, was er bereits auf Grund der Bibel als wahr angenommen hat."
Von den Theorien moderner Gelehrten will ich nur die Moses Mendelssohns anführen. Er nimmt unbedingt die Lehre der Bibel an; alle ihre Wahrheiten sind absolut und vollkommen; keine Beweisführung kann sie jemals verwerfen; wohl indessen können sich auch Schwierigkeiten bieten in dem Versuch, die Lehre der Bibel mit der unserer Vernunft zu vereinigen. Was haben wir also zu tun? Der Philosoph erklärt: "Wenn ich meine Vernunft in Widerspruch finden würde mit dem Worte Gottes, so könnte ich der Vernunft Schweigen gebieten; doch die Beweise werden sich nichtsdestoweniger im Innersten meines Herzens behaupten, solange sie nicht widerlegt sind; sie werden die Form beunruhigender Zweifel annehmen, die sich in kindliches Gebet und ernstes Flehen um Erleuchtung auflösen. Ich würde die Worte des Psalmisten sprechen: ,Gott sende mir dein Licht, deine Wahrheit, dass sie mich führen und bringen auf deinen heiligen Berg, an deine Wohnstätte!"
Die Auffassung, welche Moses Mendelssohn vom jüdischen Glauben und seiner Beziehung zur Vernunft hatte, ist aus folgender Stelle zu entnehmen: "Ich erkenne keine anderen ewigen Wahrheiten als die, die der menschlichen Vernunft nicht nur begreiflich, sondern durch menschliche Kräfte dargetan und bewahrt werden können. Ich kann dies behaupten, ohne von der Religion meiner Väter abzuweichen. Ich halte dieses vielmehr für einen wesentlichen Punkt der jüdischen Religion und glaube, dass diese Lehre einen charakteristischen Unterschied zwischen ihr und der christlichen Religion ausmacht. Um es mit einem Worte zu sagen: ich glaube, das Judentum wisse von keiner geoffenbarten Religion in dem Verstände, in welchem dieses von den Christen genommen wird. Die Israeliten haben göttliche Gesetzgebung, Gesetze, Gebote, Befehle, Lebensregeln, Unterricht vom Willen Gottes, wie sie sich zu verhalten haben, um zur zeitlichen und ewigen Glückseligkeit zu gelangen; dergleichen Sätze und Vorschriften sind ihnen durch Mose aus eine wunderbare und übernatürliche Weise geoffenbart worden, aber keine Lehrmeinungen, keine Heilswahrheiten, keine allgemeinen Vernunftsätze. Diese offenbart der Ewige uns, wie allen übrigen Menschen, allezeit durch Natur und Sache, wie durch Wort und Schriftzeichen. Ob nun gleich dieses göttliche Buch, das wir durch Moses empfangen haben, eigentlich ein Gesetzbuch sein und Verordnungen, Lebensregeln und Vorschriften enthalten soll, so schließt es gleichwohl, wie bekannt, einen unergründlichen Schatz von Vernunftwahrheiten und Religionsichten mit ein ... Je mehr wir in demselben forschen, desto mehr erstaunen wir über die Tiefe der Erkenntnisse, die darin verborgen liegen . . . Allein alle diese vortrefflichen Lehrsätze werden der Erkenntnis dargestellt, der Betrachtung vorgelegt, ohne dem Glauben aufgedrungen zu werden . . . Dem Glauben wird nicht befohlen; denn der nimmt keine anderen Befehle an, als die den Weg der Überzeugung zu ihm kommen. (Alle Befehle des göttlichen Gesetzes sind an den Willen, an die Tatkraft der Menschen gerichtet.) Ja, das Wort in der Grundsprache, das man durch den Glauben zu übersetzen pflegt (אמונה), heißt an den mehrsten Stellen eigentlich Vertrauen, Zuversicht, getroste Versicherung auf Zusage und Verheißung. "
Diese Worte Mendelssohns zeigen, wie sehr diejenigen irren, die in seinen Ansichten eine Unterstützung des Ausspruchs finden, das Judentum kenne keine Dogmen. Nach Mendelssohn besteht die jüdische Religion nicht ausschließlich aus Gesetzen; sie lehrt auch gewisse Wahrheiten. Wir haben gewisse Dogmen, ohne die die Gesetze keinen Sinn hatten, doch es gibt keine Vorschrift, die da lautete: "Du sollst glauben. " Nirgends, weder in der schriftlichen noch in der mündlichen Lehre, wird eine feierliche Ablegung des Glaubensbekenntnisses gefordert. Soweit ist Mendelssohns Ansicht korrekt; wenn er jedoch glaubt, dass alle Wahrheiten, über die wir in der Schrift belehrt werden, logisch klargelegt werden können, so irrt er. Uber die Bedeutung von אמונה siehe oben.
Die dreizehn Grundsätze unseres Glaubens
Die Hauptquelle unseres Glaubens ist die Bibel, und unter den biblischen Büchern hauptsächlich der Pentateuch (תורה). Hier finden wir viele Wahrheiten, die von Gott selbst oder von seinen inspirierten Boten verkündet wurden; sie bilden die Grundlage unseres Glaubens. Es macht wenig aus, wie wir sie anordnen, wie wir sie in Haupt- und Unterabteilungen einreihen, wofern wir einfach an sie glauben. In der Bibel sind sie nicht in ein System gebracht; sie finden sich zwischen den Geschichtserzählungen und Gesetzen, die den Grundstoß der Schrift bilden, oder sind in ihnen enthalten; die Beobachtung jener Gesetze gibt den besten Beweis, dass der Glaube im Herzen Platz gefunden hat. Im Pentateuch wird nicht eine öffentliche Erklärung oder das Hersagen eines Glaubensbekenntnisses befohlen, nicht ein Gerichtshof eingesetzt zu erforschen, ob der Glaube eines Menschen richtig oder falsch sei; keinerlei Bestrafung ist für den Mangel an Glauben festgesetzt oder angedroht. Als jedoch über den Sinn und die Verbindlichkeit der in der Bibel gelehrten Wahrheiten Meinungsverschiedenheiten entstanden, wurde es nötig, sie zu formulieren. Die Mischna erklärt etliche Ansichten als unjüdisch, d. h. der Lehre des göttlichen Wortes widersprechend. Später, als die Glaubenszwiste zwischen den verschiedenen Sekten des jüdischen Volkes wie auch zwischen Juden und Christen, Juden und Mohammedanern sich mehrten, hielt man es für sehr wichtig, die Form und Anordnung unserer Glaubenssätze festzustellen. Der große Religionsphilosoph Moses Maimonides lehrte in seinem Mischnakommentar dreizehn Glaubenssätze, die von den Juden allgemein angenommen wurden und als die "dreizehn Glaubensartikel " bekannt sind. Das Gebetbuch weist diese in zwei verschiedenen Formen auf, in prosaischer und poetischer. Maimonides empfiehlt sie dem Lehrer mit folgenden Worten: "Lies sie wieder und wieder und denke gut über sie nach; lass dir nicht einfallen zu meinen, dass du ihren vollen Sinn begriffen, nachdem du sie ein paarmal gelesen hast; du würdest sehr irren; denn ich habe nicht niedergeschrieben, was mir beim ersten Nachdenken in den Sinn kam, sondern gründlich erwogen und geprüft, was ich schreiben wollte, die verschiedenen Lehren verglichen, die wahren und falschen, und als ich das gesunden, was als unser Glaube von uns anzunehmen ist, war ich imstande, es durch Belegstellen und Vernunftgründe zu beweisen." Die dreizehn Artikel, die Maimonides aufstellte und für Haupt- und Grundsätze unserer Religion erklärte, sind folgende:
1. Der erste Artikel: Der Glaube an die Existenz des Schöpfers. Das ist der Glaube, dass ein Wesen existiert, für dessen Existenz keine andere Ursache anzunehmen ist, das selbst die Ursache aller Wesen ist.
2. Der zweite Artikel: Der Glaube an die Einheit Gottes; das ist der Glaube, dass das Wesen, welches die Ursache alles Bestehenden ist, einzig ist; ungleich der Einheit einer Gruppe oder Klasse, die aus einer gewissen Anzahl von Einzelwesen, ungleich der Einheit eines Einzelwesens, das aus verschiedenen Elementen zusammengesetzt ist, ungleich auch der Einheit eines einfachen Körpers, der ins Unendliche teilbar ist; vielmehr kann nichts seiner Einheit verglichen werden.
3. Der dritte Artikel: Der Glaube an die Unkörperlichkeit Gottes; das ist der Glaube, dass dieser eine Schöpfer weder aus körperlicher Substanz noch in körperlicher Form besteht, dass er nicht als eine Kraft in einem Körper enthalten ist, und dass keinerlei körperliche Eigenschaft oder Tätigkeit ihm beigelegt werden kann.
4. Der vierte Artikel: Der Glaube an die Ewigkeit Gottes; das ist der Glaube, dass Gott allein, kein andres Wesen, ohne Anfang ist.
5. Der fünfte Artikel: Der Glaube, dass der Schöpfer allein anzubeten ist, kein anderes Wesen, ob Engel, Sterne oder sonst etwas; denn alle diese sind selbst Kreaturen Gottes.
6. Der sechste Artikel: Der Glaube an Prophetentum. Das. ist der Glaube, dass Menschen gelebt haben, begabt mit außergewöhnlichen sittlichen und geistigen Kräften, durch die sie einen für andre unerreichbaren Grad und eine für andre unerreichbare Art der Erkenntnis erlangten.
7. Der siebente Artikel: Der Glaube, dass unser Lehrer Moses der größte von allen Propheten war, die vor oder nach ihm lebten.
8. Der achte Artikel: Der Glaube an den göttlichen Ursprung der "Lehre"; der Glaube, dass der ganze Pentateuch Moses von Gott mitgeteilt wurde, die Gesetze sowohl wie die Erzählungen, die darin enthalten sind.
9. Der neunte Artikel: Der Glaube an die Unversehrtheit der Lehre; der Glaube, dass sowohl die geschriebene wie auch die mündliche Lehre göttlichen Ursprunges ist, und dass nichts hinzugefügt oder fortgenommen werden dürfe.
10. Der zehnte Artikel: Der Glaube, dass Gott die Taten und Gedanken der Menschen kennt und merkt.
11. Der elfte Artikel: Der Glaube, dass Gott diejenigen, die die Vorschriften seiner Lehre erfüllen, belohnt, und die, welche sie verletzen, bestraft.
12. Der zwölfte Artikel: Der Glaube, dass der Messias in einer zukünftigen Zeit, die wir nicht bestimmen können, kommen wird, dass er aus Davids Stamm und von außerordentlicher Weisheit und Macht sein wird.
13. Der dreizehnte Artikel: Der Glaube an die Wiederbelebung der Toten oder die Unsterblichkeit der Seele.
Diese dreizehn Artikel (שלשהעשרעקרים) kann man in drei Gruppen teilen, gemäß ihrer Zugehörigkeit zu den drei Grundlehren: 1. Vom Dasein Gottes, 2. von der Offenbarung, 3. von Belohnung und Bestrafung. Die ersten fünf bilden die erste Gruppe, die nächsten vier die zweite, die letzten vier die dritte. In dieser Ordnung sollen sie nun betrachtet werden.
1. Existenz Gottes מציאותהבורא
Die Vorstellung von der Existenz Gottes, als einer unsichtbaren Macht, die alle Vorgänge in der Natur beeinflusst, ist weitverbreitet und fast dem ganzen Menschengeschlecht gemeinsam. Sie findet sich bei allen zivilisierten Völkern und vielen unzivilisierten. Die Vorstellung von der Existenz Gottes darf als eine angeborene Idee angesehen werden, die wir von den frühesten Tagen her besitzen. Dies ist der Ursprung der "natürlichen Religion". Denker aller Zeiten und Völker haben versucht, diese angeborene Idee durch überzeugende Gründe zu befestigen. So auch lenkten oftmals Propheten und göttliche Sänger die Aufmerksamkeit ihrer Zuhörer auf die Wunder in der Natur, um sie mit der Idee eines allweisen und allmächtigen Schöpfers zu erfüllen.
"Erhebt zur Höhe eure Augen und sehet: wer hat diese geschaffen? Er, der herausführt nach der Zahl ihr Heer, ruft sie alle beim Namen —nicht eines entgeht ihm; der groß ist an Macht und stark an Kraft" (Jes. 40, 26). "Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und das Firmament kündet seiner Hände Werk" (Ps. 19, 2).
Die Regelmäßigkeit im Auf- und Untergang der Himmelskörper, auf Grund deren wir die genaue Zeit und Dauer einer Sonnen- oder Mondfinsternis voraussagen, ist gewiss ein starker Grund für den Glauben, dass ein mächtiger und weiser Schöpfer die Gesetze bestimmt hat, nach denen diese Lichter sich bewegen.
"Schön sind die Lichter, welche unser Gott geschaffen hat. Er hat mit Erkenntnis, Einsicht und Verstand sie gebildet; Kraft und Stärke gab er ihnen, inmitten der Welt zu herrschen. Voll von Glanz, lichtstrahlend, erhellen sie die ganze Welt; fröhlich beim Aufgang, freudig beim Untergang, tun sie in Ehrfurcht ihres Herren Willen" (Sabbat-Morgengebet).
Eine ähnliche Regelmäßigkeit bemerken wir an der Oberfläche der Erde. Die verschiedenen Jahreszeiten, jede von besonderem Aussehen und Einfluss, die Folge von Tag und Nacht in regelmäßigen Zwischenräumen, die allmähliche und gesetzmäßige Entwicklung des Pflanzen- und Tierlebens — alles weist zwingend daraufhin, dass diese Dinge nicht dem Zufall ihr Dasein schulden, sondern dem Willen eines allmächtigen und allweisen Schöpfers.
Wiederum, wenn wir den Bau einer einzelnen Pflanze oder eines einzelnen Tieres betrachten, finden wir, dass jedes Glied und jeder Teil in der Haushaltung der ganzen Pflanze oder des ganzen Tieres seine besondere Verrichtung oder Bestimmung hat. Würde einer dieser Teile seinen Dienst verweigern oder aufhören, seine Bestimmung zu erfüllen, — die Entwicklung des Ganzen wäre gestört. Gewiss muss es ein Wesen geben, das die verschiedenen Glieder eines Organismus zwingt, zur Entwicklung und zum Wohle des Ganzen gemeinsam zu arbeiten. Die Zweckidee, welche diese gemeinsame Arbeit leitet, kann weder in den Teilen noch im Ganzen entsprungen sein, sondern nur im Plane dessen, durch dessen Willen diese geschaffen wurden.
"Der Finger Gottes" ist ferner sowohl in den wichtigen Lebensereignissen des Einzelnen, wie in der Geschichte ganzer Völker zu erkennen. Wir werden häufig an die Lehre erinnert: "Das Herz des Menschen überdenkt seinen Weg, und der Ewige richtet seinen Schritt" (Sprüche 16, 9). "Rettung vom Herrn, dein Lob von deinem Volke" (Ps. 3,9).
Ein anderes Argument für den Glauben an die Existenz Gottes bietet das sittliche Bewusstsein, das jedes menschliche Wesen besitzt. Dies weist auf das Dasein eines höheren, allgütigen Wesens als Ursache und Grund des sittlichen Bewusstseins in unserm eigenen Herzen.
Diese und ähnliche Argumente werden angeführt, um unseren Glauben an Gott zu kräftigen und zu läutern. Es fragt sich jedoch: Sind diese Argumente allein ausreichend, uns zu überzeugen? Sind sie stark genug den Angriffen der Zweifelsucht gegenüber?
Bei genauer Prüfung finden wir, dass sie von außerordentlichem Wert für den Gläubigen sind. Sein Glaube wird gewappnet wider viele Bedenken, die ihn anfechten mögen; und die Zweifelsucht wird durch diese Argumente gezähmt. Aber auf sich selbst gestellt, dürften sie nicht immer ausreichen, den Gottesglauben zu begründen; und wenn sie für den Augenblick uns überzeugen, so sind wir nicht sicher, ob nicht wieder frische Gründe der Gegner unsere Sinne verwirren. Ein anderer Weg wird daher vom Allmächtigen gewählt, durch welchen Sicherheit erreicht worden ist; ein sicherer Führer ist uns für unser sittliches und religiöses Leben gegeben: es ist die Offenbarung. Von dieser werden wir später noch sprechen.
Die Hauptformen der Religionen, die dem natürlichen Glauben an Gott entstammen, sind: Vielgötterei, Pantheismus, Atheismus, Theismus und Deismus.
1. Die erste Form der Gottesverehrung, von der uns Geschichte und Altertumskunde Nachricht geben, ist der Polytheismus. Die schöpferische und herrschende Kraft irgendeines unsichtbaren Wesens wurde überall bemerkt. Jede augenfällige Übung solchen Einflusses wurde einer besonderen Gottheit zugeschrieben, die nun eine Verehrung fand gemäß der besonderen Auffassung der Gottheit im Herzen der einzelnen Person, Familie oder Nation. Dies ist hauptsächlich die Art des Götzendienstes, welche in der Bibel erwähnt und von den Propheten bekämpft wird.
Ein sehr allgemeiner Gegenstand der Anbetung waren die Sterne. Rabbi Jehuda Hallevi, im Kusari 4, t, sucht den Ursprung dieses Kultus wie folgt zu erklären: "Die Sphären der Sonne und des Mondes bewegen sich nicht in gleicher Weise. Eine gesonderte Ursache oder Gottheit wurde daher für jeden der Himmelskörper angenommen, ohne dass die Menschen daran dachten, dass von einer höheren Macht all die Ursachen abhingen."
Die alten Denkmäler und die Sammlungen in unseren Museen zeigen, wie groß die Mannigfaltigkeit in den Formen des Götzentums gewesen und wie eifrig große Völker dieser Art der Gottesverehrung anhingen und noch anhangen. Aber Denker und Philosophen sind erstanden, selbst unter den götzendienenden Völkern, die eine Einheit im Bau und in der Bewegung des Weltalls suchten, und sie gelangen früh zu einer "Ersten Ursache" als der einzigen Quelle alles Existierenden.
2. Der Umstand, dass die Wirkung der göttlichen Macht sich allerorts dem aufmerksamen Auge des Menschen zeigt, verursachte eine andere Art menschlichen Irrtums: den Pantheismus (Gott ist das All). Der moderne Pantheismus datiert von Spinoza. Doch lange vor Spinoza, als die geheimen Kräfte, die in den an allen Körpern von uns wahrgenommenen Veränderungen tätig sind, als Eigenschaften erkannt wurden, die der Substanz der Dinge anhaften, wurden diese Kräfte als die einzigen unabhängigen Ursachen des bestehenden Universums betrachtet, und der Bund dieser Kräfte, Natur genannt, galt als die erste Ursache oder als Gott. Eine nähere Bestimmung dieser Theorie ist in der Philosophie Spinozas enthalten. Nach dem System dieses großen Philosophen hat das Universum in seiner Ganzheit die Eigenschaften der Gottheit: Es existiert nichts außer der Substanz (Gott), ihren Eigenschaften und den verschiedenen Formen, in welchen diese Eigenschaften dem Menschen wahrnehmbar werden. Spinoza war bemüht, sich gegen den Vorwurf, als beschreibe er Gott als körperlich, zu verteidigen, aber das gelang ihm nicht. Die Eigenschaft der Ausdehnung oder der Räumlichkeit, welche Gott nach Spinoza besäße, ist nur in Beziehung auf Körper zu begreifen. Die Philosophie Spinozas hat zu wählen: entweder ist Gott körperlich, oder die körperliche Welt existiert nicht. Beide Annahmen sind gleich sinnlos. Freilich beklagt er sich in einem seiner Briefe, dass fälschlich von ihm behauptet worden sei, er glaube, Gott bestehe aus einer gewissen körperlichen Masse. Aber wir können nicht umhin, die Existenz einer gewissen körperlichen Masse anzunehmen, und wenn diese nicht Gott ist, so müssen wir in unserm Geiste unterscheiden zwischen Gott und etwas, was nicht Gott ist, entgegen der Grundlehre des Pantheismus. Überdies ist noch viel Ungereimtes und Unwahrscheinliches mit dieser Theorie verknüpft. Sie bietet keine Grundlage für ein sittliches Bewusstsein. Das Schlechte und das Gute sind gleich unzertrennlich von Gott. Beide stammen mit Notwendigkeit von den Eigenschaften Gottes und können nicht anders sein, als sie wirklich sind. Wenn wir durch die Betrachtung, dass das Leid, das unser Nächster uns zufügt, nicht durch diesen allein bewirkt wird, sondern durch eine Kette von vorherbestimmten, notwendigen Ursachen, bewogen werden dürften, den Hass wider die sichtbare Ursache unseres Leids zu überwinden, so würde dieselbe Überlegung uns in gleicher Weise dazu bringen, Güte und Wohltat unserer Freunde nicht wert der Dankbarkeit zu erachten; denn sie wären ja gezwungen, so und nicht anders zu handeln.
3. Der Pantheismus ist durch seine Lehre: "Alles in Gott und Gott in Allem " der Anschauung von der Verantwortlicheit des Menschen einem höheren Wesen gegenüber entgegengesetzt, leugnet die Existenz Gottes im gewöhnlichen Sinne des Wortes und ist verglichen mit wahrer Religion dem Atheismus gleichwertig.
In der Bibel wird die Gottlosigkeit als Quelle alles Übels bezeichnet. So hatte der Patriarch Abraham gegen die Leute von Gerar den Verdacht, dass "nicht Furcht vor Gott" an diesem Orte wäre, und war besorgt, "sie möchten ihn erschlagen" (Gen. 20,11); Joseph indes suchte seinen Brüdern Zutrauen einzuflößen durch die Versicherung, "ich fürchte Gott" (ib. 42,18). Das erste Beispiel eines Atheisten sehen wir in Pharaoh, dem König von Ägypten, wenn er herausfordernd sagt: "Ich kenne den Herren nicht, noch will ich Israel ziehen lassen" (Exod. 5,2). Vor einer anderen Form des Atheismus warnt Moses mit den Worten: "Sprich nicht in deinem Herzen: meine Kraft und die Stärke meiner Hand hat für mich all diesen Wohlstand bereitet" (Deut. 8,17) und "dass sie nicht sprechen: unsere Hand ist hoch, und nicht der Herr hat all dies gewirkt" (ib. 52,27). Die Propheten tadeln gleichfalls das Volk wegen Mangels an Gottesglauben. In den Psalmen werden die Verbrechen und bösen Absichten von gewalttätigen Menschen auf Gottlosigkeit zurückgeführt. "Der Schlechte spricht in seinem Herzen: es gibt keinen Gott" (Ps. 14, 1). Aber dieser Atheismus der Bibel ist kein theoretischer oder dogmatischer; er ist nicht das Ergebnis des Denkens, des tiefen Forschens nach den Gründen der Dinge, sondern bloß die Stimme einer bösen Neigung, die den Menschen lockt, dem Gottbefehle entgegenzuhandeln, und die ihn der Straflosigkeit auf Grund der Vorstellung versichert, dass seine Handlungen von einer höheren Gewalt nicht beobachtet würden. In der nachbiblischen Literatur wird der Kern des Atheismus mit dem Satz bezeichnet: "Es gibt kein Gericht und keinen Richter."
4. Obgleich die Überzeugung von der Verantwortlichkeit des Menschen einer höheren Gewalt gegenüber das Hauptelement im Gottesglauben bildet, so war doch der Begriff der Gottlosigkeit so eng mit dem des Verbrechens und der Schlechtigkeit verbunden, dass diejenigen, welche die Autorität und Herrschaft der Gottheit verwarfen, Scheu hatten, sich gottlos oder Atheisten zu nennen. Viele Philosophen behielten den Namen "Gott " (theos, deus) für ihre "Erste Ursache " des Weltalls bei, obgleich diese der Haupteigenschaften Gottes beraubt wurde. So haben wir als die hauptsächlichen religiösen Anschauungen, die aus philosophischen Forschungen sich ergeben haben, den Theismus und den Deismus. Wörtlich bezeichnen beide Ausdrücke: Lehre von Gott oder Glaube an Gott; das eine Wort ist vom griechischen theos abgeleitet, das andre vom lateinischen deus, beide bedeuten Gott.
Jedoch besteht ein wesentlicher Unterschied zwischen den beiden Anschauungen. Theismus und Deismus haben das gemein, dass beide eine geistige Macht annehmen, ein göttliches Wesen, als die Ursache und Quelle alles Existierenden. Sie unterscheiden sich in folgendem: Nach dem Theismus ist diese Macht uns und den Dingen um uns innewohnend; der Deismus betrachtet diese Macht als getrennt von den Dingen. Offenbarung wie Prophetentum werden von den Deisten geleugnet, während die Theisten beides nach eigener Weise annehmen und vernunftmäßig ausdeuten.
Alle diese verschiedenen Religionssysteme haben das Gemeinsame, dass sie aus der Religion alles auszuscheiden versuchen, was menschlicher Vernunft unfassbar ist. Aber alle Versuche, menschliche Vernunft an die Stelle göttlicher Autorität zu setzen, sind fehlgeschlagen. Eine Grenze ist menschlicher Vernunft gesetzt, die nicht überschritten werden kann. In jedem Religionssysteme — das natürliche und vernunftgemäße eingeschlossen — gibt es ein mystisches Element, das in eine Wolke von Worten gehüllt werden kann und doch unerklärt bleibt. Ob wir den Schöpfer und Lenker des Weltalls Gott, Deus oder Theos nennen, seine Beziehung zum Weltall und zum Menschen im Besonderen kann nicht durch die Gesetze bestimmt werden, welche die natürlichen Erscheinungen in dem durch seinen Willen geschaffenen Weltall bewirken.
Was ist unsere Auffassung von der Gottheit? Der Grundgedanke, von dem alle unsere Begriffe von Gott herrühren und den wir mit allen anderen Gottgläubigen teilen, ist der, dass er die erste Ursache, der Schöpfer des Weltalls ist. Dieser Gedanke, bezeichnet durch den Ausdruck הבוראיתברךשמר, bildet die Grundlage unseres Bekenntnisses. Also vom Schöpfer ist in diesem die Rede. Sieben der Artikel beginnen: "Ich glaube mit vollkommenem Glauben, dass der Schöpfer, sein Name sei gelobt" usw.
Wir gebrauchen nicht den Ausdruck "erste Ursache", weil dieser zu eng ist. Er bezeichnet nur einen Teil der Wahrheit, nicht die ganze. Unter "erster Ursache" verstehen einige die Ursache der stufenweisen Entwicklung des einfachen Stoffes zur unbegrenzten Mannigfaltigkeit der das Weltall ausmachenden Dinge; die Entwicklung des ursprünglichen Chaos zur Ordnung und zum System.
Wahr ist, dass der Schöpfer die Ursache von all diesem ist; aber er ist mehr als das: er ist die Ursache des einfachen Stoffes und des ursprünglichen Chaos. Denn er hat die Welt aus Nichts geschaffen. Der erste Vers der Bibel lehrt uns die Schöpfung aus Nichts (creatio ex nihilo): "Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde" (Gen. 1,1); das ist das ganze Weltall. Einige allerdings verstanden die hebräische Wurzel ברא anders und wollten ihr den Sinn beilegen: aushauen, herausbilden aus einem gegebenen Stoff. Aber sie missverstanden sicherlich den Geist der Schrift. Das ewige Nebeneinander von Gott und Materie würde einen Dualismus bedeuten, der mit der Lehre der Bibel völlig unvereinbar ist. Die häufig wiederholte Erklärung. "Er ist unser Gott, keiner sonst! (איןעוד)" schließt deutlich jede Form eines Dualismus aus. Diejenigen, welche behaupten, das Weltall könne nicht aus dem Nichts entstehen, gehören zu der Klasse von Leuten, von denen der Psalmist sagt: "Wieder und wieder versuchten sie Gott und setzten Grenzen dem Heiligen Israels" (Ps. 78, 41).
Wenn wir den Schöpfungsakt nicht verstehen können, so ist es unser Geist, dem Schranken gesetzt sind; und wenn wir uns überredeten zu glauben, dass wir die Ewigkeit des Stoffes besser verstehen, so täuschen wir uns selbst. Wir können nicht begreifen, wie Stoff ohne Form in Wirklichkeit existieren kann, noch haben wir einen klaren Begriff von irgendeiner Unendlichkeit. Wir sind menschliche Wesen, durch des Schöpfers Wille und Weisheit mit beschränkten, körperlichen und geistigen Fähigkeiten ausgestattet, und können in Dingen, die unsere Kräfte überschreiten, nichts Besseres tun, als der Führung des göttlichen Worts zu folgen. So können wir sicher sein, auf dem rechten Wege zur Wahrheit uns zu befinden.
Der erste Artikel unseres Bekenntnisses lehrt: Gott ist nicht allein der Schöpfer des Himmels und der Erde nebst all ihren Scharen, er ist auch der beständige Leiter aller geschaffenen Wesen, er ist בוראומנהיג. Wir preisen ihn daher in unserm täglichen Morgengebet als "den, der Wunder tut, in seiner Güte jeden Tag das Werk der Schöpfung erneuert. " Beobachten wir die regelmäßigen Naturerscheinungen, wie sie nach festen, von Menschen entdeckten und beschriebenen Gesetzen einander ablösen, so sehen wir in ihnen die Größe des Schöpfers, nach dessen Willen diese Gesetze gegenwärtig in Kraft sind, und durch dessen Willen eine von ihnen oder auch alle eines Tages aufhören könnten zu wirken.
Man hat behauptet, dass eine Unterbrechung oder ein Wechsel in diesen bestimmten Gesetzen eine Schwäche und einen Mangel an Voraussicht von Seiten des Schöpfers und einen Fehler im Schöpfungsplane anzeigen würde. Diese Meinung hat manche dazu geführt, entweder die Wahrheit der biblischen Wundererzählungen zu leugnen, oder auch die Wirklichkeit der Geschehnisse zuzugeben, ihren wunderbaren Charakter jedoch abzuleugnen, oder endlich die festen Naturgesetze zugleich mit ihren Ausnahmen als ursprünglich im Schöpfungsplane vorgezeichnet anzusehen. Wie kurzsichtig ist der Mensch! Er kann seine eigene Kurzsichtigkeit sogar nicht völlig begreifen. Gott machte ihn zum Herrscher über die Werke seiner Hände, und er maßt sich die Herrschaft an über Gott selbst! Wenn wir aus zahlreichen Beobachtungen und Experimenten das Gesetz erforschen, das gewisse wiederkehrende Erscheinungen zu regeln scheint, haben wir dann die unendliche, göttliche Weisheit in der Schöpfung ergründet? Wissen wir, aus welchem Grunde er gewisse Dinge nach gewissen Gesetzen hervorbrachte und nicht auf andere Weise? Haben wir bei Entdeckung eines Naturgesetzes die Gewalt erhalten, dasselbe Gesetz Gott vorzuschreiben und ihm die Verletzung desselben zu verbieten? Fern sei es von uns, menschlichen Wesen, Staub und Asche, uns solch ein Recht anzumaßen! Einer der Zwecke, um dessentwillen die Wunder vollbracht wurden, möchte sein, uns zu lehren, dass wir doch nicht alles wissen, dass Ereignisse eintreten können, die wir nicht imstande sind vorherzusehen, dass Erscheinungen sich zeigen können, die wir nach den bisher entdeckten Gesetzen unfähig sind zu erklären, kurz, dass unserem Wissen und unserer Weisheit Schranken gesetzt sind.
Die Tatsache, dass Gott das Weltall aus dem Nichts geschaffen hat, ist von jüdischen Philosophen wie folgt erläutert worden: Gott ist das einzige Wesen, das keiner Ursache für sein Dasein bedarf; die wahre Gottesidee schließt die Existenz ein und kann ohne sie nicht begriffen werden. Alle anderen Wesen verdanken ihre Existenz gewissen Ursachen, ohne welche sie nicht existieren würden. Gott allein ist daher ausschließlich aktiv wirkend, ohne je passiv zu sein, nur Ursache, nie Wirkung, während jedes andre Wesen sowohl aktiv wie passiv, Ursache als auch Wirkung ist; es ist durch gewisse Ursachen hervorgebracht worden und ist seinerseits die Ursache für die Existenz andrer Wesen. Im ersten Artikel ist folgender Satz zum Ausdruck dieses Gedankens hinzugefügt: "Und er allein ist die aktive Ursache für alle Dinge in Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft. " Durch diesen Zusatz sollte die Ewigkeit der Materie (קדמותהעולם) geleugnet werden. Der Hinweis auf Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft soll das fortdauernde Wirken des Schöpfers und die Abhängigkeit der Naturkräfte von seinem Willen betonen. Der erste Artikel hat daher die folgende Form:
"Ich glaube fest, dass der Schöpfer, gelobt sei sein Name, Schöpfer und Lenker aller geschaffenen Wesen ist, und dass er allein die wirkende Ursache ALLER Dinge, der vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen ist."
Bevor wir uns zum zweiten Artikel, Gott betreffend, wenden, wollen wir kurz eine Frage beantworten, die häufig gestellt wird: Wie verhalten sich die Evolutionstheorien oder überhaupt die Ergebnisse der modernen Wissenschaft und der biblische Schöpfungsbericht zueinander? In der Erzählung der Bibel von der Schöpfung wird gesagt, dass die mannigfaltigen Pflanzen- und Tierarten das Ergebnis verschiedener und deutlich getrennter Handlungen des Schöpfers waren, während gemäß der Evolutionstheorie ein schöpferischer Akt genügte, und die große Mannigfaltigkeit der Geschöpfe aus einer stufenweisen Entwicklung nach gewissen, den geschaffenen Dingen innewohnenden Gesetzen sich ergeben hat. Die Bibel erzählt uns von sechs Schöpfungstagen; nach der Evolutionstheorie müssen Jahrmillionen hingegangen sein, bevor die verschiedenen Arten sich auseinander entwickeln konnten. Während die biblische Erzählung die Erde als den Mittelpunkt des Universums darstellt, zeigt die Astronomie, dass die Erde einer der unbedeutendsten Körper ist, die den unendlichen Weltraum füllen. Astronomie und Geologie berechnen das Alter der Erde nach Jahrmillionen; aus der biblischen Erzählung entnehmen wir, dass die Erde verhältnismäßig jung ist. In der Bibel ist der Mensch Zweck und Schluß der ganzen Schöpfung; Naturgeschichte und Evolutionstheorie betrachten den Menschen einfach als eine der Formen, die aus einer natürlichen Entwicklung der tierischen Welt entstanden sind. Wie sollen wir diesen Widerstreit schlichten? Sollen wir unsere Augen gegenüber den Ergebnissen der modernen Wissenschaft verschließen im festen Glauben an die Wahrheit der Bibel? Oder sollen wir die ersteren anerkennen, die letztere aber aufgeben?





























