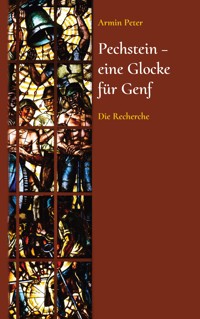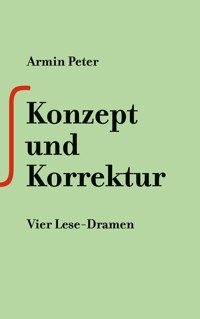Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In diesem Buch geht einer mit sich ins Gericht und lädt Mitmenschen ein, sich anhand des von Immanuel Kant begründeten Kategorischen Imperativs zu befragen, ob dessen Anwendungen - eben die Apps - im alltäglichen Leben tatsächlich ein Anstoß sind, sich selbst in autonomer Entscheidung zu bewähren. Für sehr unterschiedliche banale wie existentielle Situationen wird Material für diese Selbstprüfung präsentiert. Es wird gezeigt, dass Kants KI nicht nur der Gipfel seines ethischen Denkens, sondern eine "Endabsicht" seiner Philosophie überhaupt war. Auch für eine Diagnose von Zeitproblemen erweist sich der Imperativ als nützlich. Die Kant Apps kann man guten Gewissens herunterladen, hat Kant uns doch eine Art Softwareprogramm für Orientierung und Navigation gegeben. In diesem Kant-Brevier ist guter Ratschlag nicht billig. Es geht in ihm um Entscheidungen in 32 Situationen, Szenen und Fällen. Aber Achtung: der Autor ist kein Philosoph vom Fach.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 256
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
1 An den Kantsteinen
2 KI im Doppel
3 Das Gericht in mir
4 Einige Etagen tiefer: Pitts Fall
5 Kant vs. Constant
6 Eine Entscheidung, zu Protokoll gegeben
7 Kantsche Sprachmaschinen
8 Wahrheitszeugen des Zeitgeists
9 In der Praxis bewährt
10 Maxime, die ethische Fußfessel
11 Ethisches Etikett
12 Am Arc de Triomphe
13 Am Fuß der Himmelsleiter
14 Ausflug zum Apfelgarten
15 Waterkant
16 Pflastersteine, durchaus revolutionär
17 Ein rostendes Talent
18 Abbruchkante
19 Nicht so abstrakt, bitte
20 Gewissen und Würde
21 Maximen der Demokratie
22 Im Netz der Versprechungen
23 Eheversprechen
24 Verpfändete Ehre
25 Verantwortung zu kleinen Preisen
26 Diebische Elstern
27 Gezählt und gewogen
28 Zeit und Raum an der Bahnsteigkante
29 Auf der Bettkante
30 Vor dem Bordstein…
31 Unter Verdacht
32 „Gedächtnis des Seins“
Anmerkungen
1 An den Kantsteinen
Eine wider Pitts Erwartungen gescheiterte Bundesregierung trug nicht nur im Volksmund, sondern auch im Politikjargon den Namen „Ampel“. Wir werden sie in der Erinnerung behalten als den kühnen Versuch, durch pure politische Vernunft die prägnante Verschiedenheit der drei politischen Farben in einen konstruktiven Dreiklang zu bringen. Doch das Ist blieb in den Resultaten und in der öffentlichen Zustimmung weit hinter dem Soll zurück. Hat die Ampel den politischen Missbrauch ihres Namens durch sprech-, schreib- und denkfaule Kommunikatoren und Medien verdient?
In Hamburg gibt es eine Ampel, an der Pitt häufiger wartet. Sie hat ursprünglich vor dem Gewerkschaftshaus gestanden und ist insbesondere für die älteren Menschen, die dem Haus zustreben, ein willkommenes Sicherungssignal an der vielbefahrenen Kurt-Schumacher- Allee gewesen. Unweit des Gewerkschaftshauses befindet sich eine soziale Einrichtung, an der viele an sich selbst oder der Gesellschaft gescheiterte Menschen Hilfen suchen. Und so hat ein Verkehrsamt beschlossen, den Gewerkschaften, die ja eine kraftvolle Selbsthilfeorganisation sind, den sichernden Ampelübergang zu entziehen und ihn hundert Schritte in die Richtung des Drob Inn zu verschieben, in dem – meist junge – Menschen Überlebenshilfe, Beratung und einen Ausstieg aus ihrem elenden, verkoksten Leben suchen.
Ist von dieser Ampel ein unsichtbares Signal ausgegangen, das Pitt inspiriert hat, an den Kantsteinen vor einer Ampel über Grundsätzliches nachzudenken?
Er stand, von Natur ungeduldig und an Unruhesyndromen leidend, ergeben unter den imperativen Leuchten in einem kleinen Pulk von Fußgängern, darunter Senioren, die er kannte, am Kantstein. Von hinten ein turbulentes Beiseitedrängen, und ein energischer Typ überquerte bei Rot die in einer Intervallleere liegende Autostraße. Pitt begleitete diesen Verkehrsverstoß mit einem gewissen Verständnis – die Bahn war wirklich frei und der Delinquent, offensichtlich einer der bedauernswerten Rauschgiftsüchtigen auf dem Weg zu seiner Ersatz- oder Hilfsdroge, hatte es wohl wirklich eilig.
Hinter ihm eine ärgerliche Stimme: „Natürlich, die Penner, die rennen bei Rot über die Straße.“ Neben Pitt eine andere beruhigende Stimme: „Der rennt nicht über die Straße, weil er ein Penner ist, der ist ein Penner, weil er bei Rot über die Straße rennt.“
Tatsächlich war an dieser Ampel zu beobachten, dass sich Menschen, die am stärksten auf die Hilfsbedürftigkeit der Gesellschaft angewiesen sind, nicht selten an Krücken oder im rasend fortbewegten Rollstuhl, an dieser Ampel besonders oft, leichtfertig und riskant für ihr eigenes Leben, über ihre so gemeinnützig gemeinten Vorschriften hinwegsetzen – das hat nur anekdotische Evidenz, ist keine Annahme a priori.
Warum hat Pitts ungeduldige Warteseele nicht den Sprung in die Freiheit gewagt, zu der doch ein Mensch, den das Leben nicht mit Glücksgaben überhäuft hat, den Mut und die Keckheit gehabt hat. Warum hat er selbst den Gessler-Hut gegrüßt, der als Unterwerfungssymbol in Gestalt zweier oder dreier Lampen am hohen Signalmast wie der Schlossturm eines abwesenden Landvogts vor ihm aufragte? Die Straße war wirklich leer, der sonst so strömende Verkehr war wirklich blockiert durch eine in der Ferne sichtbare konkurrierende Ampel.
Hatte er es nach dem kritischen Dialog der unwirsch am Kantstein Wartenden als unschicklich, ja illoyal empfunden, dem Wildgänger zu folgen, ohne den reflektierten Protest gegen sein Verhalten zu beachten? Oder hatte ihn, blitzhaft, die Erinnerung überfallen, dass er einmal, eine Straße ohne Ampel und ohne Zebrastreifen überquerend, von einem aus einer Seitenstraße kommenden Pkw auf die Haube genommen war, elegant über sie abrollen konnte (er war noch jung) und neben dem Kantstein (oder dem Randstein, denn es war eine süddeutsche Stadt) landete, ohne anhaltendes Trauma (nimmt er den beschädigten Ärmel aus, der ihm einen neuen, vom Schuldigen bezahlten Anzug eintrug).
Hatte er sich dem Wildgänger moralisch überlegen gefühlt, weil er, den Verkehrsvorschriften Folge leistend, der loyale Bürger sein wollte, der auf Mit- und Gegenmenschen in seiner Umgebung, nicht nur auf möglicherweise zuschauende Kinder, musterhaft korrekt wirken wollte? Dabei könnte es als ein Akt sozialer Rücksichtnahme wirken, wenn er beim Spaziergang die Bettelampel am Roten Hahn nicht auf Grün programmieren würde, um den Autos das Bremsen oder Warten in der Rotrestzeit zu ersparen (was sogar ökologisch sinnvoll wäre).
Oder hatte er sich ihm unterlegen gefühlt, weil es seinem Herzen an Abenteuerlust und Risikofreude fehlte, an der Unbekümmertheit, in der starke, „lockere“ oder unverfrorene Charaktere ihrem persönlichen Willen folgen – einem entfesselten, der nicht durch Gesetze und moralische Anschauungen präformiert ist, sondern freibeuterisch wie Bommi Baumann dem eigenen Typ gehorcht, der sich selbst seine Richtlinien gibt. Getreu dem Titel des aufrührerischen Buches der Psychologin Ute Ehrhardt „Gute Mädchen kommen in den Himmel, böse überall hin“, eines Megasellers, indem Hunderttausende auch ohne den feministischen Zeigefinger eine Aufforderung zu befreienden „goldenen Rücksichtslosigkeiten“ (Theodor Storm) sehen wollten.
Ist die Geduld an und mit Ampeln etwa gar eine Gewissensfrage, die uns in das Labyrinth gesellschaftlicher und individualpsychologischer moralischer Orientierung führt? So unbekümmert gesetzlos, so anarchisch sorglos kann kein durch die Zivilisation domestiziertes wildes Wesen sein, um vor dem Rot einer Ampel, das missachtet wird, nicht einen Gewissensbiss, vor ihrem Gelb eine meditative Hemmung und vor ihrem Grün eine Befreiung zu erfahren.
Wie immer seine persönlichen oder wirtschaftlichen Verhältnisse sein mögen: der Mensch kann sich an den Kantsteinen nicht über die Nötigungen von Ampeln hinwegsetzen, auch wenn er sich ihnen in Willkür entgegenstellt. Natürlich haben die Tausenden Bankiers, die in hemmungsloser Gier durch Scheingeschäft mit Wertpapieren den Staat um Milliarden betrogen haben, den Mückenstich ihres Gewissens gespürt, auch wenn sie in verachtungsvollem Überlegenheitswahn sich klüger als die Ämter und dadurch gerechtfertigt sahen. Und auch die Elenden, die zum Drob Inn hasten, weil sie in ihrem Elend gar keine Kraft haben, über Regeln nachzudenken, werden kein gutes Gefühl haben, wenn sie sich ihrer Regellosigkeit überlassen. Auch ihnen geht es wie dem Jean Valjean im Roman „Die Elenden“, den Pitt seit seiner Kindheit in einer volkstümlichen Ausgabe mit einigen eigenhändigen Illustrationen Victor Hugos besitzt: „Ich bin ein Galeerensträfling, der seinem Gewissen folgt.“ Auch wenn er mit seinem Leben nicht zufrieden ist, weiß er: „Der Mensch muss mit sich selbst zufrieden sein“.
2 KI im Doppel
In der Königsberger Kopfsteinwelt wird es auch Kantsteine gegeben haben. Der Philosoph Kant1 wird an ihnen nie ein Signal der Vorsicht nötig gehabt haben, um sich nicht in Verkehrsgefahren zu bringen, denn durchgehende Gäule verursachen mit ihrem Gespann genug Lärm, der warnen kann. Und doch hat er sich die Frage gestellt und ein Leben lang über sie nachgedacht: Kann es Gebote geben – er nennt sie „Imperative“ –, die uns sagen, wie wir uns im menschlichen Verkehr und uns selbst gegenüber nicht nur klug (wie es der Freiherr Knigge später im Auge hatte), verhalten sollten, sondern auch vernünftig: in Achtung vor der Freiheit und Würde der Person. Hat uns Immanuel Kant wesentliche Softwareprogramme geschrieben, die wir uns jederzeit und an jedem Ort als App herunterladen können?
Im November 1767 – der gut Vierzigjährige hatte noch keines seiner großen Werke geschrieben – informierte Immanuel Kant den zwanzig Jahre jüngeren Johann Gottfried Herder, der bei ihm schon moralphilosophische Vorlesungen gehört hatte, dass er über eine „Metaphysik der Sitten“ nachdenke. Ehe er diese Arbeit angehen könne, müsse er danach trachten, „die eigentliche Bestimmung und die Schranken der menschlichen Fähigkeiten und Neigungen zu erkennen“. Plagten ihn Zweifel, was er überhaupt den Menschen in ihrer konstitutionellen Selbstliebe an sittlichen Verhaltensregeln, die nicht religiös-testamentarisch gesichert sind, sondern von der Vernunft auf Brauchbarkeit abgeklopft werden, überhaupt zumuten könne? Herder, der sich in einem Brief an Kant zu einer „Philosophie des Lebens“ bekennt, nimmt lebhaft teil an der „werdenden Moral“. Sie „wird“ noch bis zum Jahr 1785, in dem die „Grundlegung“2 einer solchen „Moral“ erscheint, und erst 1797 erscheint das so früh angedachte Werk zur Metaphysik der Sitten als Schlusspunkt im Lebenswerk eines 73-Jährigen.
Wie ist dieser lange Weg zur Wahrheit zu erklären? Der Philosoph will zunächst diese „Fähigkeiten“ des Menschen in ihren Grenzen und Möglichkeiten und ihr Zusammenspiel mit seinen „Neigungen“ erkunden, ehe er ihm einen moralischen, auf seinen Königsberger Norden geeichten Kompass an die Hand geben kann. Allerdings: So praktisch orientierend wie ein geistig-seelischer Navigator erweist der sich trotz allen Nachdenkens über die „praktische Vernunft“ gerade nicht.
In seiner Korrespondenz mit dem Schweizer Mathematiker Johann Heinrich Lambert, einem genialen Autodidakten, erläutert Kant dem anregenden Logiker 1770 sein Konzept. Der Vorstoß zu einer das Handeln bestimmenden unanfechtbar verbindlichen Moral verlange, dass eine moralische Entscheidung von allen empirisch beobachtbaren sinnlichen Einflüssen und Bedingungen befreit werden müsse, „rein“ sein müsse. Um eine Moral aus Vernunftgründen etablieren zu können, müsse sie prinzipiell von aller „Beimischung des Sinnlichen“ befreit werden. Es müsse die kritische Grenze zwischen der Welt der sinnlichen Phänomene und einer von Vernunftgründen bewegten Sittlichkeit eindeutig bestimmt werden. Auf diesen Grenzstreifen hat Kant seine „Kritik der reinen Vernunft“ (und zum Teil auch der „praktischen Vernunft“) wie einen gewaltigen Wachtturm gewuchtet: Alle Werke, mit denen Kant weltberühmt geworden ist, waren nur Vorstudien, wären nur eine „propädeutische“, d. h. vorbereitende Disziplin, so wie Eichenpfähle in den Morast gerammt werden, um stabile nachhaltige Gebäude auf ihnen zu errichten. Ein in der Geistesgeschichte unvergleichlich ungeheurer Plan! Ehe wir uns Gedanken darüber machen können, was wir tun sollen, müssen wir wissen, was wir überhaupt wissen können.3
Wir leben am Beginn eines Äons, in dem Utopien für ein Überleben der Menschheit in einem Wissensuniversum mit galaktischen Kolonien gegen die Furcht entwickelt werden, der Globus könnte den Menschen unter den Füßen wegbrechen oder -schmelzen. Eine Longevity einer totalen, auf Künstliche Intelligenz gestützten Wissensgesellschaft, die sich von individuellen Fähigkeiten völlig gelöst hat, soll in kosmischen Dimensionen den menschlichen Geist von den Fesseln des Irdischen befreien und ihm so das Überleben als superintelligente Gattung sichern.
In dieser Welt der angewandten Logik muss es keine Ampeln an frequentierten Straßen und Kreuzungen geben, um Schäden von Leib und Sachen abzuwenden. Die mobile Gesellschaft organisiert sich aus humanen und technisch autonomen Hirnstrukturen, die keine Entscheidungen mehr brauchen, sondern nur noch prompte Reaktionen auf eindeutige Informationslagen. Die Künstliche Intelligenz ist das kollektive Superhirn mit unzählbaren und ins Unendliche verfeinerten Synapsennetzen zwischen den Mensch-Maschine-Zellen. Moralische Entscheidungen müssen nicht getroffen werden, weil sie in diesem System nicht nötig sind. Niemand muss nach Gründen für Entscheidungen fragen. Persönliche Entscheidungen wären äußerst bedauerliche Störungen, in denen sich die geistmechanischen Abläufe verheddern. Dass einer bei Rot über eine Ampel – gäbe es sie noch – läuft, wäre keine Regelwidrigkeit, sondern ein mathematisch minimiertes Restrisiko, wie es die Pharmazie für ihre Alleskönner- Präparate in den Beipackzetteln beschreibt. Sind die Auspizien verheißungsvoll? Es beruhigt Pitt ein wenig, dass einer der KI-Pioniere, ein Franzose, den so humanen Namen Arthur Mensch trägt (wie Pitt gerade aus seiner Sonntagszeitung erfahren hat).
Das alles konnte Immanuel Kant in seinem Jahrhundert nicht ahnen, aber er hatte dennoch die Gültigkeit seines Imperativs von totaler Transparenz abhängig gemacht. Sein Imperativ ist kategorisch, das heißt, er ist unabhängig und muss „gesäubert“ werden von allen situativen Bedingungen und Empfindungen. Er spricht ein kategorisches Nein gegen alle Entschuldigungen, die Menschen für ein persönliches oder gesellschaftliches vernunftwidriges Handeln aufs Tapet bringen. In seiner großen anthropologischen Neugier, die auf ein Weltwissen zielte, wäre Kant von den Möglichkeiten der Künstlichen Intelligenz, die irgendwann alle Fragen beantwortet, entzückt gewesen, selbst wenn er sein professorales Monopol zu verlieren befürchten musste. Oder wäre die Verheißung einer allwissenden, alles in klugen Urteilen verknüpfenden künstlichen Intelligenz für ihn nicht doch nur ein kleines Kapitel in seinen „Träumen eines Geistessehers“ gewesen?
An unserer Ampel erkennen wir gleichzeitig die in Farben (und für Blinde in akustischen Signalen) sinnlich erfahrbare Fremdbestimmung, die Heteronomie, und die Autonomie der Person, die ein kategorisches Gebot unter ein Vernunftgesetz stellt, das uns frei sein lässt, wenn wir ihm gehorchen.
So lang kann eine Ampelphase nicht sein, um die Tragweite des Zusammenpralls des Kantschen KI, des Kategorischen Imperativs, und der KI, der Künstlichen Intelligenz, als Verheißung der kommenden Welt- und Universalregierung zu bedenken. Aber lassen wir uns nicht von Ampeln stressen, auch nicht, wenn eine von ihnen, am Hamburger Glockengießerwall, uns die Sekunden bis zum Farbwechsel vor Augen führt, damit wir Wartenden wissen und uns energetisch darauf vorbereiten können, beim Grün wie ein Kurzstreckenläufer zu starten.
3 Das Gericht in mir
Es gibt immer wieder diese Ampel-Sekunden zwischen Rot und Grün, wo wir uns entscheiden müssen, ob wir dem Vernunftgesetz folgen oder unserer wie immer vor uns selbst gerechtfertigten Willkür. In dieser kleinen Zeitspanne liegt das ganze Feld der Gewissensentscheidungen vor uns. Nach Kant belehrt uns das Gewissen nicht in erster Linie über unsere Pflichten gegenüber Mensch und Gesellschaft, sondern über unsere Pflicht gegen uns selbst: gegen die Menschheit in jedem von uns.
Nachdem Kant den Geltungsbereich seines KI sorgfältig abgesteckt hat, kann er sich in dem Werk, in dem alle seine Überlegungen münden, nämlich in die „Metaphysik der Sitten“, der Erscheinung des Gewissens zuwenden, das für uns Nicht-Philosophen mit ihrem auf Alltagserfahrungen begrenzten Intellekt wichtiger ist als für ihn, der das Vernunftgesetz kennt.
An der Ampel habe ich nicht einen Richter im Nacken, sondern ein ganzes Gericht in mir. „Das Bewusstsein eines inneren Gerichtshofes im Menschen (‚vor welchem sich seine Gedanken einander verklagen oder entschuldigen‘) ist das Gewissen.“ In mir wohnt ein Staatsanwalt als Hüter und intimer Kenner meiner „intelligiblen“, also nur in der Vernunft vorstellbaren Person und auch ein Verteidiger, der mein empirisch-tatsächliches Wesen mit seinen Bestrebungen, die dem Vernunftgesetz nicht oder nur zufällig entsprechen, vertritt. Doch der Gerichtshof hat keinen Richter. Wohnte auch er in mir, gäbe es einen Widerspruch: Ich kann mich nicht selbst aus meinem tatsächlichen Leben, aus meiner empirischen Existenz, herausheben und mich am „reinen“ Vernunftgesetz messen. Ein von Kant inspirierter Richter in mir hat nicht einmal die Vollmacht, mich freizusprechen, denn die persönlichen Motive einer Entscheidung sind nicht erkennbar, weder für ihn noch für mich selbst.
Mit der Unwahrhaftigkeit im ethischen Sinn – deren rechtliches Pendant die Lüge ist – muss sich Kant nur in einem kurzen Absatz seiner „Metaphysik“ beschäftigen, denn er hat in ihrer „Grundlegung“ ein Dutzend Jahre zuvor das Nötige gesagt. Die größte Verletzung der Pflicht des Menschen als moralisches Wesen gegen sich selbst, gegen die Menschheit in seiner Person, ist die Lüge – das „Widerspiel der Wahrhaftigkeit“. Oh, die harten Sätze! „Die Lüge ist Wegwerfung und gleichsam Vernichtung seiner Menschenwürde.“ Die Lüge im ethischen Sinn ist nicht nur verwerflich, wenn sie anderen Schaden zufügt. Sie ist ein „Verbrechen des Menschen an seiner eigenen Person.“
Viele Anwendungen oder handliche Apps für den Geltungsbereich seines Kategorischen Imperativs hat uns Kant in seinen Schriften nicht geliefert. Es sind, wenn man’s genau nimmt, nur vier, die er, wie einem beiläufigen Einfall gehorchend, in seine schwierigen Texte streut (Experten haben ein halbes Dutzend weiterer Fälle gefunden). Seine Beispiele sollen auch nicht zeigen, dass der Imperativ praxistauglich ist, denn dann wäre er nur eine „praktische Regel“. Sie dienen in ihrer logischen Trennschärfe dem Nachweis, dass die Gebote allgemeingültig sind und notwendig für alle Vernunftwesen gelten, wobei es keineswegs eine Nebenbedingung ist, dass sie in sich logisch widerspruchsfrei sein müssen.
Die Applikation „Unwahrhaftigkeit“, die er in der „Kritik der reinen Vernunft“ schon einmal angesprochen und in der „Metaphysik der Sitten“ betrachtet hat, kehrt wieder in einer schmalen Extra-Schrift: „Über ein vermeintes Recht, aus Menschenliebe zu lügen“ (einer seiner letzten Schriften überhaupt). Sie zeigt viel stärker als die anderen Beispiele, wie rigoros Kant die Geltung seines Imperativs verteidigt. Er schießt eine Breitseite gegen den gesunden Menschenverstand und gegen den Schlendrian, in dem wir uns von seiner Geltung dispensieren.
Er sah sich herausgefordert durch einen Artikel von Benjamin Constant, dem liberalen Staatsphilosophen und Napoleon-Freund. Der hatte die These vertreten, die Wahrheit zu sagen sei Pflicht, jedoch nur dem gegenüber, der ein Recht habe, sie zu erfahren. Wo keine Rechte, keine Pflichten. Auch habe kein Mensch ein Recht auf eine Wahrheit, die anderen schaden könnte.
Und Constants schlagendes Beispiel hört sich so an: Ein Hausherr, an dessen Tür ein Mörder klopft und fragt, ob sich der von ihm Verfolgte in sein Haus geflüchtet habe, darf belogen werden, um Schaden von dem Verfolgten abzuwenden. (Wobei Pitt sich fragt, woher der Hausherr wisse, einen Mörder an der Tür zu haben – ist der stadtbekannt oder sieht er so aus?) Nein! donnert Kant. Der Hausherr, ein „Nein“ sagend, könne nicht wissen, ob der Bedrohte nicht unbemerkt das Haus verlassen habe, und dann könnte der Mörder ihm im Freien begegnen und seine Tat verüben. Auch wenn er Ja gesagt hätte, wäre das für den Geflüchteten kein Todesurteil gewesen, denn er könnte ja das Haus unbemerkt verlassen haben. Wenn der Mörder nach dem Verfolgten im Haus hätte suchen können, wären vielleicht Nachbarn aufmerksam geworden und hätten ihn unschädlich gemacht. Eine „gutmütige Lüge“, meint Kant, könne „zufällige Folgen“ haben. Wahrhaftigkeit sei Pflicht, auch wenn Nachteile für andere nicht ausgeschlossen werden könnten, ja, die Lüge bleibe stets verwerflich, auch wenn niemand durch sie geschädigt worden wäre. In einer Fußnote meint Kant, das Böse sei nicht durch den Brudermord des Kain in die Welt gekommen, sondern schon durch die Lüge im Paradies (gemeint ist wohl das lügenhafte Versprechen der Schlange).
Und wenn der Hausherr sein wahrhaftiges Ja gesagt hätte, der Mörder gewaltsam in das Haus eingedrungen wäre und sein Opfer getötet hätte? Dann hätte der Hausherr moralisch gerechtfertigt im Licht der Wahrheit gestanden, und er wäre für die Tat nicht verantwortlich gewesen (wenn er ohnmächtig gewesen wäre, sie zu verhindern, denn es gibt bei Kant natürlich auch den Vorwurf der unterlassenen Hilfeleistung). Der Hausherr hätte in seiner Wahrhaftigkeit die „Menschheit in sich“ gerettet, aber den Menschen unter seinem Dach verraten. Beispiele, die von der Rigorosität der Kantischen Ethik geprägt sind, sind oft vertrackt konstruiert. Seine Ethik zeigt nicht selten eine harte Kante und erlaubt nicht eine Unentschiedenheit des Tennisballs auf der Netzkante.
Das für Kant so zentrale Gebot, nicht zu lügen, dessen Missachtung das moralische Weltgebäude erschüttert, wird in den testamentarischen Geboten, im achten, nicht eindeutig ausgedrückt. Vielleicht müsste man Theologie studiert haben, um zu erkennen, ob das biblische „Nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten“ die Lüge meint oder die Lüge einschließt (neben übler Nachrede und Ehrabschneidung, die in den sozialen Medien ein oft kindisches Massenphänomen sind), eine Falschaussage vor Gericht bedeutet oder ob es eine Umschreibung des Wortes Lüge in Luthers konkreter und eigenwilliger Sprache ist.
In zwei wunderbaren Romanen des besonders lügenhaften und unmenschlichen 20. Jahrhunderts, die auf Pitts Bücherbord im höheren Zufall des Alphabets nebeneinanderstehen, haben große Autoren wohltätige Wirkungen von Lügen geschildert.
Jakob der Lügner im gleichnamigen Roman des in einem Ghetto geborenen Jurek Becker hört bei seiner Arbeit im Ghetto zufällig Radionachrichten über die Bewegungen der russischen Armee – der Besitz eines Radios ist bei Todesstrafe verboten. Ein Kollege, den er in seine intime Kenntnis einweiht, kann das Geheimnis nicht hüten, und die Bedrängten und Verfolgten bestürmen Jakob, sie am neuesten Stand der Radioinformationen teilhaben zu lassen. Das tut der widerstrebend, und da er von der Radioquelle abgeschnitten ist, erfindet er ständig neue, eine baldige Erlösung aus dem Lagerelend versprechende phantasievolle Nachrichten, die sich verbreiten. Das Leben kehrt zurück in das Ghetto – „die Leute sind völlig verrückt, die Selbstmordziffern sinken auf Null“. Die erste Lüge war eigentlich keine, die Kette danach ist als Lüge gerechtfertigt: „die Hoffnung darf nicht einschlafen, sonst werden sie nicht überleben.“ Es ist eine abstrakte Wahrheit: „die Russen sind auf dem Vormarsch.“ 4
Zu den vielen „Lügen in Zeiten des Krieges“, von denen Louis Begley erschütternd erzählt hat, gehört auch die Teilnahme des zehnjährigen jüdischen Jungen Maciek in Polen an der Kommunion: “Falsch-Zeugnis-reden war verboten, aber schwerwiegende Lügen und Heucheleien waren dasselbe wie Falsch-Zeugnis-reden. Ich log und heuchelte jeden Tag – allein deshalb steckte ich tief im Sündenpfuhl.“ Seine Tante Tanja – die von einem deutschen Offizier vom Abtransport nach Ausschwitz befreit wurde, weil sie sich bei Thomas Mann auskannte – hält von Macieks Skrupeln nichts: „Wenn Jesus Christus zulässt, dass solche Dinge geschehen, dann ist das seine Sache, nicht deine.“ 5 Die klug-couragierte Frau beherzigt den Hauptlehrsatz für alle Lügner: „Lügen müssen konsistent sein – konsistenter als die Wahrheit“, denn „Erfindungsgabe und Gedächtnis haben Grenzen“. Das Lügengebäude ist nicht eingestürzt – weil es ein Moralgebäude war?
4 Einige Etagen tiefer: Pitts Fall
Der Biss des Gewissens kann weh tun, und er ist schmerzhafter, wenn ein Publikum sein Zeuge ist. Pitt war Teilnehmer des Kongresses der Public Relations Gesellschaft, deren Mitglied er war, denn sein Metier in seinem Unternehmen war es auch, dafür zu sorgen, dass es ohne kritische Blessuren und möglicherweise mit ein bisschen Glanz aus den Meinungskämpfen in Medien, Gesellschaft und Mitarbeiterschaft hervorginge – nach einem persönlichen, nicht professionellen Motto in diesem Berufsstand, das er von Rainer Maria Rilke entlehnt hat: „Wer spricht von Siegen, Überstehen ist alles.“ 6 Die Gut-Wetter-Macher wird man in ihrer Meinungsdiplomatie nicht per se für unwahrhaftig halten.
Eben war sein großes, in manchen Regionen ehemals marktführendes genossenschaftliches Unternehmen mit vielen Tausenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in ein entlarvendes Scheinwerferlicht kritischer Medien und in bedrohliche Blitzgewitter von Banken und Geschäftspartnern geraten. Nach einem Jahrhundert erfolgreicher, nicht selten beispielhafter Arbeit war es an den Rand des Ruins geraten, und der Vorwurf an den Pressesprecher und die Verantwortlichen in den Führungsorganen war nicht abzuweisen, dass die Kommunikation mit der Öffentlichkeit nicht der Maxime der Wahrhaftigkeit gefolgt war. Ein Anschein strafrechtlich relevanter Phänomene verstärkte die Kritik. Natürlich haben in unserer Zeit alle so genannten Stakeholder eines Unternehmens, nicht nur seine Aktionäre, ein Recht auf die Wahrheit, wie sie von Benjamin Constant als Voraussetzung der Pflicht, Fragen – aber auch ungefragt – wahrhaftig oder wenigstens redlich zu beantworten, gefordert wurde. Nicht nur die Presse und andere Medien, auch die Öffentlichkeit insgesamt hat sich mit Hilfe modern-subtiler Lautsprecher den Anspruch darauf, Antworten auf Fragen zu erhalten, in einem heftigen Wettbewerb erobert.
Ein früherer, durchaus charismatischer Bundesminister mit einer sternengleichen Karriere, jetzt Vorstandsmitglied eines bedeutenden Medienunternehmens, war von den Öffentlichkeitsarbeitern eingeladen worden, die Konfliktfelder und den gesellschaftlichen Nutzen ihrer Arbeit zu reflektieren – was er brillant tat. Und dezent, doch deutlich übte er Kritik an dem Kommunikationsleiter eines schlingernden Unternehmens, der dazu beigetragen habe zu verschleiern, dass der Vorstand seines Unternehmens allem Anschein nach „unehrlich“ agiert habe. Jeder im Saal wusste, welches Mitglied des Berufsverbandes gemeint war, und schaute in unauffälliger Teilnahme auf den unrühmlichen Verteidiger offenbar unhaltbarer Positionen. Schließlich kam die ernsthafte Kritik von einem Professor für Kultur und Medienmanagement an einer Hochschule für Musik und Theater, und ganz sicher hatte er die Kritisierten nicht in den Mittelpunkt einer theatralischen Inszenierung stellen wollen, die auf den Medienplattformen so beliebt sind.
Von einem Pressesprecher – auch von anderen Mitarbeitenden – wurde in den 1980er Jahren noch nicht erwartet, als Whistleblower zu agieren, wenn er in seinem Unternehmen von Tatbeständen erfährt, die gegen Gesetze, Verordnungen und die guten Sitten verstoßen; heute ist er durch Vorschriften der EU und der Regierung nicht nur gerechtfertigt, sondern sogar moralisch verpflichtet, es zu tun. Er musste früher, wenn ihn sein Gewissen drückte, seine Insiderkenntnisse von Kritikwürdigem auf sehr konspirativen Wegen an die Medien herantragen, die ihm nicht selten stattliche Honorare als Risikoprämie für einen eventuellen Verlust des Arbeitsplatzes zahlten; so war es in dem größten europäischen Wohnungsbauunternehmen, einem Schwesterunternehmen des in Pitts Fall kritisierten Unternehmens, ein paar Jahre zuvor mit desaströsen Folgen für beide Unternehmen und ihre gemeinsamen Miteigentümer geschehen.
Eine Unternehmensgruppe, deren Interessen Pitt mit viel Engagement, ja Herzblut vertrat, hatte im Wettbewerb ihre früheren Vorsprünge, ja ihr Geschäftsmodell verloren und hatte sich einen für viele schmerzhaften Reformprozess verordnet, der gleichzeitig ein Sanierungsprozess war, denn viele ihrer Mitglieder waren, ohne dass sie es selbst wahrhaben wollten, schon aus dem Markt geschleudert worden. Pitt hat in seiner Arbeit diesen Reformweg als einen notwendigen Hospitalaufenthalt dargestellt, der angesichts bedeutender (leider überschätzter) Ressourcen selbstverständlich zu einer Genesung führen würde. Doch die versprochenen Resultate hatten sich nicht eingestellt.
Das zentrale Problem lag – neben einer teilweile unzulänglichen Managementqualität – darin, dass der Reformweg nur durch sehr schwache finanzielle Mittel gepflastert war. Eine Bank, die als Aktionär mit einer großen Beteiligung Hilfestellung geleistet hatte, zog sich irgendwann zurück und die Kapitalnot wurde schreiend. Ein im luftleeren Raum flottierendes Kapital wurde von Beteiligungsgesellschaften übernommen, die meistens kein eigenes Kapital hatten, sondern sich von dem Unternehmen, das sie finanzieren sollten, finanzieren und kontrollieren ließen. Am Ende der Agonie besaß der Vorstand des Unternehmens mittels gewagter Konstruktionen die volle Kontrolle über die eigene Aktiengesellschaft, sie war faktisch „zu einem Stück von ihm“ geworden (ob das auch rechtlich der Fall war, wurde in einem aufwendigen Gerichtsverfahren nie geklärt). Ob er sich an seinem Quasi-Besitz hätte erfreuen können, stand in den Sternen, denn das Unternehmen war immer noch nicht gesund. Seine Bilanz war in den Aktiven und Passiven ein in dünner Luft sehr hochgestiegener Luftballon, der jeden Augenblick platzen konnte.
Das Unternehmen war zu einer Aktiengesellschaft geworden, wie sie von der Performance-Künstlerin Maria Eichbaum auf der Kasseler Documenta 11 in einem genialen Werk in einer Reihung brillant fingierter Dokumente als Prototyp einer Aktiengesellschaft ohne Aktionäre dargestellt worden ist – als ein Unternehmen, das sich selbst gehört. Nur hatte ihr fabelhaftes Kunstwerk keinen Gewinnzweck: es sollte sich nur selbst erhalten und damit den Kapitalismus ad absurdum führen (was heutzutage ernsthaft als Chance einer gemeinwohlorientierten Unternehmensform diskutiert wird). Ein Kunstwerk unterliegt nicht dem Strafrecht, das es einer Aktiengesellschaft verbietet, eigene Aktien zu halten, es sei denn, sie kaufe sie aus eigenen Mitteln zurück oder widme sie eng umrissenen Zwecken. Ob die Verantwortlichen in Pitts Fall nicht doch den von Maria Eichbaums Kunstwillen streng verschlossenen Tresor, in dem das eigentümerlose Gesellschaftskapital gehortet wird, eines Tages geöffnet hätten, ist zweifelhaft. Den Schlüssel zu ihm hatten sie nicht fortgeworfen.
In Pitts Fall hatten sich vier bedeutende Großbanken bereit erklärt, das Kapital der Pseudo-Aktionäre durch Kredite zu finanzieren. Pitts kommunikatives Kunststück musste darin bestehen, zu verhehlen, woher das Kapital kam und wem es gehörte und wem letzten Endes sein Unternehmen überhaupt gehörte. Er wurde oft gefragt, wer das Kapital der Pseudo-Aktionäre besitze. Er hatte glaubwürdige Narrative entwickelt, woher die Mittel für die Beteiligungen stammten – nämlich angeblich aus den Relikten und Reserven von Traditionsunternehmen der Gruppe in ihrer ruhmreichen Vergangenheit. Er konnte überzeugend darüber berichten, denn er war stolz auf diese Traditionen, die nicht fingiert waren.
Als die unüberschaubar verschachtelte und verschleiernde Beteiligungsstruktur durch die Recherchen eines für seinen investigativen Stil geachteten und gefürchteten Magazins offenbart wurde, war das Vertrauen in die Seriosität der Verantwortlichen zerstört. Vertrauen ist das eigentliche Kapital eines Unternehmens. Es geriet an den Rand des Konkurses.
Am Rand eines Abgrunds hatte Pitt, der Sprecher, verzweifelt versucht, einen Anker für das Unternehmen zu werfen. Er hatte das fragwürdige, durch die Hilfe der Großbanken ermöglichte Konstrukt gebeichtet und sie dadurch genötigt, ihre Darlehen in echte Beteiligungen umzuwandeln und damit Verantwortung für das Unternehmen „vor Merkur und den Menschen“ zu übernehmen. Das taten sie auch in großer Entschlossenheit, und das Unternehmen konnte geordnet und unter Schonung der meisten der Arbeitsplätze ohne Konkurs, allerdings mit einem für die Gläubiger schmerzlich großen Milliarden-Verlust abgewickelt werden. Pitt hatte zunächst gegenüber einem auf Interna spezialisierten Nachrichtendienst seine Enthüllung platziert, doch dessen Renommee reichte nicht, um seine Informationen glaubwürdig zu machen: die Wahrheit wurde Pitt nicht geglaubt. Sie war allerdings skurril genug. So hatte er sich um ein Gespräch mit dem jungen Redakteur eines bedeutenden europäischen Blattes aus der Finanzwelt bemüht, um gemeinsam mit einer objektiven Intelligenz der Wahrheit eine Gasse zu bahnen.
Doch der Versuch, die Wahrheit zu retten, entschuldigte Pitt nicht. Denn er stand mit dem Lügenbekenntnis am Ende einer Kette von Lügen, die irgendwann kein neues Glied mehr gefunden hätte, in dem sie sich hätte fortsetzen können. Sein Geständnis, wäre es von allen Verantwortlichen getragen worden, hätte strafmindernd, aber nicht ehrenrettend wirken können. Daran hätte sich auch nichts geändert, wenn er die Lüge als eine Unterdrückung der Wahrheit deklariert hätte (was er sich selbst gegenüber natürlich tat). Übrigens: das Halten eigener Aktien in einem Unternehmen wird in der Praxis in der Regel nur strafrechtlich verfolgt, wenn es im Zusammenhang mit Betrugsmanövern steht, die zu persönlichen Bereicherungen führen, doch davon war Pitt nichts bekannt.
Lügengespinste beginnen irgendwann mit einem Knoten, der einen zweiten braucht, um ihn zu stützen, und einen dritten, um das Netz irgendwo aufhängen zu können. Als Pitt sich in einer Pressekonferenz gehalten sah, einen ersten Knoten zu schürzen, weil er zur Wahrheit nicht befugt war, wusste er, welche Knüpfarbeit auf ihn zukommen würde. An diesem Tag hatte er seinem privaten Tagebuch einen neuen Namen gegeben: „Diary of Disaster“. Der Reformweg, auf dem er sein Unternehmen begleitete, war schon sieben Jahre alt gewesen und hatte noch keine überzeugenden Resultate gebracht. Warum hat er nicht wie Graf Douglas gesagt: „Ich habe es getragen sieben Jahr und kann es nicht länger tragen mehr“. Er hätte kündigen müssen. Er hat es nicht getan. Die Frage, warum er es nicht getan hat, wäre in der Antwort nicht frei von Selbsttäuschungen gewesen. Ein berühmter Mann der PR- und Presseszene, der Graf Zedtwitz- Arnim, hatte einmal gesagt: „Der PR-Mann muss auf gepackten Koffern sitzen.“ Er hatte sie nicht in die Hand genommen.
Nicht lange vor dem tatsächlich eingetretenen Desaster hatte der CEO des Unternehmens, also das hauptverantwortliche Vorstandsmitglied, ein Gespräch mit der temperamentvollen Autorin eines Buches über Manager geführt. Sie hatte ihn nach Philosophen gefragt, die ihn beeindruckt hätten. Er nannte Arno Plack. Und auf die Frage, ob er einen besonders eindrucksvollen Satz zitieren könne, fragte er, ob er auch mit einem Titel dienen könne. Ja? „Ohne Lüge leben“. Das machte Pitt sprachlos – er hatte den Bestseller mit seinen fünfhundert Seiten auch schon mal gelesen. In diesem Augenblick tat ihm der CEO, sein Leidensgefährte in der Lüge, leid, wobei das Gewicht seiner Lüge gemäß seiner Verantwortung und seiner Gehaltsklasse tausendmal schwerer wog als Pitts.