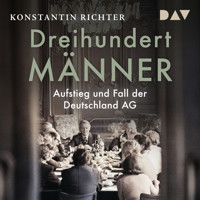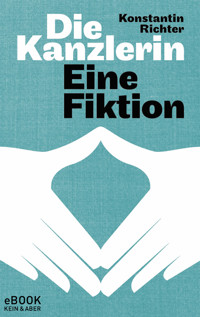
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kein & Aber
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Was geht im Kopf der Kanzlerin vor? Und was hatten Kohlrouladen und die Opern von Wagner mit ihrer Flüchtlingspolitik zu tun? Dieses Buch lässt Angela Merkel als tragikomische Figur von Shakespeare'schem Format lebendig werden. Überraschend, scharfzüngig und äußerst amüsant.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 198
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
INHALT
» Über den Autor
» Über das Buch
» Buch lesen
» Impressum
» Weitere eBooks des Autors
» Weitere eBooks von Kein & Aber
» www.keinundaber.ch
ÜBER DEN AUTOR
KONSTANTIN RICHTER, geboren 1971, hat bei Kein & Aber zwei Bücher veröffentlicht: Bettermann und Kafka warjung und er brauchte das Geld. Er hat für deutsch- und englischsprachige Medien über Merkel und die Flüchtlingskrise geschrieben und ist Contributing Writer für das US-Nachrichtenportal Politico. Im Jahr 2011 gewann er den Deutschen Reporterpreis für eine Reportage in der Zeit.
ÜBER DAS BUCH
Was geht im Kopf der Kanzlerin vor? Was macht sie traurig? Und was hatten Kohlrouladen und die Opern von Wagner mit ihrer Flüchtlingspolitik zu tun? Dieses Buch lässt Angela Merkel als tragikomische Figur von Shakespeareschem Format lebendig werden. Überraschend, scharfsinnig und äußerst amüsant.
»Ein Roman über Merkel – das ist so schwierig wie ein Rocksong über Edmund Stoiber oder ein Liebesgedicht an ein Chamäleon. Konstantin Richter hat es geschafft.«
Harald Martenstein
Die Kanzlerin hatte sich vorgenommen, die ruhigeren Passagen von Tristan und Isolde zu nutzen, um über ein paar Dinge nachzudenken. Im Ersten Aufzug wollte sie das Griechenland-Hilfspaket behandeln. Im Zweiten Aufzug würde sie sich den hohen Asylbewerberzahlen widmen. Und im Dritten Aufzug hätte sie vor dem Liebestod bestimmt noch ein paar Minuten, um ein weiteres Mal die Minsker Vereinbarung durchzugehen, die den Frieden in der Ostukraine sichern sollte.
Zuhören wollte die Kanzlerin auch ein bisschen. Sie mochte klassische Musik, besonders Opern. So stand es zumindest auf ihrer Homepage. Nur hatte sie Tristan und Isolde schon oft gesehen. Sie war mit Handlung und Rezeptionsgeschichte hinreichend vertraut. Außerdem hatte sie die Mappe gelesen, die ihre Mitarbeiter zusammengestellt hatten. Etwaige Fachfragen, mit denen ja immer zu rechnen war, würde sie mühelos beantworten. Kurz: Sie konnte es sich leisten, einen Teil der Zeit, die ihr in Tristan und Isolde zur Verfügung stand, für die Arbeit abzuzweigen.
Die Kanzlerin fand ihren Platz in der Mittelloge des Bayreuther Festspielhauses. Da, wo vor mehr als hundert Jahren auch der König von Bayern gesessen hatte. Ihr Ehemann, auf dem Stuhl rechts neben ihr, fragte, ob sie das Telefon angelassen habe. Sie griff in die Handtasche. Selten, fast nie hatte sie das Telefon mehrere Stunden lang ausgeschaltet, bloß hier, in Bayreuth, wo ihr Mann darauf bestand, dass sie auch während der Pausen keine Textnachrichten schrieb. Was in Ordnung ging. Einmal im Jahr. Im Hochsommer.
Die Kanzlerin presste den Po gegen die Lehne des Stuhls, um aufrecht zu sitzen, wenn das Vorspiel begann. Ihr Kleid spannte. Sie hatte sich für ein zweiteiliges Ensemble entschieden, knöchellang, himmelblau. Die für diese Dinge zuständige Beraterin hatte ihr zu Blau geraten, weil im Vorfeld zu hören war, dass Tristan und Isolde ebenfalls Blau tragen würden. Doch das Kleid saß schon ein bisschen eng. Und es war heiß im Festspielhaus. Sehr heiß. Die Kanzlerin hatte in der Mappe gelesen, dass die Festspielleitung eine Firma beauftragt hatte, Messungen durchzuführen. Angeblich betrugen die Temperaturen im Zuschauerraum bis zu 30 Grad. Mit der Hand fächelte sich die Kanzlerin Luft zu. Sie fühlte sich schwach an diesem Spätnachmittag. Es ging ihr nicht gut, rein physisch. (Aber sie hätte auch nicht gewollt, dass man ihr zuliebe Umstände machte, die anderen Opernfreunde ertrugen die Hitze ja auch.)
Hinzu kam, dass die Kanzlerin soeben, auf dem Weg ins Festspielhaus, dem bayerischen Ministerpräsidenten begegnet war. Es verspreche nun wirklich eine spannende Aufführung zu werden, hatte sie unnötigerweise gesagt, und da der bayerische Ministerpräsident gefragt hatte: »Wieso spannend?«, war sie ins Detail gegangen, obwohl sie doch wusste, dass der bayerische Ministerpräsident empfindlich war und es hasste, wenn sie sich besser informiert zeigte als er. Dass die Sopranistin auf Weisung des Dirigenten ausgetauscht worden sei, hatte sie gesagt. Und dass man mit Interesse darauf schaue, ob der jungen Festspielleiterin der Tristan gelingen würde. Die Meistersinger nämlich habe die Festspielleiterin vor ein paar Jahren – die Kanzlerin hatte es salopp formuliert, weil sie nicht oberlehrerhaft klingen wollte – »glatt vergeigt«. Der bayerische Ministerpräsident hatte genickt (spöttisch, wie ihr schien) und sie einfach stehenlassen.
Mit Unbehagen dachte die Kanzlerin an die Begegnung zurück, sodass sie gar nicht bemerkte, wie die Lichter erloschen und das Publikum verstummte. Der dissonante Akkord, mit dem die Oper dann einsetzte, irritierte die Kanzlerin. Obwohl sie den berühmten Akkord kannte und wusste, dass die Irritation beabsichtigt war, traf er sie unvorbereitet. Wagner hatte einen Akkord gewählt, der reizen und aufwühlen sollte, das war schon klar. Aber irgendwie schien ihr der Tristan-Akkord heute noch unangenehmer als sonst. Lag es an der Interpretation des Dirigenten? Oder an der Hitze? Oder daran, dass der dissonante Akkord mit dem nicht minder dissonanten Gedanken an den bayerischen Ministerpräsidenten zusammentraf?
Die Musik beruhigte sich und ging über in jene wogenden Tonfolgen, die Wagner als »unendliche Melodie« bezeichnet hatte. In der Vergangenheit hatte die Kanzlerin Wagners unendliche Melodien oft zum Anlass genommen, um über komplexe Sachverhalte nachzudenken. Und die griechische Schuldenkrise, die sie auch schon unendlich lang beschäftigte, schien ihr wie gemacht für so eine unendliche Melodie. Doch diesmal störte sie die Musik in ihrer Konzentration. Die ganze Oper erschien ihr fürchterlich überspannt. Ja, sie ärgerte sich sogar über den Komponisten. Mit Tristan und Isolde hatte Wagner, wie sie wusste, die musikalische Entsprechung eines starken Gefühls schaffen wollen, das Werk war Ausdruck eines quälenden Sehnens – und die Kanzlerin dachte, dass sie sich in diesem Moment sicherlich nicht sehne, aber, verdammt noch mal, sie quälte sich schon ein bisschen.
Vielleicht, so dachte die Kanzlerin dann, war es an der Zeit, einmal zu überlegen, ob sie Wagner wirklich mochte. Sie schüttelte den Kopf und betrachtete ihren Ehemann von der Seite. Er hatte sein Opernglas auf die Bühne gerichtet, auf das hässliche Labyrinth aus Treppen und Brücken, das die Bühnenbildner aufgetürmt hatten. Hoffentlich hatte wenigstens er seinen Spaß. Ganz hatte sie nie verstanden, was ihn – den Quantenchemiker, der so lärmempfindlich war, dass er zu Hause am Kupfergraben auf dicken Strickstrümpfen über das Eichenparkett schlich und von ihr selbiges erwartete – ausgerechnet an Wagner reizte. Er war es, der Wagner so sehr liebte, nicht sie. Zwar hatte sie Wagner irgendwann zu ihrem Lieblingskomponisten erklärt. Aber das war eher ein Zugeständnis gewesen, nicht nur an ihren Mann, sondern auch an den konservativen Flügel ihrer Partei, der Wagner mehrheitlich ebenfalls schätzte.
Die Kanzlerin selbst hätte in diesem Moment etwas Leichtes bevorzugt. Eine Operette von Franz Lehár. Oder eines der Mozart-Klavierkonzerte, die ja auch nicht so hohe akustische und emotionale Anforderungen stellten. Vielleicht war sie einfach alt geworden. Sie konnte nicht mehr über den Europäischen Stabilitätsmechanismus und die damit verbundenen Haftungsrisiken nachdenken, wenn anstrengende Musik spielte und ihr Mann sie alle paar Minuten am Ärmel zupfte, um auf eines der Leitmotive hinzuweisen (das Todesmotiv, das Blickmotiv, das Sehnsuchtsmotiv et cetera), die Wagner dauernd verwandte.
Doch leider steckte die Kanzlerin in Bayreuth fest. Nicht nur die nächsten 5 Stunden und 55 Minuten, die das Festspielhaus für Tristan und Isolde veranschlagt hatte, sondern auch die restlichen Sommer ihrer Kanzlerschaft. Als Kanzlerin der Bundesrepublik Deutschland konnte sie, nachdem sie einmal behauptet hatte, dass Tristan ihre Lieblingsoper sei, nicht plötzlich eine Pirouette drehen und sagen, dass sie Mozarts Klarinettenkonzert und, ach ja, Die Lustige Witwe genauso gern möge. Zumal ihr der konservative Parteiflügel immer schon vorgeworfen hatte, sie habe keine festen Überzeugungen, keine inneren Werte.
»Wer wagt mich zu höhnen?«, sang Isolde nun, sie brüllte schon fast. Eine hysterische Frau, diese Isolde, dachte die Kanzlerin, und sie erinnerte sich im gleichen Moment, wie sie Wagner zum ersten Mal gehört hatte. Sie dachte nicht oft daran zurück. Ohnehin war es nicht ihre Sache, die großen Bögen von der Gegenwart in die Vergangenheit zu spannen (für so etwas hatte sie Biografen), und diese eine Erinnerung war ihr besonders unangenehm. Aber da sie nun einmal damit angefangen hatte, konnte sie die Erinnerung auch nicht mehr unterdrücken.
Joachim Sauer hieß der etwas ältere Wissenschaftler, der damals, Anfang der Achtzigerjahre, häufig bei ihr vorbeikam. Er sah recht gut aus für einen Quantenchemiker, hatte dichtes schwarzes Haar, einen kräftigen Körperbau, war (und vor allem das machte ihr Eindruck) sehr angesehen an der Akademie der Wissenschaften. Ja, es schmeichelte ihr, dass dieser mehrfach ausgezeichnete Mann, der Johann-Gottlieb-Fichte- und Friedrich-Wöhler-Preisträger, zu ihr kam, um sie zu besuchen, in dem schrecklich düsteren Büro, vor dessen Fenster die Schlehenbüsche wucherten. »Sauer ist hin und wieder nachmittags bei ihr im Arbeitszimmer und trinkt mit ihr Kaffee«, stand in ihrer Stasi-Akte, und auch wenn sie sich nicht daran erinnerte, mit Sauer jemals Kaffee getrunken zu haben, so dürfte es, wenn die Stasi das behauptete, doch so gewesen sein.
Was die Stasi nicht mitbekam, war, dass Sauer eines Nachmittags mit einer Ledertasche in ihrem Büro stand. Er tat sehr geheimnisvoll, schloss die Tür hinter sich und sagte so leise, dass sie fast seine Lippen lesen musste: »Richard Wagner.« Dann holte er ein Kassettengerät und fünf handbeschriftete Kassetten aus der Tasche – »Nur geliehen natürlich« –, und sie musste ihm versprechen, erstens, niemandem weiterzusagen, dass er Wagnerianer sei, und, zweitens, die Musik jenes Werks anzuhören, das die Kanzlerin Jahre später zu ihrer Lieblingsoper erklären sollte.
So schön und überraschend die Leihgabe auch war, stellte sie die junge Physikerin doch vor einige Probleme. Sie konnte das Gerät mit den Tristan-Kassetten nicht einfach nach Hause nehmen, wo Ulrich Merkel, der Mann, mit dem sie damals verheiratet war, sicherlich Fragen gestellt hätte. Im Büro zurücklassen wollte sie es auch nicht. Also fuhr sie nach der Arbeit zu einer Freundin, um die Leihgabe dort in der Speisekammer abzustellen. Zu mehr kam sie an diesem Tag nicht. Als sie Sauer am nächsten Morgen auf dem Flur begegnete, warf er ihr einen verschwörerischen Blick zu. »Schon fertig mit dem Tristan?«, fragte er.
Sie ließ sich krankschreiben und fuhr mit der Tram durch ganz Ostberlin, um in Bibliotheken nach Literatur zu suchen. In Köpenick schließlich fand sie einen Opernführer sowie Martin Gregor-Dellins große Wagner-Biografie. Bis spät saß sie im Lesesaal und machte sich Notizen. Als Sauer ein paar Tage später wieder zu ihr kam, erzählte sie ihm, was sie wusste. Sie sprach über den Tristan-Akkord – f, h, dis, gis –, die unendliche Melodie und über Wagners Gebrauch der Leitmotivtechnik. Aber als sie fertig war, sah sie, dass Sauer enttäuscht wirkte. Er wandte sich zum Gehen. Als er schon in der Tür stand fragte er: »Was bedeutet dir Tristan und Isolde, Angela?«
»Was es mir bedeutet?« Sie spürte, wie ihr die Tränen kamen.
»Was ist Tristan und Isolde?«
»Eine Oper von Wagner?«, fragte sie mit versagender Stimme.
Er schüttelte den Kopf. »Tristan und Isolde ist Gefühl in Reinform«, sagte er, »kein Lernstoff.« Er ging hinaus.
Erst später, als sie längst liiert waren, zunächst heimlich, dann auch offiziell, war der Kanzlerin aufgegangen, dass Sauer womöglich schon damals in sie verliebt gewesen war. Er hatte in Tristan und Isolde eine Parallele gesehen, eine Anspielung auf die scheinbare Aussichtslosigkeit ihrer Liebe. Beide waren sie damals mit anderen Partnern verheiratet, sie zudem mit einem Mann, dessen Nachname ein bisschen so klang wie der des alternden Königs, der in der Oper zwischen Tristan und Isolde stand. Merkel und Marke.
Trotzdem war diese Erinnerung, die ja eigentlich eine erfreuliche sein müsste, heute noch schmerzhaft. Sie zuckte zusammen, wenn sie an Sauers Worte dachte, die ihr so hart erschienen, weil sie treffend waren. Ja, Emotion war ihre Schwäche. Sie wusste oft nicht, was sie empfand. Sie hatte keine Sprache dafür. Auch war es ihr unangenehm, wenn andere Leute starke Emotionen zeigten, ihr fiel nichts dazu ein. Und Sauer war sogleich auf diese Schwachstelle gestoßen.
Auf der Bühne rief Isolde nun Tristan zu sich, und der Tristan trat heran, übergewichtig wie immer, unterstützt von anschwellenden Bläsern. Sauer warf der Kanzlerin einen Blick zu und hob bedeutungsvoll die Brauen. Die Kanzlerin nickte. Das Ehrenmotiv, natürlich.
Etwas anderes kam ihr in den Sinn, eine Sache, die gerade mal ein paar Tage zurücklag und an die sie eigentlich auch nicht denken wollte. Der Bürgerdialog in Rostock. Das palästinensische Flüchtlingsmädchen, über das alle sprachen. Diese Reem Sahwil, die in Tränen ausgebrochen war, als ihr die Kanzlerin die deutsche Asylgesetzgebung erläuterte. Die Kanzlerin hatte versucht, dem Mädchen klarzumachen, dass nicht jeder Asylbewerber in Deutschland bleiben dürfe. »Wenn wir jetzt sagen, ihr könnt alle kommen, dann können wir das auch nicht schaffen«, hatte sie gesagt – eine Selbstverständlichkeit eigentlich, und trotzdem war es nicht einfach gewesen, das so zu sagen, weil diese Reem nett und vernünftig ausgesehen hatte. Außerdem war das Fernsehen dabei gewesen. Eine unmögliche Situation.
Die Kanzlerin fand im Nachhinein, dass sie es ganz gut gemacht hatte. Sie war zu dem weinenden Mädchen gegangen, hatte ihr die Hand auf den Hinterkopf gelegt und den Moderator, der sich einmischte, zurechtgewiesen. Man werde doch mal streicheln dürfen, hatte sie gesagt, und abends, im Fond der Dienstlimousine sitzend, auf dem Weg zurück nach Berlin, war sie der Meinung gewesen, dass sie Emotionen inzwischen besser handhabe als noch zu Beginn ihrer Kanzlerzeit. Sie hatte, was das Emotionale anging, wirklich Fortschritte gemacht.
Nur war die öffentliche Wahrnehmung eine ganz andere, wie die Kanzlerin am folgenden Tag in der morgendlichen Besprechung erfuhr. Der Regierungssprecher war die üblichen Medien durchgegangen, die überregionalen Zeitungen also, die das Treffen mit dem Flüchtlingsmädchen erwartungsgemäß übergangen hatten. Dann hatte sich dieser junge Mann zu Wort gemeldet, der erst vor ein paar Tagen dazugestoßen war. Er hatte eine ungewöhnliche Berufsbezeichnung, er nannte sich »Social Media Analyst«. Die Kanzlerin hatte dem Vorschlag, einen Mitarbeiter einzustellen, der für das Kanzleramt die sozialen Medien beobachtete, bloß widerwillig zugestimmt. Und sie war weiterhin der Meinung, dass jemand, dessen Aufgabe lediglich darin bestand, im Internet zu surfen, unmöglich mehr sein könne als ein Praktikant. Weshalb sie ihn im Stillen auch als solchen bezeichnete.
»Hashtag merkelstreichelt«, hatte der Social-Media-Analyst (also der Praktikant) in diesem Moment gesagt.
»Hashtag Merkel was?«, hatte die Kanzlerin gefragt, und sie hatte den betretenen Blicken der anderen angesehen, dass alle über »Hashtag merkelstreichelt« Bescheid wussten, ihr dieses Wissen aber vorenthielten.
»Was soll das heißen: Hashtag merkelstreichelt?«, hatte die Kanzlerin erneut gefragt, und als der Social Media Analyst, der in dieser Geschichte noch eine größere Rolle spielen wird, weit ausholte, unterbrach sie ihn. Unwirsch sagte sie, sie müsse hier nicht erklärt bekommen, wie Twitter funktioniere, denn sie wisse sehr wohl, wie man twittere oder – und hier hob die Kanzlerin ironisch die Brauen – »einen Tweet absetze«. Doch schreibe sie lieber ganz normale SMS, und im Übrigen solle man ihr doch sagen, was daran so bemerkenswert sei, dass sie, die Kanzlerin der Bundesrepublik Deutschland, streichele.
Darauf hatten alle geschwiegen. Es war ein ungewöhnliches, fast peinliches Schweigen in dieser morgendlichen Besprechung, in der ansonsten, so fand die Kanzlerin, sehr engagiert diskutiert wurde. Bis die Büroleiterin aussprach, was die anderen wohl nicht auszusprechen wagten. »Aber Sie wissen doch selbst, dass Sie jetzt nicht der emotionalste Mensch sind«. Es war verletzend, das so gesagt zu bekommen. Reichte es denn nicht, dass die Mitarbeiter eine Chefin hatten, die einen kühlen Kopf bewahrte? Die zuhören konnte und selbst im Zorn nicht laut wurde? Die manchmal sogar Humor bewies (wenn auch einen ziemlich trockenen)? Ja, was wollten die Leute denn? Liebe und Leidenschaft im Kanzleramt?
Die Kanzlerin hatte sich ein wenig echauffiert. Sie versuchte, sich wieder zu beruhigen. Auf die Oper zu konzentrieren, die sie so gut kannte. Sie kniff die Augen zusammen. Angestrengt schaute sie auf die Bühne, wo Isolde gerade mit einem Messer rumhantierte, das sie mal auf Kurwenals Brust richtete, dann wieder auf die eigene, und die Kanzlerin sagte sich: Das ist ja dermaßen überkandidelt. Muss das wirklich so intensiv sein? Geht’s nicht auch ein bisschen moderater? Und wie lang ist’s noch bis zur Pause? Sie schwitzte stark. Das Kleid zwickte. Sie lehnte sich vor. Sie lehnte sich wieder zurück. Sie schloss die Augen. Sie hielt durch.
Als der Erste Aufzug endlich vorbei war, verließ die Kanzlerin die Mittelloge, ohne auf ihren Mann zu warten, der stehend Beifall klatschte. Sie schob sich in schweißnassem Himmelblau an anderen Opernbesuchern vorbei, zwei Personenschützer folgten ihr. Im Foyer sah sie schon von Weitem den bayerischen Ministerpräsidenten. Ihr war, als sehe auch er ganz bleich aus, sodass sie ihn schon fragen wollte, ob ihm der diesjährige Tristan ebenso schlecht bekommen sei wie ihr. Sie entschied sich dagegen. Ungelenk hielt sie auf die Steigenberger Festspielrestauration zu, in der sie, wie immer, einen Snack zu sich nehmen wollte. Man erwartete sie schon und hatte einen Tisch für sie bereitgestellt. Sie peilte ihn an. Doch war ihr komisch zumute. Links und rechts sah sie flimmernde Punkte, ihr Blickfeld verengte sich, es wurde düster, und sie konnte den Stuhl, auf den sie sich retten wollte, kaum noch erkennen. Theatralisch, wie sie dachte, sank sie zu Boden, dann war da nichts mehr. Bloß Farben. Überirdisch leuchtend. Und pures Glück.
Als sie ein paar Sekunden später auf dem Teppich der Festspielrestauration Steigenberger erwachte, wusste sie zunächst nicht, wo sie war. »Warum bin ich nicht in meinem Bett?«, fragte sie den Bundestagspräsidenten und die Kulturstaatsministerin, die sich mit besorgten Gesichtern über sie beugten. »Und was haben Sie hier zu suchen? Lassen Sie mich schlafen.« Sie blinzelte verwirrt und brauchte Zeit, um die Situation zu erfassen. »Ich bin in Bayreuth«, sagte sie dann. »Tristan und Isolde. Erste Pause.« Und in diesem Moment wusste sie auch, dass sie dem starken Wunsch, noch ein bisschen auf dem Teppich liegen zu bleiben, auf keinen Fall nachgeben durfte.
Die Kanzlerin war erfahren genug, um zu wissen, dass ihr Schwächeanfall seinen Weg in die Öffentlichkeit finden würde. Die Leute würden reden – auch diejenigen, von denen sie es am wenigsten erwartete. Also erklärte sie dem Bundestagspräsidenten und der Kulturstaatsministerin, dass sie keine Hilfe beim Aufstehen brauche. Die Hitze habe ihr etwas zugesetzt, aber nun sei sie hungrig und durstig, und anschließend, nach einer kleinen Erfrischung, freue sie sich auf den Zweiten Aufzug. Da saß sie auch schon sehr munter auf dem weich gepolsterten Stuhl. Und als sie später erfuhr, dass der bayerische Ministerpräsident die Aufführung wegen Erschöpfung verlassen hatte, fühlte sie sich noch besser – und bestärkt in ihrem Vorhaben, bis zum Liebestod durchzuhalten. Sie betrachtete Tristan und Isolde nicht mehr als Vergnügen, sondern als Aufgabe, die es zu bewältigen galt. Das machte die Sache viel einfacher.
Stoisch ließ sie den Zweiten und Dritten Aufzug über sich ergehen, gab danach noch ein Statement ab – es habe ihr sehr gefallen – und sah, als sie schließlich ins Hotel zurückkehrte, dass eine Boulevardzeitung den »Kollaps« im Netz gemeldet hatte. Sie rief den stellvertretenden Regierungssprecher an. Er sagte, man könne die Nachricht nicht einfach dementieren und schlug vor, dem Stuhl die Schuld zuzuschieben, wofür man jedoch die Zustimmung des Steigenberger-Managements einholen müsse. Die Sache zog sich. Es ging hin und her, war ziemlich mühsam. Als die Meldung schließlich dahingehend korrigiert worden war, dass ein defektes Sitzmöbel unter der Kanzlerin zusammengebrochen sei, war es zwei Uhr morgens. Die Kanzlerin zog sich um. Sie putzte sich die Zähne. Sie legte sich zu ihrem Mann, der mit weit geöffnetem Mund seinen Tristan-Rausch ausschlief. Sie starrte im Dunkeln noch lange vor sich hin, und als sie endlich die Augen schloss, träumte sie wirres Zeug, Isoldes Geschrei im Ohr.
Die Kanzlerin war an dem Sommerabend, als sie in Bayreuth Tristan und Isolde sah und in Ohnmacht fiel, fast zehn Jahre im Amt. Stets mit einer Öffentlichkeit umzugehen, die sie genauestens beobachtete, war für sie nichts Neues. So gut wie jeder Tag in ihrem Leben wurde dokumentiert. In Pressemitteilungen und Gesprächsprotokollen, in Zeitungsartikeln und Fernsehberichten, in Biografien und Langzeitbeobachtungen. Ja, man könnte sich an dieser Stelle, wie ein fauler Festredner, auf den Satz beschränken, dass über die Kanzlerin schon alles gesagt und nichts Wesentliches hinzuzufügen sei. Doch das hätte sie selbst anders gesehen. Die Kanzlerin hatte kein so klares Bild von sich, wie man das als Außenstehender vermuten würde. Sie war sich oft ein Rätsel – und das, obwohl es ihr nicht an Informationen mangelte.
Fast jeden Tag bekam sie in der Morgenlage – der morgendlichen Besprechung im Kanzleramt – präsentiert, was die Medien über sie schrieben. Sie sah sich jede Woche im Fernsehen, manchmal sogar mehrfach. Auch hatte sie im Lauf der Jahre eine große Anzahl von Büchern erworben, die ihr Leben und Wirken zum Thema hatten. Zu Anfang ihrer Kanzlerzeit hatte sie noch davor zurückgescheut, die Merkel-Biografien ins Büro schicken zu lassen. Es erschien ihr eitel, sie schämte sich, ja, sie hatte sich so schwer damit getan, dass sie schließlich bei Amazon eine große Sammelbestellung getätigt hatte, in der Hoffnung, dass die vier oder fünf Merkel-Titel zwischen mehreren Kochbüchern, russischer Lyrik, einer kontroversen Nazi-Satire sowie der 18-bändigen Werkausgabe von Immanuel Kant nicht groß auffallen würden. Mit der Zeit hatte sie dann gelernt, das Lesen der Biografien als gewöhnlichen Teil ihrer Arbeit zu betrachten. Sie fand, dass sie ein Recht darauf hatte, zu erfahren, was die Leute über sie schrieben. Und manchmal brachte sie die Lektüre sogar auf neue Ideen oder gewährte ihr einen Einblick in das eigene Wesen, den sie sonst nicht gehabt hätte.
Doch ging es der Kanzlerin mit der sie betreffenden Fachliteratur wie anderen Leuten mit Fotos, die nach und nach die Erinnerung verdrängten. Die Kanzlerin hatte schlichtweg zu viel gelesen und wusste nicht mehr, woran sie sich selbst erinnerte und was sie bloß bei Langguth, Boysen und Roll über sich erfahren hatte. Hinzu kam, dass die Biografen alle beieinander abschrieben, sodass bestimmte Geschichten im Lauf der Jahre immer mehr Gewicht bekamen, während andere im Rückblick an Kontur verloren.
In fast jeder Biografie konnte man nachlesen, dass sie als Schülerin im Sportunterricht eine Dreiviertelstunde auf dem Drei-Meter-Brett gestanden und sich erst kurz vor dem Pausengong zum Sprung durchgerungen habe. Diese Anekdote kam der Kanzlerin sehr zupass. Sie ließ sich nämlich derart interpretieren, dass die Kanzlerin in wichtigen Fragen oft Zeit brauchte, um dann im letzten Moment eine starke Entscheidung zu treffen. Die Kanzlerin hatte aber auch viele Dinge erlebt, die nie jemand aufgeschrieben hatte – und sie fragte sich, ob diese Dinge dann überhaupt eine Rolle spielten. Wie bedeutsam, wie wahrhaftig waren sie, wenn allein sie sich daran erinnerte?
Den Überblick darüber, was geschehen war und was nicht, hatte die Kanzlerin vor allem verloren, wenn es um die Jahre vor der Wende ging. Fünfunddreißig Jahre hatte sie in der DDR gelebt, und sie war der Meinung, ein ziemliches Schattendasein geführt zu haben. Eine Wissenschaftlerin war sie gewesen, an einem renommierten Institut, sicherlich, aber ohne Ehrgeiz, ohne große Perspektive. Es überraschte sie immer wieder, wie viele Leute, denen sie damals flüchtig begegnet war, Notiz von ihr genommen hatten – und was für Geschichten sie zu erzählen wussten.
Ihre eigene Erinnerung an diese Zeit dagegen war verschwommen. Womöglich würde sie am Ende ihres Lebens bloß noch ein paar Daten und Fakten im Kopf haben. Dass sie als Tochter eines Pfarrers in der Uckermark aufgewachsen war. Dass sie nach der Schule an der Karl-Marx-Universität in Leipzig Physik studiert hatte. Und dann elf Jahre lang an der Berliner Akademie der Wissenschaften gearbeitet und mit einer »Untersuchung des Mechanismus von Zerfallsreaktionen mit einfachem Bindungsbruch und Berechnung ihrer Geschwindigkeitskonstanten auf der Grundlage quantenchemischer und statistischer Methoden« promoviert hatte.
Aber auch die Zeit nach der Wende war ihr, wenn sie es recht bedachte, nicht viel präsenter. Das lag vermutlich daran, welch steilen Aufstieg sie in kurzer Zeit genommen hatte. Stellvertretende Regierungssprecherin der letzten DDR-Regierung. Bundestagsabgeordnete. Ministerin für Frauen und Jugend. Ministerin für Umwelt. CDU-Generalsekretärin und Vorsitzende. Kanzlerkandidatin. Bundeskanzlerin. Sie hatte in dieser ganzen Zeit nicht nur unglaublich viel gearbeitet, sondern sich auch die Lebensweise einer ganz anderen Gesellschaft aneignen müssen. Herrgott, als sie Anfang der Neunziger als junge ostdeutsche Physikerin nach Bonn zog, um im Herzen der alten Bundesrepublik Politikerin zu werden, kam sie sich manchmal vor, als habe sie zuvor in einer Höhle gelebt wie Kaspar Hauser. Fast alles, was sie über den Westen wusste, wusste sie aus dem Fernsehen. Sie hatte nie das Oktoberfest besucht, nie einen Mercedes gefahren oder gar Marihuana ausprobiert. Wie Kreditkarten funktionierten, musste sie sich erklären lassen.