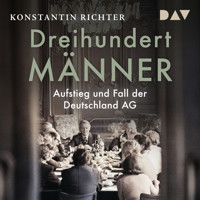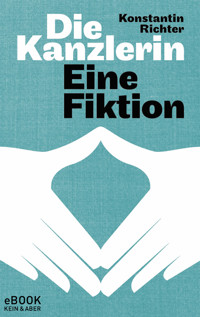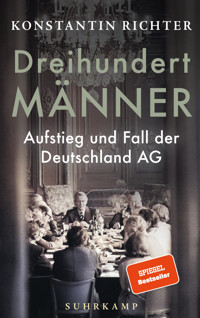
25,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Dreihundert deutsche Männer, schrieb Walther Rathenau zu Beginn des 20. Jahrhunderts, bestimmten die wirtschaftlichen Geschicke des Kontinents. Er meinte das enge Geflecht aus Bankiers, Industriekapitänen und Lobbyisten, das sich mit dem Aufstieg von Firmen wie der Allianz, Krupp oder Siemens herausgebildet hatte. Man kannte einander, man sprach miteinander – und man sprach sich ab. Bis in die 1990er Jahre prägte dieses Netzwerk namens »Deutschland AG« die Politik und die Unternehmenskultur in der Bundesrepublik.
Konstantin Richter montiert die Geschichten dieser Macher und Magnaten zu einer temporeichen szenischen Erzählung. In meisterhaft arrangierten Episoden lässt er ihre Welt zu unserer werden: Er begleitet Nicolaus Otto und Gottlieb Daimler bei der Gemüseernte, wo die beiden genauso erbittert konkurrieren wie bei der Entwicklung neuer Motoren. Richter sitzt mit am Tisch, wenn die Gebrüder Mannesmann in Marokko irrwitzige Intrigen spinnen, und er pendelt mit Thomas Middelhoff von Bielefeld nach Essen, wenn dieser sich mit seinem Hubschrauber auf den Weg ins Büro macht.
So entsteht ein einzigartiges Epos, das rund 150 Jahre umspannt: von der Start-up-Nation Kaiserreich bis in die krisengebeutelte Gegenwart, vom Aufstieg der Deutschland AG bis zum ihrem Niedergang.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 702
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Cover
Titel
3Konstantin Richter
Dreihundert Männer
Aufstieg und Fall der Deutschland AG
Suhrkamp
Impressum
Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.
Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.
Zur Gewährleistung der Zitierfähigkeit zeigen die grau gerahmten Ziffern die jeweiligen Seitenanfänge der Printausgabe an.
Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2025
Der vorliegende Text folgt der Erstausgabe, 2025.
Originalausgabe© Suhrkamp Verlag GmbH, Berlin, 2025
Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlaggestaltung: Rothfos & Gabler, Hamburg
Umschlagabbildung: Berthold Beitz (hinten links) während einer Vorstandssitzung der Krupp GmbH in der Villa Hügel, 17. Juli 1974. Rechts neben Beitz: Ernst Wolf Mommsen, Aufsichtsratsvorsitzender der Friedrich Krupp AG. Foto: Brigitte Hellgoth/akg-images
eISBN 978-3-518-78354-2
www.suhrkamp.de
Übersicht
Cover
Titel
Impressum
Inhalt
Informationen zum Buch
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Inhalt
Prolog
Erstes Buch. 1870-1914
1
Gründerjahre
2
Die soziale Frage
3
Ordnung
4
Innovation
5
Globalisierung
Zweites Buch. 1914-1945
1
Krieg
2
Revolution
3
Der amerikanische Traum
4
Hitler
5
Rüstung
6
Barbarei
Drittes Buch. 1945-2000
1
Die Wunderbaren Jahre
2
Achtundsechzig
3
Reuter und Herrhausen
4
New Economy
Epilog Das neue Jahrtausend
Quellen und Dank
Firmenregister
Namenregister
Informationen zum Buch
3
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
359
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
7
Prolog
Die erste Symphonie beschäftigte Johannes Brahms mehrere Jahrzehnte lang. Schon 1854, da galt der Komponist noch als junges Talent, arbeitete er an einem großen Werk, das er schließlich, weil er nicht weiterkam, in ein Klavierkonzert verwandelte. Ein nächster Versuch, ein paar Jahre später, wurde zur Serenade reduziert. Weitere Nichtsymphonien folgten. Der Gedanke ließ Brahms nicht los, er wollte so sehr. Aber er verzweifelte an der verfluchten Symphonie, er träumte nachts von ihr, er fürchtete, der Tradition von Wolfgang Amadeus Mozart und Ludwig van Beethoven nicht gerecht zu werden.
Hoch waren die eigenen Ansprüche, hoch auch die Erwartungen anderer. Als er 1862 begann, intensiv an einer Komposition zu arbeiten, schrieb Clara Schumann, die berühmte Freundin, einen Brief an den nicht minder berühmten Geiger Joseph Joachim: »Johannes schickte mir neulich – denken Sie, welche Überraschung – einen ersten Symphoniesatz.« Doch die Arbeit an der Ersten geriet in den folgenden Jahren immer wieder ins Stocken. Wenn Freunde Brahms danach fragten, antwortete er nicht. Oder er sagte, es sei nun mal schwierig, auf einen Riesen wie Beethoven zu folgen. Noch Anfang der 1870er, da waren zwei Sätze fertig, erklärte er fast kindlich verzweifelt: »Ich werde nie eine Symphonie komponieren!« Erst 1876 war das Stück vollendet. Es wurde in Karlsruhe uraufgeführt und rasch als großer Wurf erkannt. Kritiker sahen die Symphonie Nr. 1 in c-Moll, Opus 68, als würdige Fortsetzung der Beethoven’schen Symphonik. Brahms’ Erste, so hieß es, sei in Wahrheit Beethovens Zehnte.
Bach, Beethoven und Brahms werden manchmal als die drei B 8bezeichnet. Die drei B verkörpern die goldene Zeit der deutschen Musik. Und Brahms, der Symphoniker, orientiert sich bewusst an den Errungenschaften seiner Vorgänger, er steht am Ende einer Epoche, er blickt zurück. Denn die Musiknation Deutschland hat ihren Zenit längst erreicht. Die Wirtschaftsnation Deutschland dagegen – und um diese soll es hier gehen – befindet sich am Anfang. In den zwei Jahrzehnten, die der Komponist Johannes Brahms benötigt, um eine einzige Symphonie zu komponieren, entstehen Hunderte von Unternehmen, die eine ganz eigene Kultur schaffen. Die Zeit, die Mitte des 19. Jahrhunderts einsetzt und bis zum Börsenkrach von 1873 andauert, wird deshalb auch als Gründerzeit bezeichnet.
Alfred Krupp in Essen und Werner von Siemens in Berlin sind Pioniere. Ihre Handwerksbetriebe wachsen zu gewaltigen Unternehmen heran, beschäftigen zunächst Hunderte, dann Tausende Mitarbeiter. Andere folgen. Die Farbenfabriken Bayer in Leverkusen, BASF in Ludwigshafen und Hoechst bei Frankfurt. Dann Dresdner Bank, Commerzbank und Deutsche Bank. Später, nach dem Börsenkrach, kommen Daimler, Allianz und Mannesmann hinzu.
Das Erstaunliche ist: Die Konzerne, die sich damals entwickeln, bauen derart solide Strukturen auf, dass sie nicht bloß den Ersten Weltkrieg überstehen, sondern auch die Inflation, die Weltwirtschaftskrise und den Zweiten Weltkrieg.
Die Ordnung, die dieser Langlebigkeit zugrunde liegt, ist von Beobachtern oft als »Deutschland AG« bezeichnet worden. Der Begriff steht für die personelle und wirtschaftliche Verflechtung einiger großer Banken, Versicherer und Industrieunternehmen, die über Aktienpakete aneinander beteiligt waren und sich auf diese Weise vor fremdem Einfluss schützten. Die führenden Vertreter trafen in Aufsichtsräten und anderen Gremien aufeinander, sie stimmten sich ab, sie sahen ihre Aufgabe darin, einen stabilisierenden Einfluss auf die Wirtschaft auszuüben.
Als Hochphase der Deutschland AG gelten die 1950er und 1960er Jahre, da kam man dem Ideal einer gefestigten Ordnung besonders nahe. Aber die Anfänge der deutschen Unternehmenskultur lassen 9sich bis in die Kaiserzeit zurückverfolgen, deshalb setzt auch dieses Buch dort ein. Walther Rathenau, der langjährige Aufsichtsratsvorsitzende der Allgemeinen Elektricitäts-Gesellschaft, kurz AEG, schrieb schon 1909 einen Aufsatz über die »dreihundert Männer«, die sich alle kannten und gemeinsam über das Schicksal der Wirtschaft entschieden.
In der klassischen Musik gibt es etwas, das als deutscher Klang wahrgenommen wird. Dieser Klang ist weich und dunkel. Ein intransparentes Konglomerat verschiedener Stimmen, die zu einem größeren Ganzen verschmelzen. Die Berliner Philharmoniker unter Wilhelm Furtwängler oder Herbert von Karajan kultivierten den deutschen Klang. Etwa wenn sie die Erste Symphonie von Brahms spielten. Vor einiger Zeit aber hat ein Musikkritiker das Verschwinden des deutschen Klangs beklagt. Der Einfluss ausländischer Dirigenten wie Simon Rattle hätte dem Sound ein Ende bereitet, der »seelensuchende, romantische Ton« sei den Berlinern abhandengekommen. So also schrieb der Kritiker – und wurde aufgrund dieser Deutschtümelei heftig angegriffen.
Auch in den Aufsichtsräten und Vorständen, in den Betriebsräten und Belegschaften deutscher Unternehmen hat es lange einen bestimmten Sound gegeben, der sich von der ausländischen Konkurrenz deutlich abhob. Man kann die Merkmale des typisch deutschen Unternehmens benennen, ich komme später darauf zurück. Und hier zumindest ist es wirklich so: Den deutschen Klang gibt es nicht mehr.
Denn die Struktur von miteinander verbundenen Finanz- und Industrieunternehmen ist in den letzten paar Jahrzehnten entflochten und zum Großteil aufgelöst worden. Einige der Unternehmen, die so lange bemerkenswert stabil geblieben sind, wurden von anderen Unternehmen übernommen und aufgelöst. Andere haben ihrerseits im Ausland akquiriert, insbesondere in den USA, und die Bindung an die Heimat ein Stück weit verloren. Wieder andere haben traditionsreiche Kerngeschäfte abgestoßen und neue dazugekauft, so dass sie kaum noch wiederzuerkennen sind. Eine Mehrheit der 10Aktien großer deutscher Unternehmen befindet sich in der Hand ausländischer Anleger.
Die deutsche Wirtschaft steht heute vor einer höchst ungewissen Zukunft. Sie muss sich einer Vielzahl von mittel- und langfristigen Herausforderungen stellen. Die demografische Entwicklung und der Fachkräftemangel, die Knappheit von Ressourcen und die Energiewende, der technologische Wandel und die großen Unternehmen aus China, der Aufstieg der Populisten und die Rückkehr der Freihandelsgegner. Auf die alten Strukturen aber, die den großen Unternehmen in früheren Krisen Sicherheit geboten haben, können sie nun nicht mehr zurückgreifen.
Man muss den Verlust der Ordnung nicht bedauern, muss die Atmosphäre, die in den Konzernen herrschte, nicht vermissen. Streng hierarchisch waren sie, wenig offen für Außenseiter oder Andersdenkende, geprägt von den persönlichen Beziehungen einiger mächtiger Bankiers und Unternehmer. Der Niedergang dieser Netzwerke erscheint aus heutiger Sicht fast unumgänglich, die dreihundert Männer passten nicht länger in die Zeit, auf die drängenden Probleme der globalisierten Gegenwart hätten sie womöglich keine Antworten.
Tatsache ist aber auch, dass die großen Unternehmen, genau wie die Symphonien von Brahms, ein Stück deutscher Kultur darstellen. Und dass eine solche Kultur einen Nachruf verdient. Denn wenn man die einzelnen Unternehmensgeschichten zusammensetzt, entsteht eine epische Geschichte, die in vielerlei Hinsicht die Geschichte der Nation widerspiegelt. Sie soll hier erzählt werden. Es ist die Geschichte vom Aufstieg und vom Fall der Deutschland AG.
11
Erstes Buch
1870-1914
13
1Gründerjahre
Im August 1870 schifft sich in Shanghai ein melancholischer Bankier auf einem französischen Paketdampfer ein. Sein Ziel ist Berlin. Dort, in der preußischen Hauptstadt, soll er Direktor einer noch jungen und kleinen Bank werden, die ein paar Monate vorher gegründet worden ist. Sie heißt, nicht ganz unbescheiden, Deutsche Bank.
Hermann Wallich ist 36Jahre alt. Er stammt aus einer orthodox-jüdischen Familie in Bonn. Nach einer Banklehre hat er zunächst in Paris gearbeitet und sich dann entschlossen, auf die Île de la Réunion zu ziehen. Die vulkanische Insel liegt im Indischen Ozean, siebenhundert Kilometer östlich von Madagaskar. Wallich soll sich im Auftrag der Pariser Bank Comptoir d’Escompte um die Geldgeschäfte der Kreolen kümmern, der französischstämmigen Siedler, die mit Hilfe afrikanischer Arbeitskräfte riesige Zuckerplantagen bewirtschaften. Wallich geht wandern. Wallich isst Ananas und Palmenherzen. Wallich schaut den Afrikanern dabei zu, wie sie den Sega aufführen, einen Tanz »voll von Originalität und besonderer Geschmeidigkeit«, wie er später schreibt. »Nicht Kunst inspiriert diesen Tanz, sondern Leidenschaft und Liebe.«
Doch wird Wallich in den Tropen nicht glücklich. Die alteingesessenen Familien, denen er Kredit gibt, haben wenig Sinn fürs Geschäftliche. Eine Serie von Missernten, die Abschaffung der Sklaverei, die Konkurrenz durch europäischen Rübenzucker – all das hat ihnen zu schaffen gemacht, so dass Wallich vor allem damit beschäftigt ist, Schulden einzutreiben. Und immerzu gibt es Ärger. Als ihn ein vornehmer, aber insolventer Schuldner zum Duell fordert, antwortet Wallich, er stehe zur Verfügung, allerdings solle der Mann zuerst das Geld deponieren.
14Wallich ist ein zurückhaltender Mann, brav gescheitelt, weiche Züge, ein gepflegter Schnurrbart. Er wäre wohl gern ein anderer gewesen, ausgelassener, spontaner, nicht so verdammt gewissenhaft. Wehmütig schreibt er in seinen Erinnerungen, dass er in den Tropen seine besten Jahre vergeudet habe: »Die fortwährende Sorge um das mir anvertraute Interessengebiet ließen mich vor der Zeit alt und ernst werden und verhinderten mich, den Anteil an den Freuden der Jugend und der Geselligkeit zu nehmen, der meinen Jahren zukam.«
Auch in Shanghai, der nächsten Station der Wanderjahre, wird Wallich nicht zum Hedonisten. Im fruchtbaren Jangtse-Delta haben englische Kaufleute eine luxuriöse Handelsmetropole aufgebaut, sie importieren Opium und exportieren Seide und Tee. Die freie Zeit vertreiben sie sich mit Regatten, mit Cricket und Pferderennen. Wallich nimmt daran kaum teil, er fühlt sich oft matt, vermisst Europa und hofft, dass ihn die Franzosen nach Paris zurückholen. Stattdessen kommt das Angebot der neu gegründeten Deutschen Bank Actien-Gesellschaft.
Die Fahrt mit dem französischen Paketdampfer macht Wallich als einziger Deutscher. Als er in Shanghai aufbricht, weiß an Bord noch niemand, dass Frankreich Preußen den Krieg erklärt hat. Das Schiff legt in Hongkong an. Die Nachricht verbreitet sich rasch. Die Franzosen geben sich siegesgewiss, sie sprechen Wallich ihr Mitgefühl aus. Doch als in Singapur, in Ceylon und in Aden immer weitere Meldungen von deutschen Siegen eintreffen, kippt die Stimmung. Der Versorgungsoffizier kündigt an, er werde von nun an täglich drei Preußen verspeisen. Der vorsichtige Wallich beschließt, die Weiterfahrt ohne Franzosen zu machen. Mit einem Fischerboot setzt er nach Suez über, nimmt die Eisenbahn nach Alexandria und den Dampfer über das Mittelmeer.
*
15Berlin also.
Wallich hat sich die Rückkehr nach Deutschland anders vorgestellt. Das Leben in der Fremde ist ihm nicht wirklich bekommen. Aber an die Annehmlichkeiten hat er sich gewöhnt, an die Gastfreundschaft der Kreolen, an das geräumige Haus in Shanghai, an die Bediensteten, die dort auf seine Anweisungen warteten. In Berlin wartet niemand. Er hat keine Freunde, keine Verwandten in der Stadt. Die Aufsichtsräte der Deutschen Bank, die ihn eingestellt haben, empfangen ihn kühl und förmlich. Nicht einmal ein Glas Zuckerwasser bieten sie ihm an. Wallich schreibt später: »Wenn ich abends in mein Hotelzimmer zurückgekehrt war, konnte ich weinen, so einsam und verlassen fühlte ich mich.«
Auch die Stadt selbst macht einen trüben Eindruck auf Wallich. Mango und Palmenherzen gibt es hier nicht, dafür den Wochenmarkt am Gendarmenmarkt, wo Fischfrauen mit Keschern in moosbewachsenen Bottichen rühren. Ringsum sind die Straßen mit einfachen Feldsteinen gepflastert, ein übler Geruch steigt aus den Rinnen auf. Ausländischen Besuchern fallen vor allem die preußischen Militärs auf, die, so notiert ein Durchreisender, »rotwangig, knusprig, zufrieden« und dabei äußerst hochmütig auftreten. Gehen die Offiziere spazieren, wird es eng auf Berliner Bürgersteigen.
Doch der Eindruck einer ständischen Gesellschaft, die in der Zeit stehen geblieben ist, täuscht gewaltig. Das Deutschland, das kurz vor der Reichsgründung steht, ist nicht mehr das Land, das Wallich 16Jahre zuvor verlassen hat. Und insbesondere Berlin, die Metropole, die bald Reichshauptstadt werden soll, verändert sich rasant. Dieser Wandel ist im kleinstädtisch anmutenden Zentrum, wo die Deutsche Bank ihre Räume hat, kaum bemerkbar. Wer das pulsierende Leben sehen will, geht nicht Unter den Linden spazieren, sondern begibt sich an die Stadtränder, die sich Tag für Tag weiter ins Umland ausdehnen. In die Arbeiterquartiere im Wedding oder in Friedrichshain, wo Großfamilien in Mietskasernen zwei, drei Räume teilen und dazu Schlafgänger beherbergen, die von früh16morgens bis spätabends arbeiten und bloß ein Bett benötigen. Oder in die Villenviertel am Tiergarten, wo neureiche Unternehmer und Bankiers inmitten von altem Baumbestand herrschaftliche Häuser errichten.
Oder aber in den wüsten Norden, Feuerland genannt, weil dort die Schlote rauchen. Nirgendwo sonst ist die Luft so schlecht, der Lärm so durchdringend. Wenn in den riesigen Fabriken nördlich des Oranienburger Tors die Dampfhämmer gehen – so steht es in einem zeitgenössischen Roman –, dann zittern in den umliegenden Wohnhäusern die Fußböden, die Gläser klirren und die Lampenkugeln klappern. Nach Feierabend treten Tausende rußgeschwärzte Arbeiter den Heimweg an, zu Fuß auf Ausfallstraßen, die kurz vorher noch Feldwege waren.
*
Deutschland befand sich 1870, als Wallich zurückkehrte, in den letzten Jahren eines langen und gewaltigen Aufschwungs, der Mitte des Jahrhunderts mit dem Eisenbahnbau seinen Anfang genommen hatte. Für die Eisenbahnen wurden Kohle und Stahl aus dem Ruhrgebiet benötigt und Lokomotiven aus Berlin. Telegrafenlinien verknüpften die Metropolen, Seekabel durchzogen die Meere. Kommunikation und Warenverkehr beschleunigten sich rasant und erleichterten den Ausbau weiterer Wachstumsindustrien.
Der Aufschwung war nicht auf Deutschland beschränkt. Doch fiel die Veränderung hier besonders extrem aus, man holte nach, was sich in anderen Ländern über einen längeren Zeitraum vollzogen hatte. Erst im Lauf des 19. Jahrhunderts – und vor allem nach der Gründung des Zollvereins 1834 – war der Flickenteppich aus deutschen Regionalmächten zu einer Volkswirtschaft zusammengewachsen. Handelsschranken fielen, der Zunftzwang wurde aufgehoben, Gewerbefreiheit geschaffen, das zunehmend einflussreiche Bürgertum wirkte hin auf eine liberale Wirtschaftspolitik.
Als Vorbild galt England. Man wollte die dortige Industrie min17destens einholen, noch lieber aber überflügeln. Der junge Alfred Krupp war einer der Ersten, die auf die Insel reisten, um sich in die Fabriken von Manchester einzuschleichen und deren Betriebsgeheimnisse zu ergründen. Er reiste anonym, weil er nicht auffallen wollte, nannte sich Baron Schropp – und man darf sich schon fragen, ob der Deckname der Tarnung wirklich dienlich war. Andere Unternehmer folgten ihm. Sie waren nicht rein wirtschaftlich motiviert, sie betrieben den Aufholkapitalismus im Dienst der Nation.
Das galt auch für die Deutsche Bank, die ihr Entstehen einer Gruppe von Privatbankiers verdankte. In einer pathetischen Denkschrift warben sie für ihr Projekt. »Die deutsche Flagge trägt den deutschen Namen jetzt in alle Welttheile«, so heißt es dort, »hier wäre ein weiterer Schritt, dem deutschen Namen in ferneren Gegenden Ehre zu machen und endlich Deutschland auf dem Felde der finanziellen Vermittlung eine Stellung zu erobern – angemessen derjenigen, die unser Vaterland bereits auf dem Gebiete der Civilisation, des Wissens und der Kunst einnimmt.«
*
Die Deutsche Bank hatte die Aufgabe, die aufstrebende Wirtschaft im Ausland zu unterstützen. Bis dahin waren die Deutschen im Außenhandel auf die Finanzierung durch Kreditinstitute in London, Paris oder Amsterdam angewiesen. Das war teuer und aufwändig. Die Bank sollte von Berlin aus ein internationales Geschäft aufbauen und die einheimische Wirtschaft aus der Abhängigkeit lösen. Zum Firmenzeichen wurde ein mächtiger Vogel erklärt, der dem Reichsadler verblüffend ähnlich sah.
Doch machte die Deutsche Bank anfangs nicht viel her. Ihre Geschichte begann wie ein Roman von Charles Dickens: im ersten Stockwerk eines Mietshauses in der Französischen Straße. Der Treppenflur war morsch, das Gebäude verfallen, der Vormieter, ein bayerisches Kaffeehaus, gerade erst ausgezogen. Im Berliner Zimmer, dem düsteren Durchgangsraum, der Vorderhaus und Seiten18flügel verband, befand sich das sogenannte Direktorenkabinett, hier standen die Schreibpulte der Gründungsdirektoren.
Als Wallich im Herbst 1870 seine Stelle antrat, traf er dort lediglich auf einen miesepetrigen Deutsch-Amerikaner, dem die Arbeit bei der Bank so wenig behagte, dass er bald kündigte. Ein weiterer Direktor hieß Georg Siemens, ein studierter Jurist und ohne jede Erfahrung im Bankgeschäft. Erschwerend kam hinzu, dass Siemens gerade in den Kriegsdienst einberufen worden war. Und dieser Krieg gegen Frankreich, er zog sich hin. Aus den französischen Ardennen schrieb Secondeleutnant Siemens Feldpost an die Deutsche Bank: »Es ist mir sehr zweifelhaft, ob ich so bald wieder nach Berlin zurückkommen werde.«
Während Wallich auf die Rückkehr des Kollegen wartete, ging er über die Bücher. Von fünf Millionen Talern Aktienkapital waren lediglich zwei Millionen eingezahlt. Mehr hatten die Aufsichtsräte nicht rausgerückt, weil sie meinten, die Direktoren seien fürs Geschäft noch nicht ausreichend vorbereitet. Wallich wunderte sich: Die Deutsche Bank, unterbesetzt und unterkapitalisiert, war trotz des stolzen Namens eine ziemlich überschaubare Angelegenheit. Und vielleicht fragte sich Wallich auch, was für ein Mensch wohl dieser Georg Siemens sei, der zwar aus einer bedeutenden Familie stammte – er war ein Vetter des Unternehmers Werner Siemens –, aber nur wenig vom Bankgeschäft wusste.
*
Im Mai 1871 kehrten die deutschen Truppen aus dem Krieg zurück. Die Reichsgründung und der langersehnte Sieg entfachten eine Euphorie, die der ohnehin schon boomenden Wirtschaft noch zusätzlich Stoff gab. Nationalstolz und Hochkonjunktur befeuerten sich gegenseitig, und die Wirtschaft trat in eine überhitzte Endphase ein, die aber nicht als solche wahrgenommen wurde. Die Reparationszahlungen der Franzosen, geleistet in Gold, bestätigten die Deut19schen in dem irrigen Glauben, dass der Boom unendlich andauern werde. Lieblingsobjekt der Anleger wurde die Aktiengesellschaft, kurz AG, eine Rechtsform, die sich für Unternehmen mit hohem Kapitalbedarf eignete. In den sogenannten Gründerjahren von 1871 bis 1873 entstanden – unter Beihilfe eines Aktiengesetzes, das die Gründung ohne staatliche Genehmigung ermöglichte – fast tausend Aktiengesellschaften.
Wie Pilze schossen diese AGs aus dem Boden. Brauereien, Handwerksbetriebe, Pferderennbahnen wurden zu hohen Preisen aufgekauft und zu noch höheren Preisen an die Börse gebracht. Manche der »Actien-Gesellschaften« hatten keinen bleibenden Wert und dienten lediglich dem Zweck, Kursgewinne zu realisieren. Aber auch Unternehmer, die eine große Zukunft vor sich hatten, wurden mit dringend benötigtem Geld versorgt und legten den Grundstein für spätere Erfolge.
*
In Mülheim nimmt das Bandeisenwalzwerk von August Thyssen die Arbeit auf. Es ist die Keimzelle des Thyssen-Konzerns.
*
Aus einer kleinen Motorenfirma namens Langen, Otto und Roosen wird in Köln die Gasmotoren-Fabrik Deutz AG. Ein Produktionsleiter aus Stuttgart kommt dazu, der große Fähigkeiten hat, aber nicht leicht zu führen ist. Er heißt Gottlieb Daimler.
*
In München stellt Gabriel Sedlmayr, Erbe der bekannten Brauerei Spaten, Räume und finanzielle Mittel zur Verfügung, damit ein junger Professor namens Carl Linde eine Kältemaschine bauen kann, 20die das Bier besser kühlt als jeder Felsenkeller. Jahre später wird aus dem Projekt ein Unternehmen mit eigenwilligem Apostroph: die Gesellschaft für Linde’s Eismaschinen.
*
In Hannover schweißt ein jüdischer Bankier aus der Konkursmasse eines Weichgummiproduzenten eine Aktiengesellschaft zusammen, die Regenmäntel und Wärmflaschen fabriziert. Die Firma nennt er Continental. Oder genauer: Continental-Caoutchouc- und Gutta-Percha Compagnie.
*
Ein typischer Financier ist Heinrich Quistorp. Um die dreißig Unternehmen bringt er in kürzester Zeit an die Börse. Nebenbei entwickelt er die Villenkolonie Berlin-Westend. Dann geht er mit seiner Vereinsbank Quistorp & Co. in den Konkurs, der Ruf ist ruiniert. Quistorp flieht nach Paraguay, gründet eine Kolonie für deutsche Siedler, die gegen Moskitos und Sumpffieber ankämpfen, kehrt nach Berlin zurück, stirbt verarmt. Aber einige der schmucken Gründerzeitvillen, die er im Westend geplant hat, in schattigen Alleen, benannt nach Ulme, Ahorn und Akazie, stehen heute noch und werden von Maklern mit schönster Premiumimmobilien-Poesie bedacht. Und auch zum nachhaltigen Erfolg der Chemischen Fabrik auf Aktien (vormals E. Schering) hat Quistorp beigetragen. Ernst Schering, Besitzer einer Apotheke in der Chausseestraße, ist mit seiner Hilfe an die Börse gegangen. Von den zahlreichen Unternehmen, die der Seriengründer Quistorp auf den Weg gebracht hat, wird eines später zum Weltkonzern. Ist das wirklich eine so schlechte Bilanz?
*
21Manche der Unternehmen, die in den Gründerjahren kurzzeitig florieren, tragen Namen, die klingen so wunderbar elaboriert, als stammten sie aus Romanen. Die Wolgaster Farbholzmühle. Der Central-Bazar für Fuhrwesen. Die Märkische Torfgräberei. Die Erste Deutsche General-Leimsiederei. Die Norddeutschen Eiswerke, vormals Bolle. Alles Schwindel, so heißt es später. Aber man könnte genauso gut sagen: Nie wieder hat der Kapitalismus den Deutschen so viel Spaß gemacht.
*
Georg Siemens, Gründungsdirektor der Deutschen Bank, kehrt rechtzeitig aus dem Krieg zurück, um die Auswüchse des Gründerfiebers noch mitzuerleben. Doch beschäftigt ihn etwas anderes. Im März 1872 verfasst er einen Liebesbrief. Das Bild der jungen Frau hat er neben den Briefbogen gelegt. Damit er, wie er schreibt, ihr »hübsches Gesichtchen« vor Augen habe. Elise Görz, 21Jahre alt, ist die Tochter eines Mainzer Juristen. Siemens hat sie in ihrem Elternhaus kennengelernt. Zunächst hat er bei Elise keinen großen Eindruck hinterlassen. Eine ungelenke Verbeugung. Eine spöttische Bemerkung über ihre Stickereien. Eine seltsam spät ausgesprochene Aufforderung zum Tanz beim Juristenball, die sie ausschlägt, weil sie sämtliche Walzer schon vergeben hat. Brüsk wendet er sich ab. Sie wirft ihm einen empörten Blick zu, den er nicht mehr vergisst. Er hält um ihre Hand an. Und schickt erstaunliche Briefe, in denen er sich und seine Tätigkeit bei der Deutschen Bank erklärt.
»Du wirst es früh genug merken, daß ich ein wirklich unglückliches Menschenkind bin«, so schreibt er an diesem Märztag in Berlin, »mit großen, sehr großen Plänen und Entwürfen, verzehrt von dem brennenden Gefühl, etwas Schönes und Bedeutendes zu leisten, und mit einer schwachen Kraft, die weit hinter den Wünschen zurückbleibt. Dieses Mißverhältnis zwischen der Phantasie, welche die Pläne und Träume in mir nährt und großzieht, und der physischen und moralischen Kraft, welche zu deren Verwirklichung 22notwendig ist, macht mich manchmal namenlos unglücklich. In der Sturm- und Drangperiode hat es ein paar Dichter gegeben, denen es ähnlich ging.«
Siemens wird von einem Geschäftsfreund beim Schreiben unterbrochen. Dann kehrt er an den Arbeitstisch zurück. Er liest den Brief und erschrickt. War er zu schonungslos mit sich? Nein, die Verlobte soll schon erfahren, was ihn bewegt. Wie er empfindet. Warum er an sich zweifelt. Im Übrigen kann er sich selbst auch viel Gutes abgewinnen: »Wenn ich den Eindruck des Unfertigen mache, so liegt das teilweise auch daran, daß ich höhere Ziele habe als andere.«
Aber sieht sich dieser Bankdirektor Siemens wirklich als Geisteskind der Genieperiode? Als den Nachfahren empfindsamer Poeten, die am Leben litten? Ist das die Geburt der Deutschen Bank aus dem Geist des jungen Werther? Wohl kaum. Sturm und Drang sind bei Siemens Synonyme für einen unbändigen und noch nicht befriedigten Ehrgeiz. Er will Großes erreichen und weltumspannend tätig sein. Und er hat keine Scheu davor, Risiken einzugehen. Anstatt gefühlsstarke Briefromane zu schreiben, plant er die Expansion einer Bank.
*
Im Sinne der Aufsichtsräte und Kapitalgeber sind Siemens’ Pläne nur bedingt. Als Privatbankiers haben sie eigene Geschäftsinteressen. Sie wollen vermeiden, dass ihnen mit der Deutschen Bank eine Konkurrenz erwächst. Groß und einflussreich darf die Bank allenfalls im Ausland werden, im Inland soll sie klein und bescheiden bleiben. Und auch Hermann Wallich bremst, wenn der Kollege Siemens wieder mal eine Idee hat und ein schwächelndes Geldinstitut in Rio de la Plata kaufen möchte.
Letztlich kann sich Siemens durchsetzen. Die Bank geht in den folgenden Jahrzehnten weit über ihre ursprüngliche Bestimmung, die Unterstützung des Außenhandels, hinaus und wird in sämt23lichen Bereichen des Bankengeschäfts tätig, betreut Privatkunden im Inland und investiert in ehrgeizige Auslandsprojekte von südafrikanischen Goldminen bis zur Anatolischen Eisenbahn. Als Hausbank und Anteilseigner finanziert die Bank die deutsche Industrie und nimmt zunehmend Einfluss auf die Volkswirtschaft.
Vielleicht ahnt Siemens schon etwas von dieser künftigen Entwicklung, als er seinen Brief an Elise schreibt. Jedenfalls traut er sich einiges zu. Er schließt mit einer Wendung, die gar nicht mehr nach unglücklichem Dichter klingt: »Ich bin auf dem Wege, einflußreich zu werden, und wenn Du mir etwas hilfst, dann kannst Du in zehn Jahren eine sehr angesehene Frau werden, um die man sich nicht nur um Deinetwillen, sondern auch um meinetwillen viel Mühe geben wird. Könnte Dir das gefallen?«
*
Ja, es gefällt ihr. Im Mai 1872 heiraten Elise Görz und Georg Siemens. Sie beziehen eine spärlich eingerichtete Wohnung in der Nähe des Tiergartens. Siemens ist damals noch kein reicher Mann. Für den Posten bei der Deutschen Bank hat er eine Gehaltseinbuße in Kauf genommen. 1500 Taler bekommt er im Jahr, heute wären das ungefähr 35000 Euro. Viele Berliner leben auf größerem Fuß als der Bankdirektor Siemens. Denn das Gründerfieber nimmt immer groteskere Züge an.
Innerhalb von zwei, drei Jahren entstehen so viele neue Eisenhütten, Hochöfen und Maschinenfabriken in Preußen wie über das gesamte Jahrhundert zuvor. Die Arbeitskräfte werden rar, die Gehälter steigen, und das leicht verdiente Geld will ausgegeben und angelegt werden. Opportunitäten gibt es genug. Landjunker und Offiziere, Rechtsanwälte und Ärzte, Maurer und Droschkenfahrer – sie alle beteiligen sich an den Aktiengesellschaften, um rasch zu Reichtum zu kommen.
Doch der Aufschwung schafft nicht nur Gewinner. Die boomenden Großstädte bieten Neuankömmlingen keinen Platz mehr. Die 24Mieten steigen rasant, weil das Gründerfiebergeld auf die Immobilienpreise wirkt. In der Blumenstraße in Friedrichshain räumt im Sommer 1872 ein Gerichtsvollzieher die Wohnung eines Tischlers. Erregte Nachbarn kommen dem armen Mann zu Hilfe, werfen die Fensterscheiben des Hauseigentümers ein. Die Polizei braucht Tage, um die öffentliche Ordnung wiederherzustellen.
*
Einer, der sich nach Ruhe und Ordnung sehnt, reist zu Beginn des Jahres müde und erschöpft in ein englisches Seebad. Das in Deutschland wuchernde Gründerfieber verabscheut Alfred Krupp – »ich bin kein Börsen-Spekulant, sondern Fabrikant«, sagt er –, und er leidet an verschiedensten Krankheiten, echten und eingebildeten. Auf Anraten der Ärzte soll er sich mehrere Monate lang erholen. Doch gefällt ihm das Seebad Torquay zunächst überhaupt nicht. In Essen, oben auf dem Hügel, wo er sich gerade eine Villa bauen lässt, ist der Spätsommer heiß gewesen. Hier, an der englischen Südküste, herrscht Nebel, und es regnet. Krupp ärgert sich: dass man so früh im Jahr den Ofen anmachen muss, um nicht zu frieren.
Anstatt auf der Promenade zu flanieren, verbringt er seine Tage in dem Haus auf der Anhöhe, das er für die Familie gemietet hat, und schreibt lange Briefe an die Geschäftsleitung in Essen. Mal mischt er sich ins Tagesgeschäft ein und ärgert sich über einen Angestellten, der vertragsbrüchig geworden ist: »Dieser Fall ist so ernst, daß von Nachgeben keine Rede sein kann.« Dann wieder erinnert er sich an die frühen Jahre. Vielleicht ist es der weite Blick aufs Meer, der ihn in Erinnerungen schwelgen lässt. Fast elegisch schreibt er: »Aus dem kleinen Keim der Fabrik, wo Rohmaterial en detail gekauft wurde, wo ich Procurist, Correspondent, Cassirer, Schmidt, Schmelzer, Coaksklopfer, Nachtwächter beim Cementofen und sonst noch viel dgl. war, wo ein Gaul sämtliche Transporte gemüthlich besorgte, wo zehn Jahre später das Wasser zur ersten errichteten Dampfmaschine in Ringeln aus dem Teiche getragen wurde in den leer gepumpten 25Brunnen, weil die Röhrenanlage zu theuer war, ist das jetzige Werk endlich hervorgegangen.«
Warum beginnt Krupp ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt zurückzuschauen? Die Firma Friedrich Krupp, die er als 14-Jähriger nach dem Tod des Vaters übernommen hat, wird ihm allmählich fremd. Er hat sie stets allein geführt, besessen und arbeitswütig, ist nie zur Ruhe gekommen. Zunächst finanziert von Verwandten und Freunden, hat er die Gewinne in immer größere Anlagen, in neue Produkte und Verfahren investiert. In einen gigantischen Dampfhammer, »Fritz« genannt und fünfzig Tonnen schwer, der mit Hilfe eines Kettenwerks in die Höhe gehievt wird, um dann mit erstaunlicher Präzision auf den zu bearbeitenden Gussstahl hinunterzusausen.
Krupps Fabriken okkupieren inzwischen einen großen Teil der Stadt Essen, in deren Zentrum die Urgroßmutter einst ein Kolonialwarengeschäft besaß. Die Firma ist in diesen Jahren finanziell erfolgreicher denn je, sie produziert Walzen, Eisenbahnschienen, Radreifen für Lokomotiven. Und Kanonen. Für die Türkei, für Russland, für das preußische Militär, das mit Hilfe der schweren Geschütze die Kriege gegen Dänemark, Österreich und Frankreich für sich entschieden hat.
Aber was nun? Krupp, der Unternehmer, sitzt einsam an der Spitze einer Hierarchie, die laufend neue Stufen dazugewinnt. Unter sich hat er die Prokura (die kaufmännische Leitung), darunter die Ressortchefs, die Betriebsführer, die Obermeister, die Meister und die Arbeiter. Eine große Sorge Krupps ist, dass die Beschäftigten, die er nicht mehr persönlich beaufsichtigen kann, faul und träge werden. Eine andere, dass sich Sozialisten und Gewerkschafter einschleichen. Auch der Geschäftsleitung traut er nicht. Er möchte alles selbst regeln, also schreibt er Briefe. »Wo ist die Kontrolle, wenn ein Feuer unbemerkt ausbrechen kann?«, fragt er, als er von einem Brand in der Fabrik erfährt. »Alles Unglück ist immer eine Folge von Mangel an Vorsicht und von Gleichgültigkeit.«
Wahrscheinlich weiß Krupp selbst, dass er nicht mehr die Kraft 26hat, dieses riesige Unternehmen zu führen. Woher sonst die Erschöpfung, die sich in diffusen Leiden äußert. (Burnout-Syndrom nennt man so etwas heute.) Die letzten Winter hat Krupp nur noch ungerne in Essen verbracht, immer wieder ist er in Kurorte geflohen und hat die länger werdenden Auszeiten auf die Gesundheit geschoben. Wie soll er die beiden einander widerstrebenden Impulse – zu kontrollieren und loszulassen – bloß vereinen?
Krupp hat eine Idee. In Torquay, an der englischen Riviera, wo im Winter die Kamelien blühen, wird diese Idee zur Obsession. Er, der immer schon versucht hat, alles schriftlich zu fixieren, möchte eine Betriebsverfassung entwerfen. Einen umfassenden Text, der alle Briefe erübrigt. Er nennt diesen Text das »General-Reglement«. Oder auch, ganz unironisch, sein Opus. Er schaut aufs Meer, er sieht die Firma vor sich. So, wie er sie einst geschaffen hat. Und er schreibt so schöne und klare Sätze wie diesen hier: »Tore, Türen, Schlösser, Wege, Rinnen, Kanäle, Pflaster, alles muß stets in Ordnung sein.«
*
Die Fragen, auf die Krupp eine Antwort zu finden sucht, stellen sich auch bei anderen Unternehmen, die stark wachsen. Die Telegrafen-Bauanstalt von Siemens & Halske, gegründet 1847 in einem Berliner Hinterhaus, ist in wenigen Jahrzehnten zur weitverzweigten Weltfirma aufgestiegen. Sie baut Telegrafenlinien in ganz Europa, in Russland und in Persien, sie verlegt Seekabel im Mittelmeer und über den Atlantik. Während des Gründerbooms hat Siemens schon über 1500 Mitarbeiter und Tochterunternehmen in London und St. Petersburg.
Trotzdem sträubt sich der Gründer Werner Siemens dagegen, Verantwortung an Angestellte abzugeben. Die Idee der Familienfirma strapaziert er bis aufs Äußerste, indem er wichtige Posten mit Verwandten besetzt. Zum Glück hat er viele davon, elf Geschwister, und die Eltern sind früh verstorben, er trägt die Verantwortung. 27Sechs von neun Brüdern werden in den Unternehmungen involviert. (Die beiden Schwestern bleiben außen vor.)
Ein Bruder, Wilhelm Siemens, leitet die Niederlassung in London.
Ebenfalls dort beschäftigt ist zeitweilig die Nummer zwei, Friedrich.
Carl, Nummer drei, baut das Russland-Geschäft in St. Petersburg auf.
Die Nummer vier, Walter, führt die Filiale in Tiflis und erwirbt gemeinsam mit den Brüdern ein Kupferbergwerk im Kaukasus.
Als Walter jung verstirbt, übernimmt Otto, die Nummer fünf, die Filialleitung in Tiflis.
Hans, Nummer sechs, gründet eine Glashütte in Dresden, finanziert von Werner.
*
Im März 1872 kehrt Krupp aus England zurück ins Ruhrgebiet. Das General-Reglement ist immer noch nicht fertig. Die Geschäftsleitung soll den Text ergänzen, redigieren und, um der Übersichtlichkeit willen, in Abschnitte gliedern. Doch die Männer in Essen verschleppen die Arbeit. Im Grunde genommen wünschen sie keine Betriebsverfassung, schon gar nicht eine, die sie in ihrer Freiheit beschneidet. Auch der Titel gefällt ihnen nicht. Krupp schlägt deshalb »Statut« vor. Am Ende wird aus dem »General-Reglement« das »General-Regulativ«.
*
Was ist sonst noch los im Boomjahr 1872? Gustav Freytag veröffentlicht den ersten Band seines Riesenwerks Die Ahnen, Felix Dahn arbeitet am ebenfalls mächtigen Ein Kampf um Rom, und Anselm Feuerbach vollendet die zweite Fassung der Amazonenschlacht. Große historische Stoffe beschäftigen die Bildungsbürger. Nach 28Telegrafenmasten, Dampfhämmern und den rot schillernden Abwässern der Farbenfabriken dagegen sucht man in Kunst und Literatur vergeblich.
Nur einer macht sich auf, um die wuchernden Industrielandschaften genauer anzuschauen. Adolph Menzel, der Berliner Künstler, berühmt geworden mit monumentalen Darstellungen aus dem Preußen Friedrichs des Großen, reist im Mai 1872 nach Oberschlesien und nistet sich mit dem Skizzenblock in einem Eisenwalzwerk ein. Das Werk ist Teil der Vereinigten Königs- und Laurahütte, einer neuen Aktiengesellschaft, geschaffen vom mächtigen Montanunternehmer Hugo Graf Henckel von Donnersmarck.
In seinem detailbetonten Realismus, der akkuraten Darstellung des Spiels von Licht und Schatten, unterscheidet sich Menzels Eisenwalzwerk nicht wesentlich vom Flötenkonzert Friedrichs des Großen in Sanssouci, sehr wohl aber im Gegenstand. Der Kronleuchter des Flötenkonzerts wird im Eisenwalzwerk zur feurig glühenden Luppe, deren Hitze in den angestrengten Arbeitergesichtern widerscheint. Menzel sagt später, er habe beim Porträtieren von Riesenschwungrädern und Eisenblöcken Angst gehabt, »gewissermaßen mitverwalzt zu werden«.
*
Das »General-Regulativ für die Firma Fried. Krupp« ist fertig. Am 30. September 1872 hält Krupp die ersten zwölf Exemplare des Werks in den Händen. Obwohl der Text gründlich redigiert worden ist, entspricht er dem Unternehmer in seiner ganzen irritierenden Widersprüchlichkeit. Da findet sich die penible Anweisung, dass die Mitarbeiter im Büro das Lesen von Zeitungen zu unterlassen hätten. Zugleich skizziert Krupp hier zum ersten Mal seine wegweisende und großzügige Sozialpolitik, er schreibt über die »Errichtung von Krankenkassen, Unterstützungs- und Pensionskassen, Krankenhäusern und Bewahr-Anstalten« für die Arbeitnehmer. Und er nimmt das betriebliche Vorschlagswesen vorweg, weist die Unter29nehmensleitung an, Verbesserungsideen der Mitarbeiter »dankbar entgegen zu nehmen«. Man liest und sieht: Krupp fordert nicht nur, er fördert auch. Ein Exemplar des General-Regulativs geht an Kaiser Wilhelm I., versehen mit einer handschriftlichen Widmung des Unternehmers: »Ursprünglich bestimmt dem inneren Gedeihen des Bestehenden – außerdem dienstbar der Abwehr sozialer Verirrung.«
*
Das Bestehende gedieh nicht mehr lange. Im Mai 1873 brach die Wiener Börse zusammen. Im September folgte New York. Und schließlich, im Oktober, Berlin. Der Konkurs von Heinrich Quistorps Vereinsbank war es, der den Anfang machte. Andere Firmen folgten rasch. Deutschland erlebte eine heftige Rezession, einen massiven Einbruch der Wirtschaftstätigkeit, der bis zum Ende des Jahrzehnts anhielt.
Doch womöglich waren die psychologischen Auswirkungen noch schwerwiegender und nachhaltiger als die ökonomischen. Die konservativen Kräfte, die schon lange eine antisemitisch gefärbte Abneigung gegen den liberalen Kapitalismus empfunden hatten, gegen Finanzmärkte und das sogenannte Spekulantentum, sahen sich bestätigt. Andere wiederum – darunter auch jene Bürger, die ihren Aufstieg der Liberalisierung verdankten – waren zutiefst verunsichert. Die Klage über die schlimmen Zustände wurde den Unternehmern zur Gewohnheit. Sie beschwerten sich über magere Gewinne und den entsetzlichen Wettbewerb, über aufsässige Arbeiter und nicht ausgelastete Fabriken. Und sie hörten auch dann nicht auf mit dem Klagen, als es schon längst wieder aufwärtsging.
Das typisch deutsche Unternehmen ist eine Geburt der Gründerzeit. Aber erst in den Jahren nach dem Krach bildeten sich jene prägenden Merkmale heraus, die das 19. Jahrhundert überdauern sollten. Denn der Schock saß tief, er nährte ein obsessives Verlangen nach Ordnung, nach Sicherheit und Planbarkeit, nach Abschottung 30und Ausgrenzung. Das zeigte sich nicht bloß in der Wirtschaftspolitik des Kaiserreichs, sondern auch in der Art und Weise, wie sich die Firmen, die den Börsenkrach überlebten, neu aufstellten. Die Antwort auf das wilde Treiben der Boomjahre war das, was manche Ökonomen später als den Organisierten Kapitalismus bezeichnet haben: Alles muss stets in Ordnung sein.
*
Das Sommerhaus der Familie Wallich steht heute noch. Man sieht es zur Rechten, wenn man auf dem Weg von Berlin nach Potsdam die Glienicker Brücke überquert. Eine fröhliche Turmvilla, erbaut im italienischen Stil, mittlerweile cremefarben gestrichen. Doch die Geschichte des Hauses ist tieftraurig und durch und durch deutsch. Hermann Wallich und seine Frau Anna, beide jüdischer Herkunft, übernahmen das Haus 1878, da war Wallich noch Direktor der Deutschen Bank. Nach Hermanns Tod ging es an Sohn Paul über, der mit seiner Familie dort wohnte und viel zu sehr an der Heimat hing, als dass er sich vor den Nationalsozialisten in Sicherheit gebracht hätte. Der Verhaftung entging er nur, indem er nach Köln flüchtete und sich von der Hohenzollernbrücke in den Rhein stürzte. »Mein Liebling«, schrieb er seiner Frau Hildegard in einem Abschiedsbrief, »Du brauchst Dich nicht zu sträuben, auf dem alten Hause an der Glienicker Brücke jetzt die Hakenkreuz-Flagge zu setzen. Die Macht, der ich unterlegen bin, ist eine Weltmacht.«
Hildegard gelang es, Deutschland kurz vor Kriegsbeginn zu verlassen, sie wanderte nach Kalifornien aus, die Köchin und zwei Bedienstete blieben zurück. Nach dem Krieg wurde die Villa zunächst zum Lazarett für russische Soldaten, dann zum Kinderwochenheim. Das Haus wurde den Nachkommen der Wallichs 1994 zurückgegeben, doch konnte sich die Familie die Wiederinstandsetzung nicht leisten und verkaufte es an einen Berliner Bauunternehmer, dessen Pläne, auf dem Grundstück moderne Stadthäuser zu errichten, an den Behörden scheiterten. Die Villa verwahrloste. Skulpturen wur31den entwendet, Fensterscheiben eingeschlagen, der Investor drohte, das Haus abreißen zu lassen.
In den 2000er Jahren schließlich kauften Mathias Döpfner, der Chef des Medienhauses Axel Springer, und der Investmentbanker Leonhard Fischer das Anwesen. Sie ließen die Villa aufwändig restaurieren und machten sie zum Museum. Im November 2009 luden sie Hunderte Gäste zu einer Feier ein, die im Zeichen der jüngeren Geschichte stand. In den Reden ging es um den Kalten Krieg, um die Glienicker Brücke und um den Segen der Wiedervereinigung. Bundeskanzlerin Angela Merkel war gebeten worden, ein paar Worte zu sprechen. Sie holte weit aus: »Perikles hat einmal gesagt…« Die Wallichs aber – die Familie des so gründlich vergessenen Gründungsdirektors der Deutschen Bank, die das Haus einst besessen hatte – erwähnte niemand an diesem verregneten Novemberabend.
32
2Die soziale Frage
Als sich der Boom schon dem Ende nähert und man in Berlin von einem großen Schwindel spricht, da baut sich der Unternehmer Alfred Krupp ein Haus. Das Haus hat 269 Räume und liegt auf einem Hügel im Süden der Stadt Essen, hoch über dem Baldeneysee. Jahre zuvor hat Krupp dort ein Anwesen, den Klosterbuschhof, erworben. Um ungestört zu bleiben, hat der Unternehmer nach und nach umliegende Wälder und Ackerflächen dazugekauft. Es heißt, er habe den Hügel nicht für sich ausgesucht, sondern für seine fast zwanzig Jahre jüngere Frau Bertha, die in der Villa auf dem Betriebsgelände – der Lärm, die schlechte Luft – nicht glücklich geworden ist.
Erste Skizzen für das neue Gebäude, das Krupp anstelle des Klosterbuschhofs errichten möchte, hat er 1864 angefertigt. Die groben Kohlezeichnungen zeigen zwei Gebäude, eines größer als das andere, über eine Galerie miteinander verbunden. Immer wieder streitet sich Krupp mit wechselnden Architekten über seine Ideen, denn diese sind für die damalige Zeit ungewöhnlich. Die Sandsteinfassade monumental, aber schnörkellos. Die inneren Gerüste, die Säulen und Treppen, allesamt aus Eisen. Dazu das gewölbte Glasdach über der Oberen Halle, ein Wohngefühl wie im Wartesaal eines riesigen Bahnhofs.
Glas, Eisen und Stahl – Krupp greift auf die Materialen zurück, die er aus der Industrie kennt. Er möchte ein Bauwerk, das den technischen Fortschritt verkörpert, nicht die Kunst, er verabscheut alles Ornamentale. Weder Neorenaissance noch Neobarock oder Neogotik soll ihm ins Haus kommen. In einem Brief kritisiert Krupp 33die Architektur seiner Epoche, die »für Aussehen, Form und Stil« unnötig Ressourcen vergeude, und er setzt hinzu: »Ich kann nicht genug Strenge empfehlen.«
Trotzdem gehen Aufwand und Kosten über jedes Maß hinaus. Der Sandstein kommt aus Chantilly, es ist dasselbe Material, das Baron Haussmann in Paris benutzt. Für den umliegenden Park wünscht sich Krupp große alte Bäume. Der Unternehmer, der einmal geschrieben hat, seine Ungeduld sei ein »Crocodil«, das sich nicht bezähmen lasse, möchte nicht auf das Heranwachsen eines Waldes warten. Also werden in Mülheim und Gelsenkirchen ganze Alleen entwurzelt und mit eigens konstruierten Baumtransportwagen auf den Hügel gekarrt. Eichen, Platanen und Kastanien. Die Nussbäume kommen aus Kettwig. Besondere Erwartungen hat Krupp an das Heizungssystem. Er wünscht ein Raumklima, das bei geschlossenen Fenstern so frisch und angenehm wirkt wie ein Frühlingstag im Freien. Durch Eisenrohre soll den Räumen unverbrauchte Luft zugeführt werden.
Natürlich verzögert sich der Bau. Die Steinmetze aus Frankreich, die im Zuschneiden des Sandsteins besondere Fähigkeiten haben, verschwinden, als Kaiser Napoleon III. Preußen den Krieg erklärt. Dann später, als der Rohbau gerade fertig ist, gibt der Boden unter den gewaltigen Materialmassen nach, der Erker löst sich und sackt ab. Krupp kann es nicht fassen, er sucht die Schuld bei seinen Baumeistern. In bitterbösen Briefen klagt er sie an, er rechnet ab mit der ganzen Architektenzunft.
Am 10. Januar 1873 schließlich zieht die Familie ein. Doch der Bauherr bleibt unzufrieden. Am meisten stört ihn das verflixte Heizungssystem. Die Hallen sind zu kalt, es zieht im Treppenhaus, und immer wieder pusten die Eisenrohre Küchengerüche in die Wohnräume. Ein halbes Jahr nach dem Einzug lässt Krupp eine umfangreiche Kosten- und Mängelliste erstellen. Zu diesem Zeitpunkt sind die Börsen von Wien und New York schon zusammengebrochen. Berlin folgt bald darauf. Und die Heizung auf dem Hügel ist längst 34nicht mehr Krupps einziges Problem. Sein Unternehmen braucht Geld. Sehr viel Geld.
*
Die große Krise, die 1873 mit dem Wiener Börsenkrach ihren Anfang nahm, traf die Deutschen völlig unvorbereitet. Das Land hatte, anders als die älteren Wirtschaftsnationen England, Frankreich oder Holland, weniger Erfahrung mit Spekulationsblasen, man kannte die brutalen gesamtwirtschaftlichen Abstürze nicht, die auf Perioden fantastischer Übertreibung folgen. Der Schock, den die Gründerkrise auslöste, hat die deutsche Wirtschaft nachhaltig geprägt.
Zwar beschränkte sich der eigentliche Abschwung bloß auf die ersten sechs Jahre nach dem Zusammenbruch. Doch weil auf kurze Erholungsphasen immer wieder Rückschläge folgten, sprach man auch in den 1880er Jahren noch von einer Krise, von der Langen Depression. Erst der wuchtige Boom, der sich Mitte der 1890er Jahre einstellte und bis zum Ersten Weltkrieg andauerte, setzte der bleiernen Zeit ein Ende.
Tatsächlich befand sich die Wirtschaft, als die Krise hereinbrach, am Anfang eines tiefgreifenden und schmerzlichen Strukturwandels. Die Schwerindustrie an der Saar, an der Ruhr und in Oberschlesien – das Geschäft mit Eisen, Kohle und Stahl – hatte einen rasanten Aufstieg hinter sich, getragen vom Ausbau der Eisenbahn. Mit dem Gründerkrach war der Zenit zunächst einmal überschritten, man hatte zu viel investiert, zu viel produziert, zu viele Leute eingestellt, der Markt war gesättigt. Auch entsprach der patriarchalische Führungsstil mancher Unternehmer nicht mehr den Erfordernissen von Geschäften, die zunehmend komplexer, diversifizierter und internationaler wurden.
Die neuen Industrien dagegen, Chemie, Elektrotechnik und Maschinenbau, die gegen Ende des Jahrhunderts blühen sollten, waren noch nicht ausgereift, die Umsätze und die Zahl der Arbeitsplätze viel zu niedrig, um die vorübergehenden Einbußen der Schwer35industrie wettzumachen. Zwar hatte das Geschäft von Firmen wie Bayer, Hoechst und der BASF aufgrund der starken Nachfrage nach künstlichen Farbstoffen eine gewisse Größe erreicht und sich in der Folge als krisenresistent erwiesen. Doch waren Forschung und Entwicklung zunächst noch wenig organisiert. Die Einrichtung gut ausgestatteter Laboratorien, die Zusammenarbeit mit den Universitäten und technischen Hochschulen, die absichtsvolle Verbindung wissenschaftlicher Arbeit und betriebswirtschaftlicher Anwendung – all das stand erst bevor.
Im Feld der Elektrotechnik wiederum ging die Familienfirma Siemens voran. Sie waltete nicht bloß in Deutschland, sondern auch in Russland, England und anderswo. Beim Bau von Telegrafenlinien allerdings stagnierte das Geschäft. Die Firma konzentrierte sich in den 1870er Jahren zunehmend auf die Verlegung von Seekabeln, ein abenteuerliches Unterfangen, geprägt von allen nur erdenklichen Rückschlägen. Noch nicht angebrochen war die große Ära der Elektrifizierung, die flächendeckende Versorgung ganzer Städte und Länder mit Strom, eine gewaltige Organisationsaufgabe, die enorm viel Kapital und ein professionelles Management erforderte.
In einer embryonalen Phase befand sich die Automobilindustrie, die sich erst nach dem Zweiten Weltkrieg zum deutschen Leitsektor entwickeln sollte. Carl Benz, Gottlieb Daimler und Nicolaus August Otto waren noch jung, als die Krise hereinbrach, sie erarbeiteten die technischen Grundlagen und feilten, bei ständiger Explosionsgefahr, an Motoren, deren späterer Erfolg überhaupt nicht abzusehen war. Entsprechend schlecht dokumentiert sind diese Anfänge, die in Werkstätten, Hinterhöfen und Gartenhäusern gemacht wurden, ohne dass die Öffentlichkeit groß Notiz davon genommen hätte.
Weil sich die Unternehmen, um die es hier geht, in ganz unterschiedlichen Entwicklungsstadien befanden, waren sie nicht alle gleichermaßen vom Einbruch der Wirtschaft betroffen. Nicht für jede dieser Firmen stand nach 1873 gleich die Existenz auf dem Spiel. Aber fast alle mussten in den Folgejahren ihre Geschäftsstrategien prüfen und sich unter veränderten Umständen neu ausrichten. Sie 36kämpften um Umsätze und Aufträge, um das tägliche Geschäft und waren zugleich mit grundsätzlichen Fragen konfrontiert.
Die 1870er Jahre waren eine überspannte Zeit, geprägt von den großen gesellschaftlichen Debatten – die »Judenfrage« und der Kulturkampf gegen die Katholiken. Das Thema aber, das die Unternehmer am meisten beschäftigte, war die soziale Frage: die Auswirkungen der industriellen Revolution auf die Gesellschaft als Ganzes und auf die Arbeiterschaft insbesondere, die in den rasant wachsenden Städten unter knappem Wohnraum, widrigen Arbeitsbedingungen und gesundheitlichen Belastungen litt.
Karl Marx, der Prophet des Umsturzes, lebte 1873 in London. Im Lesesaal des British Museum arbeitete er an einem Nachwort für die zweite Auflage des Kapitals, Band1, und er freute sich wie ein Kind über die schlechten Nachrichten aus Deutschland. Die Krise sei mal wieder im Anmarsch, so schrieb er, sie werde den Glückspilzen des heiligen deutschen Reiches Dialektik einpauken und dem »praktischen Bourgeois« die Widersprüche der kapitalistischen Gesellschaft offenbaren.
Tatsächlich sahen die Unternehmer diese Widersprüchlichkeit auch, sie begriffen, dass die Krise zum Wesen der freien Marktwirtschaft gehörte, und das gefiel ihnen überhaupt nicht. Vom Gründerfieber hatten sie profitiert, doch empfanden sie die liberale Ordnung nun, da das Pendel in die andere Richtung schlug, als wild und ungezügelt und gemeingefährlich. Im Besonderen fürchteten sie die Reaktion der Arbeiter auf Lohnkürzungen und Entlassungen, die drohende Revolution wurde in Unternehmerkreisen endlos diskutiert, sie beeinflusste Denken und Handeln.
Auch um das eigene Geschäft zu sichern, vollzogen viele Unternehmer den Abschied vom Laissez-faire-Liberalismus. Sie gaben den »Kapitalisten« und »Spekulanten«, den »Aktienschwindlern« und »Börsenjuden« die Schuld an einem Zusammenbruch, zu dem sie selbst beigetragen hatten. Als hätten sie nie anders gedacht, behaupteten sie nun, man müsse den freien Markt beschneiden und stabile Strukturen schaffen. Sie fanden in größeren Einheiten zusammen, 37in Großbetrieben, Kartellen und Verbänden, und sie suchten die Nähe zu einem starken Staat, der sich ebenfalls vom Liberalismus abwendete und ordnend und schützend in die deutsche Wirtschaft eingriff.
*
Ein paar Zahlen, die das Ausmaß der Krise wiedergeben.
Von den neunhundert Aktiengesellschaften, die nach 1870 gegründet wurden, überlebten den Gründerkrach gerade mal 200.
Die Rohstoffpreise sanken dramatisch. Bei der Gutehoffnungshütte in Oberhausen kosteten Stahlschienen, Stabeisen und Eisenblech im Sommer 1874 nur noch halb so viel wie ein Jahr vorher.
In Berliner Maschinenbaubetrieben waren 1873 um die 35000 Menschen beschäftigt, vier Jahre später weniger als die Hälfte.
*
Und ein Todesfall: Im Oktober 1873 wird im Stadtgraben von Stralsund ein Mann mit aufgeschlitzten Pulsadern gefunden. Der Pensionär, er heißt Riedel mit Nachnamen, hat ein Vermögen von 20000 Talern bei Quistorps Vereinsbank in Berlin investiert und infolge der Krise verloren.
*
Der Verwaltungsrat der Commerz- und Discontobank in Hamburg, gegründet 1870, genau wie die Deutsche Bank, bedauert, dass er aufgrund der Geschäftsentwicklung keine Dividende zahlen könne. Ein Prokurist hat Spekulationsgeschäfte getätigt und vergeblich versucht, die Verluste zu verschleiern. Eine jede Bankenkrise bringt solche Charaktere hervor, Hasardeure, deren Geschäfte so lange gut gehen, bis der Crash kommt. Doch der Mann bleibt anonym. Im Geschäftsbericht der Commerzbank heißt es sehr dis38kret: »Die Wechselstube hat uns pro 1873 einen Verlust gebracht von Rm (Reichsmark) 180933.44. Als wir im Jahre 1872 dieselbe errichteten, war es die Absicht, ein Effecten-Geschäft der solidesten Art zu machen, was jedoch durch die Handlungsweise der zur Leitung derselben berufenen Persönlichkeit vereitelt wurde, und hatten wir schon gegen Ende vorigen Jahres beschlossen, dieses Institut wieder aufzugeben.«
*
Die Berliner Union Actien-Gesellschaft für Eisengiesserei und Maschinen-Fabrikation wird 1875 liquidiert. Zehn Jahre zuvor hat der Maschinenbauer Emil Rathenau die Firma in der Berliner Chausseestraße gegründet. Im ehemaligen Tanzsaal der Gaststätte Bella Vista hat er, umgeben von alten Bäumen, eine kleine Fabrik untergebracht, die Dampfmaschinen herstellt sowie Bühnenkonstruktionen für das Königliche Opernhaus; das Schiff für Giacomo Meyerbeers Afrikanerin ist dort entstanden.
Rathenau selbst hat rechtzeitig verkauft. Als das Unternehmen schließen muss, ist er bloß angestellter Direktor. Trotzdem rutscht er in eine schwere Krise. Er ist 37Jahre alt und weiß nicht, was er mit sich anfangen soll. Um auf neue Ideen zu kommen, reist er zu Weltausstellungen. Nach Wien. Nach Philadelphia. Nach Paris. Mal begeistert er sich für das eine Projekt, dann wieder für ein anderes. So sucht Emil Rathenau jahrelang nach seiner Bestimmung, bis er schließlich, in einem hellen Moment, das deutsche Patent auf Thomas Alva Edisons Glühlampe erwirbt.
*
Krupp wendet sich an den Kaiser. Zehn Millionen Taler möchte er vom Staat haben. Er benötige das Darlehen, so schreibt er Wilhelm I. in einem Brief, um seine Handlungsfähigkeit zu sichern: »So bleibt mein Werk vor Missbrauch von Kapitalisten bewahrt.« 39In den guten Zeiten hat Krupp die Gewinne ins Unternehmen reinvestiert, er hat Eisenhütten und Kohlenzechen erworben und sich an einer Erzgrube in Bilbao beteiligt. Nun, da die Preise fallen und die Nachfrage einbricht, kann der Unternehmer die Schulden nicht mal annähernd begleichen.
Krupps Nöte sind nicht einzigartig. Auch die Rivalen, die Dortmunder Union, der Bochumer Verein oder Phoenix, leiden unter den riesigen Investitionen, die sie während der Boomjahre getätigt haben, und unter der verschärften internationalen Konkurrenz, weil jetzt alle Unternehmen, ob in Wallonien oder Yorkshire, versuchen, ihre Industrieprodukte zu Niedrigpreisen loszuwerden.
Was Krupp von anderen Unternehmern unterscheidet: Er ist fest davon überzeugt, dass der Staat einspringen muss, um ihn zu retten. Er denkt an die Kanonen, die dem Militär in den Kriegen gegen Österreich, Dänemark und Frankreich gute Dienste geleistet haben. Und an die Wohnanlagen, die er für seine Arbeiter errichtet hat, ein soziales Pionierprojekt, das an Größe und Ambition in Deutschland seinesgleichen sucht.
Gerade erst ist mit Cronenberg die schönste Kolonie entstanden, eine Siedlung westlich des Essener Fabrikgeländes, 1400 Wohnungen in dreigeschossigen Bauten, dazu ein hübscher Park in der Mitte, ein Einkaufsladen, ein Gasthaus mit Kegelbahn und ein Musikpavillon – und all das bloß, um die Arbeiter, die bei Krupp beschäftigt sind, zu loyalen und obrigkeitshörigen Kruppianern zu machen, zu Vorbildern für das gesamte deutsche Proletariat, das immun werden soll gegen die Versprechungen des Sozialismus.
In der Krise zeigt sich der Charakter eines Menschen. Krupp begreift sich als Ausnahmeunternehmer. Weil er schon im Aufschwung nicht den Prinzipien betriebswirtschaftlicher Logik gehorcht hat, findet er, dass er auch im Abschwung davon ausgenommen sein müsse. Eine nationale Institution sei das Unternehmen Krupp, so meint er. Und er warnt davor, was passieren sollte, wenn diese Institution, der es nie um Dividenden gegangen sei, sondern um das Gemeinwohl, in die Hände ausländischer Anleger fallen sollte.
40In der Tat ist die Zukunft des Unternehmens im Jahr 1873 höchst ungewiss. Krupp weist die Unterhändler an, nicht allzu demütig aufzutreten. »Stolz und frech« sollen sie sich in der Hauptstadt Berlin geben. Seine Leute wissen es besser. Unzählige Bittgänge sind vonnöten, um überhaupt etwas zu erreichen. Denn die Regierung des Reichskanzlers Otto von Bismarck, zu diesem Zeitpunkt noch wirtschaftsliberal ausgerichtet, hat überhaupt kein Interesse daran, ein Riesenunternehmen, das sich verhoben hat, mit zinsfreien Darlehen zu retten. Erst Ende März 1874 erklärt sich ein Konsortium, angeführt von der preußischen Staatsbank, bereit, einen Kredit über zehn Millionen Taler zu geben. Nicht zinsfrei, sondern zu den marktüblichen Konditionen. (Fünf Prozent.) Mit einer kurzen Laufzeit. (Bloß neun Jahre.) Und unter der Auflage, dass ein Bankenvertreter als Treuhänder in die Geschäftsleitung einzieht.
Krupp ist nicht enttäuscht, nein, schlimmer, er empfindet die Konditionen als Niederlage, als persönliche Demütigung, und eine schreckliche Schwermut überfällt ihn: Wie hat ihm so etwas überhaupt geschehen können? Und wenn es denn einmal geschehen ist, kann es nicht jederzeit wieder geschehen? Das Unternehmen aber überlebt. Das Staatsgeld reicht am Ende aus, um Krupp durch die Krise zu bringen.
*
Nicht allen geht es schlecht. Für die Gasmotorenfabrik Deutz in Köln wird das Geschäftsjahr 1875/76 zum Rekordjahr. Nie hat sie mehr Motoren verkauft, 634 Stück sind es. Der kaufmännische Direktor Nicolaus August Otto hat einen Gasmotor erfunden, den vor allem Handwerksbetriebe nutzen. Der technische Direktor Gottlieb Daimler ist aus Karlsruhe dazugestoßen, um die industrielle Fertigung aufzubauen.
Otto und Daimler, ein ideales Gespann, so möchte man meinen, denn beide gehen später als Automobilpioniere in die Geschichte ein. Aber die zwei leitenden Mitarbeiter, die gegenüber dem Firmen41gelände ein stattliches Doppelhaus teilen und deren Kinder miteinander spielen – sie können einander nicht ausstehen. Sie konkurrieren, wo sie nur können. Im Geschäft. Und bei der Gemüseernte in den langgestreckten Gärten, die hinter den Doppelhaushälften bis ans Rheinufer reichen.
*
Auch die BASF, kurz für Badische Anilin- & Soda-Fabrik, macht weiterhin Gewinne. Mitten in der Krise wird der Palast des Gründers fertig. Der Gründer hat den Bau noch während der Boomzeit geplant. Er heißt Friedrich Engelhorn, sein Haus nennt er, wenig erfinderisch, »Palais Engelhorn«.
Engelhorn ist ein Mannheimer Unternehmer, der als junger Mann ein Gasbeleuchtungsgeschäft geführt hat. Bei der Gasherstellung entstehen Abfallprodukte, die zur Erzeugung von Teerfarben genutzt werden können. In England stößt ein Chemiker eher zufällig auf ein sehr attraktives Violett, das sogenannte »Mauvein«, geeignet zum Färben von Seide und Baumwolle. Aus Frankreich kommt bald darauf ein rotblaues »Magenta«. Chemiker in ganz Europa wetteifern darum, die nächste Farbe auf den Markt zu bringen.
Engelhorn ist einer der ersten deutschen Unternehmer, die in das neue Geschäft einsteigen. (Bayer in Wuppertal und Hoechst bei Frankfurt sind frühe Konkurrenten.) In einer alten Zinkhütte auf dem Mannheimer Pestbuckel produziert er Magenta, Violett, Blau und andere Farben für die Textilindustrie. Ein Chemiker, der die Familie Engelhorn trifft, berichtet danach, dass »die frohe Mädchenschar in den neuesten Anilinfarben« geleuchtet habe. Die Welt wird bunt.
Die BASF bezieht einen Standort in Ludwigshafen, ein Gelände nördlich der noch winzigen Stadt, 13 Hektar groß und günstig gelegen am Ufer der Rheins, den man als Transportweg, Abwasserbecken und Müllkippe nutzen kann. Engelhorn selbst bleibt auf der gegenüberliegenden Rheinseite wohnen, in Mannheim, der 42