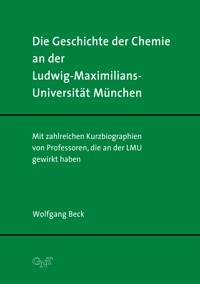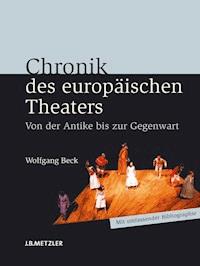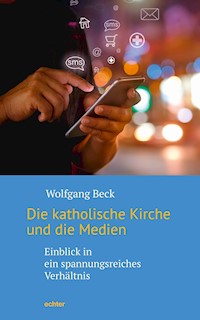
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Echter
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Die katholische Kirche gilt vordergründig mit ihren aufwändigen Liturgien oder einem romantisch anmutenden Klosterleben als ideale Medienreligion. Mit eigenen Zeitungsverlagen, Medienhäusern und einem beachtlichen MitarbeiterInnenstab agiert sie in der deutschen Gesellschaft selbst als Schwergewicht der Medienlandschaft. Und doch findet sie nur mühsam zu einer modernen Offenheit gegenüber einem freien Journalismus und zeitgemäßen Kommunikationsformen. Aus der veränderten gesellschaftlichen Position ergeben sich für die Kirche immer wieder auch Kränkungen. So agiert sie insbesondere in einer von Digitalität geprägten Gesellschaft erkennbar verunsichert. Dieser Band vermittelt grundlegende Kenntnisse der katholischen Medienarbeit in der Moderne, bietet Grundlagenwissen über das kirchliche Medienengagement und erste Ansätze für eine Theologie der Digitalität.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 336
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wolfgang Beck
Die katholische Kirche und die Medien
Einblick in ein spannungsreiches Verhältnis
Wolfgang Beck
Die katholische Kirche
und die Medien
Einblick in einspannungsreiches Verhältnis
Inhalt
Vorwort
1. Einleitung
2. Gegenwärtige Wahrnehmungen
2.1. Gibt es eine Mediengesellschaft?
2.1.1. Medientheorie
2.1.2. Das Bild
2.2. Wie ticken die „Digital Natives“?
2.3. Kirchliches Medien-Engagement
2.3.1. Der Pfarrbrief als Beispiel unterschätzter Potenziale
2.3.2. „Körperschaft öffentlichen Rechts“
2.4. Herausforderungen digitaler Mediennutzung
2.4.1. Medienpädagogik
2.4.2. Medienethik
3. Keine Verkündigung ohne Medien
3.1. Biblische Grundlagen
3.2. Buchdruck, Reformation und Aufklärung
3.3. Massenmediale Aufbrüche
3.4. Gesellschaft gestalten und Themen setzen
3.5. Freiheit oder Freiheitsverlust?
3.6. Weltkirchliche und vatikanische Ebene
4. Historische Perspektiven
4.1. Die kirchliche Suche nach dem eigenen Medienverständnis
4.1.1. Inter Mirifica
4.1.2. Communio et Progressio
4.1.3. Aetatis novae
4.1.4. Chancen und Risiken der Mediengesellschaft
4.1.5. Virtualität und Inszenierung
4.1.6. Medienbildung und Teilhabegerechtigkeit
4.2. Medien als Instrument zur Mobilisierung
4.3. Entwicklung des katholischen Zeitungswesens
4.4. Katholischer Filmdienst, katholisches Filmwerk, Katholischer Kinder- und Jugendbuchpreis
5. Aufbrüche und aktuelle Entwicklungen
5.1. Krisenphänomene
5.2. Neue Formen der Sozialen Medien
5.2.1. Auswahl diverser Social-Media-Formate
5.2.2. Digital-Games
5.2.3. Storytelling, TED-Talk und Humor
5.3. Veränderungen der Arbeits- und Lebenswelt
5.3.1. Die Robbe „Paro“ und andere Roboter
5.3.2. Das Internet der Gegenstände
5.4. Fake News, Manipulation, Big Data
6. Unterschätzte Medienwirkungen
6.1. Erwartung an Partizipation und Nähe
6.2. Mehr als Kirchen-Marketing
6.2.1. Seelsorge und Gottesdienst im Internet
6.2.2. Pastoral im digitalen Terrain?
6.3. Demokratisierungseffekte?
6.3.1. Kommunikative Beschleunigungen
6.3.2. Partizipationsmöglichkeiten
6.3.3. Privatheit, Öffentlichkeit und Kontrolle
6.4. Tendenz zu neuen Gemeinschaftsformen
7. Fazit und Ausblick
7.1. Rückgriffe in vormoderne Medienpraxis
7.2. Eine Theologie der Digitalität?
Anmerkungen
Literaturverzeichnis
Vorwort
Die Annahme, nicht die Autor_innen suchten sich ein Thema, sondern das Thema suche sich die Autor_innen, klingt wie eine abgegriffene Phrase. Doch sie entspricht sehr weitgehend meinem Verhältnis als Autor zum Thema dieses Buches. Meine Aufgabe als Sprecher der Sendung „Wort zum Sonntag“ in der ARD musste von mir eher autodidaktisch und ohne journalistische Ausbildung erarbeitet werden. Hinzu kam 2015 als Dozent die Zuständigkeit für ein Studienprogramm Medien an der Phil.-Theol. Hochschule Sankt Georgen, mit dem Studierenden der Theologie und anderer geisteswissenschaftlicher Fächer die Grundlagen journalistischer Arbeit und kirchlichen Medienengagements vermittelt werden sollen.
Das vorliegende Buch ist im Zuge der Erarbeitung eines Beitrags für „Theologie im Fernkurs“ entstanden und informiert dementsprechend zunächst über Grundlagen des Verhältnisses von katholischer Kirche und modernen Medien.
Die genannten Tätigkeitsfelder wurden auch für mich selbst zu einem pastoraltheologischen Lernfeld, in dem gerade auch die kultur- und gesellschaftsübergreifenden Effekte einer „Kultur der Digitalität“ sichtbar werden. Das Verhältnis zwischen der katholischen Kirche und den Medien erscheint dabei als ein Segment, in dem die Verortung der Kirche in einer modernen Gesellschaft ablesbar wird. Dass dieses Verhältnis auf Seiten der katholischen Kirche über weite Strecken durch Ressentiments gegenüber den Werten und Errungenschaften der Moderne bestimmt ist, lässt nach den markanten Entwicklungen insbesondere der vergangenen 150 Jahre fragen. So wird sichtbar, dass menschliches Leben, insofern es durch Kommunikation geprägt ist, immer mit Medien verbunden ist. Es gibt kein menschliches Leben ohne Kommunikation und ohne die Nutzung von Medien. Deshalb haben sich nicht nur Kommunikations- und Medienwissenschaften, sondern gerade auch die Pastoraltheologie für diese Themen zu interessieren. Wichtige Schritte wurden dazu in den vergangenen Jahren bereits gegangen, etwa mit dem Kongress der deutschsprachigen Pastoraltheolog_innen im Jahr 2017 oder der Profilierung einiger wissenschaftlicher Ansätze. Ich danke vor diesem Hintergrund den Teilnehmer_innen des Rhein-Main-Medienkreises für anregende Gespräche und Impulse. Ich danke dem Team des „Studienprogramms Medien“ an der Phil.-Theol. Hochschule Sankt Georgen für Anregungen und Impulse und Madeleine Helbig-Londo, Barbara Niemetz und Ansgar Weiß für ihre Hilfe bei den Textkorrekturen. Dem Echter Verlag, insbesondere Herrn Heribert Handwerk, gilt der Dank für die Betreuung der Veröffentlichtung. Der Deutschen Bischofskonferenz wie auch dem Freundeskreis der Hochschule Sankt Georgen gilt der Dank für Druckkostenzuschüsse zur Ermöglichung der Veröffentlichung.
Wolfgang Beck
1. Einleitung
Der Mensch „kann nicht nicht kommunizieren“1. Diese Beobachtung geht auf den Kommunikationswissenschaftler Paul Watzlawick zurück, der Kommunikation vor allem als Beziehungsgeschehen versteht. Damit wird zugleich das Dilemma beschrieben, vor dem Menschen immer stehen. Menschliches Leben ist durch alle Stadien seiner individuellen Entwicklung in unterschiedlichen Formen und Intensitäten wie auch durch die kulturgeschichtlichen Epochen mit der Kommunikation verbunden. Die Kommunikation bindet sich an Medien, grundsätzlich an den menschlichen Körper und dessen Sinnesorgane. Mediengeschichtliche Reflexionen und Medientheorien können daher nicht von der Menschheitsgeschichte losgelöst werden. Wenngleich einzelnen kulturgeschichtlichen Entwicklungsschritten, wie dem Aufkommen der Schrift und des Bildes, des Buchdrucks und der modernen Massenmedien bis hin zu den digitalen Medien eine markante, Epoche bildende Bedeutung zukommt.
Auch Religion baut immer als Kommunikation zwischen dem Menschen und dem Göttlich-Transzendenten bis hin zu einem personalen Gottesverständnis auf Kommunikation auf.2 Zudem bildet sich Religion mithilfe von generationsübergreifenden Tradierungsprozessen und ist dabei auf zwei grundlegende Funktionen von Medien angewiesen: erstens das Überbrücken von zeitlichen und/oder räumlichen Distanzen wie auch zweitens die Speicherung von Informationen, also das Erinnern. Diese beiden Funktionen markieren die wesentlichen Bedeutungsgehalte aller Medien.
In besonderer Weise ist in dem Prozess des Zweiten Vatikanischen Konzils und insbesondere in der Erarbeitung der Pastoralkonstitution „Gaudium et spes“ (GS) aus dem Bewusstsein der kommunikativen Grundstruktur des christlichen Glaubens für die katholische Kirche eine grundlegende Struktur abgeleitet worden: als dialogische Verwiesenheit von Kirche und Welt, in der die Kirche zu einer lernenden Haltung (GS 44) findet.3
Sie sind auch die Grundlage einer Einführung in die theologische Reflexion zum Verhältnis von katholischer Kirche und Medien, die hier im Folgenden unternommen werden soll. Mit ihr wird deutlich, dass sich der Gegenstand der Betrachtung nicht eindeutig abgrenzen lässt: Alles kann zum Bestandteil menschlicher Kommunikation werden. Alles kann Medium sein, sodass der Gegenstand der Untersuchung sich als verwirrend komplex darstellt.
An kaum einem anderen gesellschaftlichen Phänomen werden zudem die rasanten gesellschaftlichen und technischen Entwicklungen des 20. und 21. Jahrhunderts so sichtbar wie im Umgang mit den Medien. Daraus ergibt sich eine Vielzahl an Möglichkeiten. Allerdings entsteht für größere Bevölkerungsteile auch Verunsicherung. Dies könnte es nahelegen, für die nachfolgende Beschäftigung ein Vorgehen zu wählen, das den Leser_innen den Eindruck vermittelt, man habe die Thematik nun im Griff. In der Betrachtung des Themas würde dabei ein (scheinbar) neutraler Beobachtungsort aufgesucht, um die komplexe Realität als Einheit zusammenfassen zu können. Dass damit lediglich eine scheinbare Sicherheit und Souveränität entstünde, liegt auf der Hand. Es wäre der Versuch, eine verwirrende Vielfalt durch massive Komplexitätsreduktion handhabbar zu machen. Stattdessen soll die Unübersichtlichkeit der Welt ausgehalten und die Differenz des Vielfältigen sichtbar bleiben.4
Deshalb sollen Aufbau und Gedankengang der folgenden Beschäftigung mit dem Verhältnis von katholischer Kirche und Medien mit Wahrnehmungen der gegenwärtigen Situation beginnen. Erst später folgt dann ein Blick in die geschichtliche und lehramtliche Entwicklung wie auch die Frage nach einer digitalen Theologie. Schon in der Wahl des Vorgehens wird also erkennbar, dass das Anliegen hier nicht in der Entwicklung eines Rasters5 besteht, mit dem eine komplexe Wirklichkeit handhabbar werden könnte. Dies entspräche einem vormodernen, sicherheitsorientierten Wissenschaftsverständnis. Stattdessen wird hier ein fragmentarisches Vorgehen6 gewählt, das darauf abzielt, durch Irritationen neue Fragen aufzuwerfen.7
2. Gegenwärtige Wahrnehmungen
Sich mit Blick auf die Gegenwart mit Medien zu beschäftigen, lädt dazu ein, eigene Erfahrungen, eigenes Medienverhalten und die für die fortschreitende Moderne als dominierend zu beobachtende Präsenz von Medien zu reflektieren. Den Blick auf die gegenwärtige Mediennutzung zu werfen, offenbart eine Willkür, insofern sie auf einer Mediengeschichte aufbaut, die immer durch die Nutzung von Medien bestimmt war. In Orientierung an dem Medienwissenschaftler Jochen Hörisch8 erscheint es jedoch vertretbar, nachfolgend den Schwerpunkt der Betrachtungen auf die seit dem 19. Jahrhundert aufkommenden Medienformate zu legen.
Sowohl in der technologischen Entwicklung, insbesondere in den digitalen Medien, als auch in der Ausbildung einer „Kultur der Digitalität“9 können zwei Elemente aufgegriffen werden, die auch in öffentlichen Diskussionen immer wieder benannt werden: Beschleunigungseffekte und Skandalisierungen.
In jüngerer Vergangenheit wurden gesellschaftliche Beschleunigungseffekte vor allem von dem Soziologen Hartmut Rosa als bestimmendes Element einer nach Wachstums- und Steigerungslogiken funktionierenden Gesellschaft analysiert.10 Diese scheinen in der Entwicklung neuer Medienformate, im technologischen Fortschritt wie auch in der inhaltlichen Gestaltung digitaler Medien besonders anschaulich zu werden: Wer gestern noch als Nutzer_in eines sozialen Netzwerkes in dem Gefühl lebte, auf der Höhe der Zeit und geradezu gesellschaftlich avantgardistisch zu sein, gilt heute schon zur belächelten Gruppe derer, die die neuesten Entwicklungen nicht mitbekommen haben. Als Beispiel dafür kann Bundeskanzlerin Merkel gelten, die früh als Nutzer_in von Twitter als durchaus technikbegeistert galt und dennoch mit ihrer Aussage, das Internet sei „für uns alle Neuland“, im Jahr 2013 eine Welle des Gespötts ausgelöst hat.
Diese Beschleunigungseffekte durchziehen alle gesellschaftlichen Bereiche, entwickeln sich zu einer „Simultaneität“11 als Lebensform und werden in den Medien besonders anschaulich. Denn die digitalen Medien bilden im 21. Jahrhundert eine beeindruckende Wirkkraft auf öffentliche Diskurse und Meinungsbildungsprozesse aus. Politische Wahlen hängen nicht nur davon ab, ob ein Wahlkampfteam in einem Gesamtkonzept alle aktuellen Medienformate nutzt, sondern auch davon, ob die Prozesse der öffentlichen Debatten wahrgenommen und verstanden werden. Und zunehmend scheinen hier Mechanismen der Skandalisierung an Bedeutung zu gewinnen, an und in denen es fortlaufend zu lernen gilt.12 Insofern moderne Kulturen sich als lernend verstehen, damit also Wachstum und Steigerung zu ihren Wesensmerkmalen gehören, stellt der Skandal nicht nur ein singuläres Phänomen oder Ärgernis dar, sondern wird zu einem gesellschaftlichen Grundschema: „In dynamischen, also von Ungewissheit durchzogenen Situationen können Gesellschaften nicht anders lernen, als durch Versuch und Irrtum. Gesellschaftliches Lernen setzt voraus, dass Fehler gemacht, akzeptiert, genutzt werden.“13 Der Skandal ist eine der gesellschaftlich etablierten Lernsituationen. Was zu einem Skandal wird, gegen welche bestehenden und gesellschaftlich akzeptierten Werte also verstoßen wurde, verändert sich mit der Gesellschaft ebenso wie das Ablaufschema innerhalb eines Skandalgeschehens. Und in diesen Prozessen haben digitale Medien eine enorme Bedeutung erlangt, da mit und in ihnen Tendenzen der „Theatralisierung“14 und Inszenierung verstärkt werden.
Mit der Wahrnehmung aktueller Entwicklungen im Bereich der Medien, die in den nächsten Schritten weiter vorgenommen werden soll, ist immer auch die grundlegende Frage verbunden, welche gesamtgesellschaftlichen Phänomene sich daran ablesen lassen. Entsprechend einem wahrnehmungswissenschaftlichen Verständnis der Pastoraltheologie gehört die Beobachtung des Zeitgeschehens zu ihren konstitutiven Merkmalen, bevor sie zu pastoraltheologischen Reflexionen im engeren Sinn übergeht. Es geht also im Folgenden nicht darum zu klären, was gut oder schlecht sein könnte, sondern darum, zu beobachten, zu verstehen und nach möglichen theologischen und kirchlichen Lernfeldern Ausschau zu halten. Zu diesen Lernfeldern gehört es aber auch, Digitalität nicht bloß als ein weiteres Beispiel in der Kette innovativer Medien zu verorten, mit denen sich nichts Grundlegendes an der Wirklichkeit und dem menschlichen Zugang zu ihr ändern würde, wie dies vielen noch am Ende des 20. Jahrhunderts erschien.15
2.1. Gibt es eine Mediengesellschaft?
Kaum etwas prägt in den soziologischen Gesellschaftsanalysen des 21. Jahrhunderts die öffentlichen Debatten so stark wie der Begriff der Medien- und Informationsgesellschaft, mit dem ein kultureller Entwicklungsprozess beschrieben wird. Dessen Anfänge liegen im 19. Jahrhundert und münden in eine ausgefaltete „Kultur der Digitalität“16 des 21. Jahrhunderts.
Der Begriff der Medien korrespondiert einerseits mit Fragen der Öffentlichkeit, die zeit- und epochenbedingt in unterschiedlicher Verhältnisbestimmung zum Privaten liegen.17 Andererseits berührt die Frage nach den Medien die technische Entwicklung der Moderne wie auch die gesellschaftlichen Prozesse der Aufklärung.
Unterschiedliche Ansätze für soziologische und philosophische Medientheorien sind im 20. Jahrhundert entstanden. So beschäftigt sich Umberto Eco (1932–2016)18 mit der Kritischen Medientheorie der Frankfurter Schule (vor allem Theodor W. Adorno und Max Horkheimer) und setzt sich von deren Interpretation der Medien als Verfallsphänomen ab. Er entwickelt ein positives Verständnis der „Massenkultur“19, zu der auch die Medien gehören. Eco beobachtet im Umgang mit modernen Medien und Phänomenen der Massenkultur zwei Typen von Haltungen: den Apokalyptiker20, der (die) in einer undifferenzierten Kritik die eigene Sorge vor dem kulturellen Zerfall ausdrückt, und den Integrierten (die Integrierte), der (die) gleich ganz ohne kritische Reflexion der Massenmedien auszukommen scheint.
Hans Magnus Enzensberger bemüht sich weniger um eine vermittelnde und differenzierende Bewertung von Medien und betrachtet sie vor allem in ihrer Verbindung mit gesellschaftlichen Machtstrukturen, also der Politik. Medien sind bei ihm daher auch als Teil der volkswirtschaftlichen Prozesse zu verstehen, als ein Teil der „ökonomischen Struktur der Gesellschaft“21. Ein zentrales Anliegen ist bei ihm im Wissen um die gesellschaftsprägende Kraft der Medien als Inbegriff kommunikativen Handelns22 gerade auch deren demokratische Kontrolle.23 Enzensberger knüpft hier an Gedanken von Berthold Brecht24 an, der sich als Literat intensiv mit dem Medium Rundfunk beschäftigt hat und schon in den 1920er Jahren dessen propagandistische Potenziale reflektiert.25
Zu den wiederkehrenden Fragestellungen der Medientheorien gehört ganz maßgeblich das Verhältnis von Technik und Inhalt. Eine weitere, grundlegende Unterscheidung ergibt sich aus der Gegenüberstellung von Kommunikations- und Distributionsmedien: Während Kommunikationsmedien von der Vielfalt unterschiedlicher Sender, der damit einhergehenden Dezentralität und deshalb demokratisierenden Effekten zu bestimmen sind, zeichnen sich Distributionsmedien durch eine monopolartige Stellung der Sender mit eingeschränkter Interaktivität aus. Enzensberger bestimmt Distributionsmedien daher allein aufgrund ihrer technologischen Struktur als „ein undemokratisches, zentralistisches Herrschaftsmodell“26. Alle Medien können nach Enzensberger als Kommunikationsmedien wirken, zielen aber aufgrund ihrer technischen Eigenarten unterschiedlich stark darauf ab und benötigen daher eine demokratische Kontrolle.27 Schon hier wird erkennbar, dass die Rolle des Publikums ausgeprägt als eine aktive verstanden wird, die auf die Kommunikationsverläufe der Medien Einfluss nimmt und dies im Sinne seiner demokratischen Rechte auch tut. Inwiefern dies auf einer allzu optimistischen Sicht von Konsument_innen im Sinne eines „emanzipatorischen Mediengebrauchs“28 beruht, gilt unter Medientheoretiker_innen als umstritten, dürfte aber gerade mit der Verbreitung des Internets und der Etablierung der Social Media realistischer geworden sein.
Von besonderer Bedeutung ist die philosophische Betrachtung der Medien hinsichtlich des Konzeptes vom „herrschaftsfreien Diskurs“ bei Jürgen Habermas, wenngleich er sich selbst nur am Rande seiner Theorie mit Massenmedien beschäftigt. Medien gehören für ihn offenbar so sehr zu den Selbstverständlichkeiten menschlicher Kommunikation, dass sie kaum in ihrer Eigenart betrachtet werden müssen. In seiner „Theorie des kommunikativen Handelns“ wirken Medien lediglich verstärkend, auch weil das emanzipatorische Potenzial jeglicher Kommunikation ihre problematischen Elemente weit übersteigt.29 Hier erweckt der Theorieansatz von Habermas einen ausgesprochen idealistischen Eindruck.
In der Soziologie hat sich vor allem Niklas Luhmann mit dem Entwurf der Systemtheorie der Bedeutung von Massenmedien30 gewidmet. Sie zeichnet sich einerseits durch einen beeindruckenden Universalitätsanspruch (es gibt keine gesellschaftlichen Phänomene, die nicht systemtheoretisch aufzufassen wären) wie durch eine Inkompatibilität mit anderen Theorieansätzen aus. Für Luhmann besteht die Gesellschaft aus Systemen, die auf sich selbst bezogen und aufgrund ihrer eigenen Instabilität auf den Selbsterhalt ausgerichtet sind (Autopoiesis). Er betrachtet die Funktion der Medien vor dem Hintergrund eines sehr unwahrscheinlichen Gelingens von Kommunikation, zudem verhindern die Medien als „Zwischenschaltung von Technik“31 die direkte Kommunikation. Im System der Massenmedien gelten Medien als Techniken zur Ermöglichung von Dialog, wo dessen Unmittelbarkeit unterbrochen ist.
Die hier lediglich angedeuteten Theorieansätze veranschaulichen die entstandene Vielfalt und Unübersichtlichkeit der Medienreflexionen in den unterschiedlichen Feldern von Medienwissenschaft32, Kommunikationswissenschaft, Philosophie und Soziologie, die einer anwachsenden Notwendigkeit der Medienreflexion geschuldet sind.
Die zunehmende Innovationsgeschwindigkeit von einer intergenerationalen Entwicklung zu einer intragenerationalen Abfolge von Neuerungen33 ereignet sich vornehmlich im Bereich moderner Medien. Die mögliche Live-Übertragung von privaten Kameraaufnahmen mit dem Smartphone in den Formaten der Social Media steigert34 diese Beschleunigung35 und kann als Symbol für einen gesamtgesellschaftlichen Trend betrachtet werden, der aufgrund seiner rasanten Entwicklung wie auch seiner umwälzenden Dramatik als umfassend erlebt wird. Diese weitreichenden Dimensionen der Wandlungsprozesse sind für den Soziologen Ulrich Beck Anlass, von einer „Verwandlung“36 der Welt zu sprechen, um deren überfordernde37 Dimension auszudrücken. Die bloße Rede von einer „digitalen Revolution“ erscheint ihm demgegenüber als unzureichend.38 Der Philosoph Christoph Türcke identifiziert vor dem Hintergrund dieser Entwicklung in der „Logik der Sensation“39 ein zentrales Merkmal einer als „erregt“ erfahrenen Mediengesellschaft und verortet sie im Kontext des europäischen Aufbruchs der Neuzeit.40 Diese soziologische Analyse verbindet sich häufig mit Forderungen nach einem stärkeren regulativen Eingreifen, etwa in medienpädagogischen Kontexten und einem kulturpessimistischen Habitus.41 Die gesellschaftlichen Modi von Empörung und Erregung innerhalb öffentlicher Debatten lassen sich dabei als Teil einer durch digitale Medien geprägten politischen Kultur verstehen.42
Das 20. Jahrhundert kann nicht zuletzt aufgrund der Entstehung von Massenmedien, vor allem von Rundfunk, Film und Fernsehen und in seinem letzten Jahrzehnt des Internets, als wichtige Wendemarke betrachtet werden. Nach einer anfänglichen Phase mit einer Ausrichtung etwa des Rundfunks auf Unterhaltungsprogramme in der Weimarer Republik entsteht erst in den 1930er-Jahren ein Bewusstsein für die politische Relevanz der neuen Massenmedien.43 Das aufkommende Bewusstsein für deren strategische Verwendung im Rahmen der politischen Propaganda wie gerade auch als Instrument wirtschaftlichen Marketings charakterisieren das 20. Jahrhundert als wichtige Umbruchphase. Das Verhältnis von Medien, insbesondere von Presse, Radio und Film zu ihrer propagandistischen Nutzung, wird im Rahmen geschichtswissenschaftlicher Aufarbeitung immer wieder behandelt.44 Es wäre aber zu kurz gegriffen, wollte man diese Problematik der Instrumentalisierungen und Manipulationen auf bestimmte Epochen und wenige Akteure begrenzen. Generell gilt, dass es keine weltanschauliche oder politische Neutralität geben kann. Deshalb sind gerade die Pluralität von Akteuren und das Vermeiden von Monopolstellungen zentraler Bestandteil einer demokratischen Medienpolitik.
2.1.1. Medientheorie
Gerade im 20. Jahrhundert hat sich die theoretische Reflexion zum Medienbegriff in eine Vielzahl von Ansätzen und Theorien unterschiedlicher Fachrichtungen ausdifferenziert.45
Der Medienwissenschaftler Marshall McLuhan (1911–1980) entwickelt in der Faszination für das Fernsehen eine Kulturtheorie der Medien46 und spricht vom Ende der „Gutenberg-Galaxis“47, in dem der Buchdruck zum bestimmenden Medium geworden war. McLuhan analysiert Strukturen moderner Mediengesellschaften48, die von ihm zwar an der Beobachtung des Fernsehens (insbesondere in den nordamerikanischen Gesellschaften) festgemacht werden, aber darüber hinaus bis in die Gegenwart für die Einordnung der digitalen Medien als Verstehenshilfe genutzt werden. Dies wird gerade im Blick auf seine drei zentralen Thesen deutlich, die er inspiriert durch den Theologen Pierre Teilhard de Chardin49 entwickelt: 1. Medien sind Körperausweitungen, 2. Wir leben in einem globalen Dorf, 3. Das Medium ist die Botschaft.50 Gerade die dritte These (und der wohl am häufigsten zitierte Satz McLuhans) bedarf der weitergehenden Beschäftigung, um nicht missverstanden zu werden: Medium und Botschaft sind untrennbar miteinander verbunden und aufeinander verwiesen.51
Die Identifikation von Medium und Botschaft kann also durchaus weiter gefasst werden.
Auch wenn hier keine ausführliche Darstellung der Theorien McLuhans52 und seiner Wirkung für die Medienwissenschaft vorgestellt werden kann, wird in den drei genannten Thesen Entscheidendes erkennbar: Die Arbeit mit Medien, insbesondere den modernen Medien des 20. und 21. Jahrhunderts, erweitert den Wirkradius menschlicher Kommunikation massiv und lässt erkennen, dass Medien immer Bestandteil menschlichen Lebens waren (und damit nicht nur sein Instrumentarium!). Indem moderne Medien den Wirkradius menschlichen Handelns erweitern und schrittweise ortsunabhängig zum Einsatz kommen, relativieren sich geographische Gegebenheiten und deren Beschränkungen. Die sich daraus ergebende Vervielfältigung menschlicher Gestaltungsmöglichkeiten geht jedoch einher mit den Eigengesetzlichkeiten der Medien und ihrer Wirkung sowohl auf ihre Nutzer_innen wie auch auf ihre Inhalte. Wie die Herausgeber_innen und Redakteur_innen von Zeitungen den Autor_innen hinsichtlich von Themenwahl, Umfang und inhaltlicher Ausrichtung der Artikel Vorgaben machen, so ergeben sich beim Buchdruck für die inhaltliche Gestaltung Vorgaben der Wirtschaftlichkeit (z. B. für den Umfang von Büchern oder deren Genre). Diese Spezifika von Medien steigern sich bei bildgebenden Formaten des Fernsehens und des Internets noch einmal beträchtlich.53 Zwar erscheint die dritte These McLuhans geradezu „mediendeterministisch“54, sie richtet dabei jedoch nur das medienwissenschaftliche Interesse am Medium und nicht am Inhalt aus. Es gibt also durchaus eine Reihe von Faktoren, die für Inhalte maßgeblich sind. Die Eigengesetzlichkeit der Medien selbst gehört dabei jedoch zu den sehr einflussreichen Größen gegenüber den Inhalten, die bis in die Gegenwart vielfach unterschätzt werden. Deshalb können die Ansätze McLuhans ihn als „Vordenker des digitalen Computerzeitalters“55 erscheinen lassen, was seine bleibende Bedeutung für die Medienwissenschaften und seine Wiederentdeckung im 21. Jahrhundert erklärt.
Gerade die religiöse Prägung McLuhans hat zu einer größeren Rezeption im Raum von Kirche und Theologie beigetragen und er wird vereinzelt als prägende Gestalt eines „katholischen Medienzeitalters“56 betrachtet.
Lässt sich McLuhan als eine der Gründungspersönlichkeiten moderner Medienwissenschaften betrachten, ergibt sich mit deren Entwicklung in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts eine beachtliche Fülle an philosophischen Theorieansätzen.57 Sie sind eng verbunden mit soziologischen und philosophischen Theorien der Postmoderne, was insbesondere für die Diskursanalyse von Michel Foucault und die Dekonstruktion von Jaques Derrida bedeutsam ist. Sie gehen bei Frank Hartmann58 und Mike Sandbothe59 in die Entwicklung eigener Medienphilosophien über.
Neben McLuhan sei hier auf Vilém Flusser60 (1920–1991) verwiesen, der als Philosoph und Kommunikationswissenschaftler das Konzept einer „Kommunikologie“61 entwickelt hat.
Er entwirft einerseits (ähnlich wie auch McLuhan) eine Kulturgeschichte der Medien62 und knüpft an dessen „Epochenkonstruktion“63 an. Zentral ist dabei die (an die Thermodynamik angelehnte) Vorstellung der Entropie: Informationen zerfallen, werden vergessen und verschwinden. Hier wird eine häufig übersehene Funktion von Medien in der Speicherung von Informationen und in der Tradierung von Wissen sichtbar. Medien transportieren Informationen nicht nur über räumliche, sondern auch über zeitliche Distanzen hinweg. Indem Menschen mit Medien arbeiten, wirken sie den entropischen Prozessen des Verlustes von Information entgegen und setzen dem Verfall ordnende Systeme entgegen. Zentrale Elemente dieser Ordnungen sind kulturgeschichtlich variierende Codes, mit deren Hilfe Menschen Abstand zur Realität gewinnen, dadurch mit ihr umgehen können und sich dabei zugleich selbst finden. Was dies hinsichtlich der gegenwärtigen Epoche des „Technocodes“ für den Menschen und sein Selbstbild bedeutet, bleibt nach Flusser bislang noch offen. Flusser verspricht sich gerade durch die gesellschaftlichen Veränderungen aufgrund neuer Medien eine neue, „telematische“ Gesellschaftsstruktur. Von besonderer Bedeutung im Werk Vilém Flussers ist das Bild64, in dessen Zirkularität er ein Gegenüber zur Linearität der Schrift sieht65 und an dem er (in Anlehnung an die Phänomenologie Edmund Husserls) eine Kulturgeschichte der Wahrnehmung (Ästhetik) konzipiert.
Mit McLuhan und Flusser wird eine entscheidende Komponente der Medientheorien des 20. Jahrhunderts erkennbar: Medien sind nicht nur etwas, mit dem der Mensch zu tun hat und wozu er sich auf unterschiedliche Weise verhält. Sie sind weit mehr: Medien bestimmen ihrerseits menschliche Kommunikation, ja menschliches Leben überhaupt und sind nicht vom Menschsein zu lösen.
Eng verbunden mit der medialen Entwicklung des 20. Jahrhunderts und deren Analyse durch McLuhan ist die Rede vom „Iconic Turn“. Einerseits ist damit die zunehmende Ausrichtung von Medien auf Bilder in der Alltagskultur gemeint, die gerade bei Fernsehen und Internet zentral ist. Der „Iconic Turn“ umschreibt jedoch weitergehende Elemente in allen gesellschaftlichen Bereichen, wie ihre philosophische und kulturtheoretischen Reflexionen.66 Inwiefern diese verstärkte Hinwendung zum Bild auch durch die Dominanz von Fernsehen und Internet initiiert und vorangetrieben wird, lässt sich kaum nachweisen, aber annehmen. Den Kunsthistoriker und Philosophen Gottfried Boehm veranlasst die zu beobachtende Bilderflut jedoch, gerade von einer „Bilderfeindlichkeit der Medienindustrie“67 zu sprechen. Technische Ansätze, mit Internetbrillen den Umgang mit der digitalen Welt vor allem optisch zu ermöglichen, gewinnen als Fortführung des „Iconic Turn“ große Plausibilität. Erst mediale Präsenz erzeugt optische Vertrautheit und ermöglicht damit Prominenz.
2.1.2. Das Bild
Dass die katholische Kirche mit ihren Liturgien und weltkirchlichen Traditionen solch einer vom „Iconic Turn“ geprägten Medienlandschaft besonders gut entspricht, ist eine populäre Annahme.
Die kulturwissenschaftliche, philosophische und theologische Reflexion des Bildes und seiner Wahrnehmung erfolgt weitgehend in den Feldern von Ästhetik und Phänomenologie.68
Im Kontext der Medienentwicklung des 20. Jahrhunderts fällt auf, dass das Bild hier zunehmend die Funktionen der Bezeugungsinstanz69 und der Bindung von Aufmerksamkeit70 (etwa im Sinne phatischer Kommunikation) übernimmt – und darin hinter den eigentlichen Potenzialen der Bildmächtigkeit zurückbleibt. Gleichwohl steht solch eine Entwicklung auch einer ganzen kulturgeschichtlichen Reihe von „Pictorial Turns“71, in denen die eine eindeutige Abgrenzung von bildlichen und sprachlichen Elementen ebenso problematisch wäre wie eine eindeutige Bestimmung visueller Medien in der Moderne.
In einer Mediengesellschaft, in der die Bildmedien zu einer dominierenden Stellung gelangen,72 findet sich die katholische Kirche in einer ungewohnten und vieldimensionalen Situation wieder: Hochformen barocker Kirchengestaltung, eine ungebrochene Spiritualität der Ikonographie und eine sinnenfreudige Liturgie gehen hier mit einer ins Geheimnisvolle changierenden Intransparenz organisationaler Abläufe ein Gemenge ein, das Raum für Verschwörungstheorien und Vorlagen für fiktive Romane bietet. Ist die katholische Kirche damit tatsächlich eine ideale Medienreligion? Stimmt die Annahme, müsste sich damit ein großes Evangelisationspotenzial verbinden. Das ist jedoch kaum zu beobachten.
Dass sich eine Bild-Religion in einer auf Bilder ausgerichteten Mediengesellschaft erkennbar schwertut, ihre Rolle zu finden, könnte in einem Paradox begründet sein: Während die klassische ikonographische Bedeutung des Bildes darin liegt, Menschen in andere Welten und komplexe religiöse Wirklichkeiten zu führen, besteht die Funktion des Bildes in modernen Mediengesellschaften gerade in der Reduktion von Komplexität und der Steigerung von Verständlichkeit.
Die katholische Kirche vermag zwar nach wie vor, in der klassischen Logik des Bildes zu agieren. Sie ist aber durch die visuelle Praxis der Postmoderne herausgefordert, sich auf gesellschaftliche Mechanismen einzulassen, von denen ihre eigenen Mitglieder und verantwortlichen Akteur_innen ohnehin auch selbst geprägt sind.
Insofern Aufmerksamkeit73 eine bestimmende Währung in einer Mediengesellschaft darstellt, scheint sich dabei für den bilderfreudigen Katholizismus tatsächlich ein großes Anknüpfungspotenzial zu ergeben. Begleitet wird dieses Potenzial jedoch von bitterer Ernüchterung: der medial-bildlichen Inszenierung von Papstwahlen74, Papst-Requien oder auch einer Fülle von sympathischen Bildern im Pontifikat Papst Franziskus steht eine optische Realität in Diözesen, Pfarreien und kirchlichen Einrichtungen gegenüber, die vor allem als Professionalitätsdefizit erlebt wird.75 Die Wahrnehmung kirchlicher Optik vor Ort bleibt in der Regel genauso hinter dem eigenen Anspruch zurück, die Verkündigung des Reiches Gottes zumindest zu unterstützen, wie dies in weltkirchlichen Bezügen zu beobachten ist (z. B. bei Weltjugendtagen). Die hier erkennbare Herausforderung wurde in den Skandalen um den Bau des Limburger Bischofshauses unübersehbar, in dem neben vielen Problemstellen auch die Kehrseite der optischen Affinität der katholischen Kirche erkennbar wurde: das Bild einer luxuriösen Sanitäreinrichtung wurde zum Negativsymbol einer verschwendungssüchtigen und klerikalistischen Institution, die zentrale Elemente ihrer eigenen Botschaft konterkariert.
Der Soziologe Hans Jonas wie auch der Medientheoretiker Vilém Flusser sehen in der menschlichen Fähigkeit, aus dem gesehenen Gegenstand durch Vorstellungskraft und Imagination ein Abbild zu schaffen, das Prinzip menschlicher Kommunikation überhaupt.76
Mit der gesellschaftlich zunehmenden Bedeutung digitaler Medien steigern sich auch die Inszenierungstendenzen77, also auch die Bedeutung des Visuellen. In der Stellungnahme „Virtualität und Inszenierung“ der Publizistischen Kommission der DBK wird diese Bedeutung des Bildes aufgegriffen und in medienethischer Einordnung reflektiert.
Eine besondere Rolle kommt in der Entwicklung medientheoretischer Ansätze der Fotografie78 zu, mit der sich etwa Walter Benjamin (1892–1940) in seiner „Kleinen Geschichte der Photographie“79 beschäftigt.80 Ihm ist auch der technische Fortschritt wichtig, der sich zunächst vor allem aus der Reproduzierbarkeit des Bildes ergibt, vor allem aber eine Geschichte des Lesens von Fotografie. Bestandteil dieses Lesens ist die Wahrnehmung der Aura der Fotografie, die eng mit der Welt bürgerlicher Aufstiegshoffnungen des 19. Jahrhunderts, dem Interesse an Inszenierungen und der Positionierung zwischen Kunst und Technikeuphorie verbunden ist.81 Mit ihm entsteht zudem ein Bewusstsein für die Bedeutung der Reproduktion.82
Sie bewirkt im 19. Jahrhundert nicht nur eine grundlegende Diskussion über den Kunstbegriff der Fotografie beziehungsweise den durch sie veränderten Kunstbegriff. Diese Auseinandersetzung wiederholt sich im 20. Jahrhundert im Umgang mit dem Film und der Entstehung der Filmtheorie83.
Gerade die Reproduzierbarkeit des Bildes in der Fotografie ermöglicht zunächst eine archivarische Funktion (etwa in der Popularität von Familienfotografien und Porträts84), später auch eine dokumentarische Funktion (im Aufkommen von Kameras in Privatbesitz und ihrer Verwendung im Zweiten Weltkrieg). Einerseits wird die Fotografie in der Nachkriegszeit des 20. Jahrhunderts zu einem Teilgebiet des Journalismus. Andererseits etabliert sie sich im Kontext der modernen Kunst85 und ordnet sich so in die Kulturgeschichte86 ein. Es kommt also zu einer deutlichen Weitung eines auf technische Bezüge reduzierten Fotografie-Verständnisses.87
Schließlich wird auch die Fotografie durch die Entwicklung der Digitalisierung grundlegend verändert, und dies nicht nur hinsichtlich der technischen Weiterentwicklungen und der Arbeitsbedingungen innerhalb des Fotojournalismus. Die Möglichkeiten, mit einem einfachen Smartphone relativ hochwertige Spontanaufnahmen anzufertigen und eigene Fotoaufnahmen auf Online-Plattformen wie www.flickr.com oder www.photocase.com anzubieten und zu vermarkten, erzeugt neue bildethische Fragestellungen,88 macht die Fotografie zu einem Feld der digitalen Massenkultur und erschwert die Profilierung professioneller Berufsbilder. Insbesondere die breite gesellschaftliche Etablierung von „Selfies“ mit Hilfe von mobilen Digitalgeräten (in der Regel Smartphone oder Tablet) kann zu einer philosophischanthropologischen Reflexion des Fotos in seiner Bedeutung für die Selbstwahrnehmung und die Inszenierung in der Öffentlichkeit führen.89
2.2. Wie ticken die „Digital Natives“?
Jüngere Bevölkerungsgruppen, zu deren Kindheitserfahrungen spätestens ab der Grundschule, häufig aber schon im Vorschulalter die Nutzung von digitalen Medien und mobilen Kommunikationsgeräten gehören, werden im Rückgriff auf Marc Prensky, John Palfrey und Urs Gasser90 als „Digital Natives“ bezeichnet. Häufig werden sie in soziologischen Ansätzen mit der „Generation Y“91 identifiziert und mit leichten Divergenzen in den Geburtsjahrgängen ab (!) 1980 verortet. Insbesondere die selbstverständliche Nutzung digitaler Medien,92 aber darüber hinaus auch andere soziologische Merkmale, wie ein verändertes Bewusstsein für ein ausgewogenes Verhältnis von Arbeit und Freizeit93 (Work-Life-Balance) oder Veränderungen im Konsumverhalten (abnehmende Bedeutung von immobilen Statussymbolen) bewirken in vielen Ansätzen eine scharfe Kontrastierung gegenüber älteren Bevölkerungsgruppen.94
In Verbindung mit dem technischen Fortschritt, der auch eine mobile Nutzung digitaler Medien ermöglichte, lässt sich beobachten, dass kein gesellschaftlicher Bereich moderner Gesellschaften von dem Einfluss digitaler Medien unbeeinflusst geblieben ist und bleibt. Eine Gegenüberstellung von digitaler und realer Welt, oftmals verbunden mit einer Wertung und häufig auch einer romantisierenden Verklärung der Vergangenheit („Wir haben uns früher noch ohne WhatsApp und Handy vor dem Freibad verabredet!“) erscheint kaum noch plausibel. Besondere Fokussierungen erfolgen in der Regel mit Blick auf generationsspezifische Lebensformen und Konsequenzen für die Arbeitskultur und das Arbeitsverständnis.95
Die selbstverständliche Nutzung digitaler Medien ist für Prensky Anlass, Konzepte des E-Learning und damit internetgestützte Formate pädagogischer Arbeit innerhalb des schulischen Unterrichts wie auch in außerschulischen Angeboten zu entwickeln und zu etablieren.
„Digital Natives“ sind jedoch nicht nur durch die größere Selbstverständlichkeit in der Nutzung digitaler Medien zu bestimmen. Aus ihrer Medienprägung ergeben sich Konsequenzen für die Ausbildung persönlicher Identitäten und Fragen der Selbstwahrnehmung, für eine veränderte Verhältnisbestimmung von Privatheit und Öffentlichkeit (insbesondere hinsichtlich des „digitalen Fußabdruckes“, also der Daten, die jeder Mensch bei der Nutzung des Internets produziert), der Fähigkeit zu kritischer Reflexion von Informationsangeboten, der Wahrnehmung von Suchtpotenzialen und in vielen anderen Bezügen.
Insbesondere die erwerbstätige Bevölkerungsgruppe, die bis in die Mitte des 21. Jahrhunderts die Arbeitswelt prägen wird, wären demnach mehrheitlich als „Digital Immigrants“96 zu bestimmen: Sie eignen sich erst im Laufe ihrer Ausbildungsbiographie oder ihres Berufslebens die unterschiedlichen Fähigkeiten zur Nutzung und Gestaltung digitaler Medien an – um die fehlende Selbstverständlichkeit im Umgang mit ihnen zu ersetzen.97
Parallel zeichnet sich ab, wie sehr die Eigenarten der „Digital Natives“ zunehmend die verschiedenen Gesellschaftsbereiche bestimmen werden. Dies gilt etwa für die Arbeitswelt, die aufgrund der technischen Entwicklung massive Verdichtungen erfährt (z. B. ermöglichen bildgestützte Telefonkonferenzen via Skype eine große Effektivitätssteigerung der beteiligten Arbeitnehmer_innen). In wirtschaftlichen Prozessen, wie sie mit der gesellschaftlichen Etablierung des Online-Banking, mit Internetportalen für den Online-Handel wie Amazon oder eBay mit Beginn des 21. Jahrhunderts auch breite Bevölkerungsschichten erreicht haben, ist zu beobachten, dass mit den digitalen Medien auch das Konsumverhalten von Verbraucher_innen massiven Wandlungsprozessen unterliegt. Hier wird sichtbar, dass digitale Medien kein separater Bereich privater Lebensvollzüge, sondern ein alle Gesellschaftsbereiche durchziehendes Kontinuum darstellen. Längst ist die klassische Unterscheidung von virtueller98 und realer Welt in dieser Entwicklung obsolet geworden.99Einerseits dürften sich damit auch Typologien wie „Digital Natives“ und „Digital Immigrants“ nivellieren und einebnen. Inwiefern es sich hierbei um eine unzulässige Komplexitätsreduktion handelt, ist Gegenstand anhaltender Diskussionen. Andererseits fällt auf, dass es insbesondere in der Soziologie mit einer systemtheoretischen Prägung kaum möglich ist, in der Digitalität überhaupt ein alle Gesellschaftsbereiche (und damit alle Systeme) bestimmendes Phänomen und Charakteristikum der Postmoderne auszumachen.100
2.3. Kirchliches Medien-Engagement
Kirchliche Medienarbeit ist mehr als das Marketing einer Organisation,101 die wie alle gesellschaftlichen Institutionen von Bekanntheit leben, um Mitglieder und Anhänger zu gewinnen und an sich zu binden. Kirchliche Medienarbeit als eine Ausformung kirchlicher Verkündigung gehört zum Selbstverständnis christlicher Nachfolge schlechthin. Neben dieser Einordnung der Medienarbeit in den Kontext der Verkündigung des Glaubens an die Reich-Gottes-Botschaft Jesu kommt es aber seit der Mitte des 20. Jahrhunderts und der gesellschaftlichen Verbreitung von bildgebenden Medien (zunächst vor allem des Fernsehens) zu einer beachtlichen Mediatisierung der katholischen Kirche, für die in besonderer Weise das Pontifikat Papst Johannes Pauls II. und die Einrichtung von Weltjugendtagen als herausragendes, internationales Medienereignis angesehen werden können.
Wie kein anderes Pontifikat zuvor war das Johannes Pauls II. durch eine beeindruckende Reisetätigkeit und ein Bewusstsein für die politischen Potenziale des Amtes geprägt. Ausdruck dieses Bewusstseins ist die Inszenierung von Bildern als selbstverständlicher, zugleich bewusst gestalteter Bestandteil des kirchlichen Amtsverständnisses: das Küssen des Bodens zu Beginn jedes Auslandsbesuchs, Bilder von Massengottesdiensten, der Gefängnisbesuch bei dem Papstattentäter Atta bis hin zum sterbenskranken Papst am Fenster des vatikanischen Palastes und dem Abschluss im Pontifikalrequiem.102
Die in Tradition und Geschichte verankerte, aber im 20. Jahrhundert mithilfe der bildgebenden Medien ausgebaute Affinität des Katholizismus zum Bild lässt sich als „Spiel von Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit“103 verstehen.
Unter Papst Benedikt XVI. kam es zu bemerkenswerten Aufrufen an Kirchenmitglieder und auch an Kleriker, die sozialen Kommunikationsmittel aktiv zu nutzen. Dem entsprechen neue Initiativen auf Seiten des Vatikan zur eigenen Nutzung der Social Media, wie etwa die Internetpräsenz „pope2you.net“104.
Auch auf diözesaner und örtlicher Ebene ist es in der katholischen Kirche Deutschlands seit 2005 zunehmend zur Entwicklung von Verkündigungsformaten mit einer Fokussierung auf den Social Media gekommen:
– Die Entwicklung eigener Apps als Programme für mobile Digitalgeräte bieten klassische Gebets- und Liturgieformen an. Dazu gehört etwa das Angebot des Stundengebets und der täglichen liturgischen Texte durch das Deutsche Liturgische Institut.
– Die Angebote im Bereich der Berufungspastoral mit YouTube-Produktionen, wie z. B. „Valerie und der Priester“.
– Klassische katechetische Materialien, wie „Mein Gott und Walter“.
– Kirchliche Verkündigungssendungen im Rahmen des digitalen Programms „Funk“ der öffentlich-rechtlichen Fernsehsender, wie „frei.willig.weg“.
Viele dieser Aktivitäten werden auf der seit 2004 bestehenden Internetplattform katholisch.de vernetzt oder eigens dafür produziert. Sie stellt das reichweitenstärkste Forum für katholische Medienarbeit im Bereich der digitalen Formate dar und ergänzt die ältere Plattform www.fernsehen.katholisch.de.
Durch diese Initiativen im Bereich digitaler Medien und vor dem Hintergrund gegenwärtiger kirchlicher Krisenphänomene entwickeln sich immer wieder Diskussionen um geeignete und zeitgemäße Formen der religiösen Kommunikation. Zu beobachten sind dabei enorme qualitative Schwankungen, Diskrepanzen zwischen zeitgemäßen, digitalen Projekten und klassischen Formaten, wie z. B. den Kirchenzeitungen oder der Predigt, in denen oftmals die Problematik einer milieuverengten kirchlichen Situation sichtbar wird.105
Drei Gruppen von Medienangeboten lassen sich dabei unterscheiden:
1. Produkte, die eigens von kirchlichen Einrichtungen oder in deren Auftrag mit dem Anliegen kirchlicher Glaubensverkündigung entwickelt worden sind.
2. Verkündigungssendungen, die auf der Basis der Konkordate, also staatskirchenrechtlicher Verträge, von öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten produziert, inhaltlich aber von der Kirche verantwortet werden.
3. Produktionen, die in Verantwortung von dritten Akteuren, wie Privatpersonen, Produktionsfirmen oder Initiativen, entwickelt und produziert werden und aufgrund ihrer inhaltlichen Ausrichtung eine große Nähe zu Themen kirchlicher Verkündigung erkennen lassen, als didaktisch-katechetische Arbeitsmittel eingesetzt werden oder einfach grundlegende Fragen menschlichen Lebens (direkt oder indirekt) aufgreifen und kirchliche Bezüge nahelegen.
Stärker als über schriftliche Verlautbarungen oder Predigten ereignet sich die Kommunikation im Bild und wird damit ihrerseits von modernen Medien bestimmt. Sie wird Bestandteil einer „Weltkommunikation“106, in der die Macht der Bilder zu einer bestimmenden politischen Größe wird. Erst dem argentinischen Papst Franziskus gelingt es, aufgrund seiner Spontaneität an diesen Trend anzuknüpfen. Ihre Höhepunkte findet diese Form moderner kirchlicher Medienarbeit und Verkündigung in den Events der Weltjugendtage. Sie fungieren als inszenierte Symbiose von Jugendkultur und Papstamt und zeigen dabei die Ambivalenz einer verstärkten Papstzentrierung der Kirche mit entsprechenden Risiken: „Durch das Papstamt verfügt die katholische Kirche über eine einfache und für die Religion konforme Möglichkeit, ihr Glaubensangebot in einer personifizierten Weise zu kommunizieren: Sie hat eine Person, die qua Amt den katholischen Glauben symbolisiert.“107 Das Risiko, das die Ambivalenz dieser Entwicklung ausmacht, besteht darin, dass die auf das singuläre Amt fokussierte Aufmerksamkeit zentrale theologische Positionen, etwa die der Volk-Gottes-Theologie, konterkarieren kann und die Chancen für die Vermittlung zentraler Inhalte mit der Begeisterung eher ab- als zunehmen.
Wenn weltweit Säkularisierungsprozesse im 21. Jahrhundert weiter fortschreiten, wie dies nachweislich zumindest für wirtschaftlich prosperierende Gesellschaften von den Religionssoziologen Detlef Pollack und Gergely Rosta108 analysiert wurde, markiert dies auch eine Krise der kirchlichen Verkündigung.
2.3.1. Der Pfarrbrief als Beispiel unterschätzter Potenziale
Ein Print-Medium, das über lange Zeit auch innerkirchlich in seiner Bedeutung stark unterschätzt wurde und oftmals noch wird, stellen Schriften auf Pfarr- und Gemeindeebene dar. Die Deutsche Bischofskonferenz hat dazu 1995 und 2001 Grundlagenpapiere veröffentlicht. Diese Mitgliedermagazine firmieren in der Regel unter dem Titel „Pfarrbrief“109 und werden von Pfarreien verantwortet. Unter dem übergeordneten Titel gibt es nicht nur eine große Bandbreite in der inhaltlichen Gestaltung von einfachen Gottesdienstordnungen bis hin zu redaktionell erstellten Zeitschriften. Die inhaltliche Bandbreite wie auch die Professionalität in der grafischen Gestaltung drücken die jeweilige Zielrichtung der „Pfarrbriefe“ aus. Ob ein Pfarrbrief sich in einer Auflage von wenigen hundert Exemplaren auf die aktiven Gottesdienstbesucher_innen ausrichtet110 und lediglich in der Kirche zur Mitnahme angeboten wird, bildet eine tendenziell verengte Wahrnehmung kirchlichen Lebens ab. Gerade in der Zusammenlegung mehrerer Pfarreien zu Groß-Pfarreien sind vielerorts Bemühungen entstanden, mit den Pfarrbriefen alle Kirchenmitglieder innerhalb des Pfarrgebietes zu erreichen und sie in die Gestaltung eines Medienkonzeptes auf Pfarreiebene mit entsprechender Internetpräsenz zu integrieren. Viele Pfarrbriefe erreichen damit eine Auflagenstärke von mehr als 10.000 Exemplaren. Sie werden überwiegend in ehrenamtlichen Redaktionsteams erstellt und oftmals auch noch von Ehrenamtlichen als Hauswurfsendung verteilt: „Kein anderes Medienangebot, das über kirchlich-religiöse Themen informiert, erreicht Katholiken besser als dieses Basismedium.“111
Bemerkenswert erscheint zudem die starke Beachtung durch die Adressat_innen.112 Die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale ergeben sich daher aus der grundsätzlichen Ausrichtung eines Pfarrbriefes. Sowohl in der redaktionellen Erarbeitung und den journalistischen Beiträgen wie auch in Design und Layout kommt es bei dem wichtigsten Medium der Kirche immer noch zu Qualitätsdefiziten113, so dass eine Diskrepanz zu den Standards anderer Postwurfsendungen oftmals unübersehbar ist.
Um Pfarreien im Bemühen um die Gestaltung ihrer Mitgliedermagazine zu unterstützen, wurde bereits 2002 der überdiözesane Hilfsdienst www.pfarrbriefservice.de gegründet. Ähnliche Unterstützungsformen bieten einzelne Diözesen bei dem Design und der Pflege von Internetseiten an wie auch mit dem Angebot von Fortbildungsmaßnahmen für Haupt- und Ehrenamtliche.
Neben den neuen Aufbrüchen, die in der inhaltlichen und grafischen Gestaltung von Pfarrbriefen im Zuge von strukturellen Veränderungen der Pfarreien zu beobachten sind, wie auch im gewachsenen Bemühen, gemeindliche Milieuverengungen auch in der Ästhetik der pastoralen Praxis kritisch zu reflektieren, gibt es mittlerweile ähnliche Initiativen auf diözesaner Ebene.
Die Diözese Essen beschloss 2013 als erste angesichts des eklatanten Rückgangs von Abonnementzahlen die Einstellung ihrer diözesanen Kirchenzeitung114 zugunsten einer neuen Mitgliederzeitschrift mit dem Titel „Bene“. Solche Mitgliederzeitschriften, die vorrangig aus Kirchensteuermitteln finanziert werden, konnten sich jedoch auch nach diözesanen und lokalen Versuchsphasen bislang nicht etablieren. Sie markieren zudem den Übergang von kirchlichem Journalismus zu einem bloßen Kirchen-Marketing.115 Es kann davon ausgegangen werden, dass eine derartige Mitgliederzeitschrift sehr viel stärker der veränderten Verhältnisbestimmung von Kirchenmitgliedern entspricht, die zwar nur punktuellen Kontakt zu Gottesdiensten oder gemeindlichem Leben suchen, sich aber dennoch bewusst für ein Verbleiben in der Kirche entschieden haben und diese mit der Zahlung ihrer Kirchensteuer unterstützen.
2.3.2. „Körperschaft öffentlichen Rechts“
Das kirchliche Medien-Engagement baut auf einer Reihe von rechtlichen Grundlagen auf, die in Deutschland das Verhältnis zwischen Staat und Kirche als Kooperationsmodell fundieren. Dies ermöglicht es den Kirchen als Körperschaften öffentlichen Rechts auch innerhalb staatlicher beziehungsweise öffentlich-rechtlicher Rundfunkangebote, eigene Sendeplätze mit rein kirchlichen Themen und in eigener Verantwortung für die inhaltliche Gestaltung zu prägen.
Damit stellt die deutsche Situation des Kooperationsmodells zwischen dem Staat und ausgewählten Religionsgemeinschaften im Status einer „Körperschaft öffentlichen Rechts“ im Vergleich zu fast allen anderen Staaten einen Solitär dar: Es bietet den rechtlichen Rahmen für eine ganze Reihe religiöser Verkündigungsmöglichkeiten innerhalb öffentlich-rechtlicher Medien. Im vierzehntägigen Rhythmus werden beispielsweise evangelische und katholische Sonntagsgottesdienste in ARD oder ZDF übertragen. Das „Wort zum Sonntag“ stellt ein weiteres Beispiel für derartige Kooperationen dar. Mit ihm erhalten die großen christlichen Kirchen einen prominenten Sendeplatz im Samstagabendprogramm der ARD.116 Als zweitälteste Sendung im deutschen Fernsehen ist das „Wort zum Sonntag“ immer wieder auch aufgrund seiner klassischen Gestaltung belächelt und in seinem Bedeutungsverlust analysiert117 worden. Es verfügt aber dennoch über eine beträchtliche Einschaltquote und erreicht durchschnittlich etwa eine Million Zuschauer_innen.118 Die Formen der Kooperation zwischen Staat und Gesellschaft stellen nicht nur ein Spezifikum des bundesdeutschen Verhältnisses von Staat und Kirche dar: „Diese rundfunkstaatsvertraglich abgesicherte Zugangskonstellation, in deren Zusammenhang man auch vom sogenannten Drittsenderecht der Kirchen spricht (eigenverantwortliche Sendungen Dritter!), stellt für die Verkündigung der Kirche im öffentlich-rechtlichen Rundfunksystem – auch im Blick auf andere Systeme weltweit – ein nicht zu unterschätzendes Privileg dar.“119 Diese Privilegien verdeutlichen auch, dass kirchliche Sendungen in den staatlichen Medien auf eine gesamtgesellschaftliche Verantwortlichkeit ausgerichtet sind und inhaltlich nicht bloß auf einen rein binnenkirchlichen Adressat_innenkreis ausgerichtet sein sollen.
Ähnliches gilt für Morgenandachten120 und andere kirchliche Sendungen im Hörfunk, die auf „Drittsenderechten“ aufbauen, eine gesellschaftliche Pluralität innerhalb des öffentlich-rechtlichen Rundfunks abbilden und dem gesellschaftlichen Zusammenhalt dienen sollen.121