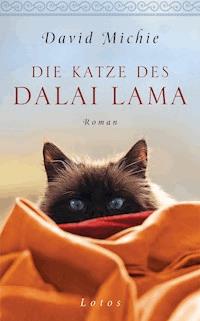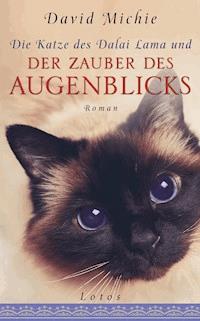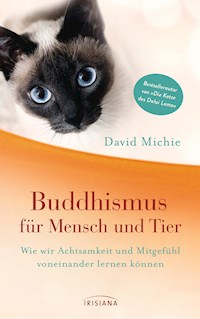13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ansata
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: Romanreihe Katze des Dalai Lama
- Sprache: Deutsch
Auf leisen Pfoten zum Glück
Wer wüsste besser als eine Katze, worin das Geheimnis des Glücks besteht? Der Dalai Lama verreist für einige Wochen und stellt seiner »kleinen Schneelöwin«, wie er sie nennt, eine Aufgabe: Sie soll die Kunst des Schnurrens erforschen und so die Ursache für wahres, tiefes Glück herausfinden. Bei ihren Streifzügen trifft die vorwitzige Himalaja-Katze einen mysteriösen Yogi, belauscht hochrangige Lamas und berühmte Schriftsteller, errettet eine Yogaklasse vor einem drohenden Unglück und findet schließlich Erstaunliches über ihre geheimnisvolle Herkunft heraus ...
Auf überaus charmante und unterhaltsame Weise vermittelt David Michie wertvolle Inspirationen, in denen sich die Weisheit des Buddhismus spiegelt. Begleitet von der »Katze Seiner Heiligkeit«, erschließen sich uns neue Wege auf der Suche nach Glück und Sinn in der modernen Welt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 265
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
David Michie
die katze des dalai lama und
die kunst des schnurrens
Roman
Aus dem Englischen übersetztvon Kurt Lang
Lotos
DAS BUCH
Als der Dalai Lama seine Katze damit beauftragt, die Kunst des Schnurrens zu erforschen, ist dies der Beginn einer abenteuerlichen Reise für die »kleine Schneelöwin«. Wie findet man tiefes, inneres Glück, das nicht nur bis zum Boden einer Thunfischdose reicht? Mit Neugier, Mitgefühl und einer Prise Übermut meistert die Katze Seiner Heiligkeit auf ihrer Suche einige haarige und amüsante Situationen. Sie lauscht mit spitzen Katzenohren, was Lamas, berühmte Wissenschaftler und ein geheimnisvoller Yogi über das Glück zu sagen haben – und sie lernt, wie man den Höhen und Tiefen des Lebens mit Achtsamkeit und buddhistischer Lebensweisheit begegnet. Denn manchmal ist Schnurren einfach die beste Lösung!
DER AUTOR
David Michie, geboren in Simbabwe, lebt heute in Australien. Ursprünglich Thriller-Autor, gelingt es dem praktizierenden Buddhisten und Meditationslehrer mit Bravour, buddhistische Prinzipien in moderner, verständlicher Form einem breiten Publikum nahezubringen.
Weitere Informationen unter: www.davidmichie.com
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte dieses E-Book Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung dieses E-Books verweisen.
Die Originalausgabe erschien 2013 unter dem Titel »The Dalai Lama’s Cat and the Art of Purring« im Verlag Hay House Inc., USA.
Copyright © 2013 by David Michie
Originally published in 2013 by Hay House Inc., USA
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2015 by Lotos Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Redaktion: Karin Weingart
Covergestaltung: Guter Punkt, München
unter Verwendung eines Motivs von © KameleonMedia/Bigstock
Illustrationen: © branche caria – Fotolia.com
Umsetzung eBook: Greiner & Reichel, Köln
ISBN 978-3-641-16436-2 V004
www.ansata-integral-lotos.de
Irren ist menschlich, Schnurren kätzlich.
ROBERT BYRNE, SCHRIFTSTELLER
Prolog
Da seid ihr ja wieder (obwohl ihr euch ganz schön Zeit gelassen habt, wenn ich das sagen darf, liebe Leser), sehr gut!, denn ich habe eine Botschaft für euch. Keine gewöhnliche und schon gar nicht stammt sie von einer gewöhnlichen Person. Aber sie betrifft euch ganz direkt, euer größtes, höchst persönliches Glück.
Ihr braucht euch jetzt nicht umzudrehen und nachsehen, ob jemand hinter oder neben euch steht. Nein, diese Botschaft ist wirklich für euch ganz persönlich bestimmt.
Nicht jeder Erdenbürger wird diese Zeilen lesen – realistisch betrachtet wohl nur eine winzige Minderheit. Aber glaubt nicht, es sei Zufall, dass ihr sie gerade in diesem besonderen Augenblick eures Lebens lest. Nur diejenigen mit einem ganz bestimmten Karma werden begreifen, was ich zu sagen habe – nämlich die, die auf eine besondere Weise mit mir verbunden sind.
Oder besser gesagt: mit uns.
Denn bekanntermaßen bin ich die Katze des Dalai Lama, und die Botschaft, die ich euch mitzuteilen habe, kommt von Seiner Heiligkeit persönlich.
Wie ich es wagen kann, eine solch lächerliche Behauptung aufzustellen? Habe ich etwa nicht mehr alle Tassen im Schrank? Wenn ihr gestattet, dass ich mich auf euren Schoß setze – selbstverständlich nur metaphorisch gesprochen –, will ich es euch erklären.
Irgendwann steht jeder Katzenliebhaber einmal vor dem Problem: Wie sage ich meinem vierbeinigen Gefährten, dass ich für längere Zeit verreise? Und nicht nur übers Wochenende?
Für uns Katzen ist die Art und Weise, mit der die Menschen ihre bevorstehende Abreise kundtun, von großer Bedeutung. Einige meiner Artgenossen bestehen auf frühzeitiger Vorwarnung, damit sie sich geistig auf die kommenden Veränderungen einstellen können. Andere dagegen ziehen es vor, von der Nachricht überrascht zu werden, als würde eine wütende Elster während der Brutzeit auf sie herniederfahren: Kaum hat man begriffen, was da vorgeht, ist es auch schon passiert.
Das Personal scheint sich darauf einzurichten: Die einen schmieren einem schon Wochen vor ihrer Abreise Honig ums Maul. Die anderen holen mir nichts, dir nichts den Koffer aus der Abstellkammer.
Ich selbst kann mich im Grunde sehr glücklich schätzen, denn auch wenn der Dalai Lama auf Reisen geht, verändert sich der Alltag hier im Namgyal nicht großartig. Nach wie vor verbringe ich viel Zeit auf dem Fensterbrett seiner Gemächer im ersten Stock, einem Aussichtspunkt, von dem aus ich mit geringstem Aufwand möglichst viel mitbekomme. Außerdem bin ich oft im Büro der Assistenten Seiner Heiligkeit. Und nicht zu vergessen der regelmäßige kurze Spaziergang ins Himalaja-Buchcafé, in dem immer eine angenehme, freundliche Atmosphäre herrscht und verlockende Köstlichkeiten auf mich warten.
Dennoch – ohne Seine Heiligkeit ist es nicht dasselbe. Wie man sich in Gegenwart des Dalai Lama fühlt? Ich kann es nicht besser beschreiben als mit dem einen Wort: großartig. Sobald er einen Raum betritt, werden alle Anwesenden von seiner Energie und seiner von Herzen kommenden Heiterkeit berührt. Welche Probleme man auch sonst im Leben hat, welche Tragödien oder welcher Verlust einen ereilt haben mögen, während der Zeit, die man mit Seiner Heiligkeit verbringt, empfindet man tief im Inneren die Gewissheit, dass alles gut ist.
Wer das noch nicht selbst erfahren hat: Es ist, als ob man eine Dimension an sich entdecken würde, die immer schon da war und die einen durchströmt wie ein unterirdischer, bisher unbekannter Fluss. Und sobald man diesen Quell einmal wiederentdeckt hat, erfährt man nicht nur tiefen Frieden im Kern seines Wesens, sondern darf auch für einen kurzen Moment einen Blick auf das eigene Bewusstsein werfen – strahlend, grenzenlos und voller Liebe.
Der Dalai Lama sieht uns so, wie wir wirklich sind, und hält uns den Spiegel unserer wahren Natur vor. Das ist auch der Grund, warum in seiner Gegenwart so viele Menschen förmlich dahinschmelzen. Mächtige Männer in dunklen Anzügen habe ich in Tränen ausbrechen sehen, nur weil er sie am Arm berührt hat. Die Oberhäupter der großen Weltreligionen stehen Schlange, um ihn kennenzulernen. Ich habe an den Rollstuhl gefesselte Menschen beobachtet, die Freudentränen vergossen, als er sich durch die Menge drängte, um ihnen die Hand zu reichen. Seine Heiligkeit erinnert uns an das Beste, was wir sein können. Gibt es ein größeres Geschenk?
Obwohl ich auch dann noch ein privilegiertes, sehr angenehmes Leben führe, wenn der Dalai Lama auf Reisen ist, könnt ihr also sicher nachvollziehen, warum mir seine Gegenwart weitaus lieber ist. Dessen ist sich auch Seine Heiligkeit bewusst – genauso wie er weiß, dass ich zu der Sorte Katze gehöre, die vorab informiert werden will, wenn er zu verreisen beabsichtigt. Will ihn einer seiner Assistenten – entweder Chogyal, der junge, pummelige Mönch, der für die spirituellen Belange und die Angelegenheiten des Klosters zuständig ist, oder Tenzin, der erfahrene Diplomat, der ihm in weltlichen Dingen zur Hand geht – an eine bevorstehende Reise erinnern, blickt Seine Heiligkeit auf und sagt so etwas wie: »Ende nächster Woche zwei Tage Neu-Delhi.«
Die Männer denken dann vielleicht, dass er den Termin bestätigt. In Wahrheit jedoch sagt er es nur meinetwegen.
Vor einer längeren Reise bereitet er mich auf seine Abwesenheit vor, indem er mir die Anzahl der Nächte vor Augen führt, die er fortbleiben wird. Außerdem legt er großen Wert darauf, dass wir am Abend vor seinem Aufbruch eine gewisse Zeit zusammen verbringen. Nur wir beide. In diesen kostbaren Minuten verständigen wir uns so innig miteinander, wie es nur Katzen und ihren menschlichen Gefährten möglich ist.
Was mich wieder zu der Botschaft zurückbringt, die ich euch von Seiner Heiligkeit überbringen soll. Er gab sie mir am Abend vor seiner Abreise zu einem siebenwöchigen Lehraufenthalt in den Vereinigten Staaten und Europa – so lange waren wir vorher noch nie voneinander getrennt gewesen. Während sich die Dämmerung über das Kangra-Tal legte, stand er von seinem Schreibtisch auf, kam zum Fensterbrett herüber und ging vor mir in die Hocke. Während er in meine blauen Augen schaute, sagte er: »Morgen muss ich fort, meine kleine Schneelöwin.« Diesen Kosenamen mag ich besonders gern, weil die Tibeter Schneelöwen als himmlische Geschöpfe betrachten, die Schönheit, Furchtlosigkeit und Fröhlichkeit symbolisieren. »Sieben Wochen, das ist länger, als ich normalerweise unterwegs bin. Ich weiß, dass du mich am liebsten hierbehalten würdest, aber ich werde auch noch von anderen gebraucht.«
Ich richtete mich auf, streckte die Pfoten und dehnte mich lange und ausgiebig. Dann gähnte ich herzhaft.
»Was für ein schönes rosa Mäulchen«, sagte Seine Heiligkeit lächelnd. »Es freut mich, dass deine Zähne und dein Zahnfleisch bei bester Gesundheit sind.«
Ich kam näher und stupste ihn liebevoll mit dem Kopf an.
»Ach, du bringst mich zum Lachen!«, sagte er. So blieben wir, Stirn an Stirn, während er meinen Hals kraulte. »Ich werde eine Zeit lang nicht hier sein, aber dein Wohlbefinden hängt nicht von meiner Anwesenheit ab. Du kannst trotzdem sehr glücklich sein.«
Seine Fingerspitzen massierten die Hinterseite meiner Ohren. Genau so, wie ich es mag.
»Du glaubst vielleicht, dass dein Glück von meiner Anwesenheit oder den Leckereien abhängt, die du unten im Café bekommst.« Seine Heiligkeit machte sich keine Illusionen darüber, weshalb ich ein so eifriger Besucher des Himalaja-Buchcafés war. »Aber versuch doch mal, in den nächsten sieben Wochen die wahre Ursache des Glücks herauszufinden. Und wenn ich zurückkomme, kannst du mir von deinen Erkenntnissen berichten.«
Behutsam und liebevoll nahm mich der Dalai Lama in den Arm, und gemeinsam betrachteten wir das Kangra-Tal durch das offene Fenster. Es ist ein majestätischer Anblick: das blühende, gewundene Tal, die sanften, von immergrünen Wäldern bedeckten Hügel, weit dahinter die schneebedeckten Gipfel des Himalajas, die in der Abendsonne glänzen. Die sanfte Brise, die durch das Fenster hereinwehte, duftete nach Kiefern, Rhododendron und Eiche; ein magisches Flirren lag in der Luft.
»Ich werde dir die wahren Ursachen des Glücks verraten«, flüsterte er mir ins Ohr. »Diese Botschaft ist nur für dich bestimmt – und für diejenigen, die karmisch mit dir verbunden sind.«
Ich fing an zu schnurren, erst leise, dann so laut wie ein winziger Außenbordmotor.
»Genau, meine kleine Schneelöwin«, sagte der Dalai Lama. »Ich möchte, dass du die Kunst des Schnurrens erforschst.«
Erstes Kapitel
Liebe Leser, habt ihr euch nicht auch schon einmal über die weitreichenden Konsequenzen gewundert, die eine scheinbar ganz triviale Entscheidung haben kann? Man trifft eine belanglose, völlig alltägliche Wahl, und dann hat sie ebenso dramatische wie unvorhergesehene Folgen.
Genau das geschah am Montagnachmittag, als ich mich dazu entschied, vom Himalaja-Buchcafé aus nicht direkt nach Hause zu gehen, sondern die sogenannte Panoramaroute zu nehmen. Diesen Weg wählte ich nur selten – einfach weil es dort nicht das Geringste zu sehen gibt, und ein Panorama schon gar nicht. Es handelt sich im Grunde nur um eine Seitengasse, die hinter dem Himalaja-Buchcafé und den angrenzenden Grundstücken verläuft.
Allerdings ist die Strecke etwas länger, sodass ich zehn statt der üblichen fünf Minuten zum Namgyal zurück brauchen würde. Aber da ich den Nachmittag auf dem Zeitschriftenregal des Cafés verschlafen hatte, konnte ich die Bewegung dringend brauchen.
Also wandte ich mich nach links, sobald ich ins Freie trat, und nicht wie sonst nach rechts. Nachdem ich das Café hinter mir gelassen hatte, bog ich noch einmal links ab und schlenderte die enge, mit Mülltonnen vollgestellte Gasse hinunter, in der es verführerisch nach Essensresten und anderen appetitanregenden Dingen roch. Ich ging etwas wackligen Schrittes, da meine Hinterbeine seit einem Unfall in frühester Jugend sehr schwach sind. Einmal blieb ich kurz stehen, um ein interessantes Objekt von silberner und brauner Farbe zu begutachten. Es stellte sich als Champagnerkorken heraus, der irgendwie im Gully stecken geblieben war.
Gerade wollte ich ein weiteres Mal links abbiegen, als ich die ersten Anzeichen einer drohenden Gefahr spürte. Auf der Hauptstraße, etwa zwanzig Meter vor mir, standen zwei der größten und bedrohlichsten Hunde, die ich je gesehen hatte. Offenbar waren sie neu in der Gegend. Sie blähten drohend die Lefzen, während ihr langes Fell von der Abendbrise zerzaust wurde.
Und was das Schlimmste war: Sie trugen keine Leine.
Im Nachhinein betrachtet hätte ich wohl den Rückzug antreten und durch den Hintereingang ins Café zurückschlüpfen sollen. Die Abstände zwischen den Gitterstäben waren für mich breit genug, für diese Ungeheuer aber viel zu schmal.
Während ich mich noch fragte, ob sie mich bereits bemerkt hatten, sahen sie mich und stürmten ohne Zögern auf mich zu. Instinktiv bog ich scharf rechts ab und lief, so schnell mich meine wackligen Beine trugen. Das Herz klopfte mir bis zum Hals, die Haare sträubten sich. Verzweifelt suchte ich nach einem Versteck. In diesen kurzen, adrenalinbefeuerten Augenblicken kamen mir kein Baum zu hoch und kein Spalt zu eng vor.
Doch ich konnte nirgendwo eine Fluchtmöglichkeit oder ein sicheres Versteck entdecken. Das Hundegebell wurde immer lauter. Sie holten auf. In blinder Panik wusste ich mir nicht anders zu helfen als mit der Flucht in einen Gewürzladen. Womöglich gab es dort ein höher gelegenes, für die Hunde unerreichbares Plätzchen oder ich konnte zumindest dafür sorgen, dass sie meine Witterung verloren.
Das kleine Geschäft war mit Holztruhen vollgestellt, auf denen sorgfältig mit verschiedenen Gewürzen gefüllte Messingschüsseln arrangiert waren. Matronenhafte Frauen, die auf dem Schoß Mörser hatten, in denen sie mit Stößeln Kräuter zu Pulver zerrieben, kreischten erschreckt auf, als ich an ihren Knöcheln vorbeiwischte – direkt gefolgt von den wütend bellenden, blutrünstigen Bestien.
Metall klirrte auf Beton, als die Schüsseln zu Boden fielen. Gewürzwolken explodierten förmlich in der Luft. Auf der Suche nach einem rettenden Regalbrett lief ich in den hinteren Teil des Ladens, nur um mich vor einer fest verschlossenen Tür wiederzufinden. Immerhin entdeckte ich zwischen zwei Holztruhen einen Spalt, in den ich mich quetschen konnte. Dahinter befand sich statt einer Wand lediglich eine zerrissene Plastikplane – und dahinter wiederum eine verlassene Seitengasse.
Die Hunde steckten ihre riesigen Köpfe in den Spalt und kläfften wie verrückt. Voller Angst sah ich mich um – die Seitengasse war mein einziger Ausweg.
Da hörte ich ein klägliches Winseln. Die empörten Damen hatten die beiden Übeltäter offenbar gestellt und wollten sie nun wohl des Ladens verweisen. Mein sonst so glänzendes Fell war mit Gewürzen in allen Farben bedeckt. Ich sprang auf die Straße und rannte, so schnell es mir meine gebrechlichen Beine erlaubten. Die Gasse führte eine leichte, aber kräftezehrende Steigung hinauf. Obwohl ich jede Faser meines Körpers bis zum Äußersten beanspruchte, kam ich nur langsam voran. Ich wollte so weit weg von den Hunden wie möglich, suchte verzweifelt nach irgendeinem Versteck. Doch ich sah nur Schaufenster, Betonwände und undurchdringliche Metallgitter.
Das Bellen hinter mir schien kein Ende nehmen zu wollen. Jetzt waren zusätzlich die wütenden Rufe der Frauen aus dem Gewürzladen zu hören. Ich drehte mich um und sah, wie sie die Hunde mit Schlägen gegen die Flanken aus dem Geschäft trieben. Die beiden geifernden Bestien strichen mit irrem Blick und heraushängender Zunge auf dem Bürgersteig herum, während ich meinen mühsamen Weg den Pfad hinauf fortsetzte – in der Hoffnung, mich unter den zahlreichen Passanten und Fahrzeugen einigermaßen verstecken zu können.
Doch es gab kein Entkommen.
Nach wenigen Augenblicken hatten die beiden Untiere erneut Witterung aufgenommen und setzten die Jagd fort. Ihr grimmiges Knurren fuhr mir durch Mark und Bein.
Mein Vorsprung war viel zu gering. Die Hunde würden mich im Handumdrehen eingeholt haben. Ich erreichte ein von hohen weißen Mauern umgebenes Anwesen. An einer Seite entdeckte ich neben einem schwarzen Eisengitter ein Holzspalier. Was ich als Nächstes tat, wäre mir unter normalen Umständen nicht im Traum eingefallen, doch ich hatte keine andere Wahl. Nur wenige Sekunden bevor sich die Hunde auf mich stürzen konnten, sprang ich auf das Spalier und kletterte daran hoch, so schnell es die Kraft meiner flauschigen grauen Beinchen erlaubte. Satz für Satz, Pfote für Pfote arbeitete ich mich weiter hinauf.
Gerade als ich den oberen Rand der Mauer erreicht hatte, warfen sich die Hunde mit wütendem Gebell gegen das Spalier. Unter lautem Knacken splitterte das hölzerne Gitterwerk, und die obere Hälfte des Spaliers löste sich an einem Ende von der Mauer. Wäre ich nicht in letzter Sekunde abgesprungen, würde ich jetzt hilflos über den weit aufgerissenen Hundemäulern baumeln.
So jedoch stand ich auf der Mauer und starrte auf ihre gefletschten Zähne hinab. Ihr entsetzliches Knurren ließ mich erschaudern. Es war, als würde ich den schrecklichen Ausgeburten der tiefsten Höllen ins Auge blicken.
Das Gebell dauerte an, bis die Hunde durch einen anderen Vertreter ihrer Spezies abgelenkt wurden, der weiter die Straße hinunter etwas vom Gehweg leckte. Als sie auf ihren Kameraden zuliefen, wurden sie von einem großen Mann in einem Tweedjackett am Kragen gepackt, der sie umgehend an die Leine legte. Während er sich noch über sie beugte, hörte ich, wie ein Passant zu ihm sagte: »Was für schöne Labradore!«
»Golden Retriever«, korrigierte der Mann. »Sie sind noch jung und ungestüm. Aber«, fügte er hinzu und streichelte sie liebevoll, »ganz entzückende Tiere.«
Entzückende Tiere? War denn die ganze Welt verrückt geworden?
Es dauerte eine Ewigkeit, bis sich mein Herzschlag einigermaßen beruhigt hatte. Erst dann wurde mir der Ernst meiner Lage bewusst. Nirgendwo war ein Ast oder ein Absatz zu erkennen, mit dessen Hilfe ich den Abstieg wagen konnte. Die Mauer, auf der ich stand, endete an einer Seite am Tor und an der anderen im Nichts. Während ich die Pfote zum Mäulchen führen wollte, um mein Gesicht einer ebenso nötigen wie tröstlichen Säuberung zu unterziehen, nahm ich einen derart intensiven Geruch wahr, dass ich innehielt. Ein einziger Zungenschlag, und mein Maul hätte wie Feuer gebrannt. Da stand ich also, gefangen auf einer mir fremden hohen Mauer und konnte mich noch nicht einmal ordentlich putzen!
Mir blieb nichts anderes übrig als abzuwarten. Im Gegensatz zu dem Aufruhr, der in mir herrschte, war der Garten hinter der Mauer ein Sinnbild der heiteren, abgeklärten Ruhe, die man sonst wohl nur im »Reinen Land der Buddhas« fand, von dem die Mönche hin und wieder sprachen. Durch die Bäume konnte ich ein großes, herrschaftliches Gebäude erkennen, das von üppigen Rasenflächen und prächtigen Blumenbeeten umgeben war. Wie gern wäre ich durch diesen Garten spaziert oder über die Veranda geschlendert – dieser Ort schien wie für mich gemacht zu sein. Nun, sobald einer der Bewohner dieses schönen Bauwerks die Schneelöwin auf der Mauer festsitzen sah, würde er bestimmt Mitgefühl empfinden und ihr zur Rettung eilen.
Doch trotz des regen Treibens auf der Straße betrat oder verließ niemand das Anwesen durch das Tor. Die Mauer war so hoch, dass mich die Fußgänger auf dem Bürgersteig kaum erkennen konnten. Und die wenigen, die zu mir aufsahen, schienen keine Notiz von mir zu nehmen. Allmählich näherte sich die Sonne dem Horizont, und mir wurde mit Schrecken bewusst, dass ich die Nacht hier verbringen musste, wenn mir niemand zu Hilfe kam. Ich stieß ein klagendes, aber nicht sehr lautes Miauen aus. Schließlich wusste ich nur zu gut, dass viele Leute eine Abneigung gegen Katzen hegen: Ihre Aufmerksamkeit zu erregen hätte mich womöglich in eine noch schlimmere Lage gebracht.
Doch um ungebetene Aufmerksamkeit musste ich mich nicht sorgen: Ich erhielt überhaupt keine. Im Himalaja-Buchcafé mochte ich zwar als die KSH, die Katze Seiner Heiligkeit, verehrt werden, hier jedoch, unerkannt unter einem Kleid aus bunten Gewürzen, schenkte mir niemand Beachtung.
Liebe Leser, ich will euch nicht mit einer genauen Schilderung der nächsten Stunden, die ich auf der Mauer verbrachte, langweilen; weder mit dem verständnislosen Lächeln und den gleichgültigen Blicken, die ich erntete, noch mit den Steinen, mit denen mich zwei gelangweilte Lausebengel auf dem Weg von der Schule nach Hause bewarfen. Es war schon dunkel und ich todmüde, als ich eine Frau auf der Straße bemerkte. Erst erkannte ich sie nicht, doch dann spürte ich irgendwie, dass sie mich retten würde.
Ich miaute flehentlich. Sie überquerte die Straße. Als sie näherkam, bemerkte ich, dass es Serena Trinci war, die Tochter von Mrs. Trinci, ihres Zeichens Köchin Seiner Heiligkeit für besondere Anlässe und meine größte Verehrerin im Namgyal. Serena war Mitte dreißig und hatte vor Kurzem die Leitung des Himalaja-Buchcafés übernommen. Das dunkle, schulterlange Haar trug sie zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden. Ihr anmutiger Körper steckte in Yogakleidung.
»Rinpoche!«, rief sie verblüfft aus. »Was machst du denn da oben?«
Zu meiner grenzenlosen Erleichterung erkannte sie mich, obwohl wir uns erst zweimal im Café begegnet waren. Im Nu hatte sie eine in der Nähe stehende Mülltonne zur Mauer hinüber gewuchtet und war zu mir hinaufgeklettert. Als sie mich in die Arme nahm, bemerkte sie den bedauernswerten Zustand meines gewürzbefleckten Fells.
»Was ist denn mit dir passiert, du armes Ding?«, fragte sie, während sie mich an sich drückte und die bunten, aromatisch duftenden Flecken inspizierte. »Du warst bestimmt in Schwierigkeiten.«
Ich vergrub mein Gesicht an ihrer Brust, spürte den warmen Duft ihrer Haut und ihren tröstlichen Herzschlag. Mit jedem Schritt, den wir uns dem Café näherten, verwandelte sich meine Erleichterung in etwas Tieferes und Stärkeres: das untrügliche Gefühl einer starken Verbindung zwischen uns beiden.
Serena hatte den Großteil ihres Berufslebens in Europa verbracht und war erst vor ein paar Wochen nach McLeod Ganj zurückgekehrt – jenes Stadtviertel von Dharamsala, in dem der Dalai Lama residiert und in dem sie selbst in einem Haushalt aufgewachsen war, in dem mit Leidenschaft gekocht wurde. Da war es kein Wunder, dass sie nach der Highschool eine Gastronomiefachschule in Italien besucht und sich anschließend einen Ruf als Spitzenköchin in einigen der besten Restaurants Europas erworben hatte. Erst kürzlich hatte sie ihren Posten als Chefköchin des berühmten Hotels Danieli in Venedig aufgegeben, um ein angesagtes Restaurant im exklusiven Londoner Stadtteil Mayfair zu leiten.
Serena war ehrgeizig, voller Energie und hochtalentiert. Dennoch hatte ich mitgehört, wie sie Franc, dem Eigentümer des Himalaja-Buchcafés, gestanden hatte, dass sie dringend eine Pause vom anstrengenden Restaurantbetrieb brauchte. Der unaufhörliche Stress hatte sie erschöpft, und sie musste sich ausruhen und erholen. In sechs Monaten wollte sie dann in London eine der angesehensten Positionen übernehmen, die die Gastronomie der Metropole zu bieten hatte.
Dass sie exakt zu dem Zeitpunkt nach Hause kam, als Franc händeringend jemanden suchte, der in seiner Abwesenheit das Café übernahm, ahnte sie natürlich nicht. Er wollte sich für längere Zeit um seinen schwer kranken Vater kümmern, der in San Francisco lebte. Serena hatte zwar nicht unbedingt geplant, während ihrer Auszeit ein Lokal zu leiten, doch im Vergleich zu ihren bisherigen Tätigkeiten nahm sich das Himalaja-Buchcafé eher wie ein entspannter Nebenjob aus. Abends war es nur von Donnerstag bis Samstag geöffnet, und das Tagesgeschäft hatte Kusali, der Oberkellner, bestens im Griff, sodass es für Serena nicht viel zu tun gab. Es würde Spaß machen, hatte Franc ihr versichert, und langweilig würde es bestimmt nicht werden.
Was aber noch viel wichtiger war: Franc brauchte auch jemanden, der sich um seine beiden Hunde kümmerte: Marcel, die Französische Bulldogge, und Kyi Kyi, den Lhasa Apso, die beiden anderen nicht menschlichen Stammgäste des Cafés. Den größten Teil des Tages dösten sie in ihrem Weidenkorb unter dem Empfangstresen vor sich hin.
Schon nach zwei Wochen hatte Serena dem Café ihren unverwechselbaren Stempel aufgedrückt. Sie zog jeden, dem sie begegnete, unwillkürlich in ihren Bann. Die Gäste wurden von ihrer Lebhaftigkeit angesteckt, ob sie wollten oder nicht.
Sie schien über die Gabe zu verfügen, aus jedem noch so gewöhnlichen Abend ein unvergessliches Erlebnis zu machen. Wenn sie durch das Lokal wirbelte, prügelten sich die Kellner beinahe darum, ihr behilflich sein zu dürfen. Auch Sam, der Inhaber des dem Café angeschlossenen Buchladens, machte aus seiner Bewunderung für sie keinen Hehl, und der ebenso hochgewachsene wie gewitzte Kusali – das indische Äquivalent eines formvollendeten englischen Butlers – nahm sie unter seine väterlichen Fittiche.
Ich hatte gerade auf meinem üblichen Platz gelegen – dem obersten Brett des Zeitschriftenregals zwischen Vogue und Vanity Fair –, als Franc mich Serena als Rinpoche vorstellte. Dieses Wort wird Rin-po-tsché ausgesprochen, bedeutet »Kostbarkeit« und ist ein tibetischer Ehrentitel für die weisesten buddhistischen Lehrer. Serena hatte der Versuchung nicht widerstehen können, sie streckte die Hand aus und streichelte mein Gesicht. »Wie überaus hinreißend!«, hatte sie gesagt.
Als sich der Blick aus meinen lapislazulifarbenen Augen mit dem aus ihren funkelnden braunen traf, war dies ein Moment des Erkennens. Sofort empfand ich das, was für uns Katzen von so großer Bedeutung ist, dass wir eine Art angeborenes Gespür dafür besitzen: Vor mir stand eine Katzenliebhaberin.
Jetzt, nach meinem Abenteuer mit den Hunden, saßen wir in der engen Waschküche des Restaurants. Mit der Hilfe von Kusali und einigen warmen, feuchten Tüchern, wusch mir Serena die Gewürze ab, die in meinem dichten Fell klebten.
»Rinpoche mag vielleicht anders darüber denken«, bemerkte die junge Frau, während sie behutsam einen dunklen Fleck von meinen grauen Pfoten wischte, »aber ich liebe den Duft dieser vielen Gewürze. Er versetzt mich in die Küche meiner Kindheit zurück: Zimt, Kreuzkümmel, Kardamom, Nelken – die wunderbaren Aromen des Garam masala, mit dem wir unser Hühnercurry und andere Gerichte zubereitet haben.«
»Sie haben früher Currys zubereitet, Miss Serena?«, fragte Kusali verblüfft.
»So habe ich überhaupt mit dem Kochen angefangen«, sagte sie. »Mit diesen Gewürzen bin ich aufgewachsen. Rinpoche hat sie mir nur wieder in Erinnerung gerufen.«
»Schon viele unserer geschätzten Kunden haben mich gefragt, ob wir nicht auch indische Gerichte anbieten, Ma’am.«
»Ja, mich auch.«
In Dharamsala herrschte kein Mangel an Imbissbuden, Garküchen und auch etwas gehobeneren Restaurants. Doch am wichtigsten war den Leuten »die Vertrauenswürdigkeit der Betreiber eines Lokals«, wie Kusali erklärte.
»Das stimmt«, pflichtete Serena ihm bei. »Aber Franc hat klipp und klar gesagt, dass wir die Speisekarte nicht ändern sollen.«
»Und wenn das Café an den üblichen Abenden geöffnet ist, müssen wir seine Wünsche auch respektieren«, meinte Kusali verschmitzt.
Schweigend entfernte Serena mehrere ganze Pfefferkörner, die sich in meinem buschigen Schwanz verfangen hatten, während Kusali vorsichtig an einem grellroten Paprikafleck auf meiner Brust rieb.
»Habe ich Sie da richtig verstanden, Kusali?«, fragte Serena schließlich mit einem Lächeln in der Stimme.
»Verzeihung, Ma’am, wie meinen?«
»Wollten Sie damit sagen, dass wir ausnahmsweise an einem Mittwochabend öffnen und versuchsweise ein paar Currygerichte anbieten sollten?«
Kusali sah sie erstaunt und mit einem breiten Grinsen an. »Eine hervorragende Idee, Ma’am!«
Wir Katzen mögen Wasser nicht besonders, und eine nasse Katze ist eine unglückliche Katze. Das wusste auch Serena. Sobald also der gewohnt prächtige Zustand meines Fells einigermaßen wiederhergestellt war, trocknete sie mich mit einem besonders weichen Handtuch ab. Dann bat sie Kusali, mir einige Stücke Hühnerbrust zu reichen, damit ich beschäftigt war, bis sie mich in den Jokhang nach Hause brachte.
Obwohl das Restaurant am Montag geschlossen hatte, zauberte Kusali einige schmackhafte Fleischbrocken aus dem Kühlschrank hervor, wärmte sie kurz auf und schüttete sie dann in meine persönliche kleine Porzellanschüssel. Aus alter Gewohnheit trug er sie zu meinem Stammplatz im Hinterzimmer des Cafés hinüber. Serena, die mich auf den Armen trug, folgte ihm.
Da es im Café schon recht dunkel war, bemerkten wir erst jetzt, dass Sam Goldberg, der Buchhändler, an diesem Abend ein Treffen seines Lesekreises veranstaltete. Während ich mich mit großem Appetit auf mein Abendessen stürzte, gingen Serena und Kusali vom Café in den angrenzenden Buchladen hinüber. Dort saßen ungefähr zwanzig Leute auf Stuhlreihen vor einer Leinwand.
»Dies hier ist eine Zukunftsvision aus einem Buch der späten Fünfzigerjahre«, sagte eine Männerstimme. Mit seinem Glatzkopf, der Intellektuellenbrille und dem Ziegenbärtchen wirkte der Sprecher irgendwie gewitzt, aber auch ein wenig arrogant. Ich erkannte ihn sofort, da Sam vor nicht allzu langer Zeit ein Plakat mit seinem Konterfei im Laden aufgehängt hatte. Ein darauf abgedrucktes Zitat aus Psychologie Heute wies den Mann – einen berühmten Psychologen – als einen der »führenden Denker unserer Zeit« aus.
Sam, der am Eingang stand, um letzte Nachzügler zu begrüßen, sah ich erst jetzt. Er hatte eine hohe Stirn, dunkle Locken und haselnussbraune Augen, die intelligent hinter einer eher altmodischen Brille hervorblitzten. Obwohl er frisch, unverbraucht und ziemlich gut aussah, mangelte es ihm aus unerfindlichen Gründen an Selbstvertrauen. Genau wie Serena arbeitete auch Sam noch nicht lange im Himalaja-Buchcafé, im Unterschied zu ihrer war jedoch seine Stelle nicht befristet.
Vor mehreren Monaten war Sam noch Stammgast des Cafés gewesen. Als ihn Franc über die Bücher und Audiobooks ausgefragt hatte, mit denen er sich ständig beschäftigte, hatte Sam erklärt, dass er in einer großen Buchhandlung in Los Angeles gearbeitet hatte, bis sie vor nicht allzu langer Zeit geschlossen wurde.
Damit hatte er sofort Francs Interesse geweckt, der sich schon länger mit dem Gedanken trug, einen Teil des viel zu großzügig bemessenen Café Franc – wie es damals noch hieß – in einen Buchladen umzuwandeln. Das Einzige, was ihm dazu noch fehlte, war jemand, der über die nötigen Fachkenntnisse verfügte. Wenn sich also je ein Mensch zur richtigen Zeit am richtigen Ort aufhielt, dann Sam.
Dennoch hatte es einiger Überredungskunst bedurft. Sam leckte noch die Wunden seiner plötzlichen Kündigung und glaubte nicht, dieser neuen Herausforderung gewachsen zu sein. Franc musste seinen ganzen Charme aufbieten, und erst mithilfe der nicht unbeträchtlichen Überzeugungskraft seines Lamas Geshe Wangpo gelang es ihm, Sam umzustimmen und ihm den Aufbau der Buchhandlung im Himalaja-Buchcafé anzuvertrauen.
»Vergessen Sie nicht – von den Fünfzigerjahren aus gesehen leben wir in der Zukunft«, fuhr Sams Gastredner fort. »Irgendwelche Anmerkungen zu dieser Illustration?«
Das Publikum kicherte. Auf der Leinwand war das Bild einer Hausfrau zu sehen, die Staub putzte, während ihr Mann sein Antigravitationsauto vor der Tür parkte. Im Himmel über ihm wimmelte es von fliegenden Autos und Menschen mit Raketenrucksäcken auf dem Rücken.
»Der toupierte Mopp, den die Frau da anstelle einer Frisur trägt, ist nicht besonders futuristisch«, bemerkte eine Zuhörerin, woraufhin Gelächter ertönte. »Und die Klamotten!«, stöhnte eine andere, was weitere Heiterkeit auslöste. Die Frau im Petticoat und ihr Gatte mit den Röhrenhosen sahen wirklich nicht sehr zeitgemäß aus.
»Und was ist mit den Raketenrucksäcken?«, warf ein anderer ein.
»Ganz recht«, pflichtete ihm der Redner bei. »Auf die warten wir immer noch.« Er zeigte noch einige ähnliche Abbildungen. »Hier können Sie sehen, wie sich die Menschen in den Fünfzigern die Zukunft vorgestellt haben. Dass diese Bilder auf so wunderbar charmante Weise veraltet auf uns wirken, liegt nicht nur an dem, was darauf dargestellt wird, sondern auch daran, was nicht zu sehen ist. Sagen Sie mir, was auf diesem Bild fehlt.« Er zeigte die Vision eines Künstlers von einer Straßenszene des Jahres 2020. Statt der Bürgersteige säumten Förderbänder die Straßen, auf denen die Passanten durch die Stadt transportiert wurden.
Obwohl ich mich in erster Linie für mein Hühnchen interessierte, fand selbst ich das Bild auf der Leinwand surreal – wenn auch aus Gründen, die ich nicht richtig benennen konnte. »Keine Handys«, sagte jemand nach einer kurzen Pause.
»Keine Frauen in Führungspositionen«, fügte ein anderer hinzu.
»Keine Farbigen«, meinte ein dritter.
»Keine Tätowierungen.« Dem Publikum fielen immer weitere Einzelheiten auf.
Der Redner wartete noch etwas ab, um die Bilder ihre Wirkung entfalten zu lassen, bevor er weitersprach: »Der Unterschied zwischen der Lebenswirklichkeit in den Fünfzigern und der Vorstellung der damaligen Menschen von der Zukunft besteht in dem, worauf sich die Leute von damals fokussierten – auf Antigravitationsautos beispielsweise oder Förderbänder auf den Gehwegen. Alles andere würde gleich bleiben, dachten sie.«
Er legte eine weitere Pause ein, damit das Publikum das Gesagte verdauen konnte.
»Und das, werte Herrschaften«, sagte er schließlich, »ist einer der Gründe dafür, weshalb wir uns so schwer damit tun, bestimmte Dinge vorherzusagen. Wir glauben, dass sich unser Leben bis auf diese einzige Sache, auf die wir uns konzentrieren, nicht verändern wird.
Diese Beinahe-Gleichsetzung der Zukunft mit der Gegenwart könnte man auch als Fixierung auf das Gegebene bezeichnen. Wenn wir ans Morgen denken, geht unser Verstand automatisch davon aus, dass sich bis auf ein bestimmtes Element nichts ändert. Das Material, mit dem wir die Leerstellen füllen, beziehen wir aus der Gegenwart, wie die Abbildungen deutlich zeigen.
Forschungen haben ergeben, dass wir uns des Mechanismus dieser ›Leerstellenauffüllung‹ nicht bewusst sind, wenn wir Vorhersagen über die Zukunft treffen. Deshalb sind wir beispielsweise der Ansicht, dass uns ein Chefbüro das Gefühl von Erfolg und Geschäftstüchtigkeit verschaffen wird oder dass ein teures Auto einen niemals versiegenden Quell der Freude darstellt. Wir glauben, dass sich unser Leben bis auf dieses einzige Detail nicht verändern wird. Doch die Wirklichkeit ist, wie wir hier deutlich sehen können« – er deutete auf die Leinwand –, »um ein Vielfaches komplizierter. Beispielsweise vergessen wir, dass wir mit dem Chefbüro auch viel mehr Arbeit aufgebürdet bekommen, oder verdrängen die Angst vor Kratzern und Dellen im schönen neuen Auto – ganz zu schweigen von den monatlichen Raten, die abzustottern sind.«