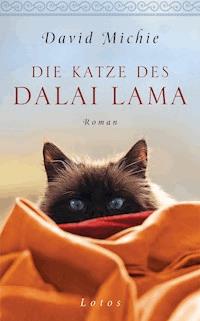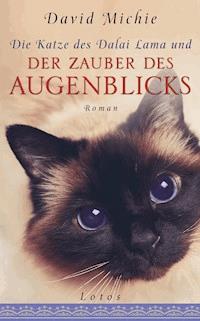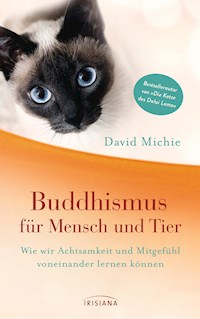14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lotos
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: Romanreihe Katze des Dalai Lama
- Sprache: Deutsch
Auch an der Katze des Dalai Lama geht die Zeit nicht spurlos vorüber – sie wird alt. Doch die in Ehren ergraute »Schneelöwin« ist immer noch genauso neugierig, naseweis und wissensdurstig wie eh und je. Die Frage, die nicht nur unsere Katze bewegt: Ist ein zukünftiges Leben mit Altersschwäche und (Katzen-)Keksen für Senioren zwangsläufig ein Grund zur Verzweiflung? Aber nicht doch! Denn eines ist klar: Die zunächst erschreckende Erkenntnis, dass unser Dasein nun mal endlich ist, ist genau das, was wir manchmal brauchen, um uns das Schöne im Leben bewusst zu machen und wertzuschätzen, was wirklich zählt. Mag die Hüfte auch etwas zwicken und der Gang etwas langsamer werden – »Bodhikatzva« erweckt jeden Tag die Neugier, Energie und unbändige Lebensfreude eines jungen Kätzchens in sich!
Auf leisen Pfoten und mit viel Witz und Weisheit vermittelt die Katze des Dalai Lama buddhistisches Lebenswissen für alle, die zu innerer Gelassenheit und Freude finden wollen – in welchem Alter auch immer.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 332
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Auch an der Katze des Dalai Lama geht die Zeit nicht spurlos vorüber – sie wird alt. Doch die in Ehren ergraute »Schneelöwin« ist immer noch genauso neugierig, naseweis und wissensdurstig wie eh und je. Die Frage, die nicht nur unsere Katze bewegt: Ist ein zukünftiges Leben mit Altersschwäche und (Katzen-)Keksen für Senioren zwangsläufig ein Grund zur Verzweiflung? Aber nicht doch! Denn eines ist ihr klar: Die zunächst erschreckende Erkenntnis, dass unser Dasein nun mal endlich ist, ist genau das, was wir manchmal brauchen, um uns das Schöne im Leben bewusst zu machen und wertzuschätzen, was wirklich zählt. Mag die Hüfte auch etwas zwicken und der Gang etwas langsamer werden – »Bodhikatzva« erweckt jeden Tag die Neugier, Energie und unbändige Lebensfreude eines jungen Kätzchens in sich!
David Michie
Die Katze des Dalai Lama und
DIE WEISHEIT
GRAUER
SCHNURRHAARE
Roman
Aus dem Englischen übersetzt
von Kurt Lang
Die Originalausgabe erschien 2021 unter dem Titel »The Dalai Lama’s Cat: Awaken the Kitten Within« im Verlag Conch Books, an imprint of Mosaic Reputation Management, Ltd.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Lotos Verlag
Lotos ist ein Verlag der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH.
ISBN 978-3-641-29551-6V001
Copyright © 2021 by Mosaic Reputation Management (Pty) Ltd.
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2023 by Lotos Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Annegret Scholz
Alle Rechte sind vorbehalten.
Einbandgestaltung: Guter Punkt, München, unter Verwendung von Motiven von © Borkin Vadim / Shutterstock (Katze); © Sue Campbell Book Design (Hintergrund)
Satz und E-Book Produktion: Satzwerk Huber, Germering
www.ansata-integral-lotos.de
www.facebook.com/Integral.Lotos.Ansata
Widmung
Mit herzlichem Dank an meine geschätzten Gurus:
Les Sheehy, ein außergewöhnlicher Quell der Inspiration und Weisheit;
Geshe Acharya Thubten Loden, unerreichter Meister und Verkörperung des Dharma;
Zasep Tulku Rinpoche, edler Vajra Acharya und Yogi.
Guru ist Buddha, Guru ist Dharma, Guru ist Sangha,
Guru ist die Ursache allen Glücks.
Ich verneige mich vor allen Gurus, suche bei ihnen Zuflucht und bringe ihnen Opfer dar.
Möge durch dieses Buch die Inspiration, die ich von meinen Gurus erhalten habe, Herz und Geist unzähliger Lebewesen erfüllen.
Auf dass alle Geschöpfe Glück und die wahren Ursachen des Glücks erfahren.
Auf dass alle Lebewesen frei von Leid und den wahren Ursachen des Leids sein mögen.
Auf dass alle Geschöpfe Glück ohne Leid erfahren – die große Freude und Befreiung des Nirwana.
Auf dass alle Geschöpfe in Ruhe und Frieden leben können, dass ihr Geist frei sei von Last und Zorn und frei von Gleichgültigkeit.
Der Eul und die Miezekatz gingen zur See
In ihrem nilgrünen Boote.
Geld packten sie weise und Honig zur Reise
In eine Hunderternote.
Edward Lear, Dichter
Das Weltbild jedes Menschen bleibt stets ein Konstrukt seiner Gedanken und der Nachweis, dass es auch jenseits davon existiere, kann nicht geführt werden.
Erwin Schrödinger, Physiker
Prolog
Der Sommer mit seinen Monsunstürmen, dem Nebel und dem endlosen Regen ist für mich die unangenehmste Zeit des Jahres, liebe Leser. Für eine Katze mit einem ausgesprochen saugfähigen Fell, die noch dazu etwas unsicher auf den Beinen ist, stellt es eine durchaus nicht ungefährliche Übung dar, sich bei einem solchen Mistwetter nach draußen zu wagen. Daher bin ich eine Gefangene in meinen eigenen vier Wänden, und mir bleibt nicht viel anderes übrig, als Tag um Tag auf dem Fensterbrett in den Gemächern Seiner Heiligkeit im ersten Stock des Namgyal-Klosters zu sitzen und auf den Innenhof hinunterzublicken. Doch selbst dieser sonst so interessante Anblick hat dann seinen Reiz verloren. Statt Mönchen in dunkelroten Gewändern und staunenden Touristen, die darauf hoffen, dass sich Seine Heiligkeit in ihrer Mitte zeigt, ist nur eintöniges Grau zu sehen. Der Innenhof ist ungefähr so spannend wie ein Unterteller mit den Resten des gestrigen Abendessens.
Deshalb hob ich eines Morgens auch neugieriger als sonst den Kopf, als ich ein vertrautes Klopfen an der Tür hörte. Es war Tenzin, der Berater des Dalai Lama in diplomatischen Angelegenheiten, wie stets im eleganten Anzug. Während er sich mit Seiner Heiligkeit unterhielt, warfen die beiden immer wieder einen Blick auf die Uhr. Mehrere Novizen schlüpften in den Raum, um routiniert die Blumentöpfe abzustauben und die Kissen aufzuschütteln – Vorbereitungen, die immer dann getroffen werden, wenn sich ein Gast angekündigt hat. Mit einem wohligen Beben des Körpers streckte ich zuerst die Vorder- und dann die Hinterbeine. Endlich Besuch, der für etwas Ablenkung sorgen würde!
Doch um wen mochte es sich handeln?
Einer der vielen Vorzüge, die Katze Seiner Heiligkeit zu sein, besteht darin, die zahlreichen Prominenten und Berühmtheiten kennenzulernen, die sich auf den Weg in den Himalaja machen, um in genau diesen Raum hier vorgelassen zu werden. Präsidenten und Popstars, Weise und Wissenschaftler, sie alle stehen irgendwann vor unserer Tür. Offiziell kommen sie aus den verschiedensten Anlässen, doch ihre wahren Beweggründe sind immer gleich, liebe Leser – und wir kennen sie genau, nicht wahr?
Zuallererst einmal wollen sie die Gegenwart des Dalai Lama spüren. Das Segen spendende Energiefeld, das alle erfasst, die sich in seiner Nähe befinden, und die Gewissheit, die er uns so spontan und mühelos vermittelt: dass – egal, wie stürmisch unser Leben oder die Welt um uns herum auch sein mögen – unter der Oberfläche alles gut ist.
Vor ein paar Jahren kam noch ein weiterer Grund hinzu, weshalb unsere erlesenen Gäste alle Hebel in Bewegung setzen, um sich eine Audienz bei Seiner Heiligkeit zu verschaffen. Dieser Grund, liebe Leser, bin selbstverständlich ich. Es mag euch womöglich dreist erscheinen, dass ich dies so freimütig zugebe, aber falsche Bescheidenheit ist eine sehr unschöne Eigenschaft, findet ihr nicht auch? Ich jedenfalls will sie mir nicht zum Vorwurf machen lassen. Unsere Gäste wollen sich mit eigenen Augen davon überzeugen, ob das Gerücht, dass der Dalai Lama »eine Katze hat« (um diese ebenso weitverbreitete wie irreführende Formulierung zu verwenden), der Wahrheit entspricht. Ist die Katze Seiner Heiligkeit – offiziell unter dem Kürzel KSH bekannt – nur eine romantische Legende oder betörende, blauäugige Realität? War dieses undeutliche graue Etwas, das während einer Videokonferenz durchs Bild huschte, etwa die flauschige Schwanzspitze jener sagenumwobenen Kreatur? Oder nur Einbildung, eine Chimäre, eine optische Täuschung unbekannten Ursprungs?
An diesem ausgesprochen trostlosen Morgen jedenfalls erschienen Autoscheinwerfer am Tor des Namgyal-Klosters. Ich spähte in den Nebel, doch abgesehen von einem sich langsam nähernden Fahrzeug war nicht viel zu erkennen. Das Brummen des Motors wurde immer lauter und verstummte schließlich. Nach einem kurzen Augenblick der Stille wurde eine Wagentür geöffnet und wieder zugeschlagen. Einige Minuten später führte Tenzin eine Frau in den Raum.
Wie ihr sicher bereits bemerkt habt, bin ich eine Katze von höchster Diskretion, weshalb ich euch unmöglich die Identität der prominenten Besucherin Seiner Heiligkeit verraten kann. Es sei nur so viel gesagt, dass es sich um eine sehr bekannte Popsängerin handelte, die unter einem Künstlernamen auftritt, der einem Adelstitel gleicht – wie ihn beispielsweise die Gattin eines englischen Lords tragen würde.
Damit aber genug der leisen Andeutungen und versteckten Hinweise – bemerkenswert wäre vielleicht nur noch, dass sie ihre Fans »Little Monsters« nennt. Und dass sie wahrscheinlich ein ziemlich gutes Pokerface machen kann.
Ja, genau die!
Vom Fensterbrett aus beobachtete ich, wie der Dalai Lama und seine Besucherin die Hände vor dem Herzen zusammenlegten und sich zur Begrüßung voreinander verbeugten. Dann setzten sie sich auf zwei gegenüberstehende Sofas mit einem Couchtisch dazwischen. Tenzin schenkte Kaffee ein und stellte ein Tablett mit Keksen bereit, bevor er sich auf einen Sessel am kurzen Ende des Tisches setzte und – wie es erfahrene Diplomaten zu tun pflegen – förmlich mit dem Hintergrund verschmolz.
Vor dem Fenster waberten immer noch dichte Nebelschwaden. Es wurde zusehends dunkler, und schon bald lag auch mein Fensterbrett in tiefem Schatten. Das war mir nur recht, da ich wie die meisten Katzen gerne beobachte, ohne selbst beobachtet zu werden. So konnte ich mir in aller Ruhe ein Bild von unserer Besucherin machen, bevor sie meine Anwesenheit überhaupt bemerkte.
Im Rahmen einer Tagung zum Thema psychische Gesundheit war eine Podiumsdiskussion geplant, an der sowohl unser Gast als auch der Dalai Lama teilnehmen würden. Die heutige Audienz sollte der Vorbereitung dieser Veranstaltung dienen. Auf die Frage Seiner Heiligkeit hin erzählte die Sängerin, dass sie am Anfang ihrer Karriere nur den Erfolg im Sinn gehabt hatte. Erst im Laufe der Zeit hatte sie nach einer Bestimmung gesucht, die über die bloße Unterhaltung des Publikums hinausging: Sie wollte die Herzen der Menschen berühren. Etwas bewirken. Da sie in ihrer Jugend missbraucht worden war, hatte sie es sich zum Ziel gesetzt, anderen mit ähnlich traumatischen Erfahrungen zu helfen. Sie erzählte, dass die Erinnerungen an den Missbrauch so belastend gewesen waren, dass sie ihr noch lange danach körperliche Schmerzen bereitet hatten.
Der Dalai Lama lauschte ihren Ausführungen aufmerksam und voller Mitgefühl. »Der Geist und der Körper sind eins«, sagte er nach einer Weile. »Wer einem schadet, schadet beidem.«
Unser Gast sah ihn erstaunt an. »Es hat sehr lange gedauert, bis ich das begriffen hatte«, sagte sie. »Jahre, in denen ich kurz davor war, den Verstand zu verlieren!«
Seine Heiligkeit beugte sich vor, nahm ihre beiden Hände in seine eigenen und sah ihr tief in den Augen. »Wie haben Sie es geschafft, damit fertigzuwerden?«
Darüber dachte sie eine Weile lang nach. »Mit der Hilfe von Ärzten und Therapeuten. Dabei habe ich viel gelernt.« Es folgte eine weitere Pause. »Das Wichtigste dabei war wohl, dass ich eine Idealversion von mir erfunden habe.«
Der Dalai Lama sprach ihren Künstlernamen laut aus.
»Ganz genau. Ich habe sie mit allen für mich erstrebenswerten Qualitäten ausgestattet und mir dann vorgestellt, sie zu sein. Wenn die Fans ihr zujubelten, jubelten sie der Idealvorstellung meiner selbst zu. Mit der Zeit fiel es mir immer leichter, daran zu glauben, dass ich tatsächlich diejenige wurde, die ich so gerne sein wollte.«
»Also wurde aus Vorstellung Wirklichkeit?«
»Richtig.«
Seine Heiligkeit nickte langsam. »Effektive Psychologie. Die setzen wir im tibetischen Buddhismus auch sehr oft ein.«
»Wirklich?« Die Besucherin schien überrascht.
»Man könnte sogar sagen, dass es sich dabei um eines der Grundprinzipien handelt, die uns Buddha gelehrt hat«, erklärte er. »Der Gedanke findet Ausdruck im Wort. Das Wort führt zur Tat. Und alles fängt hier an.« Der Dalai Lama tippte sich an die Stirn. »Und hier.« Er berührte sein Herz. »Wir werden, was wir denken. In welcher Situation wir uns auch wiederfinden mögen, die Gedanken sind frei. Und am wichtigsten ist: Wir können entscheiden, wie wir über uns selbst denken. Wenn Sie sich dazu entscheiden, so zu leben wie die beste Version von sich selbst, die Sie sich vorstellen können, zeugt das …«, er lächelte, »von großer Weisheit!«
»Vielen Dank!« Selbst aus dem Schatten vor dem Fenster konnte ich erkennen, dass das Kompliment Seiner Heiligkeit unseren Gast hatte erröten lassen. »Das ist natürlich leichter gesagt als getan. Und es gelingt mir nicht immer.«
»Geistige Gewohnheiten zu ändern …« – der Dalai Lama beugte sich vor – »… ist schwierig und manchmal unmöglich. Deshalb« – er zuckte mit den Schultern – »akzeptieren wir uns. Wir akzeptieren uns, aber wir versuchen es weiter.«
»Selbstakzeptanz«, sagte sie.
»Ist sehr wichtig.« Seine Heiligkeit lehnte sich wieder zurück und kicherte. »Wir können unseren Mitmenschen nur bedingt helfen, wenn es uns schlecht geht. Deshalb müssen wir zuerst Mitgefühl mit uns selbst haben.«
Sie nickte mit ernster Miene.
»Und uns wie einen sehr guten Freund behandeln«, fuhr er mit funkelnden Augen fort.
Ausnahmslos alle, die diesen Raum betreten, machen früher oder später die Erfahrung, dass ihnen der Dalai Lama alle Liebe und Güte, die sie in sich tragen, wie einen Spiegel vorhält. In seiner grenzenlosen Gegenwart fühlen sie sich verstanden, geschätzt und bedingungslos akzeptiert. Kann es ein größeres Geschenk geben?
Ich lauschte noch eine Weile der Unterhaltung, dann aber war es höchste Zeit, sich den Ratschlag Seiner Heiligkeit zu Herzen zu nehmen. Ich sprang von meinem Kissen auf dem Fensterbrett, schlich mich unbemerkt um die Möbel herum durch den Raum und sprang schließlich neben der berühmten Popsängerin auf das Sofa.
Der Schreck über meinen plötzlichen Auftritt verwandelte sich sofort in freudiges Entzücken. »Oh, was für eine unglaubliche Schönheit!«, rief sie und streichelte mich. »Also gibt es sie wirklich!«
Ich hob ganz leicht den Kopf, damit sie mein Kinn mit ihren langen Fingernägeln, mit denen die Menschenweibchen zu meiner Freude gelegentlich ausgestattet sind, besser kraulen konnte.
»Ich habe mich schon immer gefragt, ob sie tatsächlich existiert oder ob da nur jemand ein Gerücht in die Welt gesetzt hat.«
»Tja, jetzt wissen Sie es«, sagte Tenzin, der sich aus dem Sessel erhoben hatte, um mich, wie uns gewisse Vorkommnisse in der Vergangenheit gelehrt hatten, beim ersten Anzeichen einer allergischen Reaktion sofort zu entfernen.
Doch die Sängerin fuhr fort, meinen Nacken zu massieren. An einer Katzenallergie schien sie ganz offensichtlich nicht zu leiden. »Sehen heißt glauben«, flüsterte sie.
»Ja, ja, genau«, pflichtete ihr der Dalai Lama bei. »Und umgekehrt ist es genauso. Glauben heißt sehen.«
Unser Gast runzelte die Stirn. »Aber man muss doch zuerst etwas sehen, um es zu glauben, oder nicht?«, fragte sie.
Seine Heiligkeit deutete auf sie und nannte sie ein weiteres Mal bei ihrem Künstlernamen. »Haben Sie sie schon immer vor sich gesehen, oder mussten sie zuerst daran glauben, dass es sie geben könnte?«
»Ach, jetzt verstehe ich.« Sie wedelte spielerisch mit dem Finger. »Erst kommt die Idee, dann die Wirklichkeit.«
»Genau.«
Sie wiederholte die Worte Seiner Heiligkeit: »Wir werden, was wir denken.«
Genug der Streicheleinheiten und des Geplauders, dachte ich, hüpfte auf den Couchtisch und näherte mich meinem eigentlichen Ziel – dem Milchkännchen.
Mir entging nicht, dass zuerst Tenzin und der Dalai Lama und anschließend der Dalai Lama und sein Gast Blicke wechselten. Daraufhin nahm die Popsängerin persönlich das Kännchen in die Hand und goss Milch auf ihren Unterteller. Alle sahen schweigend zu, wie ich mich vorbeugte, um mich mit hörbarem Genuss darüber herzumachen.
»Gewisse Lebewesen sind äußerst bewandert in der Kunst, ihre Vorstellungen Wirklichkeit werden zu lassen«, bemerkte Tenzin.
Alle lachten.
Nachdem sie ein offizielles Foto mit Seiner Heiligkeit und ein inoffizielles Selfie mit der Katze Seiner Heiligkeit gemacht hatte, verließ uns die Popsängerin wieder. Der Dalai Lama sah ihr mit vor dem Herzen zusammengelegten Händen hinterher, dann kam er zu mir herüber, hob mich auf und ging ans Fenster. Von unten waren einmal mehr sich schließende Wagentüren und das Brummen zu hören, mit dem der Motor angelassen wurde.
»Ich weiß, dass du den Monsun nicht magst, weil du nicht nach draußen kannst«, sagte Seine Heiligkeit. »Aber bald ist er vorbei, meine kleine Schneelöwin, und dann folgt die schönste aller Jahreszeiten.«
Ich bin eine Katze mit vielen Namen, doch keiner gefällt mir so gut wie dieser ganz besondere, den sich der Dalai Lama für mich ausgedacht hat. In Tibet gilt der mythische Schneelöwe als tapferes, mutiges und Freude bringendes Wesen.
Der Wagen mit unserem Gast rollte vorsichtig durch den Klosterhof. Die roten Rücklichter wurden vom Nebel verschluckt.
In diesem Augenblick war mir das trostlose Wetter, das mich daran hinderte, das Haus zu verlassen, völlig egal. Wie jedes Mal, wenn mich der Dalai Lama in den Armen hielt, rief die grenzenlose Güte seiner Gegenwart ein tiefes Wohlbehagen in mir hervor. Ich schnurrte dankbar, und es dauerte nicht lange, bis ich jedes Gefühl dafür verloren hatte, wo mein Körper und Geist endete und der Seiner Heiligkeit anfing. Ich spürte nichts außer dem sanften Schein seiner liebenden Güte, der weit über uns hinausreichte – eine Kraft, die allen, die ihre Herzen dafür öffneten, Freude brachte.
Seine Heiligkeit kehrte wieder an den Schreibtisch zurück. Ich setzte mich mit untergeschlagenen Pfoten auf das Fensterbrett. Der Nebel lichtete sich kurzzeitig, und ich sah einen weiteren Besucher, der langsam den Innenhof des Namgyal-Klosters durchquerte – jemanden, der mir in den letzten Monaten zu einem lieben Freund geworden war und der, wie ich ganz sicher wusste, den Dalai Lama noch nie persönlich getroffen hatte. Immer wieder sah er zu uns hinauf. Offenbar hatte er vor, uns einen Besuch abzustatten.
Doch was war die Ursache seines unerwarteten Erscheinens? Und was trug der Pflegehelfer, der ihm folgte, da Sperriges mit sich herum? War es das, was ich dachte?
Erstes Kapitel
Eine Woche zuvor
Für kleine Kätzchen ist die Welt voller Wunder. Eine vom Wind herumgewirbelte Vogelfeder, ein unerwarteter Leckerbissen oder das verführerische Plätschern von Wasser genügen bereits, um uns komplett in ihren Bann zu ziehen. Staunen. Verzauberung. Das völlige Aufgehen im Hier und Jetzt.
Doch je älter wir werden, desto weniger können uns derartige Belanglosigkeiten beeindrucken. Wir werden gleichgültige Alleswisser. Und wenn uns das Leben Wunden zugefügt hat, auf denen sich bereits dickes Narbengewebe befindet, sind wir ganz besonders unempfänglich für die einfachen Freuden des Lebens.
Doch dabei verlieren wir etwas: die Fähigkeit, sich von der Welt um uns herum verzaubern zu lassen. Sich uneingeschränkt und vorbehaltlos dem Augenblick hinzugeben. Alles so zu sehen, als wäre es das erste Mal.
Das wirft einige interessante Fragen auf: Ist es möglich, diesen urwüchsigen Lebenshunger zurückzuerlangen? Sich zu ent-öden? Können wir – ihr und ich, liebe Leser – unsere grauen Haare akzeptieren und das Kätzchen in uns wiederfinden?
Eines eintönigen Morgens, als ich auf dem Aktenschrank im Büro der Assistenten Seiner Heiligkeit döste, erhielt ich unverhofft eine Antwort auf diese Frage. Sie präsentierte sich mir allerdings in Form einer Erfahrung, die so schrecklich war, dass ich einiges darum gegeben hätte, sie nicht machen zu müssen.
Tenzin saß vor seinem Computer und verfasste eine E-Mail an das deutsche Bundeskanzleramt. Er roch leicht nach der Karbolseife, mit der er seine stets makellos manikürten Hände zu waschen pflegte, und trug – ganz formvollendeter Diplomat – Anzug und Krawatte, als hätte er soeben eine Besprechung mit einem Staatsoberhaupt, Außenminister oder einer sonst irgendwie wichtigen Person hinter sich. Was im Zeitalter der Videokonferenzen auch durchaus des Öfteren der Fall war.
Ihm gegenüber saß Oliver, der Übersetzer Seiner Heiligkeit, ein großer, stets fröhlicher Engländer, hinter dessen Brillengläsern außergewöhnlich hellblaue Augen funkelten. Der hochintelligente und herzensgute Oliver war nicht nur buddhistischer Mönch, sondern auch der Sohn eines anglikanischen Pfarrers, weshalb man ihn mit Fug und Recht auch als spirituell mehrsprachig bezeichnen konnte. Mit dem hoffnungslos anglophilen Tenzin teilte er die Liebe zum English Breakfast Tea, dem BBC World Service – und eine ausgeprägte Leidenschaft für Kricket.
Oliver arbeitete an diesem Morgen mit höchster Konzentration an einem Vorwort zu einem neuen Buch über die Bardo-Zustände. Auch Tenzin hatte viel zu tun, weshalb sie nicht wie sonst scherzten und plauderten. Sie hatten noch nicht einmal die Zeit, den jüngsten Sieg des indischen Kricketteams beim Auswärtsspiel im australischen Perth zu analysieren, sondern starrten auf ihre Bildschirme, ließen die Tastaturen klappern, sprachen kaum miteinander und mit mir schon gar nicht.
Gelangweilt von dieser eintönigen, jeder vernunftbegabten Katze völlig unbegreiflichen menschlichen Tätigkeit, muss ich wohl eingenickt sein, denn mit einem Mal war es kurz vor elf. Oliver verließ das Büro und kehrte wenig später mit dem wohl furchterregendsten Gegenstand im ganzen Namgyal-Kloster unter dem Arm zurück: der Katzentransportbox.
Weder wusste ich, wo diese aufbewahrt wurde, noch, weshalb er sie gerade jetzt hervorgeholt hatte – und es war mir auch völlig egal. Allein sie so plötzlich und unerwartet vor mir zu sehen, versetzte mich in Panik. Oliver stellte die Box mit einer schwungvollen, beinahe übermütigen Bewegung auf den Schreibtisch, Tenzin stand gleichzeitig auf und drehte sich zu meiner völlig überrumpelten Wenigkeit um. Seine Karbolfinger packten mich mit erbarmungsloser Effizienz, während Oliver das Türchen der Transportbox aufhielt.
Und schon hatten sie mich in dieses höllische Foltergerät gesteckt.
»Nur die jährliche Routineuntersuchung, KSH«, sagte Oliver. Er beugte sich vor und beäugte mich durch das Gitter meines grausamen Gefängnisses, als wäre ihr heimtückischer Angriff das Normalste von der Welt.
Ich jaulte jämmerlich.
Und ich hörte auch den ganzen Weg bis zu der verhassten Tierarztpraxis nicht damit auf. Doch keiner ist so taub wie die, die nicht hören wollen. Sobald ich in dieser Kammer des Schreckens saß, die sich Sprechzimmer schimpft, öffnete ein mir völlig unbekannter Arzt – seinem Bekunden nach die Vertretung – meinen Mund, zerrte an meinen Augenlidern, drückte auf meinem Bauch herum und ersparte mir auch nicht die größte aller Demütigungen, indem er meinen flauschigen Schwanz hob und ein kaltes Fieberthermometer einführte.
»Die Krallen müssen gestutzt werden«, bemerkte er sachlich und spreizte meine Pfote.
Oliver stimmte ihm geflissentlich zu.
Die Vertretung kürzte systematisch eine Kralle nach der anderen – eine Prozedur, die ich mir in meinen eigenen vier Wänden wohl kaum hätte gefallen lassen, wie Oliver sehr wohl wusste. Doch hier, auf dieser Schlachtbank, war ich hilflos. Der Arzt setzte seine nüchterne Untersuchung fort. »Die Krallen nutzen sich im Alter nicht mehr so stark ab. Ist sie denn weniger umtriebig als früher?«
»Die KSH?« Oliver legte den Kopf schief und dachte nach.
»Wie alt ist sie?«, bohrte die Vertretung nach, ohne Olivers Antwort abzuwarten.
»Mindestens sechs.« Oliver überlegte, wie lange er schon für Seine Heiligkeit arbeitete. »Vielleicht sogar acht?«
Endlich war der Tierarzt mit der verdammten Krallenstutzerei fertig und wandte sich einem Computerbildschirm zu. »Sie wurde in dieser Praxis zum ersten Mal vor zehn Jahren geimpft«, sagte er.
»Zehn Jahre?«, fragte Oliver überrascht.
»Sie wird langsam alt«, sagte die Vertretung. »Und bei älteren Katzen machen oft die Nieren Probleme. Ich würde Katzenkekse für Senioren empfehlen, da sie viel Protein und Vitamin E enthalten, falls Sie ihr nicht schon welche geben. Außerdem sollten Sie darauf achten, dass sie nicht zu viel Phosphat zu sich nimmt, um die Nieren nicht noch weiter zu belasten.«
Ältere Katzen? Senioren? In nur wenigen Minuten war ich von einer mit dem Leben mehr als zufriedenen, weltbekannten Berühmtheit zu einer tattrigen, höchstwahrscheinlich an diversen Zipperlein leidenden Greisin degradiert worden. Was bildete sich dieser sadistische, infame Weißkittel eigentlich ein?
»Ist Ihnen aufgefallen, dass sie mehr Flüssigkeit zu sich nimmt als früher?«, fragte er.
»Eigentlich nicht.«
»Behalten Sie das im Auge. In fortgeschrittenem Alter leiden Katzen oft unter Nierenproblemen. Machen wir vorsichtshalber einen Bluttest.« Bevor ich wusste, wie mir geschah, hatte er mir schon eine Nadel ins Bein gerammt. »Gerade bei alten Tieren sollte man das Blut regelmäßig untersuchen.«
Alten Tieren?
»Was sagt man dazu, KSH? Anscheinend bist du jetzt eine Katze in den besten Jahren.« Offenbar versuchte Oliver, mich aufzumuntern. Der Tierarzt starrte wieder auf seinen Bildschirm. Oliver öffnete die Transportbox, damit ich hineinkriechen konnte. Diesmal ließ ich mich nicht lange bitten.
»Hmmm.« Der Arzt brachte meine Patientenakte auf den neuesten Stand. Während er tippte, tauchte das Licht des Bildschirms sein Gesicht in einen gespenstisch weißen Schimmer. Und da gab er als Antwort auf Olivers Bemerkung einen Satz von sich, der mich noch sehr lange beschäftigen sollte. Er war einfach so dahingesagt, als wäre es nichts Besonderes, doch er erschreckte mich zutiefst. »Wissen Sie, dreizehn Jahre ist für Katzen ein ganz ordentliches Alter. Für ein Tier mit einem solchen Hüftschaden hatte sie schon ein ziemlich langes Leben.«
Ich war so perplex, dass ich von dem weiteren Gespräch und auch von der Rückfahrt zum Namgyal nichts mehr mitbekam. Ich gab keinen einzigen Laut von mir. Oliver dachte wahrscheinlich, dass ich einfach froh war, wieder nach Hause zu kommen. Doch in Wahrheit hatten mich die Worte des Tierarztes zutiefst erschüttert.
Ich musste der Tatsache ins Auge sehen, dass meine besten Jahre auf Erden bereits hinter mir lagen und der Großteil meines Lebens vorüber war. Was konnte ich mir noch erhoffen außer Nierenversagen und Katzenkekse für Senioren? Waren Verfall, Krankheit und Tod mein unausweichliches Schicksal?
Sobald wir zu Hause waren und mich Oliver von dem vermaledeiten Käfig erlöst hatte, stürmte ich außer mir vor Zorn aus dem Kloster. Nebel und Feuchtigkeit waren mir völlig egal – ich wollte einfach nur weg. Fort. Irgendwohin. Ich lief durch den Innenhof und das Klostertor, die Straße hinunter und in eine Richtung, die ich in den letzten Monaten so oft eingeschlagen hatte, dass es mir zur Gewohnheit geworden war.
Neben dem Kloster befand sich ein gut gepflegter Garten. Auf der Rasenfläche in seiner Mitte stand eine große, uralte Zeder mit einer einladenden Sitzbank darunter. Ich hatte viele glückliche Stunden in diesem Garten verbracht – genauer gesagt in der üppigen Katzenminzenstaude, die in einer der Blumenrabatten wuchs.
Doch heute war die Katzenminze, die nach dem Monsun sowieso zu einem traurigen regennassen Haufen geworden war, genauso wenig mein Ziel wie das an den Garten angrenzende Altenheim, in dem ich inzwischen als Therapiekatze bekannt und beliebt war. Nein, ich lief an der Terrasse der Seniorenresidenz vorbei, durch den angrenzenden Küchengarten mit vielen Gemüsesorten und weiter zu einem großen Schuppen, in dem einmal Gartengerät aufbewahrt worden war.
Ich hörte die beruhigenden Klänge von Barockmusik, noch bevor ich den Schuppen erreichte, hielt vor der Tür inne und betrieb etwas Körperpflege, um den antiseptischen Geruch der Tierarztpraxis loszuwerden. Dabei fuhr meine Zunge über die ungewohnt scharfen Kanten der frisch gestutzten Krallen.
Der Mann, der mitten im Schuppen vor einer Staffelei stand, sah zu mir herüber, nahm meine Ankunft zur Kenntnis, ohne sich davon ablenken zu lassen, und wandte sich wieder seinem Gemälde zu. Genau dies war der Ort, an dem ich jetzt sein wollte. Ich betrat den Schuppen, ging zu dem Korbstuhl, auf dem ich für gewöhnlich lag, machte es mir auf dem Kissen darauf bequem und beobachtete den Künstler bei der Arbeit.
Mein erster Besuch vor mehreren Monaten war eine völlig überraschende Erfahrung gewesen – also genau das Richtige für eine so neugierige Katze wie mich. Er hatte wie jetzt vor der Leinwand gestanden, eine Werkbank voller Tuben, Paletten und Pinsel hinter sich, und in kühnen Strichen Farbe aufgetragen. Aus einer alten, farbverschmierten Stereoanlage in der Ecke drang ein Divertimento von Bach.
Ich kannte den hochgewachsenen Mann mit dem weißen Haarschopf und dem schelmischen Funkeln in den großen braunen Augen mittlerweile sehr gut – und er mich. Wir waren beste Freunde geworden. Bei den ersten Malen, als ich den Aufenthaltsraum des Altenheims und die dort vor sich hin dösenden Bewohner besucht hatte, war es Christopher gewesen, der die größten Anstrengungen unternommen hatte, mich zu sich zu locken. Er hatte mich einen »Engel« genannt, weil ich ihn an eine Katze erinnerte, mit der er vor langer Zeit viele Jahre zusammengelebt hatte.
Trotz der Altersflecke auf seiner Haut und der fadenscheinigen Kleidung mit den zerschlissenen Ärmeln war mehr Leben in ihm als in den meisten anderen Heimbewohnern. Eines fand ich an ihm von Anfang an ganz besonders interessant: den merkwürdigen Geruch der hellbunten Farbkleckse auf seiner Cordhose.
Zufällig hatte ich ihn eines Tages auf dem Pfad gesehen, der am Gemüsegarten vorbei zum Schuppen führte, und dabei beobachtet, wie er das Vorhängeschloss zu einem Raum öffnete, der voll Licht und Farbe zu sein schien. Selbstverständlich hatte ich mir das genauer angesehen.
Zu meiner großen Verblüffung fand ich mich in einer wahrhaften Schatzkammer der sensorischen Freuden wieder, die ich nach Herzenslust erkunden durfte – jedenfalls schien Christopher nichts dagegen zu haben. Genau wie heute hatte er auch bei meinem ersten Besuch in seinem Atelier meine Anwesenheit lediglich mit einem Blick in meine Richtung zur Kenntnis genommen und weitergearbeitet. Dass er mich nicht begrüßte, empfand ich nicht als unfreundlich. Er war nicht abweisend, sondern einfach nur auf andere Dinge konzentriert, sodass ich alle Freiheit hatte, jeden Winkel seiner Wirkstätte zu erkunden.
Ich hatte die Gelegenheit beim Schopfe gepackt und mir diesen faszinierenden Ort mit seinen vielen unbekannten Gegenständen und intensiven Gerüchen genau angesehen. Der ehemalige, großzügig dimensionierte Gartenschuppen war mit zusätzlichen Fenstern und einem Oberlicht ausgestattet worden, der Boden mit einem Sisalteppich ausgelegt. Das Mobiliar bestand aus einem unzusammenhängenden Sammelsurium – zwei Korbstühle, ein Stehtisch und eine Küchenzeile mit einem kleinen Kühlschrank und einem Wasserkocher. Christopher hatte bemalte Leinwände und Holzbretter gegen die drei Wände gelehnt, die er beim Malen vor sich hatte – die so entstandenen Tunnel zwischen Gemälden und Wand, in denen eine Katze spurlos verschwinden konnte, gehörten zweifellos zu den interessantesten Aspekten des Ateliers.
Der erdige, sehr spezielle, aber nicht unangenehme Duft von Ölfarbe auf Leinwand gefiel mir. Ich öffnete den Mund, um möglichst viel davon meinem Jacobson-Organ zuzuführen, und stand eine Weile lang mit der Nase knapp vor der Leinwand da. Dann erkundete ich die geheimnisvollen, von winzigen Lichtschlitzen unterbrochenen Tunnel hinter den an den Wänden lehnenden Gemälden, erschnupperte die vielfältigen Gerüche – Farbe, Sisal, Leim, dazu noch eine flüchtige Ahnung von Dünger und Rindenmulch – und kam mir vor wie in Aladins Schatzhöhle. Es war ein Ort der Wunder, in den ich mich ganz und gar versenken konnte.
Als ich geraume Zeit später meine Erkundung beendete, malte Christopher noch immer. Ich sprang auf einen Korbstuhl – der schon bald mein Korbstuhl werden sollte – und beobachtete ihn, da ich noch nie einen Künstler so versunken in seiner Arbeit erlebt hatte. Dabei vollführte Christopher eine Art Tanz, dessen Rhythmus völlig unabhängig von dem Bach-Divertimento im Hintergrund war. Die Energie, die ihn beseelte, vermochte ich nicht zu spüren – doch als ich ihn dabei beobachtete, wie er ganz und gar in seiner Tätigkeit aufging, überkam mich ein bestimmtes Gefühl, er erinnerte mich an jemanden, doch mir wollte nicht einfallen, an wen. Dafür lenkte mich das Künstleratelier mit seinen Farben und seinem Licht und seinen mannigfaltigen Gerüchen viel zu sehr ab.
Christopher hatte das zerschlissene Tweedjackett, das er auch immer im Aufenthaltsraum des Altenheims trug, über den Rücken des anderen Korbstuhls gehängt, und ich sah, dass in einer Tasche ein abgegriffenes Taschenbuch steckte. Dann ließ ich den Blick über die vielen an den Wänden lehnenden Gemälde schweifen. Ein Bild in einem Goldrahmen hatte einen ganz besonderen Platz auf dem einzigen Regal an der weiß getünchten Wand gegenüber. Es war das Porträt einer temperamentvollen, schwarzhaarigen Frau.
Nach einer ganzen Weile trat Christopher plötzlich von der Leinwand zurück und bekam einen Hustenanfall. Als er sich wieder erholt hatte, legte er behutsam den Pinsel auf die Werkbank, drehte sich zu mir um und breitete mit bühnenreifer Gestik die Arme aus:
»Der Eul blickt’ auf zu der Sterne Lauf,
Und er sang und spielte dazu
Auf seiner Laute: O Mieze, du Traute,
Welch liebliches Miezchen bist du!
Bist du –
Bist du –
Welch liebliches Miezchen bist du!
Der Eul und die Miezekatz von Edward Lear, meine liebe Minou!« Er redete wie ein Wasserfall. »Aber das weißt du sicher. Wie sehr ich mir gewünscht habe, dieses Gedicht einmal meiner eigenen Katze vorzutragen. Ein schöner Traum, Frau Mieze. Dachte ich zumindest. Und jetzt bist du wirklich hier. Wie aus heiterem Himmel. Und nicht nur irgendeine Katze, sondern noch dazu ein so wunderschönes Wesen mit überaus hinreißenden saphirblauen Augen.«
Er streckte die Hand aus, um meinen Nacken zu kraulen, wie er es sonst immer im Aufenthaltsraum des Altenheims tat. Ich schnurrte beflissen und versuchte, mir einen Reim auf seine Worte zu machen – insbesondere auf jene rätselhafte ›liebe Minou‹. War das eine Katze, mit der er einmal sein Leben geteilt hatte?
Während sich das Klavierkonzert von Mozart, das wir gerade hörten, dem großen Finale näherte, machte er sich in der Ecke eine Tasse Tee, dann setzte er sich mir gegenüber in den anderen Korbsessel und starrte das Gemälde an, an dem er gerade noch gearbeitet hatte. Nach einem Schluck Tee wandte er sich mir zu.
»Ich bitte um Verzeihung, meine Frau Mieze, aber ich habe so selten Besuch. Wo sind nur meine Manieren?« Er stellte die Tasse ab und erhob sich aus dem Sessel, was ihn einige Mühe kostete und wobei er einmal mehr heftig husten musste. Dann ging er in seine kleine Küchenecke und kehrte mit etwas Milch in einem Marmeladenglasdeckel zurück, den er ehrfürchtig vor mir abstellte. Mit tiefer Faszination sah er mir zu, wie ich den Kopf senkte und den Deckel bis zum letzten Tropfen ausleckte.
»Es sind die einfachen Dinge, die einem die größte Freude machen, nicht wahr?« Seine Augen leuchteten vor Rührung. »Wie zum Beispiel einer Miezekatze einen Schluck Milch anzubieten.« Ein schelmisches Funkeln schlich sich in seine Augen. »Ich hoffe doch sehr, dass das Anreiz genug ist, um mich noch einmal besuchen zu kommen.«
Doch dazu bedurfte es keiner Milch. Das Künstleratelier, in dem ich mich frei und ungehindert bewegen konnte, war Motivation genug, und so wurden aus einer Tasse Tee und einem Schluck Milch schließlich viele und mein Besuch bei ihm willkommene Routine.
Als der Dalai Lama Dharamsala einmal mehrere Wochen lang verlassen musste, um Mönchsprüfungen in Südindien zu beaufsichtigen, verbrachte ich viele glückliche Stunden in dem Korbsessel inmitten dieser faszinierenden neuen Welt aus Ölfarben, Vivaldi, Licht und Raum. Und Christopher, dieser Zauberer des Visuellen, erschuf weite Täler und hohe Berggipfel, üppige arkadische Landschaften und kaskadierende Wasserfälle – jedenfalls behauptete er das. Allein vom Betrachten der fertigen Kunstwerke war dies nämlich nicht unbedingt ersichtlich.
»Abstraktion«, erklärte er mir einmal, »ist nichts für Ignoranten oder Feiglinge. Aber wir sind weder das eine noch das andere, nicht wahr? Die Abstraktion beflügelt uns. Denn was ist die Welt denn anderes als eine Projektion des Geistes – stimmt doch, Madame Babou?«
Inzwischen hatte ich mich an seine drollige, wenn auch rätselhafte Plapperei ebenso gewöhnt wie an die merkwürdigen Kosenamen, mit denen er mich bedachte. Im Gegensatz zu allen anderen mir bekannten Menschen äußerte Christopher eher allgemeine Eindrücke als konkrete Gedanken, was zu einem bunten Durcheinander aus überschwänglichen Sprachbildern und Ideen führte, das dem, was er da so unermüdlich auf die Leinwand bannte, nicht unähnlich war. Wie sollte eine Katze da folgen können?
Das Porträt der Frau dagegen war überhaupt nicht abstrakt. Immer wieder unterbrach er seine Arbeit an der Staffelei, trat vor das gerahmte Bild und starrte es lange an. Dabei legte er den Kopf schief oder trat ein oder zwei Schritte zurück, um sein Werk mit kritischem Auge zu prüfen. Manchmal, aber nur sehr selten, hob er sogar den Pinsel und trug einen winzigen Farbpunkt auf, bevor er sich wieder ein paar Schritte entfernte, um die vorgenommene Änderung zu begutachten.
Wenn wir uns dann in trautem Schweigen zum Tee setzten, griff er in die Tasche des Jacketts über seinem Stuhl und nahm einen Umschlag mit einem handgeschriebenen, mehrere Seiten langen Brief aus der Tasche. Ich sah, wie seine Augen über jede einzelne Zeile flogen, als läse er den Brief zum ersten Mal – obwohl das Papier so abgegriffen war, dass er ihn ganz offensichtlich bereits unzählige Male auseinander- und wieder zusammengefaltet hatte.
Mit größter Vorsicht steckte er das Schreiben wieder in den Umschlag und diesen in die Jacketttasche zurück. Dann lehnte er sich zurück und starrte völlig in Gedanken versunken ins Nichts. Bei einer dieser Gelegenheiten sah ich, wie ihm Tränen in die Augen stiegen. Ich streckte eine Vorderpfote nach ihm aus, und die Bewegung holte ihn ins Hier und Jetzt zurück.
»Oh!« Er beugte sich vor, um meinen Nacken zu kraulen. »Was für ein hübsches Ding du bist, meine allerliebste Ozelotdame. So viele Jahre habe ich die Last des Scheiterns und der Schuld mit mir herumgetragen. Was für eine Verschwendung!« Er wurde von einem weiteren langen Hustenanfall unterbrochen. »Aber schließlich haben wir es doch geschafft, nicht wahr? Vielleicht war es mein Karma, in den Hades hinabzusteigen, doch wie es aussieht, ist meine nächtliche Seereise vorüber. Ich bin am Ende des Weges und habe meinen Frieden gemacht, hier im Himalaja mit meiner ganz eigenen Babou.«
An einem ganz besonderen Morgen, als die Dämmerung die Berge in ein unwiderstehlich klares und vielversprechendes Licht tauchte, verließ ich in aller Frühe meinen Platz am Fensterbrett und begab mich an die frische Luft, um den reinen Duft der Kiefern und Himalajaeichen genießen zu können. Da Seine Heiligkeit noch auf Reisen und die Wohnung leer war, verpasste ich nichts im Namgyal, und so schlug ich aus einer Laune heraus den Weg in Richtung Garten und dann zu Christophers Atelier ein, obwohl ich nicht damit rechnete, ihn zu so früher Stunde dort vorzufinden.
Doch die Schuppentür stand offen, und als ich näher kam, drehte sich Christopher zu mir um. »Oh, Exsultate, jubilate! Meine liebe Miezekatze, spürst du es auch?«
Ich miaute.
»Du bist ein Geschöpf der Natur, selbstverständlich spürst du es! Gerade als ich ein Exemplum unberührter Reinheit und Glückseligkeit gesucht habe, wer erscheint anderes als die Saphirprinzessin höchstselbst? Wir müssen diesen ursprünglichen Morgen so gut wie möglich ausnutzen. Wer weiß, ob sich uns noch einmal eine so seltene Gelegenheit bietet.«
Er stellte eine leere Leinwand auf die Staffelei und drückte Farben – Blautöne, Gelbtöne, Weiß – auf die Palette. Mit schnellen, überschwänglichen Bewegungen fing er an zu arbeiten, verfiel erneut in seinen konzentrierten Tanz, ganz im Augenblick versunken.
Ich beobachtete ihn genau, und da fiel mir endlich ein, an wen er mich schon die ganze Zeit erinnerte. Die Ähnlichkeit war so offensichtlich, dass ich bis jetzt nicht darauf gekommen war. Wenn er malte, hatte das dieselbe Wirkung, wie wenn Seine Heiligkeit meditierte. Die Trennung zwischen Selbst und Anderem, zwischen Subjekt und Objekt war aufgehoben. Nur das Hier und Jetzt zählte, und das war pure Freude.
Selbstverständlich war Christopher ganz anders gestrickt als der Dalai Lama – und über das Innenleben der beiden konnte ich nur spekulieren. Dennoch waren die Parallelen unübersehbar. In beiden Fällen war deutlich eine gewaltige Verbundenheit zu spüren, die über ihre materielle Gestalt hinaus in den Raum um sie herum reichte – und mich, da ich immer ganz in der Nähe saß, ebenfalls erfasste.
An diesem Vormittag schenkte mir Christopher viel mehr Aufmerksamkeit als sonst. Immer wieder sah er zu mir herüber, doch seine Blicke waren anders als sonst. Als wäre ich sein Modell, seine Inspiration, womöglich sogar seine Muse.
Er arbeitete mehrere Stunden lang mit Feuereifer, dann legte er den Pinsel beiseite. In genau demselben Augenblick überkam ihn der heftigste Hustenanfall, den ich bisher miterlebt hatte. Er musste sich an der Werkbank festhalten, während sein Körper vom Hustenkrampf geschüttelt wurde.
Als er sich endlich wieder erholt hatte, war er kreidebleich.
Nach dem mehr als beunruhigenden Tierarztbesuch suchte ich also Schutz und Ruhe in seinem Atelier. Während Christopher völlig in seine Malerei versunken war, saß ich auf dem Korbsessel und lauschte Haydn. Da geschah es wieder – nach einer langen Phase der äußersten Konzentration krümmte sich Christopher plötzlich unter einem schmerzhaften Hustenkrampf zusammen.
Beinahe zeitgleich waren Schritte auf dem Pfad zu hören, der zum Schuppen führte, und eine Frau jenseits der fünfzig mit Jackett und elegant frisiertem dunklem Haar erschien. Es war Marianne Ponter, die Leiterin des Altenheims. Sofort eilte sie an Christophers Seite und half ihm auf einen Stuhl, den er vor Kurzem aus dem Speisesaal hergeschafft hatte.
Sobald sich der Anfall mehr oder weniger gelegt hatte, brachte sie ihm ein Glas Wasser. Er bedankte sich keuchend, und sie legte ihm eine tröstende Hand auf die Schulter.
»Das bringt das Ganze eben so mit sich«, sagte er nach einer Weile.
»Sie halten sich sehr gut«, sagte sie aufmunternd.
Er machte eine ausholende Bewegung mit der Hand, in der er das Wasserglas hielt. »Das habe ich allein dem Atelier hier zu verdanken«, sagte er. »Leider kann ich mich nur mit meiner aus tiefstem Herzen kommenden Dankbarkeit dafür revanchieren. Wie gerne würde ich Ihnen mehr anbieten, aber ich bin völlig abgebrannt. Natürlich bin ich mir der Tatsache, dass ich Ihnen drei Lakh schulde, schmerzlich bewusst …« Er deutete hinter sich.
Auf einem kleinen Regal neben dem Wasserkocher lag ein Stapel brauner Umschläge. Alle zwei Wochen traf ein weiterer ein. Ich hatte mehrmals erlebt, wie ein Assistent von Mr. Naidoo aus der Buchhaltung mit einem solchen Umschlag in der Hand an die Schuppentür geklopft hatte. Christopher hatte ihn eingelassen, woraufhin der Assistent wortlos den Raum durchquert und den Umschlag auf den Stapel gelegt hatte.
Im Gegensatz zu dem Brief in seiner Jackettasche hatte Christopher noch keinen einzigen dieser Umschläge geöffnet. Sie lagen alle unangetastet an derselben Stelle.
»Machen Sie sich deshalb keine Sorgen«, sagte Marianne resolut. »Der Heimvorstand hat sich darauf geeinigt, Sie als Härtefall einzustufen. Sie dürfen bleiben. Das ist beschlossene Sache.«
»Und ich bin Ihnen unglaublich dankbar dafür, dass Sie ein gutes Wort für mich eingelegt haben.« Christopher konnte einen weiteren Hustenanfall nur mit Mühe im Zaum halten. »Ich werde Ihnen sowieso nicht mehr allzu lange zur Last fallen.«
Härtefall? Ich war verwirrt. Nicht mehr allzu lange?