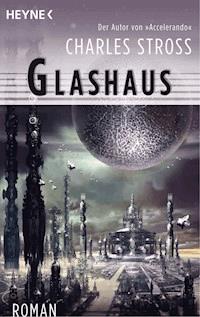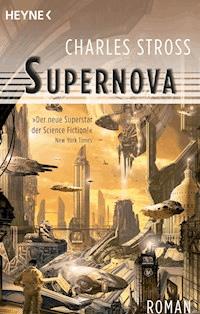Inhaltsverzeichnis
DAS BUCH
DER AUTOR
Lob
ASIMOVS DREI ROBOTERGESETZE
ERSTER TEIL - DAS INNERE SYSTEM
überleben lernen
telemus und lindy
Copyright
DAS BUCH
Freya Nakamachi-47 wurde geschaffen, um als perfekte Konkubine jedes menschliche Bedürfnis zu erfüllen. Doch leider zu spät: Als ihre Produktionslinie auf den Markt kommt, ist die Menschheit bereits ausgestorben und existiert nur noch auf Datenträgern, als abgespeicherte Bewusstseinseinheiten. Maschinenwesen haben an ihrer statt das All kolonisiert und ein Klassensystem entwickelt, das jedem Androiden seinen festen Platz zuschreibt. Ihrer eigentlichen Daseinsberechtigung in diesem System enthoben, nimmt Freya einen Job als Botin an: Sie soll ein geheimnisvolles Paket vom Merkur zum Mars bringen. Doch damit gerät sie in den Fokus mächtigerer Wesen, die nicht nur nach ihrer Fracht, sondern auch nach ihrer Seele trachten …
»Mehr als grandios! Charles Stross’ Romane sind der atemberaubendste Blick in die ferne Zukunft, den ein Schriftsteller in den letzten Jahren gewagt hat.« Vernor Vinge
»Für Autoren wie Charles Stross wurde die Science Fiction erfunden!« Locus Magazine
DER AUTOR
Charles Stross, geboren 1964 im englischen Leeds, studierte Pharmakologie und Computerwissenschaften und arbeitete in vielen unterschiedlichen Berufen, bevor er sich ganz dem Schreiben widmete. Er gilt als einer der bedeutendsten Science-Fiction-Autoren unserer Zeit, seine Romane »Accelerando« und »Glashaus« wurden zu internationalen Bestsellern.
Weitere Informationen zum Autor unter: http://www.antipope.org/charlie/index.html
»Wenn ich weiter sehen konnte, so deshalb, weil ich auf den Schultern von Riesen stand.«
SIR ISAAC NEWTON
Dieser Roman ist zwei Riesen der Science Fiction gewidmet:
ROBERT ANSON HEINLEIN (7. Juli 1907 - 8. Mai 1988)
und
ISAAC ASIMOV
(2. Januar 1920 - 6. April 1992)
ASIMOVS DREI ROBOTERGESETZE
1. Ein Roboter darf kein menschliches Wesen verletzen oder durch Untätigkeit gestatten, dass einem menschlichen Wesen Schaden zugefügt wird.
2. Ein Roboter muss den ihm von einem Menschen gegebenen Befehlen gehorchen - es sei denn, ein solcher Befehl würde mit Regel eins kollidieren.
3. Ein Roboter muss seine Existenz beschützen, solange dieser Schutz nicht mit Regel eins oder zwei kollidiert.
ERSTER TEIL
DAS INNERE SYSTEM
überleben lernen
SO WEIT ICH ES RICHTIG DATIEREN KANN, ist es heute zweihundert Jahre her, dass meine Einzig Wahre Liebe endgültig ausstarb. Ich habe mir mit Batteriesäure einen Rausch angetrunken, mich in meine besten Partyklamotten geworfen und sitze jetzt auf dem Balkon eines Vergnügungspalastes, der in der Stratosphäre der Venus treibt. Meine Füße baumeln über einer glitschigen Regenrinne, während ich über den Rand spähe. Dreißig Kilometer unter meinen Fersen sehe ich die rot glühenden, mit Metall übersäten Gebirgsausläufer von Maxwell Montes. Ich überlege, ob ich springen soll. Zumindest würde ich eine hübsche Leiche abgeben, sage ich mir. Bis ich schmelze.
Und dann …
Ich liebäugele nicht leichtfertig mit dem Selbstmord.
Ich bin alt, zynisch und habe einen Charakterfehler, der darin besteht, dass ich nicht scharf aufs Sterben bin. Selbstverständlich habe ich diesen Fehler mit meinen noch lebenden Geschwistern gemein. Unter uns Schwestern gilt das, was uns Rhea - unsere Kopiervorlage und Matriarchin - überliefert hat, als sakrosankt: Durchlebt jeden Tod in der Schwesternschaft, befahl sie mit eiserner Entschlossenheit, und ich ehre ihr Andenken. Jedes Mal, wenn eine von uns stirbt, bergen wir ihren Seelenchip und lassen ihn in unserem Kreis, dem ständig schrumpfenden Kreis trauernder Schwestern, kursieren. Das Ende einer Schwester mitzuerleben und nachzuvollziehen tut zwar weh, ist aber nötig. Wenn regelmäßig andere stellvertretend für einen selbst den Tod erleiden, bleibt man wachsam. Man lernt dabei mühelos, die Anzeichen dafür zu deuten, dass einem jemand nach dem Leben trachtet.
(Letzteres ist ein bisschen zu stark formuliert. Schließlich sind wir so nett und gefallsüchtig, dass nur wenige uns gegenüber Mordlust verspüren, es sei denn, wir befinden uns in einer depressiven Phase. Sehen Sie mir das bitte nach.)
Allerdings fällt uns allen das Weitermachen von Tag zu Tag schwerer. Wir sind so alt, dass wichtige Jahrestage durchaus einen verhängnisvollen Reiz auf uns ausüben. Geburtstage bringen unangenehme Erinnerungen mit sich, und wenn die besten Tage bereits gekommen und gegangen sind, warum dann noch am Leben hängen? In meiner Sippe ist diese Betriebsstörung weit verbreitet: Erst werden wir nostalgisch, dann versinken wir im Gefühl völliger Sinnlosigkeit, und schließlich beschäftigen wir uns zwanghaft mit dem Tod. In der letzten Seelenqual unserer Schwestern, kurz vor ihrem Ableben, erkennen wir Zuschauerinnen zu unserem Entsetzen einen Teil dessen wieder, was am Ende auf uns alle zukommt. Durchlebt jeden Tod in der Schwesternschaft - es ist schon eine bittere Ironie des Schicksals, dass Rhea, das Original, dessen Kopien wir alle darstellen, eine der Ersten war, die uns diese schreckliche Last aufbürdete.
Und so gebe ich heute meine sorgfältig gehorteten Ersparnisse dafür aus, mich an den Rand eines Balkons oberhalb eines Kasinos zu hocken, in dem sich gut gelaunte Spieler drängen. Denn heute ist, soweit ich das behaupten darf, mein hundertneununddreißigster Geburtstag. Genau einundsechzig Jahre, nachdem eine grausame Laune des Schicksals die Existenz eines Wesens meiner Art für alle Zeiten völlig sinnlos machte, erlebte ich meine Wiedergeburt und erwachte im realeren Sinne als beim ersten Mal zum Leben.
Der rötlich glühende Boden weit unter mir bildet einen Kontrapunkt zu den aufwallenden Wolken über meinem Kopf. Während ich hinunterblicke, sinniere ich über den ewigen Tod und versuche mir einzureden, dass diese Endgültigkeit immer noch eine erschreckende Vorstellung ist.
Die Situation könnte ja noch schlimmer sein als jetzt, sage ich mir. Ich bin nicht mehr elf; ich habe die freie Wahl.
Und dann …
Eine Lachsalve und ein Schwall kühler Luft, die durch eine offene Tür dringen, sowie das schwache Vibrieren des Fußbodens unter schweren Schritten verraten mir, dass ich hier draußen nicht mehr allein bin, und das nervt mich. Den größten Teil dieses Arbeitsjahres habe ich still und zurückgezogen verbracht. Und ausgerechnet jetzt, da ich mit meinen Erinnerungen und den Wolken allein sein will, bekomme ich plötzlich Gesellschaft.
»Oh, seht mal: ein Monster!«, schreit jemand in meinem Rücken zu mir herauf. »Was macht dieses Ding denn hier?«
Am besten gar nicht beachten. Ich will deren einprogrammierte Verhaltensmuster ja nicht noch verstärken. Trotzdem spanne ich mich an, und meine Kampf- und Fluchtreflexe setzen ein. Widerwärtige kleine Rüpel. Ich kenne solche Typen, genau wie meine Schwestern. Wir wissen, wie man mit ihnen umgehen muss.
»Muss eine Arbeitssklavin sein. Macht die etwa blau?«
Langsam blicke ich mich um und sorge dafür, dass die Chromatophoren in meinem Gesicht den blassesten milchweißen Ton annehmen, so dass meine Miene völlig ausdruckslos wirkt und keine Emotionen verrät. »Ich bin keine Zwangsverpflichtete«, bemerke ich äußerst kühl. Und das ist, was diesen Ort und diese Zeit betrifft, keineswegs gelogen. Eine weitere von Rhea festgelegte Regel lautet: Lasst nie zu, dass eine eurer Schwestern zur Arbeitssklavin gemacht wird. Diese Regel wurde in einer früheren Epoche aufgestellt, und es hat uns viel gekostet, sie zu befolgen, aber bis heute ist keine von uns mit dem Kontrollchip eines Sklavenhalters ausgestattet. »Ich bin eine unabhängige Frau«, setze ich nach.
Es sind drei, die sich zwischen mir und der Tür zur Spielhalle befinden: eine Bishojo-Frau, etwa so groß wie ich, und ein zusammenpassendes Paar von Zwergen - einer weiblich, der andere männlich -, das nach Chibi-Art übergroße Köpfe aufweist. Sie alle gehören zu der neuen Aristokratie und stellen, aufgeputzt in der aufwendigen Tracht, die in diesem Jahrhundert bei den Aristos Mode ist, Karikaturen unserer ausgestorbenen Schöpfer dar. Die beiden Zwerge, die stehen, während ich sitze, reichen mir nur bis zur Nase. Ohne jeden Funken Mitgefühl glotzen sie mich mit riesigen leeren Augen an, während ihre voll ausgewachsene Gebieterin auf mich herunterblickt und höhnisch bemerkt: »Dem können wir leicht abhelfen. Was für eine ekelhafte Parodie! Wer hat das Ding hier hereingelassen?« Ich halte sie für die Anführerin, denn ihr Gewand, das vor allem aus gerüschten und von Draht verstärkten Spitzen besteht und von Schleifen zusammengehalten wird, ist viel raffinierter als die Kleidung ihrer Gefährten. Sie hat ein zartes Kinn, stark ausgeprägte Wangenknochen, spitz zulaufende Ohren und eine atemberaubende Mähne aus federweichen grünlichen Strähnen.
Die Zwergin schlägt sich die Hand, die in einem Spitzenhandschuh steckt, vor den Mund und gähnt theatralisch: »Sie verstellt uns die Aussicht, Domina.«
Domina? Das kann nichts Gutes heißen. Die Instinkte, die ich aufgrund der Erfahrungen meiner toten Schwestern so mühsam erworben habe, verraten mir, dass ich schlimmer in der Klemme stecke, als mir bislang klar war. In mir blitzt die Erinnerung einer Schwester auf, die vor langer Zeit in einem Hutong unter der Kuppel von Lunograd ermordet wurde. Sie hat Recht: Auf die Aufmerksamkeit fieser, vom Spielen gelangweilter Aristos, die nach stärkeren Kicks Ausschau halten, kann ich gut und gern verzichten. »Ich wollte sowieso gerade gehen«, erkläre ich gelassen und setze einen Fuß auf den Boden, um aufzustehen.
»Danke, mein Kind«, sagt die Domina zu ihrer Gefährtin, »aber ich hatte das Hindernis bereits bemerkt.« Mit einem Fuß stoße ich mich vom Rand ab und stütze mich gleichzeitig auf eine Hand, um mich aufzurichten. Ich wende mich bereits der Glastür zu, als die Domina mit einem verächtlichen Schnauben auf ihren männlichen Gefährten hinunterblickt und ihm befiehlt: »Kümmere dich um diesen Abschaum, Stone!«
Stone - in seiner schwarzen Tunika mit den goldenen Applikationen wirkt er wie eine den Tod darstellende Babypuppe - geht auf mich zu und legt dabei eine Hand auf die Elektrokeule an seinem Gürtel. Sein Kopf reicht mir bis an die Hüften. »Ist mir ein Vergnügen, meine Dame.«
»Ich gehe jetzt«, sage ich. Mein Kampf-/Flucht-Modul veranlasst mich, so zu tun, als marschierte ich auf die Glastür zu, während ich mich plötzlich ducke und zur Seite abrolle. Ich rolle immer noch, als ein Hammerschlag auf die lackierten Aragonit-Intarsien der Balkoneinfassung niederfährt und abgespaltene Stücke herumfliegen. An den Stellen, wo jetzt das Fundament der Schmuckornamente freiliegt, beginnt es zu zischen und zu dampfen.
»Graah!«, brüllt der Zwerg und hebt erneut die Keule.
Ich befinde mich näher am Abgrund, als mir lieb sein kann, und der Angreifer blockiert mir den Zugang zur Glastür. Am besten wäre es jetzt, am Rande des Balkons entlangzuhuschen, durch eine andere Glastür in die Spielhalle zu sausen und mich zu verdünnisieren. Aber ich bin neben der Spur, denn ich koche vor Wut und fühle mich durch die beiläufig dahergesagte, brutale Anweisung der Domina gedemütigt, deswegen tue ich nichts dergleichen, sondern etwas wirklich Dummes: Während ich mit einem Fuß über dem Abgrund hänge, fasse ich mit der freien Hand nach dem Arm des Zwergs.
»Hoppla!« Ich greife daneben und erwische versehentlich den Kopf des Gnoms, der mich daraufhin zurück an den Balkonrand drängt. Seine Füße sind so fest im Boden verankert, als wären sie dort angeklebt, aber ich bin doppelt so groß wie er und mindestens fünfmal so schwer. Als er erneut den Elektroschocker hebt, gerate ich in Panik, packe seine Schulter und stoße ihn mit aller Kraft weg, um so viel Abstand wie möglich zwischen uns zu bringen. Nur vergesse ich dabei, ihn loszulassen.
Der Kopf, den ich immer noch im Schwitzkasten habe, löst sich vom Körper. Sofort erschlafft der Rest und schlägt scheppernd auf dem Boden auf. Zugleich sickert aus dem Halsstumpf eine blasse Flüssigkeit, die den Rumpf versiegeln und vor weiteren Schäden schützen soll. Immer noch summt und surrt die Elektrokeule. Sobald sie mich berührt, bin ich dem Tode geweiht, deshalb schlage ich einen großen Bogen um sie herum, während ich der Domina den Zwergkopf hinstrecke und sie wütend anfunkle.
»Das wird dir noch leidtun«, sagt der Kopf und benutzt dazu die Elektrosprache, da ihm der Kehlkopf fehlt.
»Da hat er Recht«, bestätigt die Domina und grinst mich unverschämt an. Offenbar amüsiert sie sich gut. »Stone, solltest du wissen, ist ziemlich rachsüchtig. Du musst schon weit weglaufen, Gliederpüppchen, um dich zu verstecken. Und dann kannst du nur hoffen, dass er dich nicht findet.«
»Wird er mich auch verfolgen, wenn ich ihn fallen lasse?«, frage ich und strecke den Kopf über den Abgrund. Dabei trete ich vorsichtig einen Schritt vom glitschigen Rand des Balkons zurück und taste mit meiner mit Stacheln gespickten linken Ferse nach einem sicheren Halt.
»Das wirst du nicht tun«, sinniert die Domina. »Er ist sehr beliebt und hat mehr als zweitausend Geschwister, die dir und den deinen allesamt Rache schwören werden.« Sie lacht leise. »Das wäre doch lustig, oder?« Ihre Gefährtin - das Echo ihrer Gebieterin - kichert komplizenhaft. »Also los, lass ihn fallen, Püppchen. Vielleicht lasse ich dir eine Kopflänge Vorsprung.«
Ich drehe Stones Kopf so, dass sie sein Gesicht sehen kann, und untersuche die Rückseite seines Halsstumpfs. Wie erwartet sitzt dort ein Seelenchip - der Engel, der sich all seine Missetaten merkt. Mit zwei Fingernägeln ziehe ich den Chip aus der Fassung und halte ihn dem Zwergenkopf vor die Augen. Seine Lippen bewegen sich noch: gut. »Schau mal.« Ich schnippe den Chip in die aufgewühlte, von Wolken vernebelte Atmosphäre jenseits unserer schwebenden Insel. »Verabschiede dich von deinem Backup, Stone.« Selbst wenn er sich mit einem neuen Chip ausstattet, wird es einige Zeit dauern, bis er neue Erinnerungen aufgezeichnet hat. Und Monate, bis ältere Erfahrungen im Chip abgespeichert werden - wie die an dieses Geschehen. Bis dahin wird er seine Erlebnisse nicht an seine Geschwister weitergeben können. Vorsichtig lasse ich seinen Kopf auf den Balkonboden gleiten. »Falls du mich verfolgst und ich dich nochmals töte, hast du’s dir nur selbst zuzuschreiben.«
Ich trete den Rückzug an und stoße zu meiner Rechten auf eine andere Glastür.
»Ich krieg dich schon!«, formuliert sein Mund lautlos, während ich die Flucht antrete.
Das hier ist kein Ort für meinesgleichen. Ich bin keine Spielerin, und die hier angebotenen Vergnügungen sind auch nicht für solche wie mich gedacht. Ich bin ein Artefakt aus einer früheren Epoche, zur falschen Zeit am falschen Ort, auf mich gestellt und völlig isoliert. Voller Angst und Wut mache ich mich auf die Suche nach dem Sauerstoff produzierenden Zentrum des Palastes. Schließlich finde ich eine für das Personal vorgesehene Luftschleuse, die so groß ist, dass ich sie betreten kann. Auf dem Weg hindurch dusche ich mit flüssigem Wasser, spüle meine Partyklamotten mit dem Schaumstrom fort und sorge dafür, dass die glitzernden langen Fingernägel und die Stacheln an den Fersen sich einziehen und meine Brustwarzen und Schamhaare wieder ihr normales Aussehen annehmen. Mein langes rotes Haar und das Gesicht behalte ich bei, denn auf manche Aspekte der Identität verzichtet man nur ungern, wie hoch der Preis dafür auch sein mag. Am anderen Ende der Luftschleuse erwartet mich der Drucker, der zweckdienliche Kleidung für mich herstellen kann - Kleidung, die zu meinem niedrigen Status als freischaffender Arbeiterin passt. Als ich der Domina sagte, ich sei eine unabhängige Frau, war das zwar nicht gelogen, aber auch nicht die ganze Wahrheit. Meine Sippe und meine Schwestern genießen Unabhängigkeit, doch aufgrund dieses Status sind wir auch arm - eine der großen Ironien des Schicksals.
Zwar habe ich im Augenblick keine feste Arbeit, kann aber Gelegenheitsjobs annehmen, wenn ich möchte. Die Lebenshaltungskosten hier erschöpfen meine Reserven, aber das ist immer noch besser, als in einem Slum unter einer Kuppel zu stranden und das eigene Nervensystem gegen Honorar einer Analyseeinrichtung für CO2-Sequestrierungen zur Verfügung zu stellen. Eigentlich sollte ich nach einem Job als Rikschakuli Ausschau halten, aber ich bin von dem Zusammenstoß mit der Domina und ihrem Schlägertyp immer noch genervt. Also mache ich mich auf den Weg zu den Kellergeschossen unterhalb des geschützten Milieus, um Victor zu suchen.
Victor ist ein Jazzpiano, ein Xenomorph, der in schwierigen Zeiten gelandet ist - ein Saiteninstrument mit Herz, das mit einem Kopf und Armen ausgestattet ist und aus einer Epoche stammt, in der Originalität gefragt war. Heutzutage sind solche Veredelungen nicht mehr in Mode; sie entsprechen nicht dem Geschmack der kultivierten Elite. Eine falsche Melodie kann als Kritik aufgefasst werden. Und Aristos geraten schnell in Wut und sind noch schneller bereit, ihre Ehre zu verteidigen. Deshalb ist Victor in der Tagschicht mit der Wartung der Atmosphäre beschäftigt und veranstaltet nachts einen Ohrenschmaus in den Wartungsschächten, wobei er seinen Standort häufig wechselt. Solche Orte haben wir schon immer gehabt, schon in der Zeit, als die Wesen, denen meine einzig wahre Liebe gilt, noch auf der alten Erde umherwanderten. Und wir, die wir die Erinnerung an sie hochhalten, bewahren solche Traditionen. (Wir trinken sogar mit Wasser verdünnte Ethanollösungen, wenn auch nicht aus denselben Gründen.)
Ich entdecke Victors derzeitigen Standort in einer großen Dampfabzugshaube unterhalb einer dicken Absaugröhre, die Sulfate aus der inneren Atmosphäre der Sauerstoff erzeugenden Zone herausleitet. Er hat die Wände mit Industrieruß ausgekleidet, sie mit einer ganzen Batterie farbiger Lampen ausgestattet und den Fußboden feste Schaumpolster erzeugen lassen, so dass der Raum in Nischen mit weichem Bodenbelag aufgeteilt ist. In der Kneipe ist heute Abend nicht viel los. Milton, der gelegentlich für Victor kellnert und sein Komplize bei Verstößen gegen die öffentliche Ordnung ist, ist gerade dabei, die Theke der Bar mit affektiertem Gehabe zu polieren. »Wo ist der Boss?«, frage ich, während ich neben ihm stehen bleibe.
»Der Boss ist dahinten, Twinkle-Tits«, sagt Milton, der Stimmenimitator, in bewusst schnarrendem und abgehacktem Ton. »Was darf ich dir bringen?«
»Einen Liter Spezial. Aber lass das Polyethylenglukol weg.« Viele echte Trinker mögen einen Schuss davon in ihrem Gebräu, aber für meinen Geschmack macht es den Drink zu süß.
»Du entscheidest, womit du dich vergiftest.« Milt zuckt eine seiner zahlreichen Schultern und serviert mir einen Literkrug. »Macht fünf Centimes.«
Ich unterzeichne die Rechnung und nehme den Krug mit zum Boss, der in einer gemütlichen Nische an der Wand sitzt und, umgeben von einem dankbaren Publikum aus unterbeschäftigten Staubsaugern, in die Tasten haut. »Hast du einen Moment Zeit, Vic?« Ich nehme ihm gegenüber Platz.
Er nickt und spielt weiter, ohne den Rhythmus zu verändern. Die Staubsauger sind wie hypnotisiert: Sie biegen die Beine durch und schwanken von einer Seite zur anderen. Manche von ihnen stecken in einheitlichen glänzenden Gehäusen, aber die meisten dieser unbedeutenden Gebäudereiniger sind so nackt wie an dem Tag, als sie serienweise produziert und mit Chips versehen wurden. Es sind schwarze Saugröhren mit zahlreichen Beinen und mit Köpfen, die kaum mehr als ausgefranste Schläuche darstellen, und in jedem Kopf sitzen oben zwei winzige Knopfaugen. »Hab dich heute Abend gar nicht erwartet«, bemerkt Vic. »Dachte, du würdest mit den Chibi-Sans eine rauschende Party feiern. Hast du Lust auf eine Jamsession?«
»Schon, aber nicht jetzt, Vic.« Ich halte einen Augenblick den Mund, um auf meine inneren Stimmen zu lauschen. »Ich glaube, ich muss weg. Weg aus der Stadt.«
»Aha. Warte kurz.« Er beendet sein Spiel mit einer virtuosen Schlusssequenz. Die Gebäudereiniger warten noch ein paar Sekunden, bis der letzte Ton verklungen ist, und springen gleich darauf begeistert auf. »Zehn Minuten Pause«, verkündet Vic. »Ihr seid ein großartiges Publikum, aber ich muss erst wieder auftanken.« Nachdem er Milton ein Zeichen gegeben hat, dringt die Aufzeichnung einer früheren Jamsession durch die hinter der Theke verborgenen Lautsprecher. Es dauert nicht lange, bis wir unter vier Augen miteinander reden können, denn das Reinigungspersonal saugt jeden Anreiz der Außenwelt sofort auf.
»Ist die Sache ernst?«, fragt er. »Wie weit willst du denn weg?«
Ich wäge die Möglichkeiten ab. »Wahrscheinlich muss ich diesen Planeten verlassen.« Meine Schwestern halten sich fast alle auf der Erde auf. Gut möglich, dass ich die Einzige meiner Art auf der Venus bin. »Bin einem Aristo auf die Zehen getreten.«
»Auf die Zehen getreten? Wie das?« Vics Körpersprache signalisiert Verblüffung: Er schlägt eine aufsteigende Folge von Akkorden an.
»War zur falschen Zeit am falschen Ort.« Ich nehme einen großen Schluck aus meinem Krug. Das Spezial schmeckt stark nach Teeröl und hat einen Beigeschmack von Schwefel und Zuckersaft. Wie meine Zunge mir verrät, wäre mir das scharfe, zähe Gebräu bestimmt zuwider, hätte ich mein olfaktorisches System nicht auf die Normen eingestellt, die auf Venus herrschen. »Hm, das schmeckt.« Auch in den Spielsalons da oben werden Erfrischungen angeboten, raffinierte Mixturen für wohlhabende Gourmets, aber dieses Gebräu ist mir auf beruhigende Weise vertraut.
»Klingt gar nicht gut«, bemerkt er gelassen. »Hast du das Geld für’ne Reise zu einem anderen Planeten?«
Ich nehme noch einen großen Schluck. »Das ist ja gerade das Problem. Das Leben hier war teurer, als ich dachte. Und ich will meine Schwestern nur im äußersten Notfall anpumpen. Zwar habe ich ein bisschen was gespart, aber so lange, wie das gedauert hat, würde ich sicher noch sechs Jahre brauchen, bis ich ein Zwischendeck zur Luna zahlen kann.« Dazu benötige ich mindestens zweihundert Real - es kostet einiges, der Gravitationssenke der Venus zu entfliehen. »Ich hatte gehofft, dass du vielleicht jemanden kennst, der mir weiterhelfen kann.«
»Möglich.« Er schlägt wieder eine kurze Folge von Akkorden an. »Kannst du für ein paar Stunden irgendwo abtauchen?«
Ich leere den Krug und spüre die Schwere in meinem Verdauungstrakt. »Wie lange wirst du brauchen?«
»Sagen wir, drei Stunden. Ich muss Nachforschungen anstellen.« Er nimmt meinen leeren Krug und streckt ihn über die Theke, wo er in Miltons dritter Hand landet. »Wirst mir fehlen, Mädchen.«
Ich zucke die Achseln. »Immer noch besser, ich bin weg von Venus als ganz weg vom Fenster.«
»Allerdings. Vamos!«
»Vamos.«
Es ist nicht einfach, in einer Stadt unterzutauchen, in der man doppelt so groß ist wie fast alle anderen, aber ich habe viel Übung darin. Wenn an jedem beliebigen Ort Zwerge mit großen Köpfen und riesigen dunklen Augen auf einen deuten und Monster schreien, lernt man das schnell, besonders in den Randbezirken, in denen es keine Polizei gibt. Das hier ist keine große Stadt, doch wie alle Städte, die in der Stratosphäre der Venus treiben, verfügt sie über eine Infrastruktur mit Räumen, in denen man sich verbergen kann - etwa mit Sauerstoff ausgestattete Aufzugskabinen oder die von Stützträgern durchzogenen Geschosse unterhalb des Bodenniveaus. Und mit solchen Schlupfwinkeln kenne ich mich mittlerweile aus. Also mache ich mich von Victors Salon aus auf den Weg zur untersten Etage der sauerstoffhaltigen Zone, justiere meinen Metabolismus, durchquere eine Luftschleuse und betrete die riesigen nebligen Räume des Stützrahmens unterhalb dieser schwebenden Welt.
In meinen Freistunden komme ich oft hierher. Meistens bringe ich mein Notebook mit, erledige meine Mails, schaue mir Filme an, surfe durch Wikis und Videoclips und versuche zu vergessen, dass ich die Einzige meiner Art auf dieser Welt bin.
Ich mache es mir in einem meiner liebsten Schlupfwinkel gemütlich - einer Nische zwischen der Aufzugskabine Nummer vier und der transparenten Außenhülle, ausgestattet mit ausgepolsterten Ballons, auf denen man sich ausruhen kann. Von hier aus habe ich sogar Ausblick auf die Wolkenlandschaft unter mir.
Als sich mein Notebook meldet, lehne ich mich in die Membran zurück, benutze sie als Kissen und konzentriere mich auf die Mitteilung. Sie kommt von Emma, einer meiner eher ausgeflippten Schwestern. Mir wird bewusst, dass ich schon eine Weile nichts mehr von ihr gehört habe. Ich sehe im Speicher nach: schon seit mehr als sechshundert Erdtagen nicht, um genau zu sein. Was seltsam ist, denn normalerweise tauschen wir etwa alle fünfzig Tage Nachrichten aus.
Ich rufe das letzte Update ihres Porträts auf: Sie ist ein honigblondes Modell mit einer langen, dichten Haarmähne, symmetrischen hohen Wangenknochen, braunen Augen, der leichten Andeutung einer Mongolenfalte und einer schwach metallisch schimmernden Haut - als Schönheitsideal genauso perfekt und veraltet wie wir alle. Doch auf diesem Bild wirkt sie leicht besorgt; es spiegelt Emotionen wider, die sie auch in ihrer Mitteilung angedeutet hat. »Freya? Ich hoffe, es geht dir gut. Kannst du dich bei mir melden? Ich habe ein Problem und könnte deine Hilfe und deinen Rat brauchen. Tschüss.«
Ich lasse das Bild die Botschaft wiederholen und werde immer weniger daraus schlau. Nach all der Zeit nur sechsundzwanzig Wörter? Ich bin drauf und dran, ihr genau das in meiner Antwort zu sagen, doch dann überprüfe ich den Router und sehe, dass sie die Mail über die zentrale Poststelle von Highport auf Eris an mich abgeschickt hat. Sofort legt sich mein Ärger, denn somit ist plausibel, dass sie sich kurz fassen muss. Allerdings gibt mir ihr Aufenthaltsort Rätsel auf. Was macht sie da draußen? Eris liegt weit außerhalb unseres Systems, ist fast doppelt so weit entfernt wie Pluto. Acht Lichtstunden! Das ist für eine von uns eine weite Reise. Normalerweise wagen wir uns nicht ins tiefe Dunkel hinaus; dort gibt es auch nichts, was für uns von Interesse wäre. Emma, ich und ein paar andere stellen mit unserer Bereitschaft, von einem Planeten zum anderen zu reisen, solange wir an irgendeinem zivilisierten Ort ankommen, die große Ausnahme dar. Keine Sippe ist wie die andere, und Rheas Kopien neigen dazu, von der Vorlage schneller und weiter abzuweichen als üblich. (Das passiert, wenn die Spezifikationen überholt sind und das Original, die Matriarchin, nicht mehr existiert.) Doch bei uns allen ist die Schwäche für Zentren der Zivilisation ausgeprägt.
Als ich das letzte Mal von Emma hörte, befand sie sich auf Kallisto, arbeitete als Reiseführerin und begleitete Skitouren durchs vereiste Hinterland. Eigentlich sollte es mich nicht weiter überraschen, dass sie in einer der Verbotenen Städte gelandet ist, und die ausgedehnte Übertragungszeit könnte ihr langes Schweigen erklären. Und trotzdem …
»Emma, ich gehe bald von hier fort. Was kann ich für dich tun?« Ich halte die Rückmeldung kurz, übermittle sie dem Postamt und bemühe mich, nicht zusammenzuzucken, als ich höre, wie teuer die Übertragung ist. Irgendwann wird mich Emmas Antwort erreichen, aber es ist eine kostspielige Sache, diese Kommunikation aufrechtzuerhalten. Einen Augenblick überlege ich, ob ich Emma persönlich aufsuchen soll, aber das ist ein lächerliches Hirngespinst: Die Energiekosten wären astronomisch hoch, mal abgesehen von der langen Flugzeit. Zehntausende von Real, wenn ich die billigste, langsamste Passage in einer Sardinenbüchse buche, und vermutlich Millionen, falls ich so rechtzeitig da sein will, dass ich ihr noch helfen kann.
Nachdem ich Emma geantwortet habe, versuche ich mich auf meinem Ballonbett zu entspannen, aber ich bin zu beunruhigt, um es mir gemütlich zu machen. Niemand außer Emma liebt mich so sehr, dass er oder sie sich bei mir meldet. Und die Drohung der Domina liegt mir immer noch auf der Seele. Wie ekelhaft, Opfer einer Aristokratin zu werden, die sich schlichtweg langweilt. Ich muss hier weg. Selbst wenn ich mich dazu als Arbeitssklavin verdingen muss? Vielleicht ist es tatsächlich so dringend. Als ich auf Venus ankam, dachte ich, ich könnte hier einen Neuanfang machen, doch das ist mir nicht gelungen. Hohlköpfig und einsam, wie ich war, habe ich mich einfach von einem aussichtslosen Job zum nächsten treiben lassen. Habe ich wirklich neun Erdjahre damit verplempert? Ich muss verrückt gewesen sein! Hier gibt es nichts, das einen weiteren Aufenthalt lohnt. Zeit zum Aufbruch.
Ganz unten, in der Nähe der schlecht beleuchteten engen Unterkünfte, in denen die Arbeitssklaven in sechsstöckigen Etagenbetten nächtigen, habe ich ein eigenes Zimmer. Nichts Besonders, aber wenigstens ist es mit elementarem Komfort ausgestattet: mit Strom, einem aufblasbaren Bett, einem Drucker, einem Werkzeugkasten, einem Schrank. Es ist ein Ort, wo ich immerhin schlafen und träumen kann, wenn ich Letzteres nach Möglichkeit auch vermeide, denn ich neige zu wiederkehrenden Albträumen. Die Miete kostet mich einen Riesenbrocken meiner Einkünfte, und ich beschränke mich auf ein Minimum an Mobiliar, denn die Materiesteuer ist wahnsinnig hoch. Außerdem habe ich festgestellt, dass es billiger ist, öffentliche Versorgungseinrichtungen zu nutzen, als mich selbst mit irgendwelchen Annehmlichkeiten auszustatten. Trotz allem ist dieses Zimmer noch am ehesten das, was ich als Zuhause bezeichnen kann. Es gibt nicht viel, was ich von hier mitnehmen möchte - bis auf den Seelenfriedhof, den ich im Zimmer aufbewahre. Ohne den gehe ich nirgendwohin.
Ich bahne mir den Weg durch schwankende Fabriktunnel, die quer durch die windgepeitschte Leere führen, klettere über Leitern, Stromschienen und nach unten führende Gleise. Hier ist es schmutzig und heiß, denn im Vergleich zu den großen Ballsälen und Spielsalons wird die Atmosphäre in diesen Räumen nur schlecht kontrolliert. Es hält sich ja sowieso nur das Wartungspersonal darin auf, das diesen schwebenden Vergnügungspalast für die Aristos in ihren hochherrschaftlichen Kabinen auf den Promenadendecks hegt und pflegt. Hier wohnen die kleinen Würstchen, die sowieso nichts zu melden haben - ein Deck oberhalb der Unterkünfte der Zwangsarbeiter, die von den Chips der Sklavenhalter kontrolliert werden.
Mein Zimmer ist einer der ehemaligen Frachtcontainer, die irgendwelche längst vergessenen Bauarbeiter zusammengeschweißt und in Apartments umgewandelt haben. Manche dieser Apartments sind höchstens handtuchgroß, während andere aus mehreren zusammengelegten Containern bestehen. Wenn die Stadt ihre Turbinenantriebe anwirft, um turbulenten Wolkenformationen auszuweichen, schwanken sie leicht. Die Aristos des Lenkungsausschusses bezeichnen uns als »Ballast« und reißen plumpe Witze darüber, dass sie diesen Ballast abwerfen werden, falls die Stadt in einen starken Sturm gerät.
Während ich die Leiter zu meiner Eingangstür hinuntersteige, höre ich ein leises, scharrendes Geräusch, so als krabbelten Gliederfüßler aus Kunststoff über Metallboden. Sofort bin ich auf der Hut und spanne mich innerlich an. Das Geräusch kommt aus meinem Zimmer! Ist einer von Stones Geschwistern mir bereits auf den Fersen? Ich wende den Kopf hin und her, lausche und versuche das Geräusch zu identifizieren. Irgendetwas bewegt sich da drinnen, irgendetwas Kleines krabbelt dort herum, das viel zu viele Beine hat. Das kann nicht Stone sein. Hastig und so leise wie möglich steige ich weiter hinunter und halte mich auf dem engen Mauervorsprung neben der Tür bereit. Die Tür ist mit einem mechanischen Vorhängeschloss gesichert, das ich selbst dort angebracht habe, und irgendjemand hat, wie könnte es anders sein, den Bügel durchgefräst. Das Schloss baumelt lose vom Türriegel herunter und ist mit weißen Pulverflocken überzogen. Immer noch bewegt sich der Einbrecher in meinem Zimmer; offenbar rechnet er nicht damit, ertappt zu werden. Ich lausche kurz: Als mein »Besucher« sich nahe beim Drucker an irgendetwas zu schaffen macht, reiße ich die Tür auf und stürme hinein.
Der Raum ist ein einziges Chaos: Das Bettzeug ist aufgeschlitzt, der Drucker umgestoßen, so dass Betriebsflüssigkeit heraussickert, die vorher im Schrank verstaute Kleidung überall verstreut. Und mittendrin hockt der Übeltäter. So etwas wie dieses Ding habe ich noch nie gesehen: Es hat sechs dünne Ärmchen, einen mit borstigem Fell überzogenen Rumpf, der mir bis ans Knie reicht, und drei große Fotorezeptoren rings um komplexe Fresswerkzeuge. Und es umklammert meinen Seelenfriedhof, hat den Deckel des Kästchens aufgeklappt und lässt seinen Atem über die Seelenchips meiner toten Schwestern streichen. »He, du da!«, schreie ich das Ding an.
Der Einbrecher wirft den Kopf zu mir herum, springt auf die Füße und erzeugt mit gesträubtem Fell auf Mikrowellenlänge eine Explosion von Zufallsgeräuschen. Meinen Seelenfriedhof fest an sich gedrückt, saust er mir zwischen die Beine. Hastig setze ich mich hin, greife nach ihm und drücke ihn zu Boden. Er hat den Umfang eines mittelgroßen Hundes - jener Kreaturen, die sich meine Erzeuger als Gefährten hielten, ehe sie uns schufen. Und die ganze Zeit über schreit er so, als hätte er Angst, ich würde ihn umbringen. Was ich vielleicht auch tun werde, falls er meinen Seelenfriedhof beschädigt hat.
»Lass das sofort los!«, brülle ich ihn an. »Auf der Stelle!« Als ich mit den Fingerspitzen sein Fell berühre, beginnen sie zu kribbeln und Funken zu sprühen. Hat er keine Ohren? Er sieht so bizarr aus, dass er durchaus ein Bewohner des Vakuums sein könnte.
Nachdem sich das Ding kurz gekrümmt hat, erschlafft es unter meiner Hand. Ich schnappe mir den Seelenfriedhof und verstaue ihn hastig hinter mir. »Wer bist du, und was machst du hier?«, frage ich scharf.
Doch das Ding antwortet nicht, rührt sich nicht einmal mehr. Zwischen meinen Fingerspitzen steigt dünner, ätzend riechender Rauch auf. »Oh je«, murmle ich. Hab ich das Ding kaputt gemacht? Ich löse die Hand von seinem Rücken und starre es an. Das raue Fell sieht so aus, als wäre es aus groben Federn gemacht. Als ich es näher untersuche, entdecke ich zweipolige rekursive Funktionen. Also handelt es sich tatsächlich um einen Vakuumbewohner, dazu noch um einen lauten. Das Ding verfügt nicht über Lungen, aber über eine kompakte Gasflasche und ein Netzwerk zur Einspeisung von Energie. All das verrät mir, dass es sich für einen kurzen Ausflug in die Gravitationssenke ausgerüstet hat. Das ist einfach zu bizarr! Ich greife nach dem Seelenfriedhof und inspiziere ihn gründlich: Offenbar ist er nicht beschädigt, aber ich kann es nicht mit Sicherheit sagen, sonst müsste ich ja jetzt all seine Bewohner, einen Seelenchip nach dem anderen, herunterladen. Später, beschließe ich und verstaue das Kästchen in meiner abgewetzten Schultertasche. »Wehe, du hast was kaputt gemacht!«, warne ich den außer Gefecht gesetzten Einbrecher. Plötzlich packt mich die Rachelust, und ich gebe dem schlaffen Körper einen so heftigen Fußtritt, dass er quer durchs Zimmer segelt. Als er auf die gegenüberliegende Wand prallt, erwacht er unerwartet wieder zum Leben, schickt ohrenbetäubend laute Mikrowellen aus, faltet Arme und Beine zusammen und richtet den Impuls direkt auf mein Gesicht.
»Verdammte Scheiße!« Ich ducke mich, als das Ding auf einer Welle streng verbotener Gase an meinem Kopf vorbeizischt und durch die offene Tür saust. Offenbar dient die Gasflasche nicht der Atmung, sondern anderen Zwecken. Zur Sicherheit wirble ich herum, aber das Ding macht keine Anstalten, ins Zimmer zurückzukehren. Stattdessen … Ist da ein Riss in der Wand gegenüber? Oh je! Ja, tatsächlich. Der kleine Einbrecher hat soeben ein Loch in die Außenhülle der Stadt gerissen. Das wird das Überwachungspersonal keineswegs freuen. Ich hau wohl besser ab.
Ich nehme nur die Schultertasche mit, in der sich die Seelenchips all meiner toten Schwestern befinden, steige die Treppe hinunter und mache mich auf den Weg zu Victor, um herauszufinden, was er für mich deichseln konnte.
telemus und lindy
IN DER KNEIPE IST KAUM MEHR LOS als bei meinem Aufbruch, aber es sitzt ein Unbekannter bei Victor. Milton deutet mit dem Kinn hinüber.
»Ah, Freya«, begrüßt mich Vic. »Ich möchte dir Ichiban vorstellen.«
Ichiban - japanisch für Nummer eins, wie ich weiß - wendet mir tellergroße blaue Porzellanaugen zu und neigt andeutungsweise den Kopf. Ein Instinkt sagt mir Aristo!, so dass ich fast zurückfahre, doch dann wird mir klar, dass ich mich geirrt habe. Er will zwar aussehen wie ein Aristo, ist aber keiner, nie im Leben! »Freut mich sehr, Sie kennenzulernen«, sage ich und erwidere seine leichte Verbeugung. Während wir alberne Höflichkeiten miteinander austauschen, versuche ich, mir ein genaueres Bild von ihm zu machen.
»Ichiban hat ein kleines Problem«, erklärt Victor. »Vielleicht kannst du ihm dabei helfen, es zu lösen. Es schließt eine Reise mit ein.«
»Ich helfe gern, soweit ich kann«, erwidere ich vorsichtig.
»Gut.« Ichiban nickt nachdenklich. »Sie sind sehr groß.« Er mustert mich von Kopf bis Fuß. Stimmt: Ich bin fast einen Meter siebzig groß. Tatsächlich bin ich eine idealisierte Reproduktion der Spezies, der unsere Schöpfer angehörten, ganz anders als die schrecklich deformierten Winzlinge, deren Phänotyp in der Klasse der neuen Reichen heutzutage am weitesten verbreitet ist. »Gut ausgeprägte thermische Stabilität«, setzt Ichiban unerwartet nach. »Und Sie wurden für die Erde geschaffen, vor der Emanzipation.«
Gut ausgeprägte thermische Stabilität? Ich lächle, denn meine biomimetischen Reflexe setzen ein. Meine Wangen erröten zart und signalisieren leichte Verlegenheit oder Verwirrung. Emanzipation? Von was redet der da? »Ich fürchte, ich kann nicht ganz folgen«, sage ich.
»Meine Auftraggeber verfügen über ein Objekt, das aus dem inneren System zum Mars befördert werden muss«, erklärt Ichiban und wartet vorsichtig ab.
Warum erzählt er mir das? Reisen ist nicht meine starke Seite: Es ist zu kostspielig für Angehörige meiner Sippe; ein solches Vergnügen können wir uns nur selten gönnen. Bei verdoppelten Maßen verachtfacht sich der Umfang - und somit auch der Preis, der bei Reisen durch den Raum für Masse und Energie zu zahlen ist. Vor allem deswegen ist das Sonnensystem eine Spielwiese für Chibi-Zwerge statt normal ausgewachsene Personen. Ich bin doppelt so groß wie fast alle anderen, und genau das ist der Hauptgrund dafür, dass ich hier festsitze. Ich verberge meine Enttäuschung hinter einer Miene höflicher Aufmerksamkeit.
»Das Objekt wird gegenwärtig auf Merkur fertiggestellt und muss in etwa achtzig Tagen weiterbefördert werden. Unser Problem ist, dass dieses Objekt ein störungsanfälliges Forschungsergebnis von beträchtlichem Wert darstellt. Es muss überwacht und in einer stoßgeschützten Umgebung aufbewahrt werden, bei gleichbleibender Temperatur, gleichbleibendem Druck und gleichbleibender Sauerstoffzufuhr.« Immer noch starrt er mich an. »Ich glaube, andere Ihres Typs haben gelegentlich schon als Begleiterinnen oder Kuriere gearbeitet, stimmt’s?«
Woher weiß er das?, frage ich mich leicht verdutzt. »Ja, mein Archetyp wurde tatsächlich als Begleitdame geschaffen«, erwidere ich vorsichtig. Begleitdame für wen oder was? - Das lasse ich für alle Fälle unausgesprochen. Bestimmte Vorurteile sind nur schwer aus der Welt zu schaffen.
»Als Begleitdame für Organismen rein biologischer Art«, ergänzt Ichiban und nickt liebenswürdig. »Replikatoren aus Pink Goo.«
Ich versuche meine Bestürzung zu überspielen. »Was genau ist dieses Objekt, dieses Forschungsergebnis?«
»Das kann ich Ihnen nicht sagen.« Immer noch lächelt Ichiban leicht. »Da es sich um ein vertrauliches Geschäft handelt, hat man mir die Einzelheiten vorenthalten. Allerdings bin ich befugt, Ihre Reise nach Cinnabar sofort zu bezahlen, falls Sie damit einverstanden sind, sich mit meinen Kollegen zu treffen, und diesen Arbeitseinsatz ernsthaft in Betracht ziehen.« Gleich darauf streckt er warnend den Zeigefinger hoch. »Allerdings sind Sie nicht die einzige Auftragnehmerin, die wir ansprechen. Da es sich um eine recht delikate Angelegenheit handelt - unsere Konkurrenten würden dieses Projekt liebend gern zu Fall bringen -, kann ich nicht garantieren, dass man Sie auswählen wird. Doch soweit ich weiß, brauchen Sie in jedem Fall ein Ticket zu einer anderen Welt, deshalb hoffe ich, dass wir einander von Nutzen sein können.«
Die wollen also, dass ich eine biologische Probe für sie befördere? Einen lebenden Organismus?
Vor Bestürzung falle ich fast vom Stuhl. »Ich … Es wäre mir ein Vergnügen«, stottere ich mechanisch. »Aber … Reise ich in einer Sardinenbüchse?«
Ichibans Lächeln schwindet. »Es wird uns eine ganze Stange Geld kosten, Ihre großen Gliedmaßen in den Orbit zu verfrachten«, bemerkt er in warnendem Ton. Was bedeuten soll: Reiz dein Glück nicht aus!
Also nicke ich und schicke mich ins Unabänderliche. Es war wohl auch vermessen, auf eine Luxuskabine zu hoffen, in der ich mich frei bewegen könnte. »Wann soll ich los?«
Ichiban sieht Victor an. »Sofort. Sie können gleich mit mir mitkommen.« Und damit ist das Vorstellungsgespräch beendet.
Ichiban hetzt mich durch eine finstere Seitengasse, von deren Existenz ich gar nichts wusste, und einen steilen Fußgängerweg neben einer Straße hinauf, wo eine Rikscha wartet. Die Rikschakulis sind zwei Ponyjungs, die mich mit leerem Blick anstarren, während ich einsteige. Die Rikscha ächzt unter meinem Gewicht, doch das scheint Ichiban nichts auszumachen. »Beeilt euch«, befiehlt er den Ponyjungs, und sie traben mit hochgereckten Schwänzen los.
Mir fällt auf, dass uns zwei kleine Ornithopter folgen. »Gehören die zu Ihnen?«, frage ich.
Ichiban sieht mich ausdruckslos an. »Das lassen Sie ruhig meine Sorge sein.« Er lehnt sich zurück und schließt die Augen. Einige Sekunden später beginnt einer der Vogelbots zu schwelen und schwenkt hektisch von seinem Kurs ab. Der andere schlägt vorsichtig einen Bogen um uns.
Wir biegen in eine Seitenpassage ab und fahren vor einem geräumigen Anlegehafen vor, wo eine winzige Barkasse wartet. Sie ist am anderen Ende der Luftschleuse unter einem halb aufgeblähten Gasballon vertäut. »Was ist denn das?«, frage ich.
»Am besten, wir bringen Sie so schnell wie möglich aus der Stadt heraus. Steigen Sie ein.« Ichiban deutet auf die Barkasse. »Das Ding ist mit Antrieben und Treibstoff ausgerüstet. Machen Sie sich’s gemütlich. Es wird eine Weile Ihr Zuhause sein.«
Skeptisch mustere ich das Ding. Unterhalb eines zylindrischen Energie- und Treibstoffadapters befindet sich ein mit Verstrebungen verstärkter, mit Gurten gesicherter, flauschig ausgepolsterter Kokon, der recht behaglich wirkt. Vermutlich bin ich dreimal so schwer wie das ganze Ding. »Und Sie erwarten, dass ich das für die ganze Strecke zum Merkur benutze?«
»Ja.« Er lächelt milde. »Ihre Aufzugkabine wird in etwas mehr als einer Stunde bereit sein.«
»Meine …« Ich habe ein Bein schon halb in den Kokon gesteckt, halte jedoch mitten in der Bewegung inne. »Sie haben für mich eine Fahrt mit dem Raumaufzug gebucht?« Ob ich will oder nicht, es kommt wie ein Jammern heraus.
»Selbstverständlich.« Zur Abwechslung ist es jetzt Ichiban, der verblüfft wirkt. »Was haben Sie denn gedacht? Wie wollen Sie denn sonst noch heute in den Orbit gelangen?«
Vorsichtig nehme ich Platz und lasse mein anderes Bein in den Kokon gleiten. Nach und nach begreife ich. Locker bleiben!, drängen mich meine Erinnerungen, und ich gebe klein bei. Mein Gas austauschendes System ist zu gut konstruiert, um aufzuwallen. Gehörte ich der Spezies meiner Einzig Wahren Liebe an, hätte ich jetzt bestimmt feuchte Hände und Herzrasen. Ich weiß nicht, was ich erwartet habe: vielleicht einen gemütlichen Flug zu einer der Äquatorialstationen und danach einen Platz an Bord einer planmäßig startenden Raumfähre. Doch wir befinden uns nahe beim nördlichen Polarplateau, und das würde einen großen Umweg bedeuten. Ichibans Geldgeber haben sich Zeit auf einem orbitalen Windrad erkauft, das schon jetzt seinen tausend Kilometer langen Arm ausstreckt und in Position bringt, um in die Stratosphäre hinabzutauchen und mich wie eine im Wind treibende Blüte zu packen. Ich lege mich hin und lasse mich vom Kokon einhüllen. Das muss sie Tausende kosten. Mehr als eine Kabine in der Aristo-Klasse. »Und wie kann ich mich verständlich machen, wenn ich …«
»Ihr Kokon wird Ihnen alles sagen, was Sie wissen müssen«, erwidert Ichiban und wendet sich ab. Die glitzernden Tattoos auf seinen Schultern und Armen zwinkern mir zu, als er sich entfernt.
»Hallo!«, quietscht der Kokon atemlos vor Aufregung. »Ich bin Lindy! Vielen Dank, dass du dich für eine Reise mit meinen Eignern Astradyne Tours entschieden hast. Wie heißt du?«
Quellcode bewahre mich, die klingt ja wirklich einsatzfreudig. Das fehlt mir gerade noch. »Ich heiße Freya. Bist du …«
»Hallo, Freya! Ich bin das Raumschiff, das dir heute zu Diensten ist! Hast du’s bequem? Fühlst du dich angespannt? Ich weiß, wie man das behebt. Darf ich dir eine Massage anbieten? Ich hoffe, du nimmst es mir nicht übel, aber ich habe bemerkt, dass du ein klassisches Design hast! Hast du irgendwelche Hohlräume? Oh! Eine Lunge zum Gasaustausch! Die packe ich wohl besser gut ein! Ich muss ein paar Sonden installieren, aber keine Bange, ich sorge schon dafür, dass du’s als angenehm empfinden wirst …«
Lindy plappert pausenlos vor sich hin, während die Sonden sich vortasten, in meine Körperöffnungen eindringen und gleich darauf vorne und hinten, oben und unten bis zu meinen Intimzonen vorstoßen. Es ist nicht das Eindringen der Sonden, das mir zu schaffen macht - Lindy geht wirklich behutsam vor, die Sonden sind gut geschmiert, und ich empfinde die Penetration nach so langer Zeit ohne Intimkontakte tatsächlich als angenehm -, sondern Lindys Persönlichkeit. Es ist so, als würde man von einem Schlafsack belästigt, der ständig in Comic-Blasen spricht - wobei jedes »i« Herzchen statt Punkte trägt.
»Oh, du hast ja wirklich einen Riesendarm! Führt der irgendwohin? Ist lange her, dass ich in so was drin war. Jetzt schließe ich nur noch deine Sichtgeräte an, und dann wirst du dich in mir richtig behaglich fühlen. Na, wie ist das?!«
Ein kurzer Ruck, und ich kann wieder nach draußen blicken. Lindy hat meine Augen, Ohren und Output-Leitungen mit ihrem Sensorium verbunden. Jetzt sehe ich, dass ich, eingehüllt in Lindys weiße Röhre, auf der Tragfläche liege, während sie glitschigen Packschaum in all meine Innenräume quetscht. Nur gut, dass ich nicht klaustrophobisch veranlagt bin. Ich lehne mich zurück und starre zur Unterseite des Ballons hinauf. Dabei frage ich mich, was wohl die Spezies meiner Einzig Wahren Liebe von diesem Transportmittel gehalten hätte. Vermutlich wären die meisten bei diesem Gefühl anonymer Vergewaltigung schreiend davongerannt, aber einige wenige … »Wann starten wir?«, frage ich und versuche, die in mir aufwallende Wärme zu ignorieren.
»Jeden Moment!«, erwidert Lindy fröhlich und kneift liebevoll in meine Brustwarzen. »Entspann dich und erlaub mir, dir den Flug so angenehm wie möglich zu machen, ja?!«
Während der Ballon von der Tragfläche aufsteigt, erschauert mein ganzer Körper. Der Kokon schenkt gewissen Einzelheiten meiner Anatomie viel mehr Aufmerksamkeit als von der Sache her unbedingt nötig. Und es ist lange her, dass irgendjemand diese Art Interesse an mir gezeigt hat. »Lindy, verwöhnst du all deine Passagiere mit Sex?«, frage ich.
»Nur diejenigen, die dafür ausgerüstet sind«, zwitschert sie und bewegt sich in mir auf und ab. »Es hilft ihnen, die Zeit herumzubringen. Oh, wie ich sehe, fahren wir mit Telemus! Das wird Spaß machen! Ich mag ihn! Er ist wirklich süß!« Ich seufze, allerdings unhörbar, denn mein Mund ist wegen des weichen Knebels, der meine Lippen und die Kehle offen hält, weit aufgerissen. Das Kribbeln in meinem Körper wird immer stärker und verlangt nach Befriedigung. Dagegen kann ich nichts tun: Manche Reflexe sind bei meiner Sippe so tief verankert, dass man sie nicht bewusst kontrollieren kann. Und es ist wirklich sehr lange her, allzu lange, dass mich jemand sexuell befriedigt hat. Da tut es sogar ein nicht sonderlich intelligenter Schlafsack, der zwischen Planet und Orbit pendelt. Ich winde mich, versuche es zumindest, denn Lindy nagelt mich regelrecht. Gerade will ich sie bitten, sich bei ihrem Dienst am Kunden ein wenig zurückzuhalten, da rammelt sie wieder. »Oh! Oh ja! Ja! Oh!«
Oberflächlich betrachtet ähneln wir zwar den Frauen aus der Spezies unserer Schöpfer, doch in mancher Hinsicht ist unsere Sippe auch völlig anders, insbesondere, was die sexuellen Reflexe betrifft. Von unserer Grundeinstellung her empfinden wir Lust, wenn wir anderen Lust spenden. (Es sei denn, wir sind von unserer Prägung her exklusiv auf unsere Einzig Wahre Liebe fixiert.) Diese Konditionierung ist mittels einer leichten Modifikation unserer grundlegenden neuronalen Strukturen sehr tief in uns verankert und wird durch etwas ergänzt, das man als »erweiterten Reflex der vomeronasalen Programmschleife« bezeichnet. Anders ausgedrückt: Wir können Pheromone besonders gut riechen und sind daher sehr empfänglich für sexuelle Lockstoffe. Ohne diese reflexartige Erregung könnte ich niemals den Zweck erfüllen, zu dem ich erschaffen wurde. Allerdings hat das manchmal nervende Nebenwirkungen. Und so verliere ich mich fast drei Minuten lang in einem längst überfälligen Orgasmus und brauche eine weitere Stunde, bis ich mich davon erholt habe.
(Was vermutlich gar nicht so schlecht ist, denn wenn ich jetzt über meine missliche Lage nachgrübeln würde, wäre ich bestimmt einer Panik nahe: Hilflos und wie ein Schlachtschwein verschnürt, liege ich im Kokon einer Barkasse, die durch die schwefelsäurehaltigen Wolken rund um die Venus treibt. Nur ein seifenblasendünner Gasballon trennt mich von den rot glühenden Gebirgsausläufern da unten, während ich darauf warte, von einer tausend Kilometer langen Seilbahn mit roher Gewalt in den niedrigen Orbit gezerrt zu werden. Hinzu kommt, dass eine böse Aristokratin mir übel will und Fremde bei mir eingebrochen sind - und all das in den letzten sechs Stunden! Die bevorstehende Fahrt mit dem Aufzug gibt mir den Rest. Doch Lindy weiß genau, wie sie nervöse Passagiere ablenken kann. Bestimmt war es Teil von Ichibans Plan, eine wie Lindy damit zu beauftragen, mich ruhig zu stellen.)
Es ist nicht das erste Mal, dass ich einen Raumaufzug benutze: Auf diese Weise kann man die Erde am einfachsten verlassen. Aber der Aufbruch von der Erde war völlig anders. Damals befand ich mich bereits im künstlichen Tiefschlaf, war Teil eines großen Handelstransports und raste mit Überschallgeschwindigkeit in einer Kapsel hoch, bis wir andockten. Dagegen ist das hier eine Solonummer auf einer riesigen Schöpfkelle mit einem tausend Kilometer langen Stiel, deren oberes Ende sich gegenläufig zu ihrer Umlaufbahn dreht - wobei die Kelle sich so weit nach unten senkt, bis sie sich nur noch fünfzig Kilometer oberhalb des mittleren Bodenniveaus befindet, um mich danach mit einer halben Drehung hinaufzuzerren und der orbitalen Beschleunigung auszusetzen. Was bedeutet, dass ich einen Druck von mehreren zehn g aushalten muss. (Einer der Gründe dafür, dass Lindy mich so lückenlos ausgestopft hat. Ich werde das Polster brauchen.) »Was passiert, wenn wir in die Umlaufbahn eintreten?«, frage ich sie und versuche, nicht weiter über den Aufstieg nachzudenken.
»Wen interessiert’s?«, erwidert sie geistesabwesend. »Telemus ist ein ganz Wilder! Bin schon ewig nicht mehr mit ihm gefahren!« Hätte sie mich nicht so sorgfältig geknebelt, würde ich jetzt mit den Zähnen knirschen. »Na ja, meine Kopiervorlage schon, aber für mich ist das alles so neu! Das ist mein erster Flug! Oh, ich bin ja so aufgeregt!« Sie erschauert leicht; ich kann spüren, wie ein Beben den Kokon erschüttert.
»Es geht um meine Abflugzeit«, erinnere ich sie vorsichtig. »Mich interessiert sie jedenfalls.«
»Wir schaffen dich schon hin!« Sie kichert kurz. »Telemus wird uns so rechtzeitig absetzen, dass wir die High Wire noch erreichen. Er bringt uns die volle Strecke hinauf. Das wird ein Spaß!«
»Und du bleibst die ganze Zeit dabei?«, frage ich und versuche, mein Entsetzen zu überspielen.
»Ja! Sobald wir an Bord der High Wire sind, trete ich in mein zweites Nymphenstadium ein, damit du’s gemütlich hast und ich dich vor all dieser grässlichen Strahlung und den Mikrometeoriten beschützen kann!«, erwidert sie lächelnd und projiziert ein Schaubild ihrer zweiten Verkörperung: Es ist ein Gebilde mit stummelartigen Solarschwingen, einem Wärmetauscher und einem verspiegelten Sonnensegel. Dieses reizende Ensemble baumelt vom Galgen des großen Raumschiffs High Wire oder irgendeines Schwesternschiffs herunter. »Wir werden viel Zeit haben, einander kennenzulernen! Juhu!«
Ich suche immer noch nach einer angemessen scharfen Erwiderung, als ich einen Blick auf Telemus’ Arm erhasche, der in der erzfarbenen Himmelskuppel eine weiße Spur hinterlässt und auf uns zukommt. Und jetzt würde ich es mir am liebsten doch noch anders überlegen - aber dazu ist es bereits zu spät.
Offensichtlich freut Lindy sich schon seit Ewigkeiten auf Sex mit Telemus, vielleicht schon ihr ganzes Leben lang, und er erwidert ihre Gefühle. Trotz des gewaltigen Beschleunigungsdrucks ficken sie heftig und schnell, wobei sein andockender Hectocotylus fest in ihrem Anschlussring einrastet. Um mich von dieser Darbietung nicht noch fesseln zu lassen, stelle ich die Kommunikation sofort auf einen Modus, bei dem ich das Stöhnen der beiden und den markerschütternden Austausch von Zärtlichkeiten ausblenden kann. Einsam und allein, von Schleim eingehüllt und von der Zentripetalbeschleunigung niedergedrückt, liege ich in Lindys glitschigem Bauchraum, während Telemus uns in den Orbit befördert. Dabei bleibt mir viel Zeit für düstere Gedanken. Es macht mir ja nichts aus, dass mein Reisekokon ein geiles Luder ist, aber wenn ich mich auf der ganzen Strecke nicht vernünftig unterhalten kann, werde ich durchdrehen, ehe wir ankommen. Vor der Abfahrt hätte ich den Seelenfriedhof einstöpseln sollen. Zumindest hätten mich die Geister meiner verstorbenen Schwestern vor dem Ausrasten bewahrt. Aber jetzt ist es zu spät dafür. Und Lindy will ich nicht bitten, den Seelenfriedhof bei mir einzustöpseln. Manche Dinge sind dazu einfach zu persönlich.
Schließlich ebben Dröhnen und Druck ab, und ich verbinde mich wieder mit dem offenen Kommunikationskanal. Ich bekomme gerade noch mit, wie Lindy sich tränenreich von ihrem Liebhaber verabschiedet. Als ich die Augen öffne, kann ich Telemus in all seiner Pracht sehen. Während sich seine Tentakelspitze in die Versorgungskapsel zurückzieht, bleibt er hinter uns zurück und steuert auf die unter uns liegenden perlmuttfarbenen Wolkengipfel zu. »Auf Wiedersehen!«, ruft Lindy. »Ich liebe dich!«
»Bis zur nächsten Begegnung mit deinem Typ«, grummelt Telemus. Während wir über ihm emporsteigen und davonschweben, verhallt seine Stimme mit Dopplereffekt. Mühsam versuche ich mich bei Lindy, deren Liebe unter einem schlechten Stern steht, wieder ins Gedächtnis zu rufen. »Kannst du die High Wire schon erkennen, Lindy?«
»Ja, dort drüben«, erwidert sie nach kurzem Zögern. Ein blinkender roter Kreis ist rings um einen kaum sichtbaren Fleck aus Sternenlicht aufgeflammt. »Ist das nicht toll?!« Flüchtig drückt sie mich an sich.
Ich schließe die Augen. Geduld. »Ich mache mir nicht viel aus Reisen.« Das ist die taktvollste Lüge, die mir gerade in den Sinn kommt. »Kannst du mich bis zu unserer Ankunft in Tiefschlaf versetzen?«
»Bist du dir auch sicher?«, fragt sie skeptisch. Offenbar ist ihr völlig unbegreiflich, wie jemand etwas dagegen haben kann, hilflos und bis auf die Gesellschaft einer geistlosen Schlampe gänzlich allein zwischen den Sternen zu treiben.
»Ja, bin ich, Lindy.« Ich zögere kurz. »Hast du vielleicht noch irgendwelche anderen Persönlichkeitsmodule?«, setze ich entnervt nach.
»Nein, tut mir leid«, erwidert sie fröhlich. »Ich bin nun mal so, wie ich bin. Das sind wir alle. Bei der Kapsel vom Typ 42 für Kurzstreckenflüge, die das Umfeld ganz auf den jeweiligen Passagier abstimmt, bekommst du genau das, was du siehst. Und ich möchte dir sagen, wie sehr ich es genieße, dich in mir zu haben. Aber wenn du dir sicher bist, dass du schlafen möchtest …«
»Ja, völlig sicher«, sage ich nachdrücklich, schließe die Augen und hoffe nur, dass ich nicht träumen werde.
»Oh. Also gut. Dann schlaf schön!«
Die Welt ringsum verschwindet.
Leider ist es eine traurige Wahrheit - eine Wahrheit, die heute allgemein anerkannt wird, wenn meine Einzig Wahre Liebe sie sich seltsamerweise auch niemals eingestand -, dass Raumreisen scheiße sind. (Scheiße verwende ich hier als allgemeinen Platzhalter für eine widerliche, unangenehme Substanz ohne jede gewinnende Eigenschaft. Da ich in einer bestimmten Epoche und mit bestimmten Merkmalen erschaffen wurde, verfüge ich nicht über unmittelbare Erfahrungen mit Exkrementen. Wir mussten uns bei unseren Übungen mit braun eingefärbtem Kieselgur begnügen. Aber ich schweife ab …)
Bist du wohlhabend, kannst du auf einem mit Magnetsegel oder Nuklear-Elektro-Antrieb ausgestatteten Gebilde - es hängt davon ab, in welche Richtung du fliegen möchtest - eine Kabine in den riesigen Frachträumen einer großen fremdartigen Intelligenz buchen. Und dann darfst du dich wochen-, monate- oder jahrelang mit Dutzenden von Mitreisenden treffen, Intrigen spinnen, hinterhältig über sie klatschen und tratschen oder dich mit ihnen langweilen. Und das alles auf einem Raum, der nicht viel größer ist als mein gemietetes Kabuff in der Wolkenstadt oberhalb der Venus. Bandbreite ist kostspielig und rar: Irgendjemand muss eine Übertragungsantenne auf das Hirn des Gastgebers richten und es mit Kilowatt füttern, damit du dein unnützes Geschwätz loswerden kannst, während die Sterne und Planeten unendlich langsam vorbeiziehen.
Aber noch viel schlimmer ist es, wenn du arm bist.
Bist du arm, wickeln sie dich in einen albernen Kokon und befestigen dich an der Außenhülle des Schiffs. Entweder ist es dort sehr kalt oder sehr heiß, und die Strahlungsverbrennungen halten die Knochenmarksproduktion während der Selbstheilung auf Hochtouren. Falls du Pech hast, trifft dich mit der Kraft eines ferngelenkten Geschosses irgendein Sandkorn und zerreißt dir alle Glieder. Gäbe es nicht die stimulierende Gesellschaft des eigenen Kokons oder Gespräche mit anderen Passagieren in ähnlicher Lage, würdest du aufgrund des Reizentzuges wahnsinnig werden.
Natürlich kannst du auch den Modus wählen, bei dem alle Betriebsfunktionen auf ein Minimum reduziert sind, doch das bringt ganz eigene Probleme mit sich: Fährt das System im Kälteschlaf völlig herunter, kann es passieren, dass du im Transit stirbst und nie wieder aufwachst. Das war’s dann. Es können Monate oder auch Jahre bis dahin vergehen.
Möchtet ihr wissen, wie es ist, wenn man ins System des Saturn auswandert? Malt euch sechs Jahre in einer Zwangsjacke aus, festgebunden an der Außenwand eines Wolkenkratzers - und das in der armseligen Gesellschaft von zwei Dutzend ähnlich Verrückter. Selbst im heruntergefahrenen Modus wird es euch wie eine monatelange Tortur vorkommen. Ihr tragt eine Augenbinde, und das ist auch wohl besser so, denn um ein wenig Abwechslung in euer Leben zu bringen, feuert irgendein kosmischer Heckenschütze, der nicht sonderlich gut zielen kann, einen Schuss ins Blaue auf das Gebäude ab.
Und nach all dem fragt ihr euch noch, warum wir Schwestern so wenig herumkommen?!
(Natürlich ist das noch gar nichts, gemessen an interstellaren Reisen: Bei solchen Reisen frieren sie dich ein und schneiden dir die Glieder ab, um Gewicht einzusparen, und lassen am Reiseziel neue für dich wachsen. Falls du nach Jahrzehnten oder Jahrhunderten in der Tiefe des Raums überhaupt noch einigermaßen unversehrt irgendwo ankommst. Allerdings habe ich persönlich nicht vor, zu Pluto, Eris oder Quaoar zu fliegen, um dort eine Passage auf einem Sternenschiff zu buchen. Zumindest derzeit nicht.)
Die Spezies meiner Einzig Wahren Liebe hat früher von der Raumfahrt geträumt. Eigentlich eine Ironie des Schicksals, denn diese Geschöpfe waren dafür so schlecht ausgestattet, dass sie zwangsläufig gestorben wären, hätte man sie ein paar Minuten dem Vakuum ausgesetzt. Der Flug zur Erdatmosphäre und darüber hinaus erforderte umständliche Vorbereitungen und eine komplexe mobile Biosphäre. Für Raumreisen jeglicher Länge war ein unhandlicher, schwerer Strahlungsschutz nötig. Ganz zu schweigen von allen anderen Widrigkeiten.
Als diese Geschöpfe die ersten Forschungssonden entwickelten, war noch gar nicht klar, auf was sie stoßen würden. Also bauten sie zaghafte, dümmliche Maschinchen und katapultierten sie in die luftlose Leere, damit sie von dort aus Bericht erstatteten. Später konstruierten sie idiotische Telefonkommunikationssysteme und verfrachteten sie in die Umlaufbahn, um die Leere mit ihrem Geschwätz zu füllen. Besessen von den auf biologischer Basis funktionierenden Replikatoren, ignorierten sie die interessantesten Winkel des Sonnensystems und konzentrierten sich auf den langweiligen öden Mars. In regelmäßigen Abständen huschten sie bis zu Regionen oberhalb der Erdatmosphäre hinauf, robbten auf Luna durch Tunnels oder unternahmen Expeditionen zum überkuppelten Mars. Vor ihrem endgültigen Aus starb eine beträchtliche Anzahl von ihnen nur deshalb, weil eingedoste Primaten im Vakuum nun mal nicht gedeihen und Sonneneruptionen nicht überleben können.
Titel der englischen Originalausgabe
SATURN’S CHILDREN
Deutsche Übersetzung von Usch Kiausch
Verlagsgruppe Random House
Deutsche Erstausgabe 10/2009
Redaktion: Angela Kuepper
Copyright © 2008 by Charles Stross
Copyright © 2009 der deutschen Ausgabe und Übersetzung by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House
Umschlagbild: Lee Gibbons
eISBN : 978-3-641-03517-0
www.heyne-magische-bestseller.de
Leseprobe
www.randomhouse.de