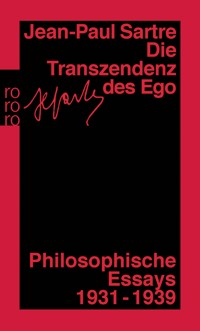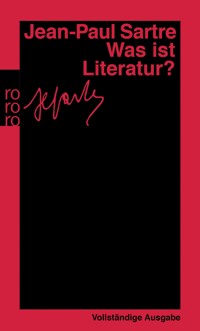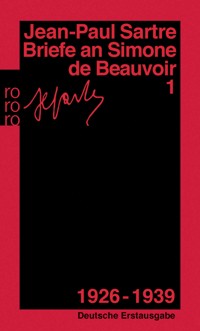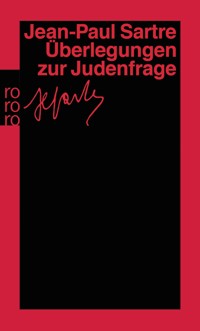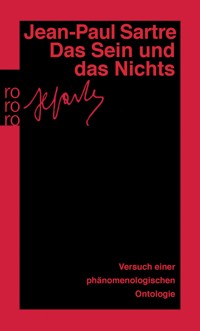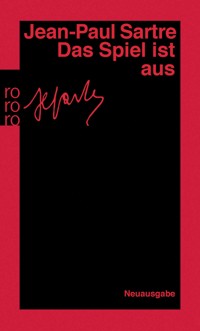9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Niemand will sich der Existenz stellen", sagt Sartre in einem Begleittext zur ersten Ausgabe dieses Erzählbandes. In ihm schildert er Menschen in sehr unterschiedlichen Grenzsituationen: Pablo, den Republikaner im Spanischen Bürgerkrieg, der versucht, seine Freiheit über den Tod hinweg zu retten, Eve, die in die Wahnwelt ihres geistesgestörten Mannes eindringen will, Paul, der die Menschen durch ein schockierendes Verbrechen zu erschüttern vorhat, Lulu, die einer Selbsttäuschung erliegt, und Lucien, der vor seiner Rolle als Chef flieht. Meisterhafte Erzählungen, ein wichtiger Mosaikstein im Werk des bedeutenden Schriftstellers und Philosophen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 336
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Jean-Paul Sartre
Die Kindheit eines Chefs
Gesammelte Erzählungen
Über dieses Buch
«Niemand will sich der Existenz stellen», sagt Sartre in einem Begleittext zur ersten Ausgabe dieses Erzählbandes. In ihm schildert er Menschen in sehr unterschiedlichen Grenzsituationen: Pablo, den Republikaner im Spanischen Bürgerkrieg, der versucht, seine Freiheit über den Tod hinweg zu retten, Eve, die in die Wahnwelt ihres geistesgestörten Mannes eindringen will, Paul, der die Menschen durch ein schockierendes Verbrechen zu erschüttern vorhat, Lulu, die einer Selbsttäuschung erliegt, und Lucien, der vor seiner Rolle als Chef flieht. Meisterhafte Erzählungen, ein wichtiger Mosaikstein im Werk des bedeutenden Schriftstellers und Philosophen.
Vita
Geboren am 21.6.1905, wuchs er nach dem frühen Tod seines Vaters im Jahre 1906 bis zur Wiederheirat seiner Mutter im Jahre 1917 bei seinen Großeltern Schweitzer in Paris auf. 1929, vor seiner Agrégation in Philosophie, lernte er seine Lebensgefährtin Simone de Beauvoir kennen, mit der er eine unkonventionelle Bindung einging, die für viele zu einem emanzipatorischen Vorbild wurde. 1931–1937 war er Gymnasiallehrer in Philosophie in Le Havre und Laon und 1937–1944 in Paris. 1933 Stipendiat des Institut Français in Berlin, wo er sich mit der Philosophie Husserls auseinandersetzte.
Am 2.9.1939 wurde er eingezogen und geriet 1940 in deutsche Kriegsgefangenschaft, aus der er 1941 mit gefälschten Entlassungspapieren entkam. Noch 1943 wurde unter deutscher Besatzung sein erstes Theaterstück «Die Fliegen» aufgeführt; im selben Jahr erschien sein philosophisches Hauptwerk «Das Sein und das Nichts». Unmittelbar nach dem Krieg wurde Sartres Philosophie unter dem journalistischen Schlagwort «Existenzialismus»zu einem modischen Bezugspunkt der Revolte gegen bürgerliche Lebensformen. 1964 lehnte er die Annahme des Nobelpreises ab. Zahlreiche Reisen führten ihn in die USA, die UdSSR, nach China, Haiti, Kuba, Brasilien, Nordafrika, Schwarzafrika, Israel, Japan und in fast alle Länder Europas. Er traf sich mit Roosevelt, Chruschtschow, Mao Tse-tung, Castro, Che Guevara, Tito, Kubitschek, Nasser, Eschkol. Sartre starb am 15.4.1980 in Paris.
Auszeichnungen: Prix du Roman populiste für «Le mur» (1940); Nobelpreis für Literatur (1964, abgelehnt); Ehrendoktor der Universität Jerusalem (1976).
Impressum
Diese Neuübersetzung folgt der 1981 bei Éditions Gallimard, Paris, veröffentlichten Neuausgabe der Erzählungen innerhalb der in der Bibliothèque de la Pléiade erschienenen Œuvres romanesques.
Angaben über frühere deutsche Ausgaben und weitere bibliographische Hinweise siehe Seite 179 am Ende dieses Buches.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Dezember 2023
Copyright © 1950, 1970, 1983 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
«Le Mur» Copyright © 1939, 1981 by
Librairie Gallimard, Paris
Covergestaltung Barbara Hanke
Coverabbildung Fred Dott
ISBN 978-3-644-01892-1
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
Die Wand
Das Zimmer
I
II
Herostrat
I
Intimität
I
II
III
IV
Die Kindheit eines Chefs
Erläuterungen zu Kindheit eines Chefs
Quellennachweis
Bibliographie
Über den gesamten Erzählungsband
Über Le mur (Die Wand)
Über La chambre (Das Zimmer)
Über Érostrate (Herostrat)
Über Intimité (Intimität)
Über L’enfance d’un chef (Die Kindheit eines Chefs)
Zu den Verboten von Le mur
Zur Verfilmung von Le mur
Für Olga Kosakiewicz
Die Wand
Wir wurden in einen großen weißen Raum gestoßen, und ich fing an zu blinzeln, weil mir das Licht in den Augen weh tat. Dann sah ich einen Tisch und vier Typen hinter dem Tisch, Zivilisten, die sich Papiere ansahen. Man hatte die anderen Gefangenen im Hintergrund zusammengedrängt, und wir mußten das ganze Zimmer durchqueren, um uns zu ihnen zu stellen. Es waren mehrere dabei, die ich kannte, und andere, die Ausländer sein mußten. Die beiden, die vor mir standen, waren blond mit runden Schädeln; sie sahen sich ähnlich: Franzosen, denke ich mir. Der Kleinere zog die ganze Zeit seine Hose hoch: das war ein nervöser Tick.
Es dauerte fast drei Stunden; ich war abgestumpft, und mein Kopf war leer, aber der Raum war gut geheizt, und ich fand das eher angenehm: vierundzwanzig Stunden lang hatten wir nur geschlottert. Die Wachposten führten die Gefangenen nacheinander vor den Tisch. Die vier Typen fragten sie dann nach ihrem Namen und ihrem Beruf. Meistens wollten sie nicht viel mehr wissen – oder aber sie stellten hin und wieder eine Frage: «Warst du an dem Sabotageakt gegen die Munition beteiligt?» Oder: «Wo warst du am Morgen des 9., und was tatest du?» Sie hörten nicht auf die Antworten, oder zumindest taten sie so: sie schwiegen einen Moment und sahen geradeaus vor sich hin, dann fingen sie an zu schreiben. Sie fragten Tom, ob es stimme, daß er in der Internationalen Brigade diente: Tom konnte nicht das Gegenteil behaupten wegen der Papiere, die man in seiner Jacke gefunden hatte. Juan fragten sie nichts, aber nachdem er seinen Namen genannt hatte, schrieben sie lange.
«Mein Bruder José, der ist Anarchist», sagte Juan. «Sie wissen ja, daß er nicht mehr hier ist. Ich gehöre zu keiner Partei, ich habe nie etwas mit Politik zu tun gehabt.»
Sie antworteten nicht. Juan sagte weiter:
«Ich habe nichts getan. Ich will nicht für die anderen büßen.»
Seine Lippen bebten. Ein Wachposten sagte, er solle den Mund halten, und führte ihn ab. Ich war dran:
«Heißen Sie Pablo Ibbieta?»
Ich sagte ja.
Der Typ sah in seine Papiere und sagte zu mir:
«Wo ist Ramón Gris?»
«Ich weiß nicht.»
«Sie haben ihn vom 6. bis zum 19. in Ihrem Haus versteckt.»
«Nein.»
Sie schrieben eine Weile, und die Wachposten führten mich hinaus. Auf dem Flur warteten Tom und Juan zwischen zwei Posten. Wir setzten uns in Marsch. Tom fragte einen der Wachposten:
«Ja und?»
«Was?» sagte der Posten.
«Ist das ein Verhör oder ein Urteil?»
«Das war ein Urteil», sagte der Wachposten.
«Und jetzt? Was werden sie mit uns machen?»
Der Wachposten antwortete unfreundlich:
«Der Urteilsspruch wird euch in euren Zellen bekanntgegeben.»
Was uns als Zelle diente, war einer der Keller des Krankenhauses. Es war schrecklich kalt dort, weil es aus allen Ecken zog. Die ganze Nacht hatten wir geschlottert, und tagsüber war es nicht viel besser gewesen. Die fünf vorangegangenen Tage hatte ich in einem Kerker des Erzbischofspalais verbracht, einer Art Verlies, das aus dem Mittelalter stammen mußte: da es viele Gefangene und wenig Platz gab, wurden sie ganz gleich wo untergebracht. Ich trauerte meinem Kerker nicht nach: ich hatte dort nicht unter Kälte gelitten, aber ich war allein; auf die Dauer ist das zermürbend. Im Keller hatte ich Gesellschaft. Juan sprach kaum: er hatte Angst, und außerdem war er zu jung, um mitreden zu können. Aber Tom hatte ein flottes Mundwerk und sprach sehr gut Spanisch.
Im Keller waren eine Bank und vier Strohsäcke. Als sie uns zurückgebracht hatten, setzten wir uns hin und warteten schweigend. Tom sagte nach einer Weile:
«Wir sind erledigt.»
«Das denke ich auch», sagte ich, «aber ich glaube, dem Kleinen werden sie nichts tun.»
«Sie haben ihm nichts vorzuwerfen», sagte Tom. «Er ist der Bruder eines Kämpfers, das ist alles.»
Ich sah Juan an: er schien nicht hinzuhören. Tom fuhr fort:
«Weißt du, was sie in Saragossa machen? Sie legen die Jungs auf die Straße und fahren mit Lastwagen über sie weg. Ein marokkanischer Deserteur hat uns das gesagt. Sie sagen, das sei, um Munition zu sparen.»
«Damit spart man kein Benzin», sagte ich.
Ich ärgerte mich über Tom: er hätte das nicht sagen sollen.
«Offiziere spazieren auf der Straße herum», fuhr er fort, «und überwachen das, die Hände in den Taschen, Zigaretten rauchend. Glaubst du, sie würden den Typen den Rest geben? Denkst du. Sie lassen sie brüllen. Manchmal eine Stunde lang. Der Marokkaner sagte, daß er beim erstenmal fast gekotzt hätte.»
«Ich glaube nicht, daß sie das hier machen», sagte ich. «Es sei denn, sie haben wirklich keine Munition.»
Das Tageslicht kam durch vier Kellerfenster und durch eine runde Öffnung, die man links in die Decke gemacht hatte und durch die man in den Himmel sah. Durch dieses runde Loch, das gewöhnlich mit einer Falltür verschlossen war, wurde Kohle in den Keller geschüttet. Genau unter dem Loch lag ein großer Haufen Feinkohle; damit hätte das Krankenhaus geheizt werden sollen, aber gleich bei Kriegsanfang waren die Kranken evakuiert worden, und die Kohle blieb ungenutzt liegen; es regnete sogar gelegentlich darauf, denn man hatte vergessen, die Falltür zu schließen.
Tom fing an zu schlottern.
«Gott verflucht, ich schlottere», sagte er, «jetzt geht das wieder los.»
Er stand auf und fing an, Gymnastik zu machen. Bei jeder Bewegung öffnete sich sein Hemd über seiner weißen und dichtbehaarten Brust. Er legte sich auf den Rücken, streckte die Beine in die Luft und machte die Schere: ich sah sein dickes Kreuz zittern. Tom war stämmig, hatte aber zuviel Fett. Ich dachte daran, daß sich bald Gewehrkugeln oder Bajonettspitzen in diese zarte Fleischmasse bohren würden wie in einen Klumpen Butter. Das wirkte anders auf mich, als wenn er dünn gewesen wäre.
Ich fror nicht gerade, aber ich fühlte meine Schultern und meine Arme nicht mehr. Ab und zu hatte ich den Eindruck, daß mir etwas fehlte, und ich fing an, um mich herum nach meiner Jacke zu suchen, und dann erinnerte ich mich plötzlich, daß sie mir keine Jacke gegeben hatten. Das war eher unangenehm. Sie hatten unsere Kleider genommen, um sie ihren Soldaten zu geben, und hatten uns nur unsere Hemden gelassen – und diese Leinenhosen, die die Krankenhausinsassen im Hochsommer trugen. Nach einer Weile stand Tom wieder auf und setzte sich schnaufend neben mich.
«Ist dir wärmer?»
«Gott verflucht, nein. Aber ich bin außer Atem.»
Gegen acht Uhr abends kam ein Major mit zwei Falangisten herein. Er hatte einen Zettel in der Hand. Er fragte den Wachposten:
«Wie heißen diese drei?»
«Steinbock, Ibbieta und Mirbal», sagte der Wachposten.
Der Major setzte seinen Kneifer auf und schaute in seine Liste:
«Steinbock … Steinbock … Hier. Sie sind zum Tode verurteilt. Sie werden morgen früh erschossen.»
Er schaute noch einmal nach:
«Die beiden anderen auch», sagte er.
«Das ist unmöglich», sagte Juan. «Ich nicht.»
Der Major sah ihn erstaunt an:
«Wie heißen Sie?»
«Juan Mirbal», sagte er.
«Tja, Ihr Name steht hier», sagte der Major, «Sie sind verurteilt.»
«Ich habe nichts getan», sagte Juan.
Der Major zuckte die Achseln und wandte sich Tom und mir zu.
«Sind Sie Basken?»
«Keiner von uns ist Baske.»
Er wirkte gereizt.
«Man hat mir gesagt, hier wären drei Basken. Ich werde doch meine Zeit nicht damit vergeuden, denen nachzulaufen. Dann wollen Sie natürlich keinen Priester?»
Wir antworteten nicht einmal. Er sagte:
«Gleich wird ein belgischer Arzt kommen. Er hat die Erlaubnis, die Nacht mit Ihnen zu verbringen.»
Er grüßte militärisch und ging hinaus.
«Was hab ich dir gesagt», sagte Tom. «Wir sind dran.»
«Ja», sagte ich, «das mit dem Kleinen ist eine Schweinerei.»
Ich sagte das, um gerecht zu sein, aber ich mochte den Kleinen nicht. Er hatte ein zu feines Gesicht, und die Angst, das Leid hatten es entstellt, sie hatten seine Züge verzerrt. Vor drei Tagen war er ein weichliches Jüngelchen gewesen, das kann einem gefallen; aber jetzt sah er aus wie eine alte Tunte, und ich dachte, daß er nie wieder jung würde, selbst wenn man ihn freiließe. Es wäre nicht schlecht gewesen, ihm ein bißchen Mitleid schenken zu können, aber Mitleid ekelt mich an, er war mir eher widerlich. Er hatte nichts mehr gesagt, aber er war grau geworden: sein Gesicht und seine Hände waren grau. Er setzte sich wieder hin und sah mit runden Augen zu Boden. Tom war eine gute Seele, er wollte ihn am Arm fassen, aber der Kleine verzog das Gesicht und machte sich heftig los.
«Laß ihn», sagte ich leise, «du siehst doch, daß er gleich anfängt zu heulen.»
Tom gehorchte widerstrebend; er hätte den Kleinen gerne getröstet; das hätte ihn beschäftigt, und er wäre nicht in Versuchung gekommen, an sich selbst zu denken. Aber das reizte mich; ich hatte nie an den Tod gedacht, weil die Gelegenheit dazu sich nicht geboten hatte, aber jetzt war die Gelegenheit da, und es gab nichts anderes zu tun, als daran zu denken.
Tom fing an zu reden:
«Hast du welche umgelegt?» fragte er mich.
Ich antwortete nicht. Er begann mir zu erklären, daß er seit Anfang August sechs umgelegt hatte; er machte sich die Situation nicht klar, und ich merkte genau, daß er sie sich nicht klarmachen wollte. Ich selbst war mir ihrer noch nicht voll und ganz bewußt, ich fragte mich, ob man viel litte, ich dachte an die Kugeln, ich stellte mir ihren durch meinen Körper brennenden Hagel vor. All das lag außerhalb der eigentlichen Frage; aber ich war ruhig: wir hatten die ganze Nacht, um zu begreifen. Nach einer Weile hörte Tom auf zu reden, und ich schaute ihn aus den Augenwinkeln an; ich sah, daß auch er grau geworden war und daß er elend aussah; ich sagte mir: «Es geht los.» Es war fast dunkel, ein matter Lichtschimmer drang durch die Kellerfenster, und der Kohlehaufen bildete einen dicken Fleck unterm Himmel; durch das Loch in der Decke sah ich schon einen Stern: die Nacht würde klar und eiskalt werden.
Die Tür ging auf, und zwei Wachposten traten ein. Hinter ihnen kam ein blonder Mann herein, der eine hellbraune Uniform trug. Er grüßte uns:
«Ich bin Arzt», sagte er. «Ich habe die Erlaubnis, Ihnen in dieser schmerzlichen Lage beizustehen.»
Er hatte eine angenehme und vornehme Stimme. Ich sagte zu ihm:
«Was wollen Sie hier?»
«Ich stehe zu Ihrer Verfügung. Ich werde mein möglichstes tun, um Ihnen diese paar Stunden zu erleichtern.»
«Warum sind Sie zu uns gekommen? Es gibt andere, das Krankenhaus ist voll davon.»
«Man hat mich hierhergeschickt», antwortete er unbestimmt.
«Oh, Sie würden gerne rauchen, was?» fügte er überstürzt hinzu. «Ich habe Zigaretten und sogar Zigarren.»
Er bot uns englische Zigaretten und puros an, aber wir lehnten ab. Ich sah ihm in die Augen, und er schien verlegen. Ich sagte:
«Sie kommen nicht aus Mitgefühl hierher. Übrigens kenne ich Sie. Ich habe Sie mit Faschisten auf dem Kasernenhof gesehen, an dem Tag, als ich verhaftet wurde.»
Ich wollte weiterreden, aber plötzlich passierte etwas mit mir, was mich überraschte: die Anwesenheit dieses Arztes hörte mit einem Schlag auf, mich zu interessieren. Gewöhnlich, wenn ich mit einem Mann aneinandergerate, lasse ich nicht locker. Und doch verging mir die Lust zu sprechen; ich zuckte die Achseln und wandte die Augen ab. Etwas später hob ich den Kopf: er beobachtete mich neugierig. Die Wachposten hatten sich auf einen Strohsack gesetzt. Pedro, der große Dünne, drehte Däumchen, der andere schüttelte hin und wieder den Kopf, um nicht einzuschlafen.
«Möchten Sie Licht?» sagte Pedro plötzlich zu dem Arzt. Der andere nickte bejahend: ich denke, er war ungefähr so intelligent wie ein Holzklotz, aber sicher war er nicht böse. Wenn ich seine großen kalten blauen Augen ansah, schien er mir vor allem aus Phantasielosigkeit zu sündigen. Pedro ging hinaus und kam mit einer Petroleumlampe zurück, die er auf die Ecke der Bank stellte. Sie gab wenig Licht, aber das war besser als nichts: am Abend zuvor hatte man uns im Dunkeln gelassen. Ich blickte eine ganze Weile auf den Lichtkreis, den die Lampe an die Decke warf. Ich war fasziniert. Und dann, plötzlich, war ich wieder ganz wach, der Lichtkreis verlosch, und ich fühlte mich von einem ungeheuren Gewicht niedergedrückt. Das war weder der Gedanke an den Tod noch Angst: es war anonym. Meine Backen glühten, und der Schädel tat mir weh.
Ich schüttelte mich und sah meine beiden Gefährten an. Tom hatte seinen Kopf in den Händen vergraben, ich sah nur seinen fetten weißen Nacken. Der kleine Juan war am allerschlechtesten dran, sein Mund stand offen, und seine Nasenflügel bebten. Der Arzt trat zu ihm und legte ihm die Hand auf die Schulter, als wollte er ihn trösten: aber seine Augen blieben kalt. Dann sah ich die Hand des Belgiers verstohlen an Juans Arm hinunterwandern bis zum Handgelenk. Juan ließ ihn gleichgültig gewähren. Der Belgier nahm sein Handgelenk mit zerstreuter Miene zwischen drei Finger, gleichzeitig trat er ein bißchen zurück, so daß er mir den Rücken zudrehte. Aber ich beugte mich nach hinten und sah, wie er seine Taschenuhr zog und einen Augenblick darauf blickte, ohne das Handgelenk des Kleinen loszulassen. Nach einer Weile ließ er die leblose Hand wieder fallen und wollte sich an die Wand lehnen, dann, als fiele ihm plötzlich etwas sehr Wichtiges ein, das er auf der Stelle notieren müßte, holte er ein Heft aus seiner Tasche und schrieb ein paar Zeilen hinein. «Das Schwein», dachte ich wütend, «der soll mir bloß nicht den Puls fühlen kommen, ich schlage ihm in seine dreckige Fresse.»
Er kam nicht, aber ich spürte, daß er mich ansah. Ich hob den Kopf und erwiderte seinen Blick. Er sagte mit unpersönlicher Stimme:
«Finden Sie nicht, daß es hier saukalt ist?»
Er sah verfroren aus; er war blaurot.
«Ich friere nicht», antwortete ich.
Er sah mich immer weiter mit hartem Blick an. Plötzlich begriff ich und faßte mit den Händen an mein Gesicht: ich war schweißgebadet. In diesem Keller, im tiefsten Winter, mitten im Zug, schwitzte ich. Ich fuhr mir mit den Fingern durch die Haare, die von Schweiß verfilzt waren; gleichzeitig merkte ich, daß mein Hemd feucht war und an meiner Haut klebte: ich triefte seit mindestens einer Stunde und hatte nichts gespürt. Aber dem Schwein von Belgier war das nicht entgangen; er hatte die Tropfen meine Backe hinunterrollen sehen und hatte gedacht: das sind Symptome eines quasi pathologischen Angstzustands; und er hatte sich normal gefühlt und stolz, es zu sein, weil er fror. Ich wollte aufstehen, um ihm in die Schnauze zu hauen, aber kaum hatte ich zu einer Bewegung angesetzt, da schwanden meine Scham und meine Wut; ich fiel gleichgültig auf die Bank zurück.
Ich begnügte mich damit, mir den Hals mit meinem Taschentuch abzureiben, weil ich jetzt spürte, wie der Schweiß aus meinen Haaren auf meinen Nacken tropfte, und das war unangenehm. Ich gab es allerdings bald auf, mich abzureiben, es war zwecklos: schon war mein Taschentuch klatschnaß, und ich schwitzte immer noch. Ich schwitzte auch am Hintern, und meine feuchte Hose klebte an der Bank.
Der kleine Juan sprach plötzlich:
«Sind Sie Arzt?»
«Ja», sagte der Belgier.
«Leidet man … lange?»
«Oh! Wann …? Aber nein», sagte der Belgier mit väterlicher Stimme, «es geht schnell vorbei.»
Er sah aus, als würde er einen zahlenden Kranken beruhigen.
«Aber ich … man hat mir gesagt … daß oft zwei Salven nötig sind.»
«Manchmal», sagte der Belgier nickend. «Es kann vorkommen, daß die erste Salve keins der lebenswichtigen Organe trifft.»
«Dann müssen Sie also die Gewehre neu laden und noch einmal anlegen?»
Er dachte nach und fügte mit belegter Stimme hinzu:
«Das dauert!»
Er hatte gräßliche Angst zu leiden, er dachte nur daran: das lag an seinem Alter. Ich selbst dachte nicht mehr viel daran, und es war nicht die Angst zu leiden, weshalb ich schwitzte.
Ich stand auf und ging zu dem Haufen Feinkohle hinüber. Tom schreckte auf und warf mir einen haßerfüllten Blick zu: ich ging ihm auf die Nerven, weil meine Schuhe knarrten. Ich fragte mich, ob mein Gesicht genauso fahl war wie seins: ich sah, daß er ebenfalls schwitzte. Der Himmel war herrlich, kein Licht drang in diesen dunklen Winkel, und ich brauchte nur den Kopf zu heben, um den Großen Wagen zu sehen. Aber das war nicht mehr wie vorher: vorgestern, von meinem Kerker im Erzbischofspalais aus, konnte ich ein großes Stück Himmel sehen, und jede Tageszeit rief eine andere Erinnerung in mir wach. Am Morgen, wenn der Himmel von einem harten und leichten Blau war, dachte ich an Strände am Atlantik; mittags sah ich die Sonne und erinnerte mich an eine Bar in Sevilla, wo ich Manzanilla trank und Anschovis und Oliven aß; nachmittags war ich im Schatten und dachte an den tiefen Schatten, der über der halben Arena liegt, während die andere Hälfte in der Sonne flimmert: es war wirklich quälend, so die ganze Erde im Himmel gespiegelt zu sehen. Aber jetzt konnte ich, solange ich wollte, hinaufsehen, der Himmel rief nichts mehr in mir wach. Das war mir lieber. Ich setzte mich wieder neben Tom. Eine lange Zeit verging.
Tom fing mit leiser Stimme an zu reden. Er mußte immer reden, sonst fand er sich nicht in seinen Gedanken zurecht. Ich denke, daß er mich anredete, aber er sah mich nicht an. Wahrscheinlich hatte er Angst, mich so zu sehen, wie ich war, grau und schwitzend: wir waren gleich und schlimmer als Spiegel füreinander. Er sah den Belgier an, den Lebenden.
«Begreifst du das?» sagte er. «Ich begreife das nicht.»
Ich fing auch leise an zu sprechen. Ich sah den Belgier an.
«Was denn, was ist los?»
«Es wird etwas mit uns geschehen, was ich nicht begreifen kann.»
Ein merkwürdiger Geruch war um Tom. Mir schien, daß ich geruchsempfindlicher war als sonst. Ich feixte:
«Du wirst bald begreifen.»
«Das ist nicht klar», sagte er eigensinnig. «Ich will gerne mutig sein, aber ich müßte zumindest wissen … Hör zu, man führt uns in den Hof. Die Typen stellen sich in einer Reihe vor uns auf. Wie viele werden es sein?»
«Ich weiß nicht. Fünf oder acht. Mehr nicht.»
«Na schön. Also acht. Man wird ihnen zurufen: ‹Legt an!›, und ich werde die acht Gewehre auf mich gerichtet sehen. Ich denke, ich werde mich in die Wand verziehen wollen, ich werde mit dem Rücken mit aller Kraft gegen die Wand drücken, und die Wand wird nicht nachgeben, wie im Alptraum. Das alles kann ich mir vorstellen. Ach, wenn du wüßtest, wie gut ich mir das vorstellen kann.»
«Na schön», sagte ich, «ich stell’s mir auch vor.»
«Das muß saumäßig weh tun. Du weißt, daß sie auf die Augen und den Mund zielen, um einen zu entstellen», fügte er bösartig hinzu. «Ich fühle schon die Wunden; seit einer Stunde habe ich Schmerzen im Kopf und im Hals. Keine wirklichen Schmerzen; es ist schlimmer: das sind die Schmerzen, die ich morgen früh spüren werde. Aber danach?»
Ich verstand sehr wohl, was er meinte, aber ich wollte es mir nicht anmerken lassen. Was die Schmerzen anging, so trug auch ich sie an meinem Körper wie eine Vielzahl kleiner Schrammen. Ich konnte mich nicht daran gewöhnen, aber ich war wie er, ich nahm sie nicht wichtig.
«Danach», sagte ich grob, «wirst du ins Gras beißen.»
Er fing an, Selbstgespräche zu führen: er ließ den Belgier nicht aus den Augen. Der sah nicht so aus, als hörte er zu. Ich wußte, weshalb er hierhergekommen war; was wir dachten, interessierte ihn nicht; er war hier, um unsere Körper anzuschauen, Körper, die bei lebendigem Leibe starben.
«Es ist wie ein Alptraum», sagte Tom. «Man will an etwas denken, man hat immerzu den Eindruck, daß es soweit ist, daß man gleich begreifen wird, und dann wird es glitschig, entwischt einem und ist wieder weg. Ich sage mir: danach gibt es nichts mehr. Aber ich begreife nicht, was das heißt. In manchen Momenten bin ich fast soweit … und dann ist es wieder weg, ich beginne wieder an die Schmerzen zu denken, an die Kugeln, an das Knallen. Ich bin Materialist, ich schwör’s dir; ich werde nicht verrückt. Aber da ist etwas, was nicht hinhaut. Ich sehe meine Leiche: das ist nicht schwer, aber ich sehe sie mit meinen Augen. Ich müßte es schaffen, zu denken … zu denken, daß ich nichts mehr sehen werde, daß ich nichts mehr hören werde und daß die Welt für die anderen weitergeht. Wir sind nicht dafür geschaffen, das zu denken, Pablo. Du kannst mir glauben: das ist schon vorgekommen, daß ich eine ganze Nacht gewacht und auf etwas gewartet habe. Aber das hier, das ist nicht dasselbe: das wird uns von hinten packen, Pablo, ohne daß wir uns darauf vorbereiten konnten.»
«Halt’s Maul», sagte ich zu ihm, «willst du, daß ich einen Beichtvater rufe?»
Er antwortete nicht. Ich hatte schon gemerkt, daß er dazu neigte, den Propheten zu spielen und mich mit tonloser Stimme Pablo zu nennen. Ich mochte das nicht; aber anscheinend sind alle Iren so. Ich hatte den unbestimmten Eindruck, daß er nach Urin roch. Im Grunde hatte ich nicht viel Sympathie für Tom, und ich sah nicht ein, warum ich, unter dem Vorwand, daß wir zusammen sterben würden, mehr für ihn hätte empfinden sollen. Es gibt Typen, mit denen das anders gewesen wäre. Mit Ramón Gris zum Beispiel. Aber zwischen Tom und Juan fühlte ich mich allein, übrigens war mir das lieber: mit Ramon wäre ich womöglich weich geworden. Aber ich war schrecklich hart in diesem Moment, und ich wollte hart bleiben.
Er murmelte weiter zerstreut irgendwelche Wörter. Er redete bestimmt, um sich vom Denken abzuhalten. Er roch durchdringend nach Urin wie alte Prostatakranke. Natürlich war ich seiner Meinung, alles, was er sagte, hätte ich auch sagen können: es ist nicht natürlich zu sterben. Und seitdem ich sterben sollte, erschien mir nichts mehr natürlich, weder dieser Haufen Feinkohle noch die Bank, noch Pedros miese Visage. Bloß, das gefiel mir nicht, daß ich dasselbe dachte wie Tom. Und ich wußte wohl, daß wir die ganze Nacht hindurch, fünf Minuten früher oder später, weiter dasselbe zur selben Zeit denken würden, zur selben Zeit schwitzen oder frösteln würden. Ich sah ihn von der Seite an, und zum erstenmal kam er mir merkwürdig vor: er trug seinen Tod auf dem Gesicht. Ich war in meinem Stolz gekränkt: vierundzwanzig Stunden hindurch hatte ich neben Tom gelebt, hatte ihm zugehört, hatte mit ihm gesprochen, und ich wußte, daß wir nichts gemeinsam hatten. Und jetzt glichen wir uns wie Zwillinge, bloß weil wir zusammen krepieren würden. Tom nahm meine Hand, ohne mich anzusehen:
«Pablo, ich frage mich … ich frage mich, ob es wirklich stimmt, daß man zu Nichts wird.»
Ich machte meine Hand los, ich sagte zu ihm:
«Schau zwischen deine Füße, du Schwein.»
Zwischen seinen Füßen war eine Pfütze, und aus seiner Hose tropfte es.
«Was ist denn das?» sagte er fassungslos.
«Du pißt in deine Unterhose», sagte ich.
«Das ist nicht wahr», sagte er wütend, «ich pisse nicht, ich fühle nichts.»
Der Belgier war näher gekommen. Er fragte mit unechter Besorgnis:
«Fühlen Sie sich nicht wohl?»
Tom antwortete nicht. Der Belgier sah die Pfütze an, ohne etwas zu sagen.
«Ich weiß nicht, was das ist», sagte Tom verstört, «aber ich habe keine Angst. Ich schwöre Ihnen, daß ich keine Angst habe.»
Der Belgier antwortete nicht. Tom stand auf und pißte in eine Ecke. Er kam seinen Hosenschlitz zuknöpfend zurück, setzte sich wieder hin und gab keinen Ton mehr von sich. Der Belgier machte sich Notizen.
Wir sahen ihn an; auch der kleine Juan sah ihn an: wir sahen ihn alle drei an, weil er lebendig war. Er hatte die Bewegungen eines Lebenden, die Sorgen eines Lebenden; er schlotterte in diesem Keller, wie Lebende schlottern sollten; er hatte einen gehorsamen und wohlgenährten Körper. Wir anderen fühlten unsere Körper kaum noch - nicht mehr in derselben Weise jedenfalls. Ich hatte Lust, meine Hose zwischen den Beinen zu befühlen, aber ich wagte es nicht; ich sah den Belgier an, durchgebogen auf seinen Beinen stehend, Herr seiner Muskeln – und der an morgen denken konnte. Da waren wir, drei blutleere Schatten; wir sahen ihn an und saugten sein Leben aus wie Vampire.
Er ging schließlich zum kleinen Juan hinüber. Wollte er aus irgendeinem beruflichen Motiv dessen Nacken befühlen, oder folgte er etwa einem barmherzigen Impuls? Falls er aus Barmherzigkeit handelte, dann war es das einzige Mal in der ganzen Nacht. Er streichelte den Schädel und den Hals des kleinen Juan. Der Kleine ließ es geschehen, ohne ihn aus den Augen zu lassen, dann, plötzlich, ergriff er seine Hand und schaute sie komisch an. Er hielt die Hand des Belgiers zwischen seinen beiden, und sie hatten nichts Lustiges an sich, die beiden grauen Flossen, die diese feiste und gerötete Hand drückten. Ich ahnte schon, was gleich passieren würde, und Tom mußte es auch ahnen: aber der Belgier sah nichts, er lächelte väterlich. Nach einem Moment hob der Kleine die dicke rote Pfote an seinen Mund und wollte hineinbeißen. Der Belgier machte sich heftig los und wich stolpernd bis an die Wand zurück. Eine Sekunde lang sah er uns voller Entsetzen an, er begriff wohl plötzlich, daß wir keine Menschen wie er waren. Ich fing an zu lachen, und einer der Wachposten schreckte hoch. Der andere war eingeschlafen, seine weit offenen Augen waren weiß.
Ich fühlte mich zugleich erschöpft und überreizt. Ich wollte nicht mehr an das, was im Morgengrauen geschehen würde, an den Tod denken. Das ergab keinen Sinn, ich stieß nur auf Wörter oder auf Leere. Aber sobald ich versuchte, an etwas anderes zu denken, sah ich Gewehrläufe auf mich gerichtet. Ich habe vielleicht zwanzigmal hintereinander meine Hinrichtung erlebt; einmal habe ich sogar geglaubt, daß es wirklich soweit wäre: Ich war wohl eine Minute eingeschlafen. Sie zerrten mich vor die Wand, und ich sträubte mich; ich bat sie um Gnade. Ich schreckte aus dem Schlaf auf und sah den Belgier an: ich hatte Angst, im Schlaf geschrien zu haben. Aber er strich seinen Schnurrbart glatt, er hatte nichts bemerkt. Wenn ich gewollt hätte, ich glaube, ich hätte eine Weile schlafen können: ich war seit achtundvierzig Stunden wach, ich war am Ende. Aber ich hatte keine Lust, zwei Stunden Leben zu verlieren: sie wären mich im Morgengrauen aufwecken gekommen, ich wäre ihnen schlaftrunken gefolgt und wäre abgekratzt, ohne «uff» zu sagen; das wollte ich nicht, ich wollte nicht wie ein Tier sterben, ich wollte verstehen. Und außerdem fürchtete ich, Alpträume zu haben. Ich stand auf, ich wanderte auf und ab, und um auf andere Gedanken zu kommen, begann ich, an mein vergangenes Leben zu denken. Eine Menge von Erinnerungen kamen mir, wüst durcheinander. Gute und schlechte – oder zumindest nannte ich sie vorher so. Da waren Gesichter und Geschichten. Ich sah das Gesicht eines kleinen novillero wieder vor mir, der in Valencia während der Feria vom Stier auf die Hörner genommen worden war, das Gesicht eines meiner Onkel, das von Ramón Gris. Ich erinnerte mich an Geschichten: wie ich 1926 drei Monate lang arbeitslos gewesen war, wie ich fast vor Hunger krepiert wäre. Ich erinnerte mich an eine Nacht, die ich auf einer Bank in Granada verbracht hatte: ich hatte seit drei Tagen nichts gegessen, ich war rasend, ich wollte nicht krepieren. Darüber mußte ich lächeln. Mit welcher Gier ich dem Glück, den Frauen, der Freiheit nachlief. Wozu? Ich hatte Spanien befreien wollen, ich bewunderte Pi y Margall, ich hatte mich der anarchistischen Bewegung angeschlossen, ich hatte in öffentlichen Versammlungen gesprochen: ich nahm alles ernst, so als wäre ich unsterblich gewesen.
In diesem Moment hatte ich den Eindruck, als läge mein ganzes Leben ausgebreitet vor mir, und ich dachte: «Das ist eine verdammte Lüge.» Es war nichts mehr wert, denn es war zu Ende. Ich fragte mich, wie ich mit Mädchen hatte Spazierengehen, lachen können: ich hätte keinen Finger gekrümmt, wenn ich geahnt hätte, daß ich so sterben würde. Mein Leben war vor mir, abgeschlossen, zugebunden wie ein Sack, und dabei war alles, was darin war, unfertig. Einen Augenblick versuchte ich es zu beurteilen. Ich hätte mir gerne gesagt: es ist ein schönes Leben. Aber man konnte kein Urteil darüber fällen, es war ein Rohentwurf; ich hatte meine Zeit damit verbracht, Wechsel auf die Ewigkeit auszustellen, ich hatte nichts begriffen. Es tat mir um nichts leid: es gab eine Menge Dinge, um die es mir hätte leid tun können, der Geschmack von Manzanilla oder das sommerliche Baden in einer kleinen Bucht in der Nähe von Cádiz; aber der Tod hatte allem seinen Reiz genommen.
Der Belgier hatte plötzlich eine großartige Idee.
«Freunde», sagte er zu uns, «ich kann es übernehmen – vorausgesetzt, die Militärverwaltung ist einverstanden -, den Menschen, die Sie lieben, eine Nachricht von Ihnen, ein Andenken zu überbringen …»
Tom brummte:
«Ich habe niemand.»
Ich antwortete nichts. Tom wartete einen Augenblick, dann sah er mich neugierig an:
«Läßt du Concha nichts ausrichten?»
«Nein.»
Ich haßte diese Verständnisinnigkeit: es war meine Schuld, ich hatte in der vorangegangenen Nacht von Concha gesprochen, ich hätte mich zurückhalten sollen. Ich war seit einem Jahr mit ihr zusammen. Noch am Vortag hätte ich mir einen Arm mit der Axt abgehackt, wenn ich sie fünf Minuten hätte wiedersehen können. Deshalb hatte ich von ihr gesprochen, es war stärker als ich. Jetzt hatte ich keine Lust mehr, sie wiederzusehen, ich hatte ihr nichts mehr zu sagen. Ich hätte sie nicht einmal in meinen Armen halten mögen: mich ekelte vor meinem Körper, weil er grau geworden war und schwitzte – und ich war nicht sicher, ob es mich vor ihrem nicht auch ekeln würde. Concha würde weinen, wenn sie meinen Tod erführe; monatelang würde sie keine Lebensfreude mehr haben. Aber schließlich war ich es, der sterben würde. Ich dachte an ihre schönen sanften Augen. Wenn sie mich ansah, wanderte etwas von ihr zu mir. Aber ich dachte, daß das vorbei war: wenn sie mich jetzt ansähe, würde ihr Blick in ihren Augen bleiben, er ginge nicht bis zu mir. Ich war allein.
Auch Tom war allein, aber nicht auf dieselbe Weise. Er hatte sich rittlings hingesetzt und hatte angefangen, die Bank mit einer Art Lächeln anzusehen, er sah verwundert aus. Er streckte die Hand aus und berührte behutsam das Holz, als hätte er Angst, etwas zu zerbrechen, dann zog er seine Hand schnell zurück und erschauerte. Ich hätte mich nicht damit vergnügt, die Bank zu berühren, wenn ich Tom gewesen wäre; das war wieder so eine Irenkomödie, aber ich fand auch, daß die Gegenstände komisch aussahen: sie waren verwischter, weniger dicht als gewöhnlich. Ich brauchte nur die Bank, die Lampe, den Kohlenhaufen anzusehen und ich spürte, daß ich sterben würde. Natürlich konnte ich meinen Tod nicht klar denken, aber ich sah ihn überall, auf den Dingen, an der Art, wie die Dinge abgerückt waren und sich auf Distanz hielten, zurückhaltend, wie Leute, die am Bett eines Sterbenden leise sprechen. Es war sein Tod, den Tom gerade auf der Bank berührt hatte.
Wenn man mir in dem Zustand, in dem ich war, mitgeteilt hätte, daß ich getrost nach Hause gehen könnte, daß man mich am Leben ließe, hätte mich das kaltgelassen: ein paar Stunden oder ein paar Jahre warten, das ist alles gleich, wenn man die Illusion, ewig zu sein, verloren hat. Mir lag an nichts mehr, in gewisser Weise war ich ruhig. Aber das war eine fürchterliche Ruhe – wegen meines Körpers: mein Körper, ich sah mit seinen Augen, ich hörte mit seinen Ohren, aber das war nicht mehr ich; er schwitzte und zitterte ganz von selbst, und ich erkannte ihn nicht mehr wieder. Ich mußte ihn berühren und ansehen, um zu wissen, was mit ihm war, als wäre es der Körper eines anderen. Manchmal fühlte ich ihn noch, ich fühlte ein Rutschen, so etwas wie ein Absacken, wie wenn man in einem Flugzeug ist, das einen Sturzflug macht, oder ich fühlte mein Herz schlagen. Aber das beruhigte mich nicht: alles, was von meinem Körper kam, hatte etwas widerlich Unzuverlässiges an sich. Meistens war er zusammengesunken, verhielt er sich still, und ich fühlte nichts mehr als eine Art Schwere, eine ekelhafte Gegenwart an mir; ich hatte den Eindruck, an ein riesiges Ungeziefer gebunden zu sein. Einen Moment lang tastete ich meine Hose ab und fühlte, daß sie feucht war; ich wußte nicht, ob sie von Schweiß oder von Urin naß war, aber ich ging vorsichtshalber auf den Kohlehaufen pissen.
Der Belgier zog seine Uhr heraus und schaute nach. Er sagte:
«Es ist halb vier.»
Das Schwein! Er hatte es bestimmt absichtlich getan: Tom sprang hoch: wir hatten noch nicht gemerkt, daß die Zeit verrann; die Nacht umgab uns wie eine formlose und dunkle Masse, ich erinnerte mich nicht einmal, daß sie angefangen hatte.
Der kleine Juan fing an zu schreien. Er rang die Hände, er flehte:
«Ich will nicht sterben, ich will nicht sterben.»
Er lief mit erhobenen Armen durch den ganzen Keller, dann warf er sich auf einen der Strohsäcke und schluchzte. Tom sah ihn mit stumpfen Augen an und hatte nicht einmal mehr Lust, ihn zu trösten. Tatsächlich lohnte es sich nicht: der Kleine machte mehr Krach als wir, aber es ging ihm weniger schlecht: er war wie ein Kranker, der sich mit Fieber gegen seine Krankheit wehrt. Wenn einer nicht einmal mehr Fieber hat, ist es viel schlimmer.
Er weinte: ich sah genau, daß er Mitleid mit sich selbst hatte; er dachte nicht an den Tod. Eine Sekunde, eine einzige Sekunde lang hatte ich Lust, auch zu weinen, vor Selbstmitleid. Aber das Gegenteil trat ein: ich warf einen Blick auf den Kleinen, ich sah seine mageren, vom Schluchzen geschüttelten Schultern und fühlte mich unmenschlich: ich konnte weder mit den anderen noch mit mir Mitleid haben. Ich sagte mir: «Ich will anständig sterben.»
Tom war aufgestanden, er stellte sich genau unter die runde Öffnung und fing an, auf den Tag zu lauern. Ich war stur, ich wollte anständig sterben und dachte nur daran. Aber darunter fühlte ich, seit der Arzt uns die Uhrzeit gesagt hatte, die Zeit, die zerrann, die Tropfen für Tropfen entwich.
Es war noch dunkel, als ich Toms Stimme hörte:
«Hörst du sie?»
«Ja.»
Es marschierten welche in den Hof.
«Was wollen die denn? Die können doch nicht im Dunkeln schießen.»
Nach einer Weile hörten wir nichts mehr. Ich sagte zu Tom:
«Es ist Tag.»
Pedro stand gähnend auf und blies die Lampe aus. Er sagte zu seinem Kameraden:
«Eine Saukälte.»
Der Keller war ganz grau geworden. Wir hörten in der Ferne Schüsse.
«Es geht los», sagte ich zu Tom, «die machen das bestimmt im Hinterhof.»
Tom bat den Arzt, ihm eine Zigarette zu geben. Ich wollte keine; ich wollte weder Zigaretten noch Alkohol. Von diesem Augenblick an hörten sie nicht auf zu schießen.
«Ist dir klar, was das bedeutet?» sagte Tom.
Er wollte etwas hinzufügen, aber er verstummte, er schaute auf die Tür. Die Tür ging auf, und ein Leutnant kam mit vier Soldaten herein. Tom ließ seine Zigarette fallen.
«Steinbock?»
Tom antwortete nicht. Es war Pedro, der auf ihn zeigte.
«Juan Mirbal?»
«Das ist der auf dem Strohsack.»
«Stehen Sie auf», sagte der Leutnant.
Juan rührte sich nicht. Zwei Soldaten faßten ihn unter den Achseln und stellten ihn auf die Füße. Aber sobald sie ihn losgelassen hatten, fiel er wieder um.
Die Soldaten zögerten.
«Das ist nicht der erste, dem schlecht wird», sagte der Leutnant, «ihr müßt ihn schon tragen, ihr zwei; wir werden da hinten irgendwie zurechtkommen.»
Er wandte sich Tom zu:
«Vorwärts, kommen Sie.»
Tom ging zwischen zwei Soldaten hinaus. Zwei weitere Soldaten folgten, sie trugen den Kleinen unter den Achseln und in den Kniekehlen. Er war nicht ohnmächtig; seine Augen waren weit geöffnet, und Tränen liefen seine Backen hinunter. Als ich hinausgehen wollte, hielt der Leutnant mich an:
«Sind Sie Ibbieta?»
«Ja.»
«Sie warten hier: Sie werden nachher geholt.»
Sie gingen hinaus. Der Belgier und die beiden Gefangenenwärter gingen auch hinaus; ich blieb allein. Ich verstand nicht, was mir geschah, aber es wäre mir lieber gewesen, sie hätten sofort ein Ende gemacht. Ich hörte die Salven in beinah regelmäßigen Abständen; bei jeder einzelnen erschauerte ich. Ich hatte Lust zu heulen und mir die Haare zu raufen. Aber ich biß die Zähne zusammen und bohrte die Hände in die Taschen, denn ich wollte anständig bleiben.
Nach einer Stunde wurde ich geholt und in den ersten Stock gebracht, in einen kleinen Raum, der nach Zigarren roch und dessen Hitze mir erstickend vorkam. Dort waren zwei Offiziere, die rauchend im Sessel saßen mit Papieren auf den Knien.
«Du heißt Ibbieta?»
«Ja.»
«Wo ist Ramón Gris?»
«Ich weiß nicht.»
Der mich verhörte, war klein und dick. Er hatte harte Augen hinter seinem Kneifer. Er sagte:
«Tritt näher.»