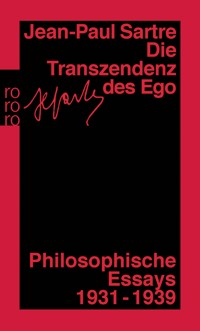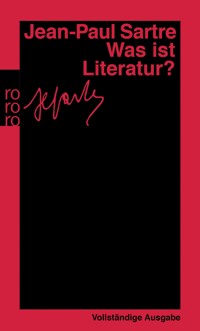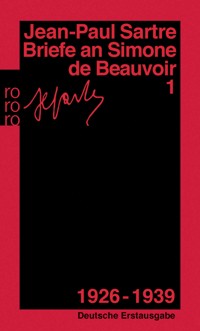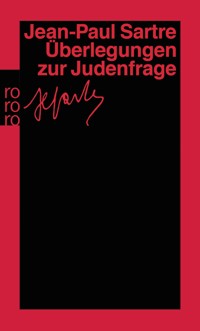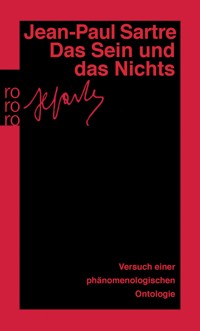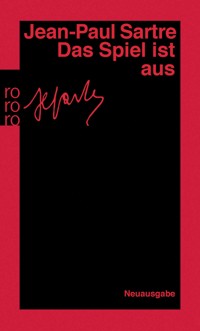10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Wege der Freiheit
- Sprache: Deutsch
"Zeit der Reife" ist der erste Band des Romanzyklus "Wege der Freiheit". Ihm folgen die Bände "Der Aufschub", "Der Pfahl im Fleische" und "Die letzte Chance". Jean-Paul Sartre lässt seine Romanfiguren seine eigene Erfahrung erleben: Ein kleiner Kreis Pariser Freunde auf dem Weg der Selbstverwirklichung wird jäh und unvorbereitet in den Zweiten Weltkrieg gestürzt. Eine spannende Beschwörung nicht allzu ferner Zeitgeschichte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 574
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Jean-Paul Sartre
Zeit der Reife
Roman
Über dieses Buch
«Zeit der Reife» ist der erste Band des Romanzyklus «Wege der Freiheit». Ihm folgen die Bände «Der Aufschub», «Der Pfahl im Fleische» und «Die letzte Chance». Jean-Paul Sartre lässt seine Romanfiguren seine eigene Erfahrung erleben: Ein kleiner Kreis Pariser Freunde auf dem Weg der Selbstverwirklichung wird jäh und unvorbereitet in den Zweiten Weltkrieg gestürzt. Eine spannende Beschwörung nicht allzu ferner Zeitgeschichte.
Vita
Geboren am 21.6.1905, wuchs er nach dem frühen Tod seines Vaters im Jahre 1906 bis zur Wiederheirat seiner Mutter im Jahre 1917 bei seinen Großeltern Schweitzer in Paris auf. 1929, vor seiner Agrégation in Philosophie, lernte er seine Lebensgefährtin Simone de Beauvoir kennen, mit der er eine unkonventionelle Bindung einging, die für viele zu einem emanzipatorischen Vorbild wurde. 1931–1937 war er Gymnasiallehrer in Philosophie in Le Havre und Laon und 1937–1944 in Paris. 1933 Stipendiat des Institut français in Berlin, wo er sich mit der Philosophie Husserls auseinandersetzte.
Am 2.9.1939 wurde er eingezogen und geriet 1940 in deutsche Kriegsgefangenschaft, aus der er 1941 mit gefälschten Entlassungspapieren entkam. Noch 1943 wurde unter deutscher Besatzung sein erstes Theaterstück «Die Fliegen» aufgeführt; im selben Jahr erschien sein philosophisches Hauptwerk «Das Sein und das Nichts». Unmittelbar nach dem Krieg wurde Sartres Philosophie unter dem journalistischen Schlagwort «Existenzialismus» zu einem modischen Bezugspunkt der Revolte gegen bürgerliche Lebensformen. 1964 lehnte er die Annahme des Nobelpreises ab. Zahlreiche Reisen führten ihn in die USA, die UdSSR, nach China, Haiti, Kuba, Brasilien, Nordafrika, Schwarzafrika, Israel, Japan und in fast alle Länder Europas. Er traf sich mit Roosevelt, Chruschtschow, Mao Tse-tung, Castro, Che Guevara, Tito, Kubitschek, Nasser, Eschkol. Sartre starb am 15.4.1980 in Paris.
Auszeichnungen: Prix du roman populiste für «Le mur» (1940); Nobelpreis für Literatur (1964, abgelehnt); Ehrendoktor der Universität Jerusalem (1976).
Impressum
Die französische Erstausgabe erschien 1945 unter dem Titel «L’âge de raison» im Verlag der Librairie Gallimard, Paris. Die neue deutsche Übersetzung folgt der 1981 bei den Éditions Gallimard, Paris, in der Bibliothèque de la Pléiade von Michel Contat und Michel Rybalka herausgegebenen Ausgabe.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Oktober 2023
Copyright © 1949 by Rowohlt Verlag GmbH, Stuttgart
Copyright © 1986 by Rowohlt Verlag GmbH,
Reinbek bei Hamburg
«L’âge de raison» Copyright © 1945 by
Librairie Gallimard, Paris,
und Copyright © 1981 by Éditions Gallimard, Paris
Covergestaltung Barbara Hanke
Coverabbildung FontShop
ISBN 978-3-644-01886-0
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Zu diesem Buch
Zeit der Reife ist der erste Band des unvollendeten Romanzyklus Die Wege der Freiheit. Sartre gelingt darin das Kunststück, Figuren zu erfinden, die seine Philosophie, den Existentialismus, vorleben und dennoch äußerst farbige und charakteristische Menschen aus Fleisch und Blut sind. Sie werden in unvorhergesehene Ereignisse und Handlungen verwickelt. Ebenso wie seine Philosophie gehen auch Sartres Romane von den unzähligen, meist widersprüchlichen Regungen, Wünschen, Selbsttäuschungen, Aversionen des Alltagslebens aus, die in bestimmten Momenten in Entscheidungen umgesetzt werden müssen, von denen sie entweder, entsprechend oder entgegen gewissen moralischen Grundsätzen, befriedigt oder unterdrückt werden – Entscheidungen, die oft in Lüge, Feigheit, Selbstbetrug oder Verrat münden. Dieser ständige Zwang zu Entscheidungen, für die man volle Verantwortung trägt, obwohl man ihre Folgen oft nicht voraussehen kann, dieses Zur-Freiheit-verurteilt-Sein, wie Sartre es nennt, wird uns auf beklemmende Weise in immer neuen Konstellationen vorgeführt.
Dabei beleuchtet Sartre seine eigene Philosophie durchaus in ironischer Distanz. Mathieu Delarue, der Hauptfigur, einem Pariser Gymnasiallehrer, hat er viele eigene Züge verliehen, oft in selbstkarikierender Weise. Im Mittelpunkt der Handlung steht die Frage: Soll Mathieu das Kind seiner langjährigen Geliebten abtreiben lassen, oder soll er es aufziehen und sie heiraten? Er hatte beschlossen, sich durch niemanden und nichts zu binden, sich in jedem Moment seines Lebens so zu verhalten, daß er verfügbar und frei bleibt. Bei der Entscheidung über Leben und Tod seines Kindes erfährt er zweierlei: 1. bisher hat er seinen Grundsatz nicht radikal genug gelebt, ist nie bis zum Äußersten gegangen, 2. hat eine Entscheidung zur Freiheit nur dann einen Sinn, wenn sie sich nicht auf etwas Beliebiges, Folgenloses bezieht, sondern zu einer Tat führt, deren Ergebnis man anzunehmen hat. Erst dann hat man die «Zeit der Reife» erreicht.
Um Mathieu kreisen einige wenige Figuren, deren Modell Sartre in seiner Umgebung vorfand: das exzentrische Geschwisterpaar weißrussischer Herkunft Boris und Ivich, die drogensüchtige Chansonsängerin Lola, der sadomasochistische Homosexuelle Daniel, der engagierte Kommunist Brunet, die selbstlose Jüdin Sarah. Heutigen Lesern vermittelt der Roman viel von der unwiederbringlichen Atmosphäre der Pariser dreißiger Jahre vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. Aber die heraufziehende Katastrophe, die mit dem Spanischen Bürgerkrieg und der Kapitulation der Westmächte vor Hitlers Kriegsdrohungen wegen der Sudetenfrage beginnt, kündigt sich bereits in der unbekümmerten, launenhaften und ahnungslosen Willen- und Ziellosigkeit der Hauptfiguren an, die damit ein Abbild der fahrlässigen Verharmlosung des Faschismus durch die westlichen Demokratien bieten.
Im zweiten und dritten Band, Der Aufschub und Der Pfahl im Fleische, werden die Figuren des ersten Bandes, zusammen mit vielen anderen, unwiderruflich ins Zeitgeschehen hineingerissen, bis sich im unvollendeten letzten Band, Die letzte Chance, die Hauptpersonen Mathieu und Brunet, inzwischen in deutsche Kriegsgefangenschaft geraten, jeder auf seine Weise zum aktiven Widerstand entscheiden.
Für Wanda Kosakiewicz
1
Mitten auf der Rue Vercingétorix faßte ein großer Typ Mathieu beim Arm; ein Polizist ging auf dem anderen Bürgersteig auf und ab.
«Gib mir was, Chef; ich habe Hunger.»
Er hatte engstehende Augen und dicke Lippen, er roch nach Alkohol.
«Hast du nicht vielleicht eher Durst?» fragte Mathieu.
«Ich schwör’s dir, Kumpel», sagte der Kerl mühsam, «ich schwör’s dir.»
Mathieu hatte ein 100-Sous-Stück in der Tasche gefunden:
«Das ist mir übrigens scheißegal», sagte er, «das hab ich nur so gesagt.»
Er gab ihm die hundert Sous.
«Was du da machst», sagte der Kerl und lehnte sich an die Mauer, «ist gut; dafür werde ich dir was Tolles wünschen. Was soll ich dir wünschen?»
Sie überlegten beide; Mathieu sagte: «Was du willst.»
«Na gut, ich wünsch dir Glück», sagte der Kerl. «So!»
Er lachte triumphierend. Mathieu sah, daß der Polizist auf sie zukam, und hatte Angst um den Typ:
«Ist gut», sagte er, «Salut.»
Er wollte weggehen, aber der Typ faßte wieder nach ihm:
«Das ist nicht genug: Glück», sagte er rührselig, «das ist nicht genug.»
«Ach komm, was willst du denn noch!»
«Ich möchte dir was schenken …»
«Ich laß dich wegen Bettelei einlochen», sagte der Polizist.
Er war blutjung, hatte rote Backen; er versuchte, hart auszusehen:
«Seit einer halben Stunde belästigst du die Passanten», fügte er unsicher hinzu.
«Er bettelt nicht», sagte Mathieu schnell, «wir unterhalten uns.»
Der Polizist zuckte die Achseln und ging weiter. Der Typ schwankte beunruhigend; er schien den Polizisten nicht einmal gesehen zu haben.
«Ich habe was gefunden, was ich dir schenke. Ich schenke dir eine Briefmarke aus Madrid.»
Er zog ein Rechteck aus grünem Karton aus der Tasche und reichte es Mathieu. Mathieu las:
«C. N. T. Diario Confederal. Ejemplares 2. Frankreich. Anarchosyndikalistisches Komitee, Rue de Belleville 41, Paris 19.» Eine Briefmarke war unter die Adresse geklebt. Sie war ebenfalls grün, sie trug den Poststempel von Madrid. Mathieu streckte die Hand aus:
«Vielen Dank.»
«Ja, aber paß auf!» sagte der Kerl wütend. «Das ist … das ist Madrid.»
Mathieu sah ihn an: der Typ sah gerührt aus und strengte sich ungeheuer an, seinen Gedanken auszudrücken. Er gab es auf und sagte nur:
«Madrid.»
«Ja.»
«Ich wollte hin, ich schwör’s dir. Das hat bloß nicht geklappt.»
Er war düster geworden, er sagte: «Warte», und fuhr langsam mit dem Finger über die Briefmarke.
«Ist gut. Du kannst sie nehmen.»
«Danke.»
Mathieu ging ein paar Schritte, aber der Kerl rief ihn zurück:
«He!»
«Was?» fragte Mathieu. Der Kerl zeigte ihm von weitem das 100-Sous-Stück:
«Einer hat mir eben hundert Sous zugesteckt. Ich spendiere dir einen Rum.»
«Heute abend nicht.»
Mathieu ging mit vagem Bedauern weg. Es hatte in seinem Leben eine Zeit gegeben, da war er mit jedem in den Straßen, in den Bars herumgezogen, der erste beste konnte ihn einladen. Jetzt war es damit vorbei: solche Sachen führten nie zu etwas. Er war witzig. Er hat Lust gehabt, nach Spanien zu gehen und zu kämpfen. Mathieu beschleunigte den Schritt, er dachte gereizt: ‹Wir hatten uns sowieso nichts zu sagen.› Er zog die grüne Karte aus der Tasche: ‹Sie kommt aus Madrid, aber sie ist nicht an ihn adressiert. Jemand muß sie an ihn weitergegeben haben. Er hat sie mehrmals berührt, bevor er sie mir gab, weil sie aus Madrid kam.› Er erinnerte sich an das Gesicht des Kerls und an den Ausdruck, mit dem er die Briefmarke angesehen hatte: einen komischen hingerissenen Ausdruck. Mathieu sah sich im Weitergehen selbst die Marke an, dann steckte er das Stück Karton wieder in die Tasche. Ein Zug pfiff, und Mathieu dachte: ‹Ich bin alt.›
Es war zehn Uhr fünfundzwanzig; Mathieu war zu früh da. Er ging, ohne stehenzubleiben, sogar ohne den Kopf zu wenden, an dem kleinen blauen Haus vorbei. Aber er sah aus den Augenwinkeln hin. Alle Fenster waren dunkel, bis auf das von Madame Duffet. Marcelle hatte noch keine Zeit gehabt, die Haustür aufzumachen: sie stand über ihre Mutter gebeugt und deckte sie mit männlichen Gesten in dem großen Himmelbett zu. Mathieu blieb mürrisch, er dachte: ‹Fünfhundert Francs bis zum 29., das macht dreißig Francs pro Tag, eher weniger. Wie soll ich das schaffen?› Er machte kehrt und ging zurück.
Das Licht in Madame Duffets Zimmer war ausgegangen. Nach einer Weile wurde Marcelles Fenster hell; Mathieu überquerte die Fahrbahn und ging an dem Lebensmittelgeschäft entlang, wobei er es vermied, mit seinen neuen Schuhsohlen zu knarren. Die Tür war angelehnt; er schob sie ganz leise auf, und sie quietschte: ‹Mittwoch bringe ich mein Ölkännchen mit und öle die Angeln ein bißchen.› Er trat ein, machte die Tür wieder zu und zog sich im Dunkeln die Schuhe aus. Die Treppe knackte ein wenig: Mathieu stieg sie mit den Schuhen in der Hand vorsichtig hinauf; er tastete jede Stufe mit dem Zeh ab, bevor er den Fuß darauf setzte: ‹Was für ein Theater›, dachte er.
Marcelle öffnete ihre Tür, bevor er den Treppenabsatz erreicht hatte. Ein nach Iris duftender rosa Dunst strömte aus ihrem Zimmer und verbreitete sich auf der Treppe. Sie hatte ihr grünes Hemd an. Mathieu sah die weiche, fette Kurve ihrer Hüften durchschimmern. Er trat ein; es kam ihm immer so vor, als beträte er eine Muschel. Marcelle schloß die Tür ab. Mathieu ging zum großen Wandschrank, machte ihn auf und stellte seine Schuhe hinein; dann sah er Marcelle an und merkte, daß etwas nicht stimmte.
«Stimmt was nicht?» fragte er leise.
«Doch, es geht», sagte Marcelle leise, «und du, alter Freund?»
«Ich bin pleite; sonst geht’s.»
Er küßte sie auf den Hals und auf den Mund. Der Hals roch nach Ambra, der Mund nach billigem Tabak. Marcelle setzte sich auf die Bettkante und sah ihre Beine an, während Mathieu sich auszog.
«Was ist denn das?» fragte Mathieu.
Auf dem Kamin stand eine Fotografie, die er nicht kannte. Er trat näher und sah ein dünnes junges Mädchen mit einer Jungenfrisur, das streng und schüchtern lachte. Es trug eine Männerjacke und flache Schuhe.
«Das bin ich», sagte Marcelle, ohne den Kopf zu heben.
Mathieu drehte sich um; Marcelle hatte ihr Hemd bis über die fetten Oberschenkel hochgeschoben und beugte sich vor, und Mathieu ahnte unter dem Hemd die Zartheit ihrer schweren Brust.
«Wo hast du das gefunden?»
«In einem Album. Sie ist vom Sommer 28.»
Mathieu faltete sorgfältig sein Jackett zusammen und legte es in den Schrank neben seine Schuhe. Er fragte:
«Siehst du dir neuerdings Familienalben an?»
«Nein, aber ich weiß nicht, heute hatte ich Lust, Dinge aus meinem Leben wiederzusehen, wie ich war, bevor ich dich kennenlernte, als ich gesund war. Bring es mal her.»
Mathieu brachte ihr das Foto, und sie riß es ihm aus der Hand. Er setzte sich neben sie. Sie fröstelte und rückte etwas ab. Sie sah das Foto mit unbestimmtem Lächeln an.
«Ich war ulkig», sagte sie.
Das junge Mädchen stand stocksteif an einem Gartengitter. Sie machte den Mund auf; sie sagte wohl auch: ‹Das ist ulkig› mit der gleichen linkischen Unbekümmertheit, der gleichen kleinlauten Keckheit. Nur war sie jung und dünn.
Marcelle schüttelte den Kopf.
«Ulkig! Ulkig! Es ist im Jardin du Luxembourg aufgenommen, von einem Pharmaziestudenten. Siehst du, was für einen Blouson ich anhabe? Ich hatte ihn mir am selben Tag gekauft, weil wir am Sonntag darauf eine große Wanderung nach Fontainebleau machen wollten. Mein Gott! …»
Sicher stimmte etwas nicht: noch nie waren ihre Gesten so heftig und ihre Stimme so abgehackt, so männlich gewesen. Sie saß auf der Bettkante, schlimmer als nackt, wehrlos, wie eine dicke chinesische Porzellanvase, in dem rosa Zimmer, und es war eher peinlich, sie mit ihrer Männerstimme reden zu hören, während ein starker dunkler Geruch von ihr ausging. Mathieu faßte sie bei den Schultern und zog sie an sich:
«Trauerst du der Zeit damals nach?»
Marcelle sagte schroff:
«Der Zeit damals nicht: ich trauere dem Leben nach, das ich hätte haben können.»
Sie hatte ein Chemiestudium angefangen, und die Krankheit hatte es beendet. Mathieu dachte: ‹Sie ist offenbar böse auf mich.› Er machte den Mund auf, um sie auszufragen, aber er sah ihre Augen und schwieg. Sie betrachtete das Foto traurig und angespannt.
«Ich bin dicker geworden, nicht?»
«Ja.»
Sie zuckte die Achseln und warf die Fotografie aufs Bett. Mathieu dachte: ‹Es stimmt, sie hat ein trostloses Leben.› Er wollte sie auf die Wange küssen, aber sie entzog sich, ohne schroff zu sein, mit einem kurzen nervösen Lachen. Sie sagte:
«Das ist zehn Jahre her.»
Mathieu dachte: ‹Ich gebe ihr nichts.› Vier Nächte in der Woche kam er zu ihr; er erzählte ihr minuziös alles, was er gemacht hatte; sie gab ihm mit ernster, leicht autoritärer Stimme Ratschläge; sie sagte oft: ‹Ich lebe ein Ersatzleben.› Er fragte:
«Was hast du gestern gemacht? Bist du weg gewesen?»
Marcelle machte eine überdrüssige runde Bewegung:
«Nein, ich war müde. Ich habe ein bißchen gelesen, aber Mama hat mich dauernd wegen dem Geschäft gestört.»
«Und heute?»
«Heute bin ich weg gewesen», sagte sie mißmutig. «Ich wollte Luft schnappen, mit Menschen zusammenkommen. Ich bin bis zur Rue de la Gaîté runtergegangen, das hat mir Spaß gemacht; und außerdem wollte ich Andrée sehen.»
«Hast du sie gesehen?»
«Ja, fünf Minuten. Als ich von ihr weggegangen bin, fing es an zu regnen, das ist ein komischer Juni, und außerdem hatten die Leute widerliche Gesichter. Ich habe ein Taxi genommen und bin nach Hause gefahren.»
Sie fragte lahm:
«Und du?»
Mathieu hatte keine Lust zu erzählen. Er sagte:
«Gestern war ich im Gymnasium und habe meine letzten Stunden gegeben. Ich habe bei Jacques zu Abend gegessen, es war sterbenslangweilig wie gewöhnlich. Heute morgen bin ich bei der Verwaltung vorbeigegangen, um zu sehen, ob sie mir nicht was vorstrecken können; das wird offenbar nicht gemacht. Aber in Beauvais habe ich mich mit dem Verwalter arrangiert. Anschließend habe ich Ivich besucht.»
Marcelle zog die Augenbrauen hoch und sah ihn an. Er redete nicht gern mit ihr über Ivich. Er fügte hinzu:
«Sie ist im Moment nicht ganz da.»
«Weshalb?»
Marcelles Stimme war fester geworden, und ihr Gesicht hatte einen vernünftigen, männlichen Ausdruck angenommen; sie sah aus wie ein fetter Levantiner. Er sagte gezwungen:
«Sie wird wohl durchfallen.»
«Du hast mir doch gesagt, daß sie arbeitet.»
«Na ja … wie man’s nimmt, auf ihre Art, das heißt, sie sitzt wahrscheinlich stundenlang vor einem Buch, ohne sich zu rühren. Aber du weißt ja, wie sie ist: sie hat Evidenzen, wie die Verrückten. Im Oktober konnte sie ihr botanisches Pensum, der Prüfer war zufrieden; und dann, auf einmal, hat sie sich einem Glatzkopf gegenübergesehen, der über Hohltiere sprach. Das kam ihr hirnverbrannt vor, sie hat gedacht: ‹Mir sind Hohltiere scheißegal›, und der Glatzkopf hat kein Wort mehr aus ihr rausholen können.»
«Komisches Mädchen», sagte Marcelle grüblerisch.
«Jedenfalls», sagte Mathieu, «habe ich Angst, daß sie wieder mit so was anfängt. Oder daß sie irgendwas ausheckt, du wirst ja sehen.»
Dieser Ton, dieser gönnerhaft unbeteiligte Ton, war das nicht eine Lüge? Alles, was man mit Wörtern ausdrücken konnte, sagte er. ‹Aber es gibt nicht bloß Wörter!›
Er zögerte einen Augenblick, dann senkte er entmutigt den Kopf: Marcelle wußte alles über seine Zuneigung zu Ivich; sie hätte sogar akzeptiert, daß er sie liebte. Sie verlangte im Grunde nur eines: daß er genau in diesem Ton von Ivich sprach. Mathieu hatte nicht aufgehört, Marcelles Rücken zu streicheln, und Marcelle fing an zu blinzeln: sie hatte es gern, wenn er ihr den Rücken streichelte, vor allem ganz unten und zwischen den Schulterblättern. Aber plötzlich entzog sie sich, und ihr Gesicht wurde hart. Mathieu sagte zu ihr:
«Hör zu, Marcelle, es ist mir scheißegal, ob Ivich durchfällt, sie ist genausowenig geeignet, Arzt zu werden, wie ich. Selbst wenn sie das Physikum besteht, bei der ersten Leichensektion im nächsten Semester würde sie sowieso umkippen und die Universität nie wieder betreten. Aber wenn es diesmal nicht klappt, macht sie eine Dummheit. Wenn sie durchfällt, will ihre Familie sie nicht weitermachen lassen.»
Marcelle fragte präzise:
«Was für eine Dummheit meinst du genau?»
«Ich weiß nicht», sagte er irritiert.
«Oh, ich kenne dich gut, mein Lieber. Du wagst nicht, es zuzugeben, aber du hast Angst, daß sie sich mit einer Kugel ein Loch in die Haut schießt. Und so was behauptet, es würde Romanhaftes verabscheuen. Sag mal, das hört sich so an, als hättest du sie nie gesehen, ihre Haut. Ich hätte eine Heidenangst, daß sie einen Riß bekommt, schon wenn ich mit dem Finger darüberführe. Und du bildest dir ein, daß Puppen, die so eine Haut haben, sich mit Revolverschüssen beschädigen? Ich kann sie mir sehr gut vorstellen, wie sie, in einem Sessel zusammengesunken, alle Haare im Gesicht, gebannt auf einen süßen kleinen Browning starrt, der auf sie gerichtet ist, das ist sehr russisch. Aber mir etwas anderes vorzustellen, nein, nein, nein! Ein Revolver, alter Freund, ist für unsere Krokodilshaut bestimmt.»
Sie drückte ihren Arm an den von Mathieu. Er hatte eine weißere Haut als Marcelle.
«Sieh dir das an, mein Lieber, vor allem meine, wie Saffianleder.»
Sie fing an zu lachen:
«Findest du nicht, daß ich alles habe, um einen Schaumlöffel abzugeben? Ich stelle mir ein hübsches kreisrundes Löchlein unter meiner linken Brust vor, mit sauberem und glattem und ganz rotem Rand. Das wäre nicht häßlich.»
Sie lachte immer noch. Mathieu legte ihr die Hand auf den Mund:
«Sei still, du weckst die Alte.»
Sie verstummte. Er sagte:
«Wie nervös du bist!»
Sie antwortete nicht. Mathieu legte die Hand auf Marcelles Bein und streichelte es sanft. Er liebte dieses wabbelige, butterweiche Fleisch mit den zarten Härchen, die unter seinem Streicheln wie tausend feine Schauer waren. Marcelle regte sich nicht: sie sah Mathieus Hand an. Schließlich nahm Mathieu seine Hand weg.
«Sieh mich an», sagte er.
Er sah einen Augenblick lang ihre dunkelumrandeten Augen, einen hochmütigen und verzweifelten Blick lang.
«Was hast du?»
«Ich habe nichts», sagte sie und wandte den Kopf ab.
So war es immer mit ihr: sie war zugeknöpft. Gleich würde sie nicht mehr an sich halten können: sie würde explodieren. Man konnte nichts tun als bis dahin die Zeit totschlagen. Mathieu fürchtete diese stillen Explosionen: Leidenschaft war in diesem Muschelzimmer unerträglich, weil sie leise und ohne Gebärde geäußert werden mußte, um Madame Duffet nicht zu wecken. Mathieu stand auf, ging zum Schrank und nahm das Stück Karton aus seiner Jackentasche.
«Da, sieh mal.»
«Was ist das?»
«Ein Typ hat sie mir vorhin auf der Straße gegeben. Er sah sympathisch aus, und ich habe ihm ein bißchen Geld gegeben.»
Marcelle nahm die Karte gleichgültig. Mathieu fühlte sich mit dem Kerl irgendwie komplizenhaft verbunden. Er fügte hinzu:
«Weißt du, für ihn bedeutete das etwas.»
«War er Anarchist?»
«Ich weiß nicht. Er wollte mir einen ausgeben.»
«Hast du abgelehnt?»
«Ja.»
«Warum?» fragte Marcelle lässig. «Das hätte amüsant sein können.»
«Ach woher!» sagte Mathieu.
Marcelle hob den Kopf und betrachtete kurzsichtig und belustigt die Stutzuhr.
«Komisch», sagte sie, «das geht mir immer auf die Nerven, wenn du mir solche Sachen erzählst: und heute gibt es wieder weiß Gott wie viele. Dein Leben ist voller verpaßter Gelegenheiten.»
«Du nennst das eine verpaßte Gelegenheit?»
«Ja. Früher hättest du wer weiß was getan, um solche Begegnungen herbeizuführen.»
«Ich habe mich vielleicht ein bißchen verändert», sagte Mathieu gutwillig. «Was denkst du? Daß ich alt geworden bin?»
«Du bist vierunddreißig», sagte Marcelle bloß.
Vierunddreißig. Mathieu dachte an Ivich und war leicht verärgert.
«Ja … Hör zu, ich glaube nicht, daß es das ist; es war eher eine gewisse Vorsicht. Verstehst du, ich wäre nicht in der richtigen Stimmung gewesen.»
«Es ist jetzt so selten, daß du in der richtigen Stimmung bist», sagte Marcelle.
Mathieu fügte schnell hinzu:
«Er wäre übrigens auch nicht in der richtigen Stimmung gewesen: wenn man besoffen ist, ist man pathetisch. Das wollte ich vermeiden.»
Er dachte: ‹Das stimmt nicht ganz; ich habe nicht so viel nachgedacht.› Er wollte sich zu mehr Aufrichtigkeit zwingen. Mathieu und Marcelle hatten verabredet, sich immer alles zu sagen.
«Es war so …» sagte er.
Aber Marcelle hatte angefangen zu lachen. Sie gurrte tief und leise, wie wenn sie ihm über die Haare strich und sagte: ‹Mein Lieber.› Sie sah jedoch nicht liebevoll aus.
«Das sieht dir ähnlich», sagte sie. «Was für eine Angst du vor dem Pathetischen hast! Na und? Selbst wenn du mit dem armen Jungen ein bißchen pathetisch gewesen wärst, was wäre schlimm daran?»
«Was hätte mir das gebracht?» fragte Mathieu.
Er verteidigte sich gegen sich selbst.
Marcelle lächelte ungnädig: ‹Sie sucht Streit mit mir›, dachte Mathieu irritiert. Er fühlte sich friedlich, ein bißchen stumpf, alles in allem guter Laune, und er hatte keine Lust zu streiten.
«Hör mal», sagte er, «du darfst die Geschichte nicht so aufbauschen. Erstens hatte ich keine Zeit: ich war unterwegs zu dir.»
«Du hast vollkommen recht», sagte Marcelle. «Es ist nichts. Überhaupt nichts, wenn man so will; das ist nicht der Rede wert … Aber es ist trotzdem symptomatisch.»
Mathieu zuckte zusammen: wenn sie nur nicht so abstoßende Wörter gebrauchen wollte.
«Also sag schon», sagte er. «Was findest du daran so interessant?»
«Nun», sagte sie, «es ist mal wieder deine berühmte Luzidität. Du bist amüsant, mein Lieber, du hast dermaßen Schiß, dir selbst etwas vorzumachen, daß du lieber das schönste Abenteuer der Welt ausschlagen würdest, als daß du riskierst, dich zu belügen.»
«Ja, ja», sagte Mathieu, «du weißt es ja. Es ist lange her, daß wir es besprochen haben.»
Er fand sie ungerecht. Diese «Luzidität» (er haßte diesen Ausdruck, aber Marcelle hatte ihn seit einiger Zeit übernommen. Im vergangenen Winter war es «Dringlichkeit»: Wörter hielten sich bei ihr kaum länger als eine Saison), diese Luzidität hatten sie sich gemeinsam angewöhnt, sie waren einander dafür verantwortlich, es war nichts weniger als der tiefe Sinn ihrer Liebe. Als Mathieu die Beziehung zu Marcelle eingegangen war, hatte er für immer auf einsame Gedanken verzichtet, auf muntere, schattige und schüchterne Gedanken, die früher mit der verstohlenen Regsamkeit von Fischen in ihm herumhuschten. Er konnte Marcelle nur in aller Luzidität lieben: sie war seine Luzidität, sein Gefährte, sein Zeuge, sein Ratgeber, sein Richter.
«Wenn ich mich belöge, hätte ich den Eindruck, gleichzeitig dich zu belügen. Das wäre unerträglich für mich.»
«Ja», sagte Marcelle.
Sie schien nicht sehr überzeugt.
«Du scheinst nicht sehr überzeugt?»
«Doch», sagte sie lahm.
«Glaubst du, daß ich mich belüge?»
«Nein … das heißt, man kann nie wissen. Aber ich denke nicht. Allerdings, weißt du, was ich glaube? Daß du allmählich ein bißchen steril wirst. Ich habe das heute gedacht. Oh, bei dir ist alles sauber und ordentlich; das riecht nach frischer Wäsche; es ist, als hättest du ein Schwitzbad genommen. Nur, daß Schatten fehlt. Es gibt nichts Unnützes mehr, nichts Zögerndes oder Zwielichtiges mehr. Es ist ausgedörrt. Und sag nicht, daß du das für mich tust: du kennst deine Neigung; es macht dir Spaß, dich zu analysieren.»
Mathieu war irritiert. Marcelle gab sich oft ziemlich hart; sie war immer auf der Hut, ein bißchen aggressiv, ein bißchen mißtrauisch, und wenn Mathieu nicht ihrer Meinung war, glaubte sie oft, er wollte sie beherrschen. Aber selten hatte er bei ihr die feste Absicht gespürt, unfreundlich zu ihm zu sein. Und dann war da dieses Foto auf dem Bett … Er musterte Marcelle beunruhigt: der Moment war noch nicht da, wo sie zum Sprechen bereit wäre.
«So sehr interessiert es mich nicht, mich zu kennen», sagte er nur.
«Ich weiß», sagte Marcelle, «es ist kein Zweck, es ist ein Mittel. Um dich von dir selbst zu befreien; dich betrachten, dich beurteilen: das ist deine Lieblingshaltung. Wenn du dich betrachtest, bildest du dir ein, daß du nicht das bist, was du betrachtest, daß du nichts bist. Im Grunde ist das dein Ideal: nichts zu sein.»
«Nichts zu sein», wiederholte Mathieu langsam. «Nein. Das ist es nicht. Hör zu: ich … ich möchte mich nur von mir selbst herleiten.»
«Ja. Frei sein. Völlig frei. Das ist dein Laster.»
«Das ist kein Laster», sagte Mathieu. «Es ist … Was soll man denn sonst tun?»
Er war gereizt: das alles hatte er Marcelle hundertmal erklärt, und sie wußte, daß ihm das am meisten am Herzen lag.
«Wenn … wenn ich nicht versuchte, die Verantwortung für meine Existenz zu übernehmen, käme es mir derartig absurd vor zu existieren.»
Marcelle hatte eine lachende und eigensinnige Miene aufgesetzt:
«Ja, ja … das ist dein Laster.»
Mathieu dachte: ‹Sie geht mir auf die Nerven, wenn sie schelmisch wird.› Aber er hatte Schuldgefühle und sagte sanft:
«Das ist kein Laster: so bin ich nun mal.»
«Warum sind die anderen nicht so, wenn es kein Laster ist?»
«Sie sind genau so, nur machen sie es sich nicht klar.»
Marcelle hatte aufgehört zu lachen, eine harte, traurige Falte war in ihrem Mundwinkel.
«Ich brauche nicht unbedingt frei zu sein», sagte sie.
Mathieu sah ihren gebeugten Nacken an und fühlte sich unbehaglich: immer dieses Schuldgefühl, dieses absurde Schuldgefühl, das ihn plagte, wenn er bei ihr war. Er dachte, daß er sich nie in Marcelle hineinversetzte: ‹Die Freiheit, von der ich ihr erzähle, ist die Freiheit eines gesunden Menschen.› Er legte die Hand auf ihren Hals und drückte dieses pralle, schon etwas verlebte Fleisch sanft mit den Fingern.
«Marcelle? Hast du Ärger?»
Sie wandte ihm etwas trübe Augen zu:
«Nein.»
Sie schwiegen. Mathieu verspürte Lust in den Fingerspitzen. Gerade eben in den Fingerspitzen. Er strich langsam mit der Hand Marcelles Rücken hinunter, und Marcelle senkte die Lider; er sah ihre langen schwarzen Wimpern. Er zog sie an sich: er begehrte sie in diesem Augenblick nicht unbedingt, es war eher die Lust, diesen widerspenstigen, eckigen Geist wie einen Eiszapfen an der Sonne schmelzen zu sehen. Marcelle ließ ihren Kopf auf Mathieus Schulter sinken, und er sah ihre braune Haut, ihre bläulichen, körnigen Ringe unter den Augen aus der Nähe. Er dachte: ‹Du lieber Gott! Wie sie altert!› Und er dachte auch, daß er alt war. Er beugte sich mit so etwas wie Unbehagen über sie: er hätte gern sich selbst und sie vergessen. Aber schon seit langem vergaß er sich nicht mehr, wenn er mit ihr schlief. Er küßte sie auf den Mund; sie hatte einen schönen, schmalen und strengen Mund. Sie sank ganz langsam zurück und legte sich mit geschlossenen Augen, schwer, aufgelöst aufs Bett; Mathieu stand auf, zog Hose und Hemd aus, legte sie ans Fußende, dann streckte er sich neben ihr aus. Aber er sah, daß ihre Augen weit offen und starr waren, sie blickte an die Decke und hatte die Hände unter dem Kopf verschränkt.
«Marcelle», sagte er.
Sie antwortete nicht; sie sah böse aus; und dann, plötzlich, richtete sie sich wieder auf. Er setzte sich wieder auf die Bettkante und war verlegen, weil er sich nackt fühlte.
«Jetzt wirst du mir sagen, was los ist», sagte er fest.
«Nichts ist los», sagte sie schlaff.
«Doch», sagte er liebevoll. «Irgend etwas quält dich, Marcelle! Sagen wir uns nicht alles?»
«Du kannst nichts dafür, und es wird dir Unannehmlichkeiten machen.»
Er strich ihr leicht übers Haar:
«Sag es trotzdem.»
«Na gut – es ist passiert.»
«Was? Was ist passiert?»
«Es ist passiert!»
Mathieu verzog das Gesicht:
«Bist du sicher?»
«Ganz sicher. Du weißt ja, daß ich nie die Nerven verliere: es ist zwei Monate ausgeblieben.»
«Scheiße!» sagte Mathieu.
Er dachte: ‹Seit mindestens drei Wochen hätte sie es mir sagen müssen.› Er wollte irgend etwas mit seinen Händen machen: zum Beispiel seine Pfeife stopfen; aber seine Pfeife war im Schrank in seiner Jacke. Er nahm eine Zigarette vom Nachttisch und legte sie gleich wieder hin.
«So, jetzt weißt du, was los ist», sagte Marcelle. «Was sollen wir machen?»
«Nun, wir … wir lassen es wegmachen, oder?»
«Gut. Also, ich habe eine Adresse», sagte Marcelle.
«Wer hat sie dir gegeben?»
«Andrée. Sie ist da gewesen.»
«Ist das das Weib, das letztes Jahr an ihr rumgepfuscht hat? Hör mal, sie hat sechs Monate gebraucht, bis sie sich davon erholt hat. Das will ich nicht.»
«So? Willst du Vater werden?»
Sie machte sich los, setzte sich in einiger Entfernung von Mathieu wieder hin. Sie sah hart aus, aber nicht wie ein Mann. Sie hatte ihre Hände flach auf die Schenkel gelegt, und ihre Arme glichen zwei Henkeln aus Ton. Mathieu bemerkte, daß ihr Gesicht grau geworden war. Die Luft war rosa und süß, man atmete Rosa, man aß es: und dann war da dieses graue Gesicht, dieser starre Blick, als müßte sie husten und würde es unterdrücken.
«Warte», sagte Mathieu, «du sagst mir das einfach so, unvermittelt: laß uns mal nachdenken.»
Marcelles Hände fingen an zu zittern; sie sagte mit plötzlicher Erregung:
«Ich habe es nicht nötig, daß du nachdenkst; es ist nicht deine Sache, darüber nachzudenken.»
Sie hatte ihm den Kopf zugewandt und sah ihn an. Sie sah Mathieus Hals, Schultern und Hüften an, dann wanderte ihr Blick noch tiefer. Sie sah erstaunt aus. Mathieu wurde knallrot und preßte die Beine zusammen.
«Du kannst nichts dafür», wiederholte Marcelle. Sie fügte mit mühsamer Ironie hinzu:
«Jetzt ist es eine Frauensache.»
Ihr Mund wurde bei diesen Worten verkniffen: ein lackierter Mund mit malvenfarbigem Glanz, ein scharlachrotes Insekt, das dabei war, dieses aschgraue Gesicht zu verschlingen. ‹Sie ist gedemütigt›, dachte Mathieu, ‹sie haßt mich.› Ihm wurde schlecht. Das Zimmer schien sich auf einmal von seinem rosa Dunst entleert zu haben; zwischen den Gegenständen war eine große Leere. Mathieu dachte: ‹Ich habe ihr das angetan!› Und die Lampe, der Spiegel mit seinen bleigrauen Reflexen, die kleine Stutzuhr, der Lehnsessel, der halboffene Schrank kamen ihm plötzlich wie unbarmherzige Maschinen vor: man hatte sie angekurbelt, und sie entfalteten ihre klapprige Existenz mit sturem Eigensinn in der Leere wie die Unterseite einer Wachsplatte, die hartnäckig ihre alte Leier spielt. Mathieu schüttelte sich, ohne sich aus dieser düsteren, säuerlichen Welt losreißen zu können. Marcelle hatte sich nicht gerührt, sie sah immer noch Mathieus Bauch und diese schuldige Blume an, die mit einem impertinenten Ausdruck von Unschuld schlapp auf seinem Schenkel lag. Er wußte, daß sie am liebsten geschrien und geschluchzt hätte, daß sie es aber nicht tun würde, aus Angst, Madame Duffet zu wecken. Er faßte Marcelle abrupt um die Taille und zog sie an sich. Sie warf sich an seine Schulter und schniefte drei- oder viermal, ohne Tränen. Das war alles, was sie sich erlauben konnte: ein trockenes Gewitter.
Als sie den Kopf hob, war sie wieder ruhig. Sie sagte nüchtern:
«Entschuldige, mein Lieber, ich mußte mich mal gehenlassen: ich nehme mich seit heute morgen zusammen. Natürlich mache ich dir keinen Vorwurf!»
«Du hättest durchaus das Recht dazu», sagte Mathieu. «Ich bin nicht stolz. Es ist das erste Mal … Verdammt noch mal, so eine Sauerei! Ich habe Mist gemacht, und du mußt dafür büßen. Nun, was passiert ist, ist passiert. Sag mal, was ist das für eine Frau, wo wohnt sie?»
«Rue Morère 24. Scheint eine komische Frau zu sein.»
«Kann ich mir denken. Sagst du, daß Andrée dich geschickt hat?»
«Ja. Sie nimmt nur vierhundert Francs. Weißt du, das scheint ein Spottpreis zu sein», sagte Marcelle plötzlich vernünftig.
«Ja, allerdings», sagte Mathieu bitter, «sozusagen eine günstige Gelegenheit.»
Er fühlte sich unbeholfen wie ein Bräutigam. Ein unbeholfener und splitternackter großer Junge, der Unheil angerichtet hatte und freundlich lächelte, damit man ihn übersah. Aber sie konnte ihn nicht übersehen: sie sah seine weißen, muskulösen, etwas kurzen Schenkel, seine satte und unwiderlegbare Nacktheit. Es war ein grotesker Alptraum. ‹Wenn ich sie wäre, hätte ich Lust, auf dieses ganze Fleisch einzuschlagen.› Er sagte:
«Gerade das beunruhigt mich ja: sie nimmt nicht genug.»
«Na, vielen Dank», sagte Marcelle. «Ein Glück, daß sie so wenig verlangt: ich habe sie gerade da, die vierhundert Francs, sie waren für meine Schneiderin, aber sie muß warten. Und weißt du», fügte sie nachdrücklich hinzu, «ich bin überzeugt, daß sie mich genauso gut behandelt wie in diesen berühmten illegalen Kliniken, in denen sie einem viertausend Francs wie nichts abknöpfen. Außerdem haben wir keine Wahl.»
«Wir haben keine Wahl», wiederholte Mathieu. «Wann gehst du hin?»
«Morgen, gegen Mitternacht. Anscheinend hat sie nur nachts Besuchszeit. Komisch, was? Ich glaube, sie ist ein bißchen meschugge, aber es ist mir lieber so, wegen Mama. Tagsüber betreibt sie einen Kurzwarenladen; sie schläft fast nie. Man geht durch einen Hof, man sieht Licht unter einer Tür, da ist es.»
«Gut», sagte Mathieu, «ich gehe hin.»
Marcelle sah ihn bestürzt an:
«Du bist wohl verrückt? Sie schmeißt dich raus, sie wird dich für einen von der Polizei halten.»
«Ich gehe hin», wiederholte Mathieu.
«Warum denn? Was willst du ihr sagen?»
«Ich will klarsehen, ich will sehen, wie das ist. Wenn es mir nicht gefällt, gehst du nicht hin. Ich will nicht, daß eine verrückte Alte an dir rummurkst. Ich sage, daß Andrée mich geschickt hätte, daß ich eine Freundin habe, die in Schwierigkeiten ist, daß sie aber im Moment Grippe hat – irgendwas.»
«Und dann? Wo soll ich hingehen, wenn es nicht geht?»
«Wir haben doch wohl zwei Tage Zeit, um uns umzusehen, oder? Ich gehe morgen zu Sarah, sie kennt bestimmt jemand. Du weißt doch, am Anfang wollten sie keine Kinder.»
Marcelle wirkte etwas entspannt, sie kraulte ihn im Nacken:
«Du bist nett, Liebling, ich weiß zwar nicht so recht, was du unternehmen willst, aber ich verstehe, daß du etwas tun willst; du hättest es gern, wenn man dich an meiner Stelle operieren würde, nicht?» Sie legte ihm ihre schönen Arme um den Hals und fügte mit komischer Resignation hinzu:
«Wenn du Sarah fragst, empfiehlt sie dir bestimmt einen Juden.»
Mathieu küßte sie, und sie wurde ganz weich. Sie sagte:
«Liebster, Liebster.»
«Zieh dein Hemd aus.»
Sie gehorchte, und er legte sie rücklings aufs Bett; er streichelte ihre Brüste. Er liebte die großen ledrigen, von Fieberbläschen umgebenen Brustwarzen. Marcelle seufzte mit geschlossenen Augen, passiv und begehrlich. Aber ihre Lider zogen sich zusammen. Die Erregung, die wie eine warme Hand auf Mathieu lag, ließ eine Weile auf sich warten. Und dann, plötzlich, dachte Mathieu: ‹Sie ist schwanger.› Er setzte sich wieder auf. Sein Kopf brummte noch von einer schrillen Musik.
«Hör zu, Marcelle, das klappt heute nicht. Wir sind zu nervös, alle beide. Verzeih mir.»
Marcelle gab ein kurzes schläfriges Murren von sich, dann stand sie abrupt auf und wühlte mit beiden Händen in ihren Haaren herum.
«Wie du willst», sagte sie kalt.
Sie fügte liebenswürdiger hinzu:
«Im Grunde hast du recht, wir sind zu nervös. Ich sehnte mich nach deinen Liebkosungen, aber mir war bange.»
«Na ja», sagte Mathieu, «das Unglück ist geschehen, wir haben nichts mehr zu befürchten.»
«Ich weiß, das war irrational. Ich weiß nicht, wie ich es dir sagen soll: du machst mir ein bißchen angst, Liebster.»
Mathieu wusch sich.
«Gut. Ich werde dann mal diese Alte aufsuchen.»
«Ja. Ruf mich morgen an und sag mir Bescheid.»
«Kann ich dich morgen abend nicht sehen? Das wäre einfacher.»
«Nein, morgen abend nicht. Übermorgen, wenn du willst.»
Mathieu hatte Hemd und Hose angezogen. Er küßte Marcelle auf die Augen:
«Nimmst du es mir nicht übel?»
«Es ist nicht deine Schuld. Es ist ein einziges Mal in sieben Jahren passiert, du hast dir nichts vorzuwerfen. Und ich, ich ekle dich hoffentlich nicht an?»
«Du bist ja verrückt.»
«Weißt du, ich ekle mich selbst ein bißchen an, ich komme mir vor wie ein großer Haufen Nahrung.»
«Mein Kleines», sagte Mathieu zärtlich, «mein armes Kleines. In acht Tagen ist alles in Ordnung, ich verspreche es dir.»
Er machte geräuschlos die Tür auf und schlich mit den Schuhen in der Hand hinaus. Auf dem Treppenabsatz drehte er sich um: Marcelle war auf dem Bett sitzen geblieben. Sie lächelte ihm zu, aber Mathieu hatte den Eindruck, daß sie ihm böse war.
Etwas machte sich in seinen starren Augen los, und sie rollten locker in ihren Höhlen, ruhig und weich: sie sah ihn nicht mehr an, er war ihr keine Rechenschaft für seine Blicke mehr schuldig. Von seiner dunklen Kleidung und von der Nacht verdeckt, fühlte sich sein schuldiges Fleisch geschützt, es bekam allmählich seine Wärme und seine Unschuld wieder, es fing an wieder aufzublühen unter dem Stoff, das Ölkännchen, übermorgen das Ölkännchen mitbringen, was mache ich, damit ich daran denke? Er war allein.
Er blieb stehen, durchzuckt: das stimmte nicht, er war nicht allein, Marcelle hatte ihn nicht losgelassen; sie dachte an ihn, sie dachte: ‹Der Mistkerl, er hat mir das angetan, er hat sich in mir gehenlassen, wie ein Balg, das ins Bett macht.› Mochte er auch mit großen Schritten durch die menschenleere, finstere, anonyme Straße davongehen, bis zum Hals in seine Kleider gezwängt, er würde ihr nicht entgehen. Marcelles Bewußtsein war da hinten geblieben, angefüllt mit Unglück und Schreien, und Mathieu hatte sie nicht verlassen: er war da hinten, im rosa Zimmer, nackt und wehrlos gegenüber dieser schwerfälligen Durchsichtigkeit, die störender war als ein Blick. ‹Ein einziges Mal›, sagte er wütend zu sich selbst. Er wiederholte halblaut, um Marcelle zu überzeugen: ‹Ein einziges Mal in sieben Jahren!› Marcelle ließ sich nicht überzeugen: sie war im Zimmer geblieben, und sie dachte an Mathieu. Es war unerträglich, da hinten im stillen so beurteilt, gehaßt zu werden. Ohne sich verteidigen, ohne auch nur den Bauch mit den Händen bedecken zu können. Wenn er wenigstens in derselben Sekunde für andere so intensiv hätte existieren können … Aber Jacques und Odette schliefen; Daniel war besoffen oder stumpf. Ivich dachte nie an Abwesende. Boris vielleicht … Aber dessen Bewußtsein war nur ein winzig kleines trübes Aufleuchten, es konnte gegen diese wilde, reglose Luzidität, die Mathieu aus der Entfernung bannte, nicht ankämpfen. Die Nacht hatte die meisten Bewußtseine verschüttet: Mathieu war mit Marcelle allein in der Nacht. Ein Paar.
Bei Camus brannte Licht. Der Wirt stellte die Stühle aufeinander; die Kellnerin hakte einen Holzladen an einem der Türflügel fest. Mathieu stieß den anderen Flügel auf und trat ein. Er hatte Lust, sich sehen zu lassen. Einfach sich sehen zu lassen. Er stützte sich auf die Theke:
«Guten Abend allerseits.»
Der Wirt sah ihn an. Außerdem war ein Busschaffner da, der mit der Schirmmütze über den Augen einen Pernod trank. Bewußtseine. Leutselige und zerstreute Bewußtseine. Der Schaffner schnipste seine Mütze nach hinten und sah Mathieu an. Marcelles Bewußtsein ließ von ihm ab und löste sich in der Nacht auf.
«Geben Sie mir ein Bier.»
«Sie machen sich rar», sagte der Wirt.
«Aber nicht, weil ich keinen Durst habe.»
«Das stimmt, daß man Durst kriegt», sagte der Schaffner. «Man könnte meinen, es wäre Hochsommer.»
Sie schwiegen. Der Wirt spülte Gläser, der Schaffner pfiff vor sich hin. Mathieu war froh, weil sie ihn ab und zu ansahen. Er sah sein Gesicht im Spiegel, es ragte fahl und rund aus einem Silbermeer heraus: bei Camus hatte man immer den Eindruck, es wäre vier Uhr morgens, wegen des Lichts, eines silbernen Dunsts, der die Augen überanstrengte und die Gesichter, die Hände, die Gedanken bleichte. Er trank. Er dachte: ‹Sie ist schwanger. Komisch: ich habe nicht den Eindruck, daß es stimmt.› Das kam ihm schockierend und grotesk vor, wie wenn man einen Alten und eine Alte sieht, die sich auf den Mund küssen: nach sieben Jahren dürften solche Sachen nicht passieren. ‹Sie ist schwanger.› In ihrem Bauch war eine kleine glasige Lache, die langsam anschwoll, am Ende wäre das wie ein Auge: ‹Das breitet sich mitten in diesen Schweinereien aus, die sie im Bauch hat, das lebt.› Er sah eine lange Nadel, die zögernd im Halbdunkel vordrang. Es gab ein schwaches Geräusch, und das Auge sprang auf, geplatzt: übrig blieb nichts als ein undurchsichtiges trockenes Häutchen. ‹Sie wird zu dieser Alten gehen; sie wird an sich rummurksen lassen.› Er fühlte sich giftig. ‹Schluß jetzt.› Er schüttelte sich: das waren fahle Gedanken, Gedanken um vier Uhr morgens.
«Gute Nacht.»
Er bezahlte und ging.
‹Was habe ich getan?› Er ging langsam und versuchte sich zu erinnern. ‹Vor zwei Monaten …› Er erinnerte sich an überhaupt nichts, oder es mußte am Tag nach den Osterferien gewesen sein. Er hatte Marcelle in die Arme genommen, wie gewöhnlich, sicher aus Zärtlichkeit, eher aus Zärtlichkeit als aus Verlangen; und jetzt … Er war hereingelegt worden. ‹Ein Kind. Ich glaubte ihr Lust zu schenken und habe ihr ein Kind gemacht. Ich habe überhaupt nicht kapiert, was ich tat. Jetzt gebe ich dieser Alten vierhundert Francs, sie wird ihr Gerät zwischen Marcelles Beinen hineinschieben und kratzen; das Leben wird vergehen, wie es gekommen ist; und ich werde genauso blöd wie vorher sein; beim Vernichten dieses Lebens werde ich genausowenig wie bei seinem Erschaffen gewußt haben, was ich tat.› Er lachte unfroh: ‹Und die anderen? Die feierlich beschlossen haben, Vater zu werden, und sich als Erzeuger fühlen, wenn sie den Bauch ihrer Frau ansehen, verstehen sie mehr als ich? Sie sind blindlings, mit drei Schwanzstößen vorgegangen. Das übrige wird in der Dunkelkammer und in der Gallerte gemacht, wie die Fotografie. Das geschieht ohne sie.› Er betrat einen Hof und sah Licht unter einer Tür: ‹Da ist es.› Er schämte sich.
Mathieu klopfte:
«Was ist?» sagte eine Stimme.
«Ich möchte Sie sprechen.»
«Um diese Zeit besucht man keine Leute.»
«Ich komme von Andrée Besnier.»
Die Tür ging einen Spaltbreit auf. Mathieu sah eine gelbe Haarsträhne und eine große Nase.
«Was wollen Sie? Kommen Sie mir nicht mit dem Polizeitrick, das zieht nicht, bei mir ist alles vorschriftsmäßig. Ich habe das Recht, die ganze Nacht Licht bei mir anzulassen, wenn es mir gefällt. Wenn Sie Inspektor sind, brauchen Sie mir nur Ihren Ausweis zu zeigen.»
«Ich bin nicht von der Polizei», sagte Mathieu. «Ich habe ein Problem. Man hat mir gesagt, ich könnte mich an Sie wenden.»
«Kommen Sie rein.»
Mathieu trat ein. Die Alte trug eine Männerhose und eine Bluse mit Reißverschluß. Sie war sehr mager, hatte starre, harte Augen.
«Kennen Sie Andrée Besnier?»
Sie musterte ihn wütend.
«Ja», sagte Mathieu. «Sie ist voriges Jahr um die Weihnachtszeit zu Ihnen gekommen, weil sie in Schwierigkeiten war; sie ist ziemlich krank gewesen, und Sie sind viermal zu ihr gegangen und haben sie behandelt.»
«Na und?»
Mathieu sah die Hände der Alten an. Es waren Männerhände, Würgerhände. Sie waren rissig, aufgesprungen, hatten ganz kurze schwarze Nägel, Narben und Schnittwunden. Am obersten Glied des linken Daumens waren violette Quetschungen und eine dicke schwarze Kruste. Mathieu grauste es beim Gedanken an Marcelles zartes braunes Fleisch.
«Ich komme nicht ihretwegen», sagte er, «ich komme wegen einer ihrer Freundinnen.»
Die Alte lachte unfreundlich.
«Das ist das erste Mal, daß ein Mann die Frechheit hat, sich vor mir zu produzieren. Ich will nichts mit Männern zu tun haben, verstehen Sie?»
Das Zimmer war schmutzig und unordentlich. Überall standen Kisten, und auf dem Fliesenboden lag Stroh. Auf einem Tisch sah Mathieu eine Flasche Rum und ein halbvolles Glas.
«Ich bin hier, weil meine Freundin mich geschickt hat. Sie kann heute nicht kommen, sie hat mich gebeten, mich mit Ihnen abzusprechen.»
Hinten im Zimmer stand eine Tür halb offen. Mathieu hätte schwören können, daß hinter dieser Tür jemand war. Die Alte sagte:
«Die armen Gören, sie sind einfach zu dumm. Man braucht Sie bloß anzusehen, um zu merken, daß Sie genau der Typ sind, der Unheil anrichtet, Gläser umwirft oder Spiegel kaputtschlägt. Und trotzdem vertrauen sie euch ihr Kostbarstes an. Eigentlich kriegen sie nur, was sie verdienen.»
Mathieu blieb höflich.
«Ich würde gerne sehen, wo Sie operieren.»
Die Alte warf ihm einen haßerfüllten, argwöhnischen Blick zu: «Na, hören Sie mal! Wer sagt Ihnen denn, daß ich operiere? Wovon reden Sie überhaupt? Was geht Sie das an? Wenn Ihre Freundin mich sprechen will, soll sie doch kommen. Ich will ausschließlich mit ihr zu tun haben. Sie wollten sich vergewissern, wie? Hat sie sich etwa vergewissert, bevor sie sich in Ihre Klauen begeben hat? Sie haben Unheil angerichtet. Schön. Dann beten Sie, daß ich geschickter bin als Sie, das ist alles, was ich Ihnen sagen kann. Adieu.»
«Auf Wiedersehen, Madame», sagte Mathieu.
Er ging hinaus. Er fühlte sich befreit. Er ging langsam zur Avenue d’Orléans zurück; zum erstenmal seit er von Marcelle weggegangen war, konnte er ohne Angst, ohne Entsetzen, mit zärtlicher Traurigkeit an Marcelle denken. ‹Morgen gehe ich zu Sarah›, dachte er.
2
Boris sah das rotkarierte Tischtuch an und dachte an Mathieu Delarue. Er dachte: ‹Der ist in Ordnung.› Die Kapelle war verstummt, die Luft war ganz blau, und die Leute unterhielten sich. Boris kannte alle in dem engen kleinen Raum: das waren keine Leute, die zum Amüsement hierherkamen; sie trudelten nach der Arbeit ein, sie waren ernst und hatten Hunger. Der Neger, der Lola gegenübersaß, war Sänger im Paradise; hinten die sechs Männer mit ihren Frauen waren Musiker bei Nénette. Bei denen hatte sich offenbar etwas getan, ein unerwartetes Glück, vielleicht ein Engagement für den Sommer (sie hatten vor zwei Tagen vage von einem Nachtklub in Konstantinopel gesprochen), sie hatten nämlich Champagner bestellt, und gewöhnlich waren sie eher knauserig. Boris sah auch die Blondine, die im Matrosenanzug im La Java tanzte. Der große Dünne mit der Brille, der eine Zigarre rauchte, war der Geschäftsführer eines Lokals in der Rue Tholozé, das gerade von der Polizei geschlossen worden war. Er sagte, es würde bald wieder geöffnet, weil er Fürsprecher an höherer Stelle hätte. Boris bereute bitter, daß er nicht hingegangen war, er würde bestimmt hingehen, wenn es wieder aufmachte. Der Typ hatte einen kleinen Schwulen bei sich, der von weitem ganz reizend aussah, einen Blonden mit feinem Gesicht, der nicht sehr affektiert wirkte und anmutig war. Boris konnte Homosexuelle nicht besonders leiden, weil sie dauernd hinter ihm her waren, aber Ivich schätzte sie, sie sagte: «Die haben wenigstens den Mut, nicht so zu sein wie alle anderen.» Boris empfand größte Hochachtung für die Ansichten seiner Schwester und bemühte sich redlich, die Tunten zu schätzen. Der Neger aß Sauerkraut. Boris dachte: ‹Ich mag Sauerkraut nicht.› Er hätte gern gewußt, wie das Gericht hieß, das man der Tänzerin aus La Java gebracht hatte: so etwas Braunes, was gut aussah. Auf dem Tischtuch war ein Rotweinfleck. Ein schöner Fleck, man hätte meinen können, das Tischtuch wäre an der Stelle aus Satin; Lola hatte etwas Salz auf den Fleck gestreut, denn sie war ordentlich. Das Salz war rosa. Es stimmt nicht, daß Salz Flecken aufsaugt. Er mußte Lola sagen, daß Salz Flecken nicht aufsaugt. Aber er hätte sprechen müssen: Boris fühlte, daß er nicht sprechen konnte. Lola saß neben ihm, matt und erhitzt, und Boris konnte nicht das kleinste Wort herausbringen, seine Stimme war abgestorben. So wäre ich, wenn ich stumm wäre. Es war lustvoll, seine Stimme schwebte unten in der Kehle, zart wie Watte, und sie konnte nicht mehr heraus, sie war abgestorben. Boris dachte: ‹Ich kann Delarue gut leiden›, und er freute sich. Er hätte sich noch mehr gefreut, wenn er nicht mit seiner ganzen linken Seite, von der Schläfe bis zur Hüfte, gespürt hätte, daß Lola ihn ansah. Bestimmt mit einem leidenschaftlichen Blick, Lola konnte ihn kaum anders ansehen. Es war ein bißchen peinlich, weil leidenschaftliche Blicke als Gegenleistung liebenswürdige Gesten oder ein Lächeln verlangen; und Boris hätte nicht die geringste Bewegung machen können. Er war gelähmt. Aber das war nicht so wichtig: er mußte Lolas Blick nicht sehen: er ahnte ihn, aber das war seine Sache. So, wie er saß, die Haare vor den Augen, sah er nicht das kleinste Fitzchen von Lola, er konnte sehr wohl annehmen, daß sie den Raum und die Leute ansah. Boris war nicht müde, er fühlte sich ganz wohl, weil er alle im Raum kannte: er sah die rosa Zunge des Negers; Boris hatte Achtung vor diesem Neger: einmal hatte der Neger Schuhe und Strümpfe ausgezogen, hatte eine Streichholzschachtel zwischen die Zehen genommen, hatte sie geöffnet, ein Streichholz herausgeholt und es angezündet, alles mit den Füßen. ‹Der Kerl ist toll›, dachte Boris voller Bewunderung. ‹Jeder sollte seine Füße genauso gebrauchen können wie seine Hände.› Seine linke Seite tat ihm vom Angesehenwerden weh: er wußte, daß der Moment näher rückte, in dem Lola ihn fragen würde: ‹Woran denkst du?› Es war völlig unmöglich, diese Frage aufzuhalten, das hing nicht von ihm ab: Lola würde sie zur gegebenen Zeit mit einer Art Zwangsläufigkeit stellen. Boris hatte den Eindruck, eine unendlich kostbare winzige Zeitspanne auszukosten. Eigentlich war es ganz angenehm: Boris sah das Tischtuch, er sah Lolas Glas. (Lola hatte soupiert; sie dinierte nie vor ihrer Gesangsnummer.) Sie hatte Château Gruau getrunken, sie verwöhnte sich, sie gönnte sich eine Menge kleine Launen, weil sie so verzweifelt war, daß sie alterte. Es war noch etwas Wein im Glas, wie staubiges Blut. Die Jazzband fing an If the moon turns green zu spielen, und Boris fragte sich: ‹Könnte ich diese Melodie singen?› Das wäre famos gewesen, im Mondschein durch die Rue Pigalle zu bummeln und ein Liedchen zu pfeifen. Delarue hatte zu ihm gesagt: «Sie pfeifen wie ein Schwein.» Boris lachte in sich hinein und dachte: ‹So ein Idiot!› Seine Sympathie für Mathieu war grenzenlos. Er warf einen kurzen Blick zur Seite, ohne den Kopf zu bewegen, und nahm Lolas bleierne Augen unter einer prachtvollen roten Haarsträhne wahr. Eigentlich war das ganz gut zu ertragen, ein Blick. Man brauchte sich nur an diese besondere Hitze zu gewöhnen, die einem das Gesicht versengt, wenn man fühlt, daß jemand einen leidenschaftlich beobachtet. Boris bot Lolas Blicken fügsam seinen Körper, seinen schmächtigen Nacken und jenes versunkene Profil dar, das sie so sehr liebte; dafür konnte er tief in sich hineinkriechen und sich mit den lustigen kleinen Gedanken befassen, die ihm gerade kamen.
«Woran denkst du?» fragte Lola.
«An nichts.»
«Man denkt immer an irgend etwas.»
«Ich habe an nichts gedacht», sagte Boris.
«Auch nicht, daß du die Melodie magst, die sie spielen, oder daß du steppen lernen möchtest?»
«Doch, irgend so was.»
«Siehst du. Warum sagst du es mir nicht? Ich möchte alles wissen, was du denkst.»
«So was spricht man nicht aus, das ist nicht wichtig.»
«Das ist nicht wichtig! Man könnte meinen, du hättest deine Zunge nur bekommen, um mit deinem Lehrer über Philosophie zu reden.»
Er sah sie an und lächelte: ‹Ich habe sie gern, weil sie rothaarig ist und weil sie alt aussieht.›
«Komischer Junge», sagte Lola und machte ein flehendes Gesicht. Boris blinzelte. Er mochte nicht, daß man über ihn sprach; das war immer so kompliziert, da kam er nicht mit. Lola sah aus, als wäre sie wütend, aber das lag nur daran, daß sie ihn leidenschaftlich liebte und sich seinetwegen grämte. Es gab solche Momente, in denen sie nicht anders konnte, sie quälte sich grundlos, sie sah Boris verstört an, sie wußte nicht mehr, was sie mit ihm machen sollte, und ihre Hände flatterten. Anfangs wunderte sich Boris darüber, aber jetzt hatte er sich daran gewöhnt. Lola legte die Hand auf Boris’ Kopf:
«Ich frage mich, was darin ist», sagte sie. «Das macht mir angst.»
«Warum? Ich schwöre dir, es ist harmlos», sagte Boris lachend.
«Ja, aber ich kann es dir nicht sagen … das kommt ganz von allein, ich kann nichts dafür, jeder deiner Gedanken ist eine kleine Flucht.»
Sie zerzauste ihm die Haare.
«Heb meine Strähne nicht hoch», sagte Boris. «Ich mag es nicht, daß man meine Stirn sieht.»
Er nahm ihre Hand, streichelte sie ein bißchen und legte sie wieder auf den Tisch.
«Du bist da, du bist ganz liebevoll», sagte Lola, «ich glaube, du bist ganz bei mir, und dann, auf einmal, niemand mehr, ich frage mich, wo du bist.»
«Ich bin da.»
Lola sah ihn von ganz nahem an. Ihr bleiches Gesicht war von trauriger Hingegebenheit verzerrt, es war genau der Ausdruck, den sie annahm, um Les écorchés zu singen. Sie schob die Lippen vor, diese ungeheuren Lippen mit den herabgezogenen Winkeln, die er anfangs geliebt hatte. Seit er sie auf seinem Mund gefühlt hatte, wirkten sie auf ihn wie eine feuchte, fiebrige Blöße mitten in einer Gipsmaske. Jetzt war ihm Lolas Haut lieber, sie war so weiß, daß sie unecht aussah. Lola fragte schüchtern:
«Du … du langweilst dich doch nicht mit mir?»
«Ich langweile mich nie.»
Lola seufzte, und Boris dachte voller Genugtuung: ‹Witzig, wie alt sie aussieht, sie verrät ihr Alter nicht, aber sie ist bestimmt an die Vierzig.› Es war ihm lieb, daß die Leute, die ihn schätzten, alt aussahen, er fand das beruhigend. Außerdem gab ihnen das eine etwas schreckliche Zerbrechlichkeit, die im ersten Augenblick nicht sichtbar war, weil sie alle eine wie Leder gegerbte Haut hatten. Er hatte Lust, Lolas verstörtes Gesicht zu küssen, er dachte, daß sie kaputt war, daß sie ihr Leben verpfuscht hatte und daß sie einsam war, vielleicht noch einsamer, seit sie ihn liebte: ‹Ich kann nichts für sie tun›, dachte er resigniert. Er fand sie in diesem Augenblick wahnsinnig sympathisch.
«Ich schäme mich», sagte Lola.
Sie hatte eine schwere und dunkle Stimme wie ein Vorhang aus rotem Samt.
«Warum?»
«Weil du ein Knabe bist.»
Er sagte:
«Ich genieße es, wenn du Knabe sagst. Das ist ein schönes Wort für deine Stimme. Waren heute abend viele da?»
«Bürgerpack. Das kam wer weiß woher, das schnatterte. Sie hatten nicht die geringste Lust, mir zuzuhören. Sarrunyan mußte sie zum Schweigen bringen; es war mir peinlich, weißt du, ich hatte den Eindruck, indiskret zu sein. Sie haben trotzdem geklatscht, als ich aufgetreten bin.»
«Das ist korrekt.»
«Ich habe die Schnauze voll», sagte Lola. «Das ekelt mich an, für diese Idioten zu singen. Leute, die kommen, weil sie sich bei einem Ehepaar für eine Einladung revanchieren müssen. Wenn du sehen würdest, wie sie ständig lächelnd ankommen; sie verbeugen sich, sie halten der Frau den Stuhl, während sie sich hinsetzt. Natürlich störst du sie dann, wenn du ankommst, sie sehen dich von oben bis unten an. Boris», sagte Lola plötzlich, «ich singe, um davon zu leben.»
«Ja sicher.»
«Wenn ich gewußt hätte, daß ich so enden würde, hätte ich nie angefangen.»
«So oder so, als du in der Music-Hall gesungen hast, hast du auch von deinem Gesang gelebt.»
«Das war nicht dasselbe.»
Schweigen trat ein, dann fügte Lola schnell hinzu:
«Sag mal, der Kleine, der nach mir singt, der Neue, ich habe heute abend mit ihm geredet. Er ist höflich, aber er ist genausowenig ein Russe wie ich.»
‹Sie glaubt, sie langweilt mich›, dachte Boris. Er nahm sich vor, ihr ein für allemal zu sagen, daß sie ihn nie langweilte. Nicht heute, später.
«Vielleicht hat er Russisch gelernt?»
«Aber du», sagte Lola, «du müßtest mir sagen können, ob er eine gute Aussprache hat.»
«Meine Eltern haben Rußland 1917 verlassen, ich war drei Monate alt.»
«Ulkig, daß du nicht Russisch kannst», schloß Lola versonnen.
‹Sie ist komisch›, dachte Boris, ‹sie schämt sich, mich zu lieben, weil sie älter ist als ich. Ich finde das natürlich, einer muß ja älter sein als der andere.› Vor allem war es moralischer: Boris hätte ein gleichaltriges Mädchen nicht lieben können. Wenn beide jung sind, wissen sie nicht, wie sie sich verhalten sollen, das funktioniert schlecht, man hat immer den Eindruck, mit Puppen zu spielen. Mit reifen Leuten ist das nicht so. Sie sind gefestigt, sie führen einen, und außerdem hat ihre Liebe Gewicht. Wenn Boris mit Lola zusammen war, stimmte sein Bewußtsein zu, er fühlte sich gerechtfertigt. Natürlich zog er Mathieus Gesellschaft vor, weil Mathieu keine Frau war: ein Typ ist witziger. Und außerdem erklärte ihm Mathieu Sachen. Nur fragte sich Boris oft, ob Mathieu Freundschaft für ihn empfand. Mathieu war gleichgültig und brutal, und natürlich dürfen Typen miteinander nie zärtlich sein, aber es gibt tausend andere Arten zu zeigen, daß man jemanden schätzt, und Boris fand, daß Mathieu ab und zu ruhig mit einem Wort oder mit einer Geste seine Zuneigung zeigen könnte. Mit Ivich war Mathieu ganz anders. Boris sah plötzlich Mathieus Gesicht vor sich, als er eines Tages Ivich in den Mantel half; er fühlte einen unangenehmen Stich im Herzen. Mathieus Lächeln: auf diesem bitteren Mund, den Boris so liebte, jenes komische verschämte und zärtliche Lächeln. Aber gleich füllte sich sein Kopf mit Rauch, und er dachte an nichts mehr.
«Weg ist er wieder», sagte Lola.
Sie sah ihn angstvoll an.
«Woran hast du gedacht?»
«Ich habe an Delarue gedacht», sagte Boris widerwillig.
Lola lächelte traurig:
«Könntest du nicht manchmal auch ein bißchen an mich denken?»
«Ich brauche nicht an dich zu denken, du bist ja da.»
«Warum denkst du immer an Delarue? Wärst du gern mit ihm zusammen?»
«Ich bin froh, daß ich hier bin.»
«Bist du froh, daß du hier bist oder daß du mit mir zusammen bist?»
«Das ist dasselbe.»
«Für dich ist es dasselbe. Für mich nicht. Wenn ich mit dir zusammen bin, ist es mir völlig egal, ob ich hier bin oder woanders. Übrigens bin ich nie froh, wenn ich mit dir zusammen bin.»
«Nein?» fragte Boris überrascht.
«Das ist kein Frohsein. Du brauchst dich nicht dumm zu stellen, du kennst das ganz genau: ich habe dich mit Delarue gesehen, du weißt nicht mehr, wo du bist, wenn er da ist.»
«Das ist nicht dasselbe.»
Lola näherte ihm ihr schönes verlebtes Gesicht: sie sah flehend aus:
«Sieh mich doch mal an, kleiner Fratz, sag mir, warum dir soviel an ihm liegt.»
«Ich weiß nicht. Mir liegt gar nicht soviel an ihm. Er ist in Ordnung. Lola, es ist mir peinlich, mit dir über ihn zu sprechen, weil du mir gesagt hast, daß du ihn nicht riechen kannst.»
Lola lächelte gezwungen:
«Sieh mal an, wie er sich windet. Mein Bürschchen, ich habe nicht gesagt, ich könnte ihn nicht riechen. Ich habe nur nie verstanden, was du an ihm so außergewöhnlich findest. Erklär es mir doch, was ich will, ist verstehen.»
Boris dachte: ‹Das stimmt nicht, schon nach drei Worten würde sie anfangen zu meckern.›
«Ich finde, er ist sympathisch», sagte er vorsichtig.
«Das sagst du mir immer. Es ist nicht gerade das Wort, das ich wählen würde. Sag mir, daß er intelligent aussieht, daß er gebildet ist, meinetwegen; aber nicht sympathisch. Das ist jedenfalls mein Eindruck; sympathisch ist für mich so jemand wie Maurice, jemand, der ganz geradeheraus ist, aber er, bei ihm fühlen sich die Leute unbehaglich, weil er weder Fisch noch Fleisch ist, er täuscht seine Umgebung. Sieh dir bloß seine Hände an.»
«Was ist denn mit seinen Händen? Ich mag sie gern.»
«Es sind grobe Arbeiterhände. Sie zittern immer ein bißchen, als hätte er gerade Schwerarbeit geleistet.»
«Ja eben.»