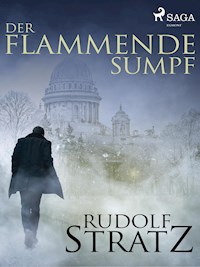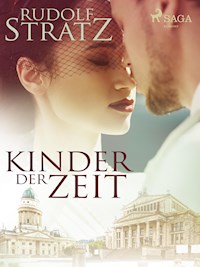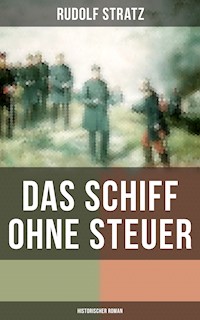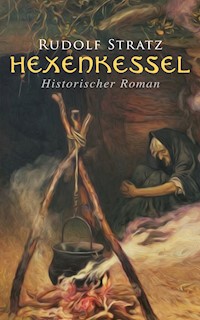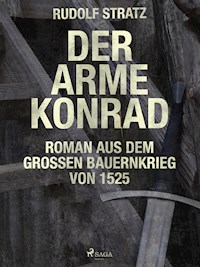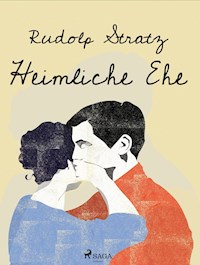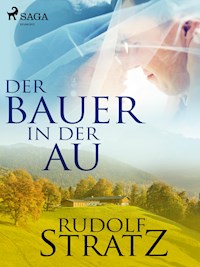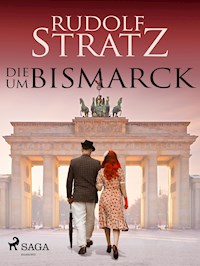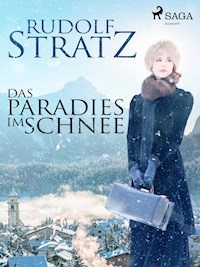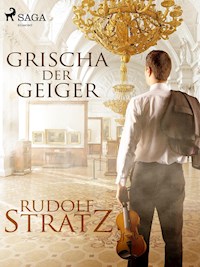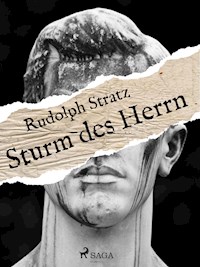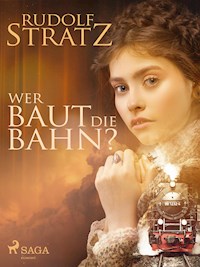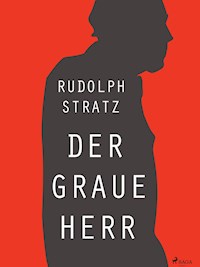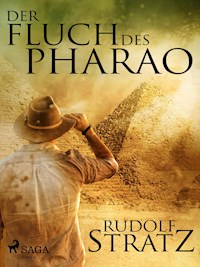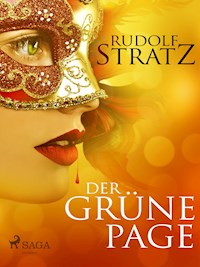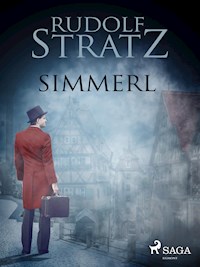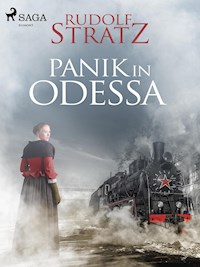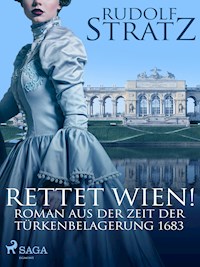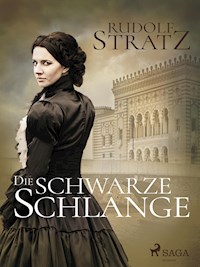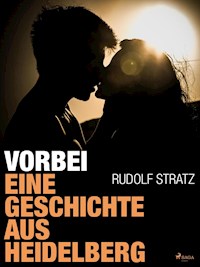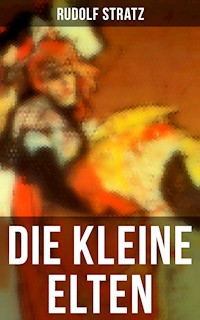
0,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,00 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Musaicum Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Rudolf Stratz' Werk "Die kleine Elten" ist ein fesselnder Roman, der die Geschichte einer einfachen Familie im ländlichen Deutschland des 19. Jahrhunderts erzählt. Mit einem klaren, präzisen Schreibstil schildert Stratz das Leben und die Höhen und Tiefen der Elten-Familie, die sich mit Armut, Krankheit und gesellschaftlichen Herausforderungen auseinandersetzen muss. Der Roman zeichnet sich durch realistische Darstellungen der damaligen Lebensumstände aus und reflektiert den sozialen und wirtschaftlichen Wandel jener Zeit. Stratz' Werk kann in die Tradition des sozialen Realismus eingeordnet werden, da es ein eindringliches Bild der Arbeiterklasse im 19. Jahrhundert malt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Die kleine Elten
Inhaltsverzeichnis
I.
Also heute war der große Tag!
Eine bedeutsame Energie lag auf Valeska Eltens schönem Gesicht, während sie sich vor dem Spiegel des Hotelzimmerchens die Haare machte.
Auf dem Teppich stand ihre irdische Habe. Ein großer Koffer mit kostbaren Theatertoiletten – ihr Schatz und Heiligtum, zu dem noch drei ähnliche, als Frachtgut nachkommende Ungetüme gehörten –, ein paar Hutkartons und ein kleines Kofferchen, das ihre »Zivilsachen«, Wäsche usw. barg.
Auf dem Tisch lag der Bühnen-Almanach. Daneben ein Stoß Briefe von Agenten und Direktoren, ein Brenneisen, ein großer Bogen, auf dem sie in zierlicher Schrift ihr Repertoire verzeichnet hatte, einige Papilloten und ein Pack mit blauem Seidenband zusammengehefteter Zeitungsausschnitte.
Das waren die Kritiken über ihre Tätigkeit am Bergheimer Stadt-Theater. Ein schöngeistiger Gymnasialoberlehrer hatte sie geschrieben. Das Herz des schwerverheirateten Mannes war in hoffnungsloser Liebe zu ihr entbrannt gewesen, und siegreich trug ihn in seinen Rezensionen der Schwung der Begeisterung über holperige Perioden und ciceronianische Schachtelsätze hinweg, wie feurige Pferde den Jagdwagen über den Knüppeldamm reißen.
Sie hatte ihm denn auch zum Abschied freundlich die Hand gedrückt und versprochen, zu schreiben.
Dabei kam sie sich sehr dankbar vor. Denn was brauchte sie jetzt in Berlin noch den Oberlehrer aus der Provinz, in Berlin, dessen Brausen und Tosen geheimnisvoll in ihr Hotelzimmer drang.
Da stand es gedruckt im »Börsen-Courier«, dessen letzte Nummer neben ihr vor dem Spiegel lag, in der Rubrik »Hinter den Kulissen«:
»Die Direktion des Westend-Theaters hat Fräulein Valeska Elten vom Stadt-Theater in Bergheim für die beginnende Saison verpflichtet. Den Abschluß vermittelte die Hasselsche Agentur.«
Eine dürftige, kleine Notiz – aber wie inhaltreich für Fräulein Elten, die sich noch immer vor dem Spiegel mit ihren langen, kastanienbraunen Flechten abquälte.
Natürlich – wenn man Eile hat, geht es erst recht nicht! Und wieviel hatte sie heute zu tun, an dem grosten Tag, der sie in den Berliner Kampf ums Dasein führte.
Einige Haarnadeln zwischen die Zähne geklemmt, mit ungeduldig flackernden Augen, beendete sie die Frisur und stieß vorsichtig den langen silbernen Pfeil durch das hochgesteckte Nest.
Dann stand sie auf, warf noch einen Blick auf die blau angestrichene Notiz des »Börsen-Couriers«, deren paar Worte sie schon auswendig konnte, und sah sich dann in dem Stehspiegel an.
Es war, als hielte sie Musterung für den Kampf, der ihr bevorstand. Ihre feinen Nasenflügel blähten sich, die schmalen Lippen preßten sich fest aufeinander, und in den Augen zitterte wieder ein unstetes grünliches Licht, wie das einer lauernden Katze.
Es war ein harter Kampf, das wußte sie.
Was hatte sie für Waffen?
Wieder blickte sie in den Spiegel.
Kein Zweifel, sie war hübsch! Sehr hübsch sogar!
Das vornehme Oval des Gesichts, über dessen schmaler Stirn die braunen Löckchen sich kräuselten, der kluge, etwas spöttische Ausdruck, der aus den lebhaften Augen sprach und um die Mundwinkel zuckte, die schlanke, mittelgroße Gestalt – gegen das alles war nichts einzuwenden.
Freilich – der Teint! Etwas Puder war kaum mehr zu entbehren, wenn man sich acht Jahre hindurch in der Kulissenluft kleiner Provinzbühnen herumgetrieben hat.
Jetzt zählte sie sechsundzwanzig. Für Berlin ist das kein Alter. Aber Zeit war es doch, hohe Zeit, den Erfolg zu packen.
Mit Schönheit allein macht man das nicht. Dazu gehören – die Elten zählte sich das in ihrem Nachsinnen, während sie sich in eine Ecke des Sofas lehnte, gewissenhaft auf –, dazu gehören außerdem Konnexionen, Geld, Tatent und Glück.
Konnexionen hatte sie keine! Wie sollte sie solche auch als fahrende Provinzschauspielerin anknüpfen? Und Geld sehr wenig. Die Koffer, etwas Schmuck und 412,50 Mark in der Tasche war alles, was sie ihr eigen nannte.
Talent? Ja, sie hatte Tatent. Aber wie weit es für Berlin reichte, wußte sie nicht. Sie war klug genug, das einzusehen.
»Ich glaube, ich bin überhaupt klug!« sagte die Elten für sich und trat wieder vor den Spiegel. »Wirklich ... Und wer in Berlin klug ist, macht sein Glück!«
Das Glück ... ja! ... Das war es schließlich doch, wovon alles abhing. Was war es anders als Glück, daß Herr Hochmann, der Direktor des Westend- Theaters, zufällig auf einer Geschäftsreise in Bergheim übernachtete und abends ins Theater ging, und daß sie gerade an diesem Abend in einer ihrer besten Rollen, der Iza im »Fall Clémenceau«, auftrat?
Nach dem ersten Akt war Direktor Hochmann, ein älterer Herr mit ausgeprägtem Schauspielergesicht, auf die Bühne gekommen, einen Augenblick suchend stehengeblieben und dann direkt auf den zierlichen Pagen zugeschritten, der eben an der Hand des Bildhauers Clémenceau wiederholt sich vor dem klatschenden Publikum verbeugt hatte.
Tags darauf war sie für den nächsten Herbst an das Westend-Theater zu Berlin engagiert. Heute, am 15. August, hatte sie sich zu melden. Am 1. September begann die Saison.
»Ja, Glück must man haben,« dachte Valeska Elten bei sich, »klug must man sein...und hübsch...dann kann es doch schließlich nicht fehlen...«
Und getröstet beendete sie ihre Toilette.
Dann überlegte sie, was der heutige Tag von ihr verlangte.
Erst Meldung beim Direktor. Da konnte man etwa um zehn Uhr hingehen.
Dann Besuch beim Agenten.
Dann Rundfahrt bei den Kritikern der großen Blätter.
»Wie heißen denn die Kerle eigentlich?« brummte sie vor sich hin, schlug den Almanach auf und begann mit einem Bleistift die Adressen auf ein Blatt Papier zu kritzeln. Das wollte sie dem Kutscher geben, da sie selbst Berlin nicht kannte. Der würde schon sehen, wie man am raschesten von der Jerusalemer nach der Beuth- und von der Zimmer- nach der Breiten Straße kommt.
Die Namen der Herren Doktoren – denn sie hegte die allgemeine Bühnenüberzeugung, daß ein Theaterkritiker unbedingt Doktor sei – notierte sie sich besonders.
Visitenkarten hatte sie sich auch schon gerichtet ... kleine, zierliche Dinger, auf denen lithographiert der Name »Valeska Elten« und darunter, von ihrer eigenen Hand geschrieben, »Mitglied des Westend-Theaters« stand.
Auf einige hatte sie noch weiter hingekritzelt: »Bittet bei ihrem Debüt um gütige Nachsicht.« Aber diese auszugeben, war noch nicht Zeit. Wußte sie doch gar nicht, welche Rollen sie bekam.
Hoffentlich schöne! Sie wußte, in Berlin wurden alle die Sensationsrollen »kreiert«, die sie in der Provinz dem Bergheimer Publikum vorgespielt hatte, die Magda und die Iza, die Alma und die Adah, die Rita und die Nora und viele andere. Und ebenso ehrte man da die Franzosen: Vielleicht durfte sie die Francillon oder Cyprienne spielen, vielleicht die Frou-Frou oder gar Marguerite Gauthier, die Kameliendame. Das sollte herrlich werden.
Sie blätterte in dem Genossenschafts-Almanach die endlose Reihe der Berliner Theater durch, sie überschlug die Opern-, Operetten-, Possen- und Vorstadtbühnen, sie warf nur einen flüchtigen Blick auf die anderen großen Schauspielhäuser, das Königliche, das Berliner, das Deutsche, das Neue, das Lessing-, das Residenz-, das Wallner-Theater, bis sie endlich an ihren eigenen Kunsttempel kam.
Da stand's unter der Rubrik Berlin:
XXVII. Westend-Theater.
(Erbaut 1836, renoviert 1886, mit elektrischer Beleuchtung versehen 1890. Das Theater faßt 1050 Personen. Spielzeit vom 1. September bis 30. Juni.)
Eigentümer: Hans Schliephacke, W, Bismarckstraße 107.
Direktion: Egbert Hochmann, Ehrenmitglied des Stadt-Theaters zu Walstett, Ritter des fürstlich Gnadenheimer Hausordens vom wachsamen Sperber und des Rhenaschen Verdienstkreuzes am grün-gelben Bande, W, Lützowplatz 104, führt die Oberregie.
Schauspiel-Vorstände: Harald Grillon, Inhaber des Sterns von Lichtenstein (um den Hals zu tragen), und Hans Bauer, Regisseure.
Bureau, Inspektion und Kasse: Franz Reichau, Sekretär, Heinz Rüsemer, Bibliothekar, Willy Krause, Inspizient, F. Hertha Kautz, Souffleuse, Ernst Seiffert, Kassierer, Ernst Berg, Inspektor, Fritz Kaltschmiedt, Theaterdiener.
Rechtskonsulent: Dr. Eugen Horwitz.
Theaterarzt: Dr. G. Mans.
Darstellende Mitglieder:
Herren: Louis Adolf, Hans Bauer (siehe Regisseure), Heinrich Franke, Hans Frey, Harald Grillon (siehe Regisseure) ...
Hier wurden ihr die Herren zu langweilig. Sie las weiter:
Damen: Anna Maria Dobschütz, Käthe Hannemann, Pepi von Hochleitner, Franziska Ilgen, Elly Krause, Mizi Stadinger, Thilda Thorbeck ...
Aber was sagten ihr diese Namen weiter? Waren ihre Trägerinnen jung oder alt, schön oder häßlich, talentvoll oder nicht?
Darüber gab der Almanach keine Auskunft. Sie mußte ihre Feindinnen persönlich sehen.
Sie legte den Almanach weg, setzte den Hut auf, zog ihr Jäckchen an, steckte die letzte Nummer ihres Agenturblattes, des »Norddeutschen Bühnenboten«, der für die 24 Mark jährliches Abonnement alle Quartale einmal ihren Namen nannte, in die Tasche und ging hinunter, um zu frühstücken.
Mit der Schokolade brachte ihr der Kellner einen Brief.
Ein großer Brief mit dem Poststempel Bergheim, die Adresse in gedrungener, schräger Militärhandschrift.
Sie öffnete und lachte laut auf.
Er war doch wirklich zu naiv, der gute Junge, trotz seiner vierundzwanzig Jahre!
Schickte er ihr da allen Ernstes eine Photographie, auf der er mit seiner Braut in ganzer Figur abgebildet war, er aufrecht stehend, in knapper Husarenuniform, auf den Säbel gestützt, sie zu seiner Rechten sitzend, mit freundlich lächelndem, rundem Kindergesicht.
»Zu dumm sieht sie aus!« dachte Valeska zornig und drehte die Photographie um, um zu sehen, ob auf der Rückseite etwas stände.
Da war nichts, auch ein Begleitschreiben lag nicht bei. Es war eben nur der letzte Gruß ihres kleinen Freundes, mit dem sie zwei Jahre hindurch in Bergheim Leid und Freud' geteilt.
Jetzt war sie in Berlin, und er heiratete. Im Trubel seiner Verlobung, des Schuldenbezahlens und Wohnungeinrichtens hatte er noch Gelegenheit gefunden, einige tausend Mark für sie zu erübrigen. Davon waren ihre neuen Toiletten und ihre ganze sonstige Equipierung bestritten worden. Der gute Fritz wollte sie doch nicht ohne Ausstattung in die Reichshauptstadt ziehen lassen und sah sich infolgedessen vier Wochen lang zwischen zwei Aussteuern, der offenkundigen seiner Braut und der heimlichen seiner »Kleinen«, die ihm übrigens an Wuchs beinahe gleichkam, stehen, so daß sein armer Kopf alle Mühe hatte, diese beiden heterogenen Dinge nicht zu verwechseln.
Jetzt war die Sache erledigt. Sie hatten sich unter ehrlichen Tränen getrennt. Das war das letzte Abschiedszeichen.
Ihm mochte vielleicht noch ab und zu einmal in dem Philisterium der Ehe die Erinnerung an jene wunderlich gemischte Stimmung von gedankenloser Lebenslust und Neckerei, von träumender Sinnlichkeit und unerklärlicher Wehmut aufsteigen, mit der die Vergangenheit solche Verhältnisse vergoldet.
Und sie ...?
Die Worte der Magda aus der »Heimat« fielen ihr ein: »Weißt du denn, ob er der einzige war?«
Sie seufzte.
Was war aus den beiden anderen geworden?
Der eine, der kurische Baron, der ihr während ihres Aufenthalts in Riga den Hof gemacht und sie des Abends in seinem Wagen zum Strande nach Bolderaa geführt hatte, der war, als er ernstlich davon phantasierte, sie zu heiraten, von der Familie eingeheimst und auf eines seiner »Gütter«, wie er sie nannte, verschickt worden. Dort sollte er inzwischen ein Landfräulein geheiratet haben und seinen Daseinszweck darin erkennen, das alte Schwertbrüder-Geschlecht derer von Mayenhausen, soweit an ihm lag, nicht aussterben zu lassen.
Und der andere? ... Sie sah ihn vor sich ... den schmucken, glänzenden Kürassier-Rittmeister, dem sie zu Ende der achtziger Jahre am Stadt-Theater zu Erfurt angehört.
Sie hatte ihn leidenschaftlich geliebt. Ihr Auge wurde feucht, wenn sie an ihn dachte.
Eines Tages war er um die Ecke! Ab nach Amerika!
Ein Jahr darauf stürzte er sich – ein zerlumpter Bettler – von einem Wasserturm in Milwaukee auf das Pflaster hinab. Er starb auf der Stelle.
Und wieder klang in ihrer Erinnerung die tiefe, wohltönende Stimme, die damals an einem lauen Juliabend zum letztenmal an ihr Ohr gedrungen, während sie sich schluchzend an seine Brust lehnte und in all ihrem Kummer doch merkte, wie stark die auswattiert war.
»Leb' wohl, mein liebes kleines Mädchen! ... Mög's dir in diesem Leben besser gehen als mir!« –
Valeska trocknete sich die Augen. Sie fühlte sich so allein, so verlassen auf der Welt. Eine tiefe, unbestimmte Sehnsucht erfaßte sie, ein Drang, sich irgendwo mit geschlossenen Augen anzuschmiegen und nach zärtlich streichelnder Liebe zu bangen.
Aber sie richtete sich entschlossen auf. Mit diesen Dummheiten war es vorbei! Auf die Weise kam man nicht vorwärts! Vier Jahre hatte sie, dem Rittmeister zuliebe, in Erfurt gesessen, und nur die Freundschaft zu dem Husaren Fritz hatte sie bewogen, ein zweites Jahr nutzlos in Bergheim zu bleiben. Jetzt mußte das ein Ende nehmen. Sie wollte sich nicht mehr verlieben – den Entschluß hielt sie in grimmer Energie fest –, sie wollte Karriere machen!
Mit Neid sah sie auf die glückliche Braut, deren Photographie sie immer noch in der Hand hielt. Die hatte es gut im Leben! Von den Eltern verwöhnt und verhätschelt, mit Sorgfalt vor allem Häßlichen und Widerwärtigen bewahrt, gehegt und gepflegt, als sei sie ein köstliches Kleinod, und nun noch einen so lieben Kerl, wie ihren Fritz, zum Mann – ja, die konnte wohl ihrem Schöpfer danken.
Aber wahrscheinlich tat sie es nicht und wußte gar nicht, um wieviel besser es ihr im Leben ging als ihr, Valeska Elten, der armen Bühnenzigeunerin, die allein und haltlos in dem Reiche des Scheins und der Lüge umhertrieb, das für sie die Welt bedeutete, gierig verfolgt von den Männern, mitleidig verachtet von den Frauen der guten Gesellschaft, deren lispelnde Wohlerzogenheit es nicht zu fassen vermag, daß ein Mensch hungern und dürsten und frieren, und daß er lieben und sich die Liebe da nehmen kann, wo er sie in seinem armen Dasein findet.
»Aber wartet nur!« Valeska Elten knöpfte sich energisch die Handschuhe zu, warf einen Blick auf die Uhr und trat in die Augustsonne hinaus auf die Friedrichstraße.
Donnernd und brausend schlug ihr im Rädergerassel und Pferdebahngeklingel, im Fluten der Menschenmassen und dem Geschrei der Verkäufer der glühende Atem der Weltstadt entgegen.
II.
Der Wagen hielt vor dem Portal des Westend- Theaters, das verlassen, im Sommerschlafe, dalag.
Nur ein Trupp Mimen stand am Eingang. Herren mit kleinem Ferienschnurrbart und einzelne Damen. Neugierig musterten sie Valeska, die aus der klapperigen Droschke – in ihrer Unerfahrenheit hatte sie natürlich eine zweiter Klasse genommen – herausstieg und sich von dem Portier den Weg in das Direktionsbureau zeigen ließ.
In dem Vorzimmer, in das man sie führte, saßen bereits wartend zwei Damen und erwiderten stumm ihren Gruß.
Offenbar auch Schauspielerinnen. Die eine eine junge, bildhübsche Blondine mit keckem Stumpfnäschen und großen Kinderaugen. Die andere älter, unscheinbar gekleidet. Ihr scharfgeschnittenes, unter der Schminke verwelktes Gesicht trug einen müden, leidenden Ausdruck. Sie mußte einmal sehr schön gewesen sein.
Komische Alte oder so was, jedenfalls ungefährlich. Hingegen die andere ... Valeska schaute vom Fenster, wo sie stand, verstohlen auf die Blondine, die ihren Blick ruhig aushielt.
Die beiden schönen Mädchen sahen sich schweigend und feindselig an. Eintönig tickte die Uhr. Sonst regte sich nichts in dem Gemach.
Endlos langsam verstrich die Zeit. Viertelstunde auf Viertelstunde. Valeska glaubte vor Ungeduld zu vergehen. Endlich hielt sie es nicht mehr aus.
»Wo nur der Direktor bleiben mag!« sagte sie zu der Blondine.
»Max Bucher ist drinnen bei ihm,« erwiderte die, »es ist wegen des neuen Stücks. Da hat er für uns Neuengagierte keine Zeit!«
Valeska hatte eine dumpfe Erinnerung, als habe sie irgendwo den Namen Bucher gelesen. Genau wußte sie es nicht. Es war ja jetzt auch gleich.
»Sie sind auch neu engagiert?« fragte sie harmlos.
»Ja ... ich komme vom Lobensteiner Stadt-Theater. Hochmann sah mich da als Iza im ›Fall Clémenceau‹ und ...«
»So ...mich auch ...«, sagte die Elten scharf, »in Bergheim ...«
»Auch als Iza?«
»Ja. Ich habe ihm sehr gefallen!«
Also zwei Rivalinnen des Rollenfaches! Die Damen verstummten. Die Blondine sah neidisch auf die Elten, und die wieder dachte bei sich: hübsch mag die Kröte schon ausgesehen haben ... als Page und dann ... vor allem in der Atelierszene ...
Die blasse Dame im Hintergrund seufzte und sah auf die Uhr. Immer mehr machte sich der schwüle Augusttag im Zimmer geltend.
Da rauschte es im Vorflur wie von leichtem Schleppenfegen. Line schlanke, hochgewachsene Dame zu Anfang der Dreißiger, mit interessantem, aber keineswegs schönem Gesicht, schritt, ohne nach rechts und links zu sehen, quer durch das Zimmer und öffnete die Tür zum Allerheiligsten.
»Morgen, Direktor!« sagte sie beim Eintreten nachlässig, dann, in höflicherem Tone: »Guten Morgen, Herr Bucher!«
Damit schloß sich die Tür. Man hörte nur noch undeutliches Stimmengewirr und Gelächter.
Das mußte etwas Besonderes sein!
Valeska sah sich fragend nach den andern um.
»Die Dobschütz!« sagte die Dame im Hintergrund mit müder Stimme.
Die Dobschütz! ... Also das war hier offenbar ein großes Tier! Die Elten und die Blondine trafen sich in einem ängstlichen Blick nach der Tür, wo jene verschwunden.
Wieder verstrich eine Weile in stummem Antichambrieren. Da ging die Tür wieder auf, die Dobschütz kam zurück, neben ihr ein dicker, mittelgroßer Herr in den Sechzigern, einen Zwicker auf der Nase und mit einer mächtigen Glatze.
»Lassen Sie sich von dem Alten nicht bange machen, Herr Bucher,« sagte die Dobschütz im Vorübergehen, »die große Szene wird gespielt, wie ich es will und wie Sie's geschrieben haben! Ich garantiere Ihnen ... der dritte Akt steht wie 'ne Mauer!«
Damit war sie hinaus. Ihr Begleiter mit flüchtiger Verbeugung gegen die Damen hinterher.
Der Theatersekretär hatte inzwischen deren Karten dem Direktor hineingetragen und kam wieder zurück.
»Der Herr Direktor bedauert,« sagte er zu der blassen Dame, »für seriöse und komische Alte ist keine Verwendung mehr. Alles komplett. Eine Empfehlung an Herrn Hassel!« – Dann zu der Blondine: »Bitte, gehen Sie nur hinein!«
Die blasse Dame stieß einen müden Seufzer aus, erhob sich und verließ, ohne ein Wort zu sprechen, den Raum.
»Die hätten Sie Ende der sechziger Jahre hier sehen sollen,« sagte der Sekretär zu Valeska, »eben in diesem Theater ... Wir haben noch die alten Kassenbücher ... Jedesmal ausverkauftes Haus, wenn sie auftrat ... und jetzt ...« Er zuckte mitleidig die Achseln. »Du lieber Gott, ja ... es ist nichts und wird nichts mehr mit ihr ... sie kann einen wirklich dauern!«
Ein Frösteln überlief Valeska.
Das war auch ihr Schicksal in zehn, fünfzehn Jahren, wenn sie nicht klug und tätig war!
Da kam die Blondine zurück, etwas mißvergnügt und niedergeschlagen, wie es schien, und empfahl sich mit freundlicher Kopfneigung Valeska und dem Sekretär.
»Na ... bitte ... nur 'rein, Fräulein!«
Valeska trat in das Direktionszimmer, wo Herr Hochmann hinter einem großen, mit Schriftstücken bedeckten Tische saß.
»Guten Morgen!« sagte er zerstreut und reichte ihr über den Tisch seine kleine fleischige Hand. »Nun, wie steht's, Fräulein ... Fräulein ...« Er warf einen Blick auf ein vor ihm liegendes Blatt. »Richtig, Fräulein Elten von Bergheim ... na, wie steht's ... haben Sie sich denn den Sprachfehler jetzt abgewöhnt? ... Oder war das eine andere?« unterbrach er sich, als er Valeskas erstauntes Gesicht sah. »Sie sind doch Fräulein Elten ...?«
»Das bin ich«, sagte die hübsche Schauspielerin pikiert. »Sie sahen mich doch in Bergheim, Herr Direktor ...«
»Als Iza ... natürlich ... und engagierte Sie ... erinnere mich, mein Fräulein, erinnere mich ... habe soviel im Kopf ...«, setzte er etwas gereizt hinzu. »Wir bringen gleich zur Eröffnung der Saison eine große Novität ... das Neueste von Max Bucher ... Sie begreifen, daß ich darüber manches andere vergesse.«
Max Bucher!
Valeska kannte nichts von ihm, aber sie wußte, daß der löbliche Bergheimer Magistrat auf Zucht und Sitte im Theater hielt und »denen Histrionen«, wie es im preußischen Zensuredikt heißt, so manche gefährliche Neuheit vorenthielt. Dazu gehörten wahrscheinlich auch die Werke des berühmten Bucher.
Sie schwieg also in ehrfurchtsvoller Teilnahme.
»Ja ... wie war mir denn?« sagte der Direktor und hielt sinnend die Hand gegen die kahle, schweißperlende Stirn. »Ich hatte Ihnen doch eine Rolle darin zugeteilt ... he ... Herr Rüsemer ...«, rief er dann, erhob sich und öffnete die Tür. »Herr Rüsemer ... bitte ... bleiben Sie sitzen, Fräulein ... Herr Rüsemer, haben Sie die Rollen zu ›Ellinor‹ bei der Hand? Ja? Dann geben Sie, bitte, dem Fräulein die Rieke ...«
Ein freudiger Schreck durchzuckte Valeska bei der Kunde, daß sie in wenigen Wochen eine Rolle kreieren werde. »Rieke« .... was mochte das wohl sein? Wahrscheinlich eines der modernen Hinterhausstücke. Einerlei ... ihre »Alma« konnte sich schon sehen lassen ...
Da gab ihr der Sekretär das dünne blaue Heft.
»Ellinor«, Schauspiel in 4 Akten von Max Bucher, stand oben auf der ersten Quartseite.
Und rechts unten: »Rieke, Dienstmagd. ½ Bogen.«
Ein halber Bogen nur! Entsetzt schlug sie das Blatt um und las.
Erster Akt. Erste Szene. Rieke
(tritt von links ein, mit dummdreistem Lächeln).
Madame ... der Herr Baron is draußen!
Ellinor.
... und außerdem hab' ich Kopfweh ...
Rieke.
... da soll ick ihm nich 'rinlassen?
Ellinor.
... also meinetwegen ... ich lasse bitten ...
Rieke.
Is jut! (Ab links.)
Das war der erste Akt!
Im zweiten Akt hatte sie die siebente Szene. Zu sprechen war da überhaupt nichts. Sie trug nur Tee herein, reichte ihn herum und ging wieder.
Der dritte Akt brachte ihr vor der großen Schlußszene ein kurzes Auftreten:
Rieke
(rasch von links).
Madame ... eben kommt der jnädige Herr ...
Adalbert.
Mut, Ellinor!
Rieke (für sich).
Na ... nu wird's jut! (Ab links.)
Im vierten Akt ging sie überhaupt leer aus.
Das war die »Rolle«.
»Was haben Sie denn?« sagte Hochmann, den die Debatte mit Bucher und der Dobschütz offenbar nervös erregt hatte. »Was machen Sie denn für ein Gesicht?«
»Die Rolle ist so klein ...« erwiderte Valeska stotternd ... »und ...«
»Ja ... soll ich Ihnen zu Ehren die ›Maria Stuart‹ spielen ... oder was wünschen Sie sonst ...«
»... und ... und ich kann gar nicht berlinerisch sprechen«, fuhr sie mit dem Mut der Verzweiflung fort.
»Ach was ... wo sind Sie geboren? ... in Eisenach? Nun also ... wer von nördlich des Mains ist, spielt die norddeutschen Dialektepisoden, wer südlich, die süddeutschen! Das ist doch ganz einfach!«
»Ja aber ... ich habe doch in Bergheim ....«
» Was haben Sie in Bergheim?« Der Bühnenleiter zog eine Schublade auf und holte nach kurzem Suchen einen bedruckten Bogen hervor. »Ist das Ihr Kontrakt oder nicht ...?«
Allerdings ... das war ihr Kontrakt, eine endlose Reihe enggedruckter Paragraphen mit all den unwürdigen Bestimmungen, die diese Sklavenformulare enthalten. Sehr genau war darin festgesetzt, daß sie an das »Westend-Theater« als Schauspielerin engagiert sei, keine Rolle zurückweisen und in ihrem künstlerischen Fache keine Tätigkeit verweigern dürfe, die nicht offenbar mit Gefahr für Leben und Gesundheit verbunden, daß sie bei Gastspielen Anrecht auf Beförderung in der dritten Klasse der Eisenbahn und der zweiten des Dampfschiffes habe, daß sie für ihre Toiletten – mit Ausnahme der Männerkleider –, für Trikots, Wäsche, Schmuck und Fußbekleidung aus eigenen Mitteln aufkomme und dafür eine Gage von 300 Mark monatlich beziehe, wenn nicht die Direktion von ihrem Rechte Gebrauch mache, sie, sobald sich auf den ersten Proben ihre künstlerische Unfähigkeit herausstelle, oder sobald sie innerhalb der ersten vier Wochen nach Beginn der Saison einmal aufgetreten, oder sobald sie über eine gewisse Zeit hinaus krank gewesen, ohne weiteres zu entlassen. Ebenso konnte sie gegen Ende der Saison entlassen werden, während sie sich ihrerseits für drei Jahre fest an das Theater gebunden hatte.
Ja ... da war nichts zu machen! Die Elten schwieg.
»Wo sollte denn das hinführen, Kind,« sagte der an sich sehr gutmütige Direktor etwas versöhnlicher, »wenn jeder nur die besten Rollen haben wollte? Da müßte man sie schließlich verlosen, um allen gerecht zu werden. Wenn es mit Ihnen geht, bekommen Sie auch größere Aufgaben. Und nun adieu! ... Morgen um zehn ist Probe!«
Er reichte ihr die Hand. Valeska ging verstört in den Vorraum zurück.
Diese Hunderolle! ... und in einem Dialekt, den sie nicht beherrschte ... und als schlampige Dienstmagd angezogen, wo sie zu Hause die großen Koffer voll glänzender Toiletten hatte ... und womöglich noch mit rotgeschminkten Backen und Armen ... es war furchtbar! Eine unsägliche Wut gegen den Autor der »Ellinor« stieg in ihr auf.
»Glauben Sie, daß man das Dings oft spielen wird?« fragte sie draußen den Sekretär.
Der schien ganz entsetzt. »Das ›Dings‹! ... Aber Fräulein ... ein Werk von Bucher ... hoffentlich macht es was!«
»Und wie oft gibt man's dann?«
»Solang es geht! ›Die kleine Herzogin‹ haben wir in der vorigen Saison hundertundzweiundzwanzigmal gespielt.«
Valeska verspürte einen gelinden Schauder. Einhundertzweiundzwanzigmal diese Köchin verzapfen ... sie, die in Bergheim die ersten Rollen gespielt, nimmermehr! Mit dem festen Entschluß, in solchem Falle kontraktbrüchig zu werden, stieg sie die Treppe hinunter und schritt durch das Portal.
Da stand die Blondine noch in eifrigem Gespräch mit einem schönen, hochgewachsenen Mimen, dem das spärliche Haupthaar in langen Strähnen auf den trotz der Sommerhitze umgeworfenen Radmantel fiel. Das war Harald Grillon, der erste Liebhaber, Regisseur und Gegenstand des schauernden Entzückens aller Backfische im Tiergartenviertel.
Er lüftete mit einem verbindlichen »Grüß' Gott!« den Kalabreser, als sie vorbeischritt. Sie dankte und bemühte sich, während sie, das blaue Heftchen in der Hand, in den Wagen stieg, so fröhlich und unbefangen auszusehen, als sei ihr eine Bombenrolle anvertraut worden.
Sie fuhr nach der Hasselschen Agentur.
Persönlich kannte sie Herrn Hassel nicht. Aber er hatte ihr Engagement wie viele andere am Westend- Theater vermittelt, und sie hielt es für angezeigt, ihn zu besuchen.
Vielleicht konnte er ihr helfen.
Viel Gutes hatte sie freilich nicht von ihm gehört. Seine Agentur gehörte keineswegs zu den alten und wohlangesehenen Berlins, sondern näherte sich vielmehr in bedenklichem Grade jener Sorte von Vermittlungsbureaus, für die der Kulissenjargon einen in keiner Weise salonfähigen Ausdruck geschaffen hat.
In dem behaglich eingerichteten Vorzimmer blieb sie lange Zeit allein.
So saß sie stumm und müßig da. An das Antichambrieren gewöhnte sie sich schon allmählich.
Im Nebenzimmer, beim Agenten, war Josef Jeserich, der berühmte Wandervirtuose und »Mauerweiler«, ein Mann, dessen imposanter Gesichtsausdruck schon sagte, daß für ihn die Achse des Weltalls mitten durch seine Garderobe ging.
Ein erregtes Gespräch klang zu Valeska hinaus. Es handelte sich um die Zusammenstellung einer Gastspieltournee. Die Namen der Direktoren und Intendanten, der Autoren, deren Stücke in Frage kamen, der beteiligten Schauspieler, die Tantiemeberechnungen und Provisionssätze, die Durchschnittserträge der einzelnen Theater, die Kosten für Ankauf eines vielversprechenden französischen Stückes, das alles schwirrte bunt durcheinander.
Man schien sich nicht einigen zu können. Wenigstens erhob sich der Mime plötzlich, ergriff seinen Hut und öffnete die Tür zum Vorzimmer. Der Agent lief hinter ihm her.
»Ich habe doch nun mal nicht die Verfügung über die Kasse des Direktors Schwarze,« rief er erregt, »wenn der Mann mir sagt ... so und so ... und mehr kann ich nicht ...«
»Ich komme morgen wieder, Herr Hassel«, sagte der Tragöde mit leiser, melodisch aus tiefer Brust klingender Stimme, grüßte freundlich die kleine Schauspielerin, die beim Eintritt ihres berühmten Kollegen aufgestanden war, und ging.
Der Agent, ein großer, wohlbeleibter Herr mit schneeweißem Patriarchenbart und spärlichem Silberhaar, unter dem eine rosige Glatze schimmerte, hörte mit freundlichem Lächeln Valeskas Klagen an.
»Ja ... Fräulein ... zu machen ist da nichts!« sagte er. »So mir nichts, dir nichts kriegt man nicht erste Rollen in Berlin. Seien Sie froh, daß ich Sie an das schöne Theater gebracht habe ... jetzt seien Sie fleißig und geschickt ... suchen Sie die einflußreichen Leute für sich zu gewinnen ... Haben Sie Seybling vielleicht kennengelernt? ... Nein? ... Da halten Sie sich daran. Der und die Dobschütz spielen die erste Flöte. Wenn Sie natürlich Schliephacke auch für sich interessieren können, ist's um so besser.«
Seybling ... Schliephacke ... Valeska sah den Agenten fassungslos an.
Aber Herr Hassel hielt es offenbar für überflüssig, sie aufzuklären.
»Also machen Sie's gut, Kind!« sagte er väterlich. Und vertraulicher setzte er hinzu: »Und verplempern Sie sich nicht! Das Westend-Theater ist ein heißer Boden.«
»Wer ist denn da besonders gefährlich?« fragte die hübsche Schauspielerin naiv.
»Ich möchte Sie vor allen Dingen vor dreien warnen! ... Der eine ist Seybling, der andere ist Harald Grillon und der dritte ...«, der Greis lächelte mild und schalkhaft, »der dritte bin ich selbst! Also seien Sie klug und werden Sie weder Frau von Seybling noch Frau Grillon ...!«
»... noch Frau Hassel!« setzte Valeska kaltblütig hinzu. Derlei Dinge waren ihr nichts Neues. »Ich verstehe. Guten Morgen!«
»Guten Morgen, liebes Fräulein!«
Nun begann die Rundfahrt auf den Redaktionen. Valeska hielt sie nach ihren Provinzerfahrungen für unbedingt erforderlich. Erst später erfuhr sie, daß man in Berlin bereits angefangen habe, sich von diesem Brauch zu emanzipieren, oder ihn durch das Versenden von Visitenkarten an die Kritiker zu ersetzen.
Von diesen traf sie auch nur wenige an. Einige Feuilletonredakteure empfingen sie freundlich, aber mit der Miene vielbeschäftigter Männer, ein oder zwei große Blätter nahmen die Anzeigen von Gastspielen und Debüts überhaupt nur auf schriftlichem Wege entgegen.
Es war doch ganz anders als in Bergheim, wo sie, der Stern des Theaters, der den ganzen Winter hindurch den Kasinotafeln und Stammtischen, den Damenkaffees und Backfischkränzchen unerschöpflichen Gesprächsstoff lieferte, von Zeit zu Zeit, wenn eine besonders günstige Kritik über sie erschienen, neckisch lachend in das düstere Redaktionszimmer rauschte, um dem Redakteur völlig den Kopf zu verdrehen und nach einem Plauderviertelstündchen sich durch ein Spalier staunender Metteure, Laufburschen und Expedienten mit lieblicher Herablassung zu empfehlen.
Dies Berlin! Diese eisige Gleichgültigkeit, die ihr entgegentrat, diese geschäftsmäßige Seelenlosigkeit im Verkehr, diese blinde, ebenso geschäftsmäßige Anbetung des Erfolges!
In der Leipziger Straße, auf deren Schattenseite sie langsam zu Fuß ihrem Hotel zuschritt, blieb sie vor einem Schaufenster stehen.
Die Photographien zahlreicher Schauspielerinnen hingen darin, wahllos zwischen Potentaten, Abgeordneten, Schriftstellern, Afrikaforschern und sonstigen Berühmtheiten des Tages. Unter jeder Photographie stand auf einem Zettelchen der Name.
Viele Namen waren es nicht. Etwa ein Dutzend, das immer wieder in den Schaufenstern der Papiergeschäfte und Buchläden auftauchte.
Sie blickte beinahe ehrfurchtsvoll auf die Bilder dieser Kolleginnen. Die hatten also den Erfolg errungen! Aber wie – das hätte sie gar zu gern gewußt.
Und da fiel ihr ein: sie trug ja noch einen Brief in der Tasche. Einen Brief, den ihr Bruckhoff, der alte Direktor des Bergheimer Stadt-Theaters, an den einst weltberühmten Menschendarsteller Sparski in Berlin mitgegeben.
Als junger Bursche war er mit Sparski zusammen an »der Burg« engagiert gewesen ... »damals« ... »unter Laube« usw. ... beides blutige Anfänger, die sich dann während ihres wechselvollen Lebenslaufes nicht mehr aus den Augen verloren hatten.
Jetzt hatte sich Sparski schon lange krankheitshalber von der Bühne zurückgezogen. Man sprach nicht mehr von ihm, der einst der Abgott des Publikums, ein Gegenstand bewundernden Neides für die Kollegen, ein Schrecken der Ehemänner und ein wonniger Dämon der Frauen gewesen war.
»Direkt helfen wird er Ihnen nicht können, Elten,« hatte der alte Bruckhoff zu ihr gesagt, »aber klug ist er, mein Freund Sparski ... sehr klug. Er kennt Berlin, er kennt das Theater, er kennt die Menschen. Suchen Sie ihn recht bald auf und grüßen Sie ihn von mir.«
Valeska entschloß sich, das jetzt gleich zu tun. Vielleicht fand sie da Trost und Ermunterung.
Eine Droschke führte sie vor ein unsauberes, altes Haus in einer stillen Seitenstraße. Eine brummige Magd öffnete die Flurtür, nahm die Karte in Empfang und führte sie in das Zimmer.
Valeska trat in einen Raum, in dem bereits das Dämmern des Augustabends brütete. Verblaßte Plüschmöbel, zahllose Lorbeerkränze mit lang herabhängenden Schleifen, Photographien mit Widmung und Diplome an den Wänden, die Luft von dem beklemmenden Dunst welker Blätter, Kölnischen Wassers und bessarabischen Tabaks erfüllt.
»Bitte, mein Fräulein!« ließ sich plötzlich eine tonlose Stimme vom Fenster her vernehmen. »Treten Sie näher... setzen Sie sich...«
Jetzt erst sah sie den siechen Mimen.
Er saß in einem Rollstuhl, vom Schlafrock umhüllt, eine Decke über die Knie gezogen. Die magere, gebrechliche Greisengestalt war nach vornüber gesunken. Aus dem leichengelben, durchfurchten und leidenden Gesicht hefteten sich die Augen in stechendem, lüsternem Glanz auf die Gestalt des schönen Mädchens.
»Setzen Sie sich, mein Fräulein!« wiederholte er hüstelnd. »Sie bringen mir einen Brief meines Freundes Bruckhoff. Bruckhoff ist ein Esel. Sonst schickte er Sie nicht zu mir. Denn ich bin, wie Sie sehen, lebendig tot. Eine Leiche auf Urlaub. Noch dazu augenblicklich in gelindem Morphiumdusel. Ich bin mit mir und meinen Schmerzen allein. Menschen kriege ich nur zu sehen, wenn sie jetzt noch etwas von mir wollen. Also was wollen Sie?«