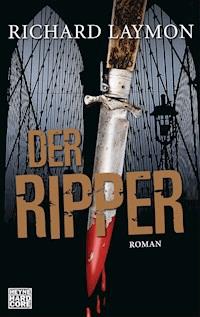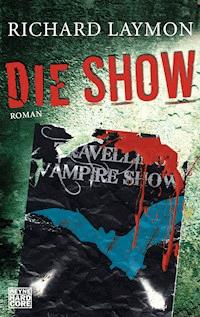2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Alte Liebe rostet nicht
Der psychopathische Albert mag Frauen. Doch die Frauen mögen Albert nicht. Unmenschlicher Hass treibt ihn dazu, alle Grenzen hinter sich zu lassen. Albert beginnt einen mörderischen Streifzug durch die USA – immer auf der Suche nach Opfern. In Kalifornien kreuzt sein Weg das Schicksal einer Gruppe junger Intellektueller. Auf einer Halloweenparty treffen alle zusammen – das Blutbad beginnt ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 439
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Zum Buch
North Glen, Illinois, Oktober 1975: Der junge Albert Prince ist ein Außenseiter, ohne Freunde, bei den Mädchen unbeliebt. Was niemand weiß: Albert hat ein ungewöhnliches Hobby. Nachts bricht er in fremde Häuser ein, versteckt sich dort und lebt abgründige Fantasien aus – sein Messer hat er immer dabei. Als er bei einem seiner Einbrüche entdeckt wird, überschreitet Albert alle Grenzen und metzelt eine ganze Familie nieder. Der wahnsinnige Albert flieht vom Ort des Verbrechens und begibt sich auf eine blutige Tour quer durch Amerika. In Kalifornien kreuzt er den Weg einer Gruppe Intellektueller, deren Schicksale durch Alberts Untaten auf grausame Weise beeinflusst werden. Auf einer Halloweenparty am Campus kommt es zu einem Finale unvorstellbaren Horrors: Alberts Klinge bahnt sich ihren blutigen Weg …
Mit einem ausführlichen Verzeichnis aller im Wilhelm Heyne Verlag erschienenen Werke von Richard Laymon.
Zum Autor
Richard Laymon wurde 1947 in Chicago geboren und studierte in Kalifornien englische Literatur. Er arbeitete als Lehrer, Bibliothekar und Zeitschriftenredakteur, bevor er sich ganz dem Schreiben widmete und zu einem der bestverkauften Spannungsautoren aller Zeiten wurde. 2001 gestorben, gilt Laymon heute in den USA und Großbritannien als Horror-Kultautor, der von Schriftstellerkollegen wie Stephen King und Dean Koontz hoch geschätzt wird.
Besuchen Sie auch die offizielle Website über Richard Laymon unter www.rlk.stevegerlach.com
Richard Laymon
Die Klinge
Roman
Aus dem Amerikanischen von Marcel Häußler
Wilhelm Heyne VerlagMünchen
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die Originalausgabe CUTS erschien bei Leisure Books, New York.
Vollständige deutsche Erstausgabe 04/2014
Copyright © 1999 by Richard Laymon
Copyright © 2014 der deutschsprachigen Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Published in arrangement with Lennart Sane Agency AB
Redaktion: Sven-Eric Wehmeyer
Covergestaltung: Hauptmann & Kompanie Werbeagentur,
Zürich, Dominic Wilhelm
Satz: C. Schaber Datentechnik, Wels
ISBN 978-3-641-11353-7V003
www.heyne-hardcore.de
Dieses Buch ist Don Cannon gewidmet.
Danke für die jahrelange
Ermutigung und Unterstützung.
Du verkaufst sie,
ich signiere sie.
TEIL EINS
OKTOBER 1975
1 NORTH GLEN, ILLINOIS
»Möchtest du auf den Rücksitz?«
»Hm?« Albert hatte nicht zugehört, er war zu fasziniert von der Weichheit ihrer Brüste in seinem Gesicht.
Sie schob ihn weg. »Der Rücksitz. Willst du mit mir auf den Rücksitz?«
»Wozu?«, fragte Albert, der nichts als wieder an ihre Brüste wollte. In der Dunkelheit sahen sie blass aus, die Nippel fast schwarz.
Obwohl er schon siebzehn und in der zwölften Klasse der Highschool war, hatte er bis heute Nacht noch nie echte Brüste erblickt. Er kannte sie nur von Fotos und Bildern – bloß einmal, als er noch ein kleiner Junge gewesen war, hatte er die Brüste seiner Mutter gesehen. Er hatte sie nicht angefasst, obwohl er es gewollt hatte. Trotz des Bluts. Oder vielleicht gerade deswegen.
Aber diese hier fasste er an. Sie fühlten sich noch wundervoller an, als er es sich vorgestellt hatte. So glatt und weich und federnd. Die Brustwarzen waren nicht glatt. Sie waren uneben und hart, und wie sie hervorstanden …
»Damit wir es machen können, du Blödmann«, sagte Betty. »Du willst es doch, oder?«
»Klar. Ich meine, ich glaub schon. Natürlich will ich.«
»Wir treiben es nicht auf dem Vordersitz, das steht fest.«
»Okay.«
Sie sah ihn an und rührte sich nicht.
»Ich mach dir die Tür auf.« Albert lehnte sich über sie. Als er sich nach dem Türgriff streckte und dabei die Wange gegen ihre Brust drückte, spürte er, wie der Nippel in sein Ohr glitt. Es kitzelte, und er erschauderte.
Sie packte seinen Arm.
»Was ist los?«, fragte er. »Ist jemand da draußen?«
Er sah aus dem Fenster. Der Wagen war am Ende einer Sackgasse geparkt. Dahinter befand sich ein kleines Waldstück, dessen nahezu blattlose Bäume ihre Äste in den Schein des Oktobermonds streckten. Falls dort jemand herumlungerte, konnte Albert ihn nicht sehen. Auch auf den Bürgersteigen und in den Vorgärten der Häuser in der Nähe entdeckte er niemanden. Bis auf ein paar Verandalampen lagen die meisten Gebäude im Dunkeln.
»Ich sehe niemanden«, sagte Albert.
»Das ist nicht das Problem, Süßer.«
»Was denn?«
»Du bist wirklich eine Nummer.«
»Soll ich dir nicht die Tür öffnen?«
»Noch nicht. Erst will ich meine zwanzig Dollar haben.«
»Was?«
»Zwanzig Dollar. Für weniger mache ich es nie. Bei vielen Männern nehme ich sogar mehr. Ich gewähre dir einen Nachlass, weil ich dich mag. Du bist ein bisschen seltsam, aber wahnsinnig süß.« Sie schob eine Hand unter sein Hemd und strich ihm über die Brust.
»Wenn ich so süß bin, solltest du kein Geld von mir verlangen.«
»Würde ich auch nicht, aber ich muss nächstes Jahr aufs College gehen.«
»Na und?«
»Das kostet eine Menge Geld. Das Wohnheim, die Bücher, von den Studiengebühren ganz zu schweigen.«
»Zwanzig Dollar also. Das ist viel Geld.«
»Es ist viel mehr wert«, sagte Betty. Sie griff mit einer Hand in Alberts Hose. Er stöhnte bei der Berührung ihrer kalten Finger. »Ohhh, keine Unterhose. Du bist wirklich ein ungezogener Junge.«
»Was hältst du von zehn Dollar?«, fragte er.
»Zwanzig.«
Er spürte ihre Hand langsam seinen Penis hinaufgleiten.
»Aber ich hab nur … ich weiß nicht, vielleicht fünfzehn dabei.«
Sie zog die Hand weg.
»Lass mich mal nachsehen.« Er holte die Brieftasche aus der Gesäßtasche seiner Jeans, klappte sie auf und nahm die Scheine heraus. Er hielt das Geld dicht an die Windschutzscheibe und betrachtete es im schwachen Licht, das hereinfiel. Ein Zehner und vier Einer.
»Wie viel?«, fragte Betty.
»Vierzehn Dollar.«
»Das reicht nicht.«
»Komm schon.«
»Vergiss es, Albert.«
»Ich kann dir den Rest morgen geben.«
»Klar. Tu das, dann können wir morgen Nacht vielleicht weitermachen.«
»Lass es uns jetzt machen, okay? Komm schon, es fehlen doch nur sechs Dollar. Bitte.«
»Hat Stan dir nicht den Preis gesagt?«
Stan hatte überhaupt nicht erwähnt, dass er sie bezahlen musste. Er hatte gesagt: »Sie ist rattenscharf, Mann. Ich hab mit ihr gesprochen. Sie will dich. Das hat sie mir gesagt. Mann, das ist deine Chance, zum Schuss zu kommen.«
»Was muss ich tun?«, hatte Albert ihn gefragt.
»Führ sie einfach aus. Ruf sie an, lade sie auf eine Pizza oder so und ins Kino ein, dann halte auf dem Heimweg an einer schön ungestörten Stelle, und nimm sie. Sie wird es dir richtig besorgen.«
Stirnrunzelnd sah Albert Betty an. »Er hat nicht gesagt, dass ich dich bezahlen muss.«
»Tja, das hätte er aber tun sollen. Der Idiot. Es kostet zwanzig Dollar, keinen Penny weniger.«
»Komm schon, Betty.«
»Wenn du so viel nicht hast, kannst du mich jetzt nach Hause bringen.«
»Dich nach Hause bringen? Warum sollte ich dich nach Hause bringen? Scheiße! Du kannst zu Fuß nach Hause gehen.«
»Sei nicht so ein Arschloch.«
»Steig einfach aus meinem Wagen«, sagte Albert.
»Soll das ein Witz sein?« Sie verrenkte die Arme hinter dem Rücken, um ihren BH zu schließen. »Mach dich nicht lächerlich. Fahr mich einfach nach Hause. Treib morgen das restliche Geld auf und ruf mich an.« Sie knöpfte die Bluse zu. »Dann haben wir morgen Nacht viel Spaß miteinander.«
»Scheiße«, murmelte er.
»Bleib locker. Das ist kein Weltuntergang.«
Es fühlt sich aber so an, dachte er.
Er startete den Motor und setzte so ruckartig zurück, dass Betty nach vorn geworfen wurde. »Hey!« Sie stützte sich mit einer Hand am Armaturenbrett ab. »Verdammt, beruhig dich!«
Doch Albert beruhigte sich nicht. Er raste durch die enge Straße und nahm die Kurven so schnell, dass die Reifen ächzten. Betty klammerte sich am Armaturenbrett fest.
Als er um eine Kurve schoss, tauchte das Heck eines parkenden Porsche im Scheinwerferlicht auf.
Er riss das Lenkrad herum.
Nicht schnell genug.
Mit einem metallischen Knirschen streifte er den Porsche.
»Jetzt ist es passiert«, sagte Betty.
»Er hätte nicht da parken sollen«, sagte Albert und trat das Gaspedal durch.
»Willst du nicht anhalten?«
»Warum sollte ich?«
»Mein Gott, Albert! Du musst anhalten. Das ist gegen das Gesetz.«
»Scheiß auf das Gesetz.« Er ignorierte ein Stoppschild und raste weiter.
»Okay«, schnauzte Betty. »Das reicht. Lass mich raus. Sofort!«
Albert hielt nicht an.
»Lass mich bitte raus!«
Er sah sie an und setzte ein Lächeln auf. »Nein.«
»Albert!«
Er fuhr schnell auf einen Kombi auf, zog über die doppelte gelbe Linie und sauste vorbei.
»Du bringst uns noch um!«
»Na und?«
»Verdammt!«
Er schleuderte mit quietschenden Reifen um eine Ecke und schoss eine steile Straße hinauf. Zu beiden Seiten standen Häuser mit breiten Einfahrten. Teure, zweigeschossige Häuser.
»In welchem wohnst du?«, fragte er.
»In der Mitte der Straße. Das weiße auf der rechten Seite.«
Vor dem Haus trat er hart auf die Bremse. Er sagte nichts. Er starrte nach vorn und rührte sich nicht, bis die Tür zuschlug.
Dann beobachtete er, wie Betty die Einfahrt hinaufging. Ihr Rock war sehr kurz. Er flatterte in der Brise. Im Mondlicht wirkten ihre Beine blass.
»Schlampe«, murmelte er.
Nur eine dreckige Hure, dachte er. Nur eine dreckige Hure verlangt Geld dafür. Wahrscheinlich hätte ich mir bei ihr einen Tripper geholt oder so. Ein Glück, dass ich keine zwanzig Dollar hatte.
Aber wenn ich das Geld gehabt hätte, würde ich sie jetzt bumsen.
Er sah zu, wie sie ins Haus ging und die Tür schloss.
»Und tschüss«, sagte er.
Dann packte er mit beiden Händen fest das Steuer und warf sich nach vorn. Seine Stirn schlug gegen die Oberseite des Lenkrads. Er tat es noch einmal. Und noch einmal.
Danach saß er eine ganze Weile reglos da. Schließlich ließ er den Motor an und fuhr langsam davon. Als er die Washington Avenue erreichte, bog er nach rechts ab und steuerte auf das Geschäftsviertel zu.
Die Vorführung im North-Glen-Kino musste gerade vorbei sein. Die Schrift über dem Eingang kündigte dieselbe Doppelvorstellung an, die Albert sich letzten Abend angesehen hatte: The Texas Chainsaw Massacre und Vier im rasenden Sarg. Er nahm an, dass den meisten Leuten, die zu ihren Autos gingen, der Schreck noch in den Gliedern steckte.
Er hatte die Filme geliebt. Beide, aber besonders Chainsaw.
Letzten Abend hatte das Publikum vor Angst geschrien.
Nicht jedoch Albert.
Er hatte sich gewünscht, er wäre in den Filmen und würde diese Frauen jagen …
Plötzlich wurde Albert klar, dass er, wäre er nicht ins Kino gegangen, genug Geld für Betty gehabt hätte. Die Eintrittskarte hatte zwei fünfzig gekostet, und er hatte mindestens vier Dollar für Snacks ausgegeben.
Er stieß ein bitteres Lachen aus.
Dann bemerkte er einen Hund, der über den Bürgersteig trottete. Er schien allein unterwegs zu sein.
Albert parkte das Auto und stieg aus.
Der Oktoberwind war ungewöhnlich warm. Er fühlte sich gut an und brachte den schwachen, würzigen Geruch von verbranntem Laub mit sich.
Albert ging schnell, blickte in die schattigen Ecken und lauschte.
Er wusste, worauf er achten musste.
Ein paar Minuten später hörte er es.
Die Marken am Halsband klingelten wie ein Schlüsselbund.
Zuerst sah er keine Spur von dem Hund. Dann tauchte er ein paar Meter vor ihm hinter einem Baum auf: ein kurzhaariger gefleckter Hund, wie ein Dalmatiner, nur mit kürzeren Beinen.
Albert ging auf ihn zu.
Der Hund beachtete ihn nicht. Er streunte mit gesenkter Nase durch das Gras am Straßenrand und schnüffelte laut.
Als Albert sich von hinten näherte, sah der Hund über die Schulter.
»Hi, Kumpel.« Albert ging in die Hocke. »Komm her.«
Der Hund beobachtete ihn, kam jedoch nicht.
Albert blickte sich um. Auf der Straße rauschte ein Auto vorbei. Ein zweites parkte aus und fuhr davon. Die nächsten Fußgänger waren ein paar Blocks entfernt und schienen in die andere Richtung zu gehen.
Er lächelte den Hund an. »Komm her, Kumpel«, rief er leise. Er klopfte sich aufs Knie. »Komm her, mein Junge.«
Der Hund trat einen Schritt auf ihn zu und zögerte.
»Alles in Ordnung, Kumpel. Komm her. Komm her. Ich hab was für dich.«
Er streckte ihm die geschlossene Hand entgegen.
Eine leere Hand, doch das wusste der Hund nicht.
Er kam näher.
»Guter Junge. Du bist ein guter Junge.«
Als der Hund an seiner linken Hand zu schnüffeln begann, streckte Albert die rechte aus und kraulte das Fell unter seinem Kinn.
»Das gefällt dir, Kumpel, was?«
Dann öffnete er die linke Hand. Der Hund drückte seine feuchte Schnauze gegen die Handfläche und schnüffelte, als wollte er das geheimnisvolle Leckerli aufspüren. Albert streichelte ihn hinter den Ohren. Der Hund ließ den Kopf tief herabhängen und schloss halb die Augen. Der Schwanz wedelte langsam hin und her.
»Ja, das gefällt dir, oder?«
Während er den Hund weiter mit der linken Hand streichelte, ließ Albert sich mit den Knien ins nasse Gras sinken und zwängte die rechte in eine Vordertasche der Jeans.
Schwanzwedelnd warf sich der Hund auf die Seite.
Albert kraulte das Brustfell. Als er seinen Bauch streichelte, zuckte die linke Hinterpfote und beschrieb kleine Kreise in der Luft.
»Ja, das gefällt dir.«
Er zog das Springmesser aus der Tasche. In der Chicagoer U-Bahn hatte er einem mexikanischen Jungen zwölf Dollar dafür gezahlt. Er drückte auf den Knopf. Als die fünfzehn Zentimeter lange Klinge herausschnellte, ruckte der Griff in seiner Hand.
Der Hund erschrak und versuchte sich aufzurichten.
»Oh nein, lass das.«
Albert hielt ihn mit der linken Hand am Boden.
Mit der rechten stieß er das Messer in das weiche Fleisch unterhalb der Rippen.
Das Kreischen des Hundes durchbrach die Stille.
Albert zog das Messer heraus.
Er war erregt und hatte eine schmerzhaft harte Erektion.
Er stach noch einmal zu.
Das Kreischen des Hundes riss ab.
Albert stieß die Klinge erneut in den Bauch des Tieres, und dieses Mal brach es aus seiner schmerzlichen Härte hervor, pulsierend, heiß und feucht.
2 GRAND BEACH, KALIFORNIEN
Am Samstagmorgen wachte Janet Arthur auf, weil sich eine Hand zwischen ihre Schenkel schob. Schläfrig stöhnte sie vor Lust und schmiegte das Gesicht tiefer ins Kissen.
Bald zog sich die Hand zurück.
Eine Brise strich über Janets nackten Rücken, als die Decke weggezogen wurde. Sie atmete tief ein. Der Wind brachte den frischen, aufregenden Duft des Meeres mit sich, das nur ein paar Straßenzüge entfernt war.
Sie drehte sich um und sah Dave neben sich knien. Sein dichtes, schwarzes Haar war wirr. Der schlanke, straffe Körper hatte die sommerliche Bräune behalten, nur dort, wo ihn während der langen Tage am Pool die Badehose bedeckt hatte, war er auffallend blass.
»Guten Morgen«, sagte sie. Lächelnd streckte sie die Hand nach ihm aus.
Er hatte eine Erektion. »Wie kommt es, dass du immer so aufwachst?«
»Ich träume von dir.«
»Ach, liegt es daran?«
»Ja, daran liegt’s.« Er kletterte zwischen ihre Knie und ließ sich herabsinken.
»Warte noch …« Janet drehte sich zur Seite, und Dave folgte der Bewegung, indem er sich auf den Rücken rollen ließ.
Janet setzte sich rittlings auf ihn. Lächelnd beugte sie sich hinab. Sie ließ ihre aufgerichteten Nippel über seine Brust streichen, als sie ihn auf den Mund küsste. »Wir müssen zuerst reden«, sagte sie.
»Das ist der falsche Zeitpunkt zum Reden.«
»Das ist ein guter Zeitpunkt.«
»Zum Bumsen.«
Sie spürte seine Hand über ihren Hintern gleiten. »Im Ernst.«
Er drückte sanft ihre Backen. »Okay.«
»Wie fändest du es, ein Kind zu bekommen?«
»Ich kann keins kriegen. Ich bin ein Mann. Aus biologischen Gründen unwahrscheinlich, wenn nicht gar unmöglich.«
»Dann formuliere ich es anders«, sagte Janet. »Wie fändest du es, Papa zu werden?«
»Irgendwann vielleicht.«
»Ich dachte eher an früher als an später.«
Seine Hände, die leicht ihren Hintern massiert hatten, hielten plötzlich still.
»Du bist nicht schwanger, oder?«
»Doch.«
»Sag mir, dass das ein Witz ist.«
»Das wäre gelogen«, antwortete Janet, während sie das Gefühl hatte, in ein Loch zu fallen.
»Wie konnte das passieren?«
»Wenn du das nicht weißt …«
»Aber du hast gesagt, es wäre sicher.«
»Es ist nie ganz sicher. Vielleicht habe ich mich mit den Tagen verzählt oder …«
»Vielleicht hast du dich verzählt?«
»Das ist keine exakte Wissenschaft, Dave. Und du wolltest kein Kondom benutzen.«
»Mit Gummi macht es keinen Spaß.«
»Also, dann …«
»Wenn du bei der Pille geblieben wärst …«
»Die Pille ist gefährlich. Soll ich riskieren, Krebs zu bekommen, nur damit du kein Gummi überziehen musst? Träum weiter.«
»Scheiße!«
»Du wusstest, dass es passieren konnte.«
Kopfschüttelnd stieß er ein langes, tiefes Stöhnen aus. »Warst du beim Arzt? Du hast nicht einfach nur deine Periode verpasst oder so?«
»Ich bin schwanger, Dave. Hundertprozentig, kein Zweifel. Ich habe es gestern erfahren.«
»Toll«, sagte er. »Einfach toll. Absolut fantastisch, verdammt noch mal.«
Janet drückte sich an seinen Schultern nach oben und setzte sich aufrecht hin. »Ich dachte, du würdest dich darüber freuen.«
»Klar. Freuen. Okay.« Er schloss die Augen und atmete ein paarmal tief durch. Dann sagte er: »Kein Problem. Was wird es kosten, damit sich jemand darum kümmert?«
»Es dauert noch sieben Monate, wir haben also genug Zeit, um zu sparen.«
»Ich meinte nicht die Entbindungskosten.«
Ihre Kehle schnürte sich zusammen. Eine Hitzewelle überkam sie, als sie fragte: »Was meintest du dann?«
»Du weißt, was ich meine.«
»Du willst es töten?«
»Ach, um Gottes willen.«
Janet stieß ein leises Wimmern aus und schlug ihm mit der Faust gegen die Wange. Mit der anderen Faust traf sie seitlich seine Nase. Blut strömte aus den Nasenlöchern.
Er drehte sich ruckartig unter ihr, packte ihren Arm und warf sie vom Bett. Sie schlug hart auf dem Boden auf, mit der Schulter zuerst, während die Füße noch durch die Luft flogen.
Dave sah zu ihr herab. »Du hast mir fast die Nase gebrochen!«
Sie rollte herum und stand auf.
»Warum willst du mich schlagen? Scheiße! Ich hab doch nur gesagt …«
»Ich weiß genau, was du gesagt hast.« Sie stieg in ihre braune Cordhose.
»Was soll das ganze Theater dann? Es ist absolut legal.«
»Klar. Legal.« Sie zog ein großes weites Sweatshirt an.
»Was zum Teufel ist los mit dir?«, stieß Dave hervor.
»Ich gehe«, sagte Janet. Sie steckte die Hände in die Hosentaschen und lehnte sich gegen eine Wand.
»Du kannst nicht einfach gehen!«
»Und ob ich das kann. Ich komme Montag, um meine Sachen zu holen. Während du bei der Arbeit bist. Keine Sorge, ich nehme nichts mit, was mir nicht gehört.«
»Du bist unvernünftig.«
»Scheiß auf die Vernunft. Ich bin schwanger. Du willst mein Baby ermorden.«
»Das ist kein Mord. Mord ist, was Idi Amin mit seinen politischen Gegnern macht. Mord ist, was Manson getan hat. Mord ist, was Nixon in Vietnam getan hat. Einen verdammten Fötus abzutreiben ist kein Mord.«
»Wenn es mein Fötus ist, dann schon.«
»Du bist verrückt.«
»Fahr zur Hölle.«
»Wo willst du das Geld hernehmen?«
»Das krieg ich schon hin.«
»Leichter gesagt als getan.«
»Ich werde unterrichten.«
»Aber sicher. Es ist Oktober, falls es dir noch nicht aufgefallen ist. Lehrer werden im Frühling angestellt, nicht im Oktober, mein Gott. In ein paar Wochen ist Halloween. Du bekommst keinen Job als Lehrerin. Meinst du, du kannst mich auf den Arm nehmen?«
»Wiedersehen.« Sie griff nach ihrer Handtasche. Als sie zur Tür ging, hörte sie einen dumpfen Schlag – Dave hatte irgendwo gegengetreten, wahrscheinlich gegen eine Wand.
»Du wirst zurückkommen!«, schrie er.
Janet antwortete nicht.
»Du wirst auf Knien zurückgekrochen kommen.«
Der Teppich im Korridor fühlte sich kalt und hart unter ihren nackten Füßen an. Bei jedem Schritt schien der Boden nachzugeben wie die Eisschicht auf einem nur dünn überfrorenen Teich.
Sie lief die Treppe im Hausflur hinunter und eilte durch das Foyer.
Es fühlte sich gut an, als ihr draußen die Sonne ins Gesicht schien. Sie stieg in ihren Ford, wendete scharf und fuhr Richtung Grand Beach Boulevard. Meg würde sich freuen, sie zu sehen. Und froh sein, dass sie sich von Dave getrennt hatte. »Das ist ein fieser Typ«, hatte sie gesagt, nachdem sie ihn kennengelernt hatte. »Gut aussehend, aber ein Widerling.«
»Du kennst ihn kaum.«
»Doch, ich kenne ihn. Ich kenne einige Typen wie Dave. Schaumschläger. Sie halten sich für Gottes Geschenk an die Menschheit. In Wirklichkeit sind sie als Menschen verkleidete Arschlöcher.«
Meg war nicht zu Hause.
Janet saß auf der Vordertreppe. Der im Schatten liegende Beton fühlte sich durch ihre Cordhose kühl an. In ihrem Sweatshirt war ihr hingegen zu warm. Doch sie konnte es nicht ausziehen, weil sie nichts darunter trug. Also wedelte sie mit der Vorderseite, um etwas Luft über ihre Haut strömen zu lassen.
Lange starrte sie auf ihren Verlobungsring. Dann zog sie ihn ab. Er hinterließ einen Streifen blasser Haut um ihren Finger.
Sie legte den Ring in ihre Handtasche und warf einen Blick in das Portemonnaie.
Ein Zwanzig-Dollar-Schein und sechs Einer.
Sie klappte ihr Scheckbuch auf. Auf ihrem Konto befanden sich hundertdreißig Dollar und zwölf Cent.
»Ein echtes Vermögen«, murmelte sie.
Das war alles, was von ihrem Gehalt als wissenschaftliche Hilfskraft im letzten Frühling an der Uni übrig geblieben war.
Ganz unten in der Handtasche fand sie einen Kugelschreiber. Weil sie keinen Zettel hatte, riss sie einen Einzahlungsbeleg aus dem Scheckbuch. Auf die Rückseite schrieb sie: »Meg, ich komme heute Nachmittag wieder. Ich muss dich sehen. Janet.«
Sie klemmte den Zettel unter den schweren Messingtürklopfer und ging zurück zum Auto.
3 DER SUPERMARKT
An diesem Morgen blickte Albert auf sein Spiegelbild im Fenster des North Glen Safeway.
Hübsch wie ein Mädchen.
Ich könnte kotzen.
Ein Schnurrbart würde vielleicht helfen.
Viel Glück, dachte er.
Er musste sich nicht öfter als ein paar Male in der Woche rasieren. Einen halbwegs anständigen Schnauzbart wachsen zu lassen, würde wahrscheinlich Monate dauern. Wenn nicht sogar Jahre.
Ich muss mich damit abfinden, dachte er.
»Du bist wahnsinnig süß«, hatte Betty gesagt. Die blöde Schlampe.
Zwanzig Mäuse!
Als die automatische Tür aufglitt, trat Albert in den Supermarkt. Er ging direkt zu dem Gang mit den Keksen, zog eine Packung Oreos aus dem Regal und steuerte auf die Kassen zu.
Wie kriege ich zwanzig Dollar zusammen?, fragte er sich.
Sechs, erinnerte er sich. Vierzehn habe ich schon, also …
Wenn ich die Oreos gekauft habe, sind es weniger.
Scheiß drauf.
Sein Geizhals von Vater rückte nur zwei Dollar Taschengeld pro Woche raus. Unter diesen Umständen würde es drei verdammte Wochen dauern, bis er sechs Dollar gespart hätte.
Und das auch nur, wenn ich nichts ausgebe.
Er riss die Tüte auf und aß einen Keks. Die Leere in seinem Magen schmerzte etwas weniger.
Vielleicht sollte ich mir einen Job besorgen.
Ja, und was soll das sein? Soll ich nach der Schule Einkäufe in Tüten packen?
Babysitten?
Die Vorstellung, babysitten zu gehen, gefiel ihm irgendwie.
Aber wer wird mich als Babysitter beschäftigen? Niemand.
Albert stellte sich hinter einer Frau mit einem Einkaufswagen in die Schlange. »Möchtest du vor?«, fragte sie. Sie hatte eine freundliche Stimme und ein offenes, nettes Lächeln.
Albert warf einen Blick in den Einkaufswagen. Es war nicht viel darin. Nicht mehr als ein Dutzend Artikel. »Nein«, sagte er. »Danke. Schon in Ordnung.«
»Bist du sicher? Mir macht es überhaupt nichts aus.«
»Ja. Ich hab es nicht besonders eilig. Aber danke für das Angebot.« Er aß noch einen Keks und sah zu, wie die Frau ihre Einkäufe auf das Laufband legte.
Der Angestellte tippte jedes einzelne Teil in die Kasse ein. Dann leuchtete die Gesamtsumme auf.
Während er einen Keks kaute, beobachtete Albert, wie sie ein Scheckbuch aufschlug und es dicht vor ihm auf dem Schalter ausbreitete.
Auf dem Scheck war ein schneebedeckter Berg abgebildet.
Links vom Gipfel sah Albert vor dem Hintergrund des tiefblauen Himmels einen Block von Buchstaben und Zahlen:
Arnold Broxton
Rita M. Broxton
214 Jeffers Lane
North Glen, IL
War diese Frau Hank Broxtons Mutter?
Nein, sie sah zu jung aus, um ein Kind an der Highschool zu haben.
Albert brach einen Keks auseinander, als er Rita einen Scheck über zweiunddreißig Dollar ausstellen sah.
Der Keks ließ sich sauber teilen, die gesamte Vanillefüllung blieb auf einer Seite haften. Mit den Schneidezähnen zog Albert eine ungleichmäßige Furche durch die weiße Masse.
Er versuchte, das Scheckbuch genauer zu betrachten, doch Rita schlug es zu.
Wie war ihr Nachname? Jeffers? Nein, das war die Straße.
Broxton! Jetzt hab ich’s. Genau wie Hank. Denk an Hank.
Albert bezahlte die Kekse und beobachtete Rita, während sie zum Ausgang ging.
Sie sah hübsch aus in ihrer engen Stoffhose. Glatt und kurvig, ohne irgendwelche sich abzeichnenden Säume.
Vielleicht trägt sie nichts drunter!
Er folgte ihr hinaus und fragte sich, ob er ihr anbieten sollte, ihre Einkaufstasche zum Auto zu tragen.
Nein, nicht.
Ich will nicht, dass mich jemand mit ihr sieht.
4 GRAND BEACH
Janet verstaute ihre Handtasche unter dem Fahrersitz des Wagens, schloss die Tür ab und steckte den Schlüsselbund in eine Tasche ihrer Cordhose. Mit freien Händen ging sie den halben Häuserblock bis zum Strand zu Fuß.
Die Brise war dort stärker und kälter und brachte einen Meeresduft mit sich, den sie tief einatmete und der ihre Stimmung hob. Sie bückte sich, um die Hose hochzukrempeln, und der Wind strömte unter das weite Sweatshirt.
Sie sah sich um. Niemand schien von seiner Position in ihren Ausschnitt blicken zu können, also blieb sie unten und rollte beide Hosenbeine auf, während der Wind über die heiße Haut ihres Bauchs und ihrer Brüste strich.
Dann richtete sie sich auf und schlenderte zur Küste hinunter. Die Wellen rollten heran, eine nach der anderen, die Täler im Licht der dahinter stehenden Sonne von durchscheinendem Grün, die Kämme glitzernd und schäumend, als sie brachen.
Beim ersten kalten Lecken des Meeres zuckte Janet zusammen. Dann schritt sie weiter hinein und ließ das Wasser an ihren Waden emporklettern.
Mit einem Rettungsschwimmerturm als Orientierungspunkt spazierte sie nach Süden.
Jedes Mal, wenn sich eine Welle zurückzog, wurde der Sand unter ihren Füßen weggesaugt.
Das Wasser floss ins Meer zurück und ließ den festgedrückten Sand einen Augenblick lang unbedeckt, ehe es wiederkam, ihre Zehen umspielte, anstieg, die aufgekrempelten Hosenbeine durchnässte und sich erneut zurückzog.
Manchmal sah sie zu, wie das Wasser um ihre Beine und Füße spülte. Andere Male beobachtete sie die Surfer, die Segelboote weit draußen oder die herabstoßenden kreischenden Möwen. Die meiste Zeit jedoch blickte sie zur linken Seite, wo der Strand lag.
Viele Jogger, Männer und Frauen. Kinder, die im Sand gruben. Hunde, die sich gegenseitig oder Treibholzstöcken hinterherjagten. Einzelne Sonnenbadende. Und Paare.
Paare, die zusammen liefen, spazieren gingen oder dicht beieinander im Sand saßen oder lagen. Viele hielten sich bei der Hand. Manche umarmten sich, als wären sie allein am Strand.
Sie war froh, dass sie nie mit Dave hier gewesen war. Als sie es einmal vorgeschlagen hatte, hatte er gesagt: »Zum Strand? Mein Gott, das soll wohl ein Witz sein.«
Wenn er mit ihr zum Strand gegangen wäre, würde es sich nun anders anfühlen. Der Strand würde nicht mehr ganz ihr gehören. Er wäre ihr verdorben.
Er gehört nur mir, dachte sie. Ganz allein mir.
Das Wasser fühlte sich so gut an.
Sie wünschte, sie trüge Schwimmsachen unter ihrem dicken Sweatshirt und der Cordhose.
Ihr einziger Badeanzug, ein blauer Bikini, lag in Daves Wohnung.
Lasse ich mich davon aufhalten?
Mit einem leisen Lachen watete Janet hinaus. Das Wasser kletterte an ihrer Hose empor und ließ den Stoff an den Beinen, im Schritt und am Hintern festkleben. Als es ihre Taille erreichte, tauchte sie unter einer Welle hindurch. Das kalte Wasser spülte über sie hinweg und zog an ihrem Sweatshirt, schob sie, rüttelte sie, saugte sie nach vorn, stieß sie zurück.
Immer wieder stand sie auf, um sich den heranbrausenden Wellen zu stellen.
Sie sprang hinein, schwamm unter ihnen durch, ritt auf ihnen in Richtung Strand, lief wieder hinaus, um neuen Wellen zu begegnen.
Schließlich watete sie erschöpft zum Strand zurück.
Das Sweatshirt hing gedehnt und schief von ihren Schultern. Die Cordhose war so schwer von dem aufgesogenen Wasser, dass Janet befürchtete, sie könne herunterrutschen. Sie hielt beim Gehen mit einer Hand den Hosenbund fest.
Als sie trockenen Sand erreichte, legte sie sich auf den Rücken und schnappte nach Luft. Schon bald beruhigte sich ihr Atem.
Das war schön, dachte sie. Sehr schön.
Aber was mache ich jetzt?
Immer einen Schritt nach dem anderen. Mir wird es gut gehen. Dem Baby wird es gut gehen.
Wir sind beide ohne Dave besser dran.
Wer braucht den schon?
Die Welt ist voller Männer, sagte sie sich. Sie sind ständig hinter mir her. Die Schwierigkeit ist, einen zu finden, der kein Arschloch ist.
Bei Dave habe ich mich offensichtlich geirrt.
Beim nächsten Mal muss ich vorsichtiger sein.
Vielleicht kommt heute Morgen genau der richtige Mann vorbei. Er sieht mich hier ausgestreckt im Sand liegen und verliebt sich wahnsinnig in mich. So wie ich angezogen bin, glaubt er vielleicht, ich wäre nach einem Schiffsunglück angespült worden.
Ich werde aufwachen, und dann steht er über mir und lächelt mich an.
Während ihr diese Gedanken durch den Kopf gingen, glitt sie in den Schlaf.
Einige Zeit später wachte sie auf. Es stand niemand über ihr, aber das Sweatshirt und die Hose waren an der Vorderseite fast trocken. Sie drehte sich um und schloss erneut die Augen.
Als sie zum zweiten Mal wach wurde, war sie immer noch allein am Strand. Sie hatte das Gefühl, in ihren dicken Kleidern gebacken zu werden. Ihr Mund war ausgedorrt.
Sie stand auf, strich sich den Sand von der Kleidung und ging zurück zu dem Rettungsschwimmerturm, an dem sie sich orientiert hatte.
Es war ein langer Weg.
Beim Turm setzte sie sich in den Sand, um sich auszuruhen. Sie war müde, voller Sand, heiß und verschwitzt. Sie hätte nicht so lange in der Sonne bleiben sollen. Wahrscheinlich war sie dehydriert.
Ich werde etwas dagegen unternehmen, sobald ich bei Meg bin, dachte sie.
Schwerfällig erhob sie sich und ging den Rest des Weges zu Megs Haus.
Die Haustür stand offen.
Janet ging darauf zu und hob die rechte Hand, um anzuklopfen, als Megs raue, heisere Stimme rief: »Komm rein, Süße.«
»Okay. Moment.« Sie stützte sich am Türrahmen ab und strich den Sand von ihren Füßen und Knöcheln.
»Das kannst du dir sparen«, sagte Meg. »Ein bisschen Sand hat noch keinem geschadet.«
Janet trat ein und sah Meg mit einer aufgeschlagenen Ausgabe des TV Guide auf dem Schoß und den Füßen auf dem Wohnzimmertisch auf dem Sofa sitzen.
»Hast du lange gewartet?«, fragte Meg.
»Seit ungefähr elf Uhr.«
»Wenn ich das gewusst hätte. Ich war bei der Kirche Volleyball spielen.«
»Hast du jemand Interessantes getroffen?«
»Dann wäre ich jetzt nicht hier. Was ist denn los?«
»Ich habe Dave verlassen.«
Meg schüttelte den Kopf. »Das tut mir leid.«
»Aber nicht besonders, oder?«
»Du tust mir leid. Ich weiß, dass es schwierig für dich ist.«
»Tja … Hast du was zu trinken?«
»Klar. Was Hartes?«
»Nichts zu Hartes.«
»Wie wär’s mit einem Bier?«
»Ja, das wäre gut. Im Kühlschrank?«
»Genau. Bring mir doch eins mit, ja?«
Mit zwei Dosen Hamms kam Janet zurück ins Wohnzimmer. Sie reichte Meg eine davon, setzte sich in einen Korbsessel und riss ihre eigene auf.
»Hast du ihn bei einem Seitensprung erwischt?«, fragte Meg.
»Nein.« Janet trank einen Schluck Bier. Es war kalt und stark und ein wenig süßlich. Sie atmete tief durch und trank noch etwas. »Er will das Baby nicht«, sagte sie schließlich.
»Das Baby?«
Lächelnd nickte Janet.
»Großartig! In welchem Monat bist du?«
»In der siebten Woche.«
»Wow! Das ist fantastisch! Wie fühlst du dich?«
Sie rieb sich mit der kalten, feuchten Dose über die Stirn. »Nicht schlecht, im Moment.«
»Du weißt, was ich meine.«
»Seit einer Weile bin ich morgens etwas zittrig. Und manchmal bin ich nicht ganz auf dem Damm. Aber sonst geht’s mir prima.«
»Ein Baby. Wow!«
»Ein Baby ohne Vater«, sagte Janet. »Ich will mit Dave nichts mehr zu tun haben. Er will es töten. Als wäre es eine Fliege oder ein Moskito oder irgendwas, das man einfach so zerquetschen kann.«
»Vielleicht ändert er seine Meinung.«
»Er kann zur Hölle fahren.«
»Er wird dich nicht so einfach gehen lassen, Süße.«
»Ich bin ihm scheißegal.«
»Selbst wenn«, sagte Meg, »er selbst ist sich mit Sicherheit nicht scheißegal. Sein Ego ist viel zu groß, um dich vom Haken zu lassen.«
»Von mir aus kann er abkratzen.«
»Willst du bis dahin bei mir bleiben?«
»Das wäre toll. Störe ich dich nicht?«
»Auf keinen Fall. Wir werden uns gut amüsieren.«
»Also, danke. Vielen Dank.«
»Hey, wofür hat man denn Freundinnen?«
5 DAS VERANSTALTUNGSKOMITEE
Ein Haufen Säufer, dachte Lester.
Gut, vielleicht nicht alle.
Aber die meisten Mitglieder des Veranstaltungskomitees der Grand Beach Highschool schienen sich Alkohol, Gelächter, selbstherrlichem Getue und Flirts verschrieben zu haben.
Lester hatte von Helen schon einiges über ihre Treffen gehört, doch dieses war das erste, bei dem er zugegen war.
Weil Helen beschlossen hatte, es in ihrem Haus abzuhalten.
Vielen Dank, dass du mir den Samstagabend vermiest, dachte er.
Nachdem sie ein paar Stunden damit verbracht hatten, Pläne für die in knapp zwei Wochen stattfindende Halloween-Party der Lehrer zu schmieden – der angebliche Zweck dieses Treffens –, hatten sie sich im Raum verteilt, um ausgiebig zu trinken und herumzualbern.
Es war kein Ende in Sicht.
Wird Zeit, mich abzusetzen, dachte Lester. Es spricht sowieso keiner mit mir. Ich bin nur der armselige Versager, der mit Helen verheiratet ist. Nicht einmal ein Lehrer.
Unter diesen Leuten ist man der letzte Dreck, wenn man kein Lehrer ist.
Ein Haufen überheblicher Ärsche.
Betrunkene, überhebliche Ärsche.
In der Absicht, sich im Schlafzimmer zu verkriechen, bis der Spaß vorüber war, durchquerte Lester das Wohnzimmer. Doch jemand hielt ihn von hinten am Arm fest. Verärgert blickte er über die Schulter.
Und sah Emily Jean Bonner, die ihn anlächelte.
Emily Jean, die alternde und bedauernswerte Südstaatenschönheit der Grand Beach High. Sie war mindestens fünfzig Jahre alt – wahrscheinlich eher an die sechzig –, stellte aber immer noch einen flammend roten Haarschopf und einen sprühenden Geist zur Schau.
»Genau nach Ihnen habe ich gesucht, Mr. Bryant«, sagte sie in ihrem weichen, schleppenden Tonfall.
Noch schleppender als sonst, dachte Lester, wegen der Martinis, die sie sich genehmigt hat.
»Was halten Sie von unseren Plänen für die Halloween-Party?«
»Hört sich gut an.«
»Das finde ich auch. Natürlich würde ich es bevorzugen, wenn die Kostümierung nicht freiwillig, sondern verpflichtend wäre. Ich bin der Meinung, jeder sollte verkleidet kommen. Dann wäre es viel feierlicher. Viel mehr Halloween, finden Sie nicht auch?«
»Ja, das stimmt«, sagte Lester.
»Sie werden doch kostümiert erscheinen, oder?«
Wenn ich bei dem Mist überhaupt mitmachen muss.
»Wahrscheinlich schon«, sagte er.
»Ich habe mich noch nicht entschieden, was ich anziehe. Haben Sie vielleicht eine Idee für mich?«
»Wie wär’s mit einer Verkleidung als Georgia-Pfirsich?«
Lachend tätschelte sie seine Schulter. »Sie sind wirklich ein Spaßvogel, Mr. Bryant. Vielleicht sollte ich tatsächlich als Pfirsich kommen.« Sie ließ die linke Hand auf seiner Schulter liegen, hob mit der rechten das Glas und nippte an ihrem Martini. »Und als was werden Sie sich verkleiden?«
»Ich könnte als Der Unsichtbare kommen.«
»Ah! Das wäre … ungewöhnlich.« Sie nahm die Hand von seiner Schulter und sah sich um, als suchte sie jemanden.
»Also«, sagte Lester, »wir sehen uns. War schön, mit Ihnen zu reden, Emily …«
Sie griff nach seinem Handgelenk. »Oh, Sie brauchen nicht wegzurennen. Ich habe nur Ihr Haus bewundert. Es ist wirklich ganz bezaubernd.«
»Es ist okay«, sagte Lester und dachte, es gefiele ihm viel besser, wenn es nicht ein Geschenk von Helens Eltern gewesen wäre. Gut, kein richtiges Geschenk. Sie hatten ihr die Anzahlung geliehen. Fast dasselbe.
»Die Lage ist günstig für Helen«, erklärte Lester. »Und es sind nur zwanzig Minuten bis zur Blessed Virgin.«
»Sie sind der Bibliothekar dort?«
Lester fragte sich, ob Helen das allen Lehrerkollegen erzählte, um ihr Gesicht zu wahren. »Nein, in Wirklichkeit bin ich nur Sekretär in der Bibliothek. Ich muss erst noch meinen Abschluss machen, bevor ich ein richtiger Bibliothekar werden kann.«
»Braucht man dazu einen Uniabschluss?«
»Ja, so was in der Art.«
»Machen Sie den an der U.C.L.A.?«
»An der U.S.C.«
»Ah, ein Trojaner.«
Obwohl die Studenten an der U.S.C. wegen der trojanischen Statue auf dem Gelände so genannt wurden, musste Lester dabei immer an die Kondommarke Trojan denken. Doch Emily Jean gegenüber erwähnte er das nicht.
»Wie lange dauert es noch, bis Sie fertig sind?«, fragte sie.
»Zwei Jahre noch, wahrscheinlich.«
Noch zwei Jahre, in denen Helen dreimal so viel verdiente wie er. Und selbst mit dem Abschluss – wer garantierte ihm, dass er eine Anstellung als Bibliothekar finden würde?
»Es muss fantastisch sein, mit diesen ganzen Büchern zu arbeiten«, sagte Emily Jean.
»Es ist nicht schlecht«, meinte er. Warum sollte er erzählen, dass die einzigen Bücher, mit denen er im Moment arbeitete, Rechnungsbücher waren?
»Ich liebe Bücher«, sagte Emily Jean. »Lieben Sie Bücher auch, Mr. Bryant?«
»Manche.«
»Ich vergöttere Tennessee Williams. Sind Sie mit seinem Werk vertraut? Ich finde es so grandios und tragisch und … lyrisch.«
»Ja, das stimmt. Aber ich muss jetzt wirklich gehen. Wir sehen uns später, okay?«
»Oh.« Verdutzt blinzelnd, ließ sie seinen Arm los. »Natürlich. Wir sehen uns später, bestimmt.«
Lester zwang sich zu einem Lächeln, wandte sich um und ging zum Bad.
Er war froh, ihr entkommen zu sein.
Diese Frau hatte ihren Zenit überschritten, ein trauriger Fall.
Er schloss die Badezimmertür ab und trat an die Toilette.
Ich sollte nicht so hart zu ihr sein, dachte er, als er den Reißverschluss herunterzog. Wenigstens ist sie nett zu mir.
Im Gegensatz zu allen anderen.
Außer vielleicht diesem Ian. Der schien ein ganz guter Kerl zu sein.
Aber die anderen waren Snobs, die Lester ignorierten.
Nur weil ich für ein bisschen Kleingeld einen Drecksjob mache.
Ein Haufen Arschlöcher.
Lester urinierte zu Ende und spülte. Ehe er die Tür öffnete, vergewisserte er sich, dass sein Reißverschluss hochgezogen war.
Das würde mir gerade noch fehlen, dachte er. Mit offenem Hosenschlitz herumzulaufen.
Als ob das jemand bemerken würde. Ich bin der Unsichtbare.
Im Wohnzimmer blickte er sich nach Ian um. Er entdeckte den großen, ernsten Mann in einer Ecke, wo er mit Helen und Ronald sprach.
Helen sah gut aus. Keck, mit ihrer Himmelfahrtsnase und dem Peter-Pan-Haarschnitt. Sexy, in dem engen Rock und dem Rollkragenpullover. Der Pullover spannte sich über ihre Brüste und betonte sie stark.
Sie stand so nah bei Ian, dass ihre rechte Brust beinahe seinen Arm berührte.
Absichtlich?
Natürlich ist es Absicht, dachte Lester.
Doch Ian schien sich der Nähe ihrer Brust nicht bewusst zu sein.
Es sei denn, er ist ein guter Schauspieler.
Ronald war derjenige, dessen Aufmerksamkeit sich auf Helens Brüste richtete. Er war ein Englischlehrer, aber nicht an der Highschool. Vor ein paar Jahren, nachdem er Dale geheiratet hatte, war er von der Grand Beach High ans College gewechselt. Aber er war ehrenamtliches Mitglied des Veranstaltungskomitees geblieben und tauchte bei jedem Treffen auf. Offenbar feierte er genauso gern, wie er lehrte. Er hielt sich für einen Experten auf jedem Gebiet und schwang ständig Reden über irgendetwas. Nun, während er weise nickte, redete und zuhörte, sah Lester, wie er verstohlene Blicke auf Helens Brüste warf.
Am liebsten würde er ihr wahrscheinlich den Pullover vom Leib reißen, dachte Lester.
Viel Glück, Kumpel.
Denn unter dem Pullover würde er einen großen, steifen Büstenhalter mit vier Haken am Rücken vorfinden, und unter dem BH erwarteten ihn zwei ganz reizende Eisberge.
Oder vielleicht auch nicht, dachte Lester. Vielleicht ist sie nur bei mir so eine frigide Zicke.
Angewidert wandte er den Blick von seiner Frau und den beiden Männern ab. Er sah Emily Jean auf dem Sofa sitzen, wo sie an ihrem Martini nippte und mit Dale sprach.
Da Dale Ronald den Rücken zugekehrt hatte, bemerkte sie nicht, wie ihr Mann Helen begaffte.
Vielleicht wäre es ihr auch egal.
Sie saß dort, hörte Emily Jean mit ziemlich spöttischem Gesichtsausdruck zu und hielt einen Scotch in der einen und eine Zigarette in der anderen Hand. Wie immer steckte ihre Zigarette in einer langen, dünnen, offenbar vergoldeten Spitze.
Groß und schlank und elegant, wie Dale war, hätte man sie fast als schön bezeichnen können. Doch sie hatte etwas Hartes an sich.
Haben sie das nicht alle?, überlegte Lester.
Nein, nicht alle. Emily Jean hatte nichts Hartes an sich. Sie wirkte ein wenig verloren und verletzlich, aber gewiss nicht hart.
Helen jedoch schon. Und Dale auch. Die meisten von ihnen, vor allem die Frauen.
Vielleicht lag es am Beruf.
Äußerst deprimiert ging Lester hinaus zum Terrassentisch, auf dem die Getränke standen. Er füllte Eis in sein Glas und goss sich aus der Plastikkanne einen Screwdriver ein. Dann kehrte er ins Haus zurück. Er setzte sich in seinen Fernsehsessel und schlürfte den Drink.
Scheiß auf sie alle, dachte er und wünschte, sie würden nach Hause gehen.
6 DER TOAST
»Das Problem fängt schon in den unteren Klassen an«, sagte Helen so nachdrücklich, als wäre es nicht ihre Meinung, sondern eine Tatsache.
Ian bemerkte, dass er verärgert die Zähne aufeinanderbiss. Er kannte Helen seit drei Jahren – seit sie an der Grand Beach High angefangen hatte –, und der strenge, humorlose, abweisende Ton, in dem sie ihre Auffassungen vertrat, zerrte an seinen Nerven.
»Du gibst den Schwarzen Peter weiter«, entgegnete Ronald grinsend und nickend, während er auf ihre Brüste schielte – die mehr als gewöhnlich hervorzustehen schienen, vielleicht wegen des engen, weißen Pullovers.
Warum zieht sie sich so an?, fragte sich Ian. Wenn es kein enger Pullover ist, ist es eine beinahe durchsichtige Bluse oder ein Minirock, der kaum den Hintern bedeckt.
Sie kleidete sich nicht nur auf Partys so freizügig, sondern auch in der Schule.
Aus Ians Sicht passte es nicht zusammen, dass eine gefühlskalte Frau wie Helen sich auf diese Weise zur Schau stellte.
Vielleicht ist sie nicht so eiskalt, wie es scheint, dachte er.
Oder ihr ist nicht bewusst, wie Männer auf eine solche Zurschaustellung reagieren, weil sie in ihrer eigenen Welt aus Lehrplänen, Testvorbereitungen und Hausaufgabenbewertung lebt.
»Ich führe ja nur aus«, sagte Helen, »dass die meisten Kinder erbärmlich schlecht lesen und schreiben können, wenn sie zu uns kommen. Sie sind so weit zurück, dass …«
»Na ja, Helen, du klingst wie ein Arzt, der sich darüber beschwert, dass die Patienten krank zu ihm kommen. Ich hätte einen Vorschlag für dich. Du könntest deinen Hintern in Bewegung setzen und den armen Wichten helfen.«
»Das ist leichter gesagt als …«
»In meine Klassen kommen Kinder, die ein Nomen nicht von einem Verb unterscheiden können. Die einzige Regel, die sie kennen, ist die, die Frauen einmal im Monat bekommen. Und das ist ein College, verdammt noch mal!«
»Das ist das City College«, erwiderte Helen. »Diejenigen, die lesen können, gehen woandershin.«
Ronald stieß ein Lachen aus. »Eins zu null für dich!«
»Außerdem«, fuhr Helen fort, »sind die Kinder nur drei Jahre bei uns.«
»Nur drei Jahre?«, fragte Ronald spöttisch.
Helen sah ihn aus zusammengekniffenen Augen an. »Man kann wohl kaum von uns erwarten, dass wir in drei Jahren die Versäumnisse von einem ganzen Dutzend nachholen.«
»Ach, bitte.«
»Vor allem, da die Hälfte der Kinder zu Hause nicht einmal englisch spricht.«
»Ach, wie dramatisch.«
Helen stieß mit einer Brust gegen Ians Arm. Die steife Schale ihres BHs gab ein wenig nach, und er spürte die federnde Weichheit darunter. »Du weißt doch, wie es ist. Sag’s ihm.«
Ian bemerkte, dass er errötete.
Warum tut sie das?
Er zuckte die Achseln und sagte: »Ich sehe keine Rechtfertigung dafür, dass Schüler nach dem Abschluss Analphabeten sind.«
»Bravo!«, rief Ronald.
»Vielen Dank auch«, meinte Helen.
»Mit diesen neuen Kompetenztests«, sagte Ian, »werden wir ihnen vermutlich auch keinen Abschluss mehr geben können.«
Emily Jean Bonner, die elegant einen Martini in der Hand hielt, schlenderte herüber und gesellte sich zu den dreien. Ian nickte zur Begrüßung, und sie lächelte ihn an, als wäre sie überrascht, dass er sie bemerkt hatte.
»Ich schätze«, sagte Ronald, »du musst zur Abwechslung mal mehr Zeit auf den Satzaufbau verwenden als auf Shakespeare. Es wird höchste Zeit, wenn du mich fragst. Mit Literatur können sie sich noch auf dem College beschäftigen.«
»Die Dame, wie mich dünkt, gelobt zu viel«, zitierte Emily Jean, während sie Ronald anlächelte und ihre scharlachroten Augenbrauen hochzog. Auf Ian hatten die Überreste ihres schleppenden Südstaatentonfalls immer eine leicht traurige Wirkung. Er musste an eine alternde Scarlett O’Hara denken, die ihre Baumwollplantage verlassen musste, jedoch an ihrem Stolz festhielt und – mithilfe eines Schönheitssalons – auch an ihrem flammend roten Haar.
»Wie soll ein sechzehnjähriges Kind«, fragte Ronald Helen, »die Bedeutung von ›Nein, zu leben / Im Schweiß und Brodem eines eklen Betts / Gebrüht in Fäulnis, buhlend und sich paarend / Über dem garstigen Nest‹ verstehen?«
»Fantastisch!«, platzte Emily Jean heraus. »Sie kennen Ihren Shakespeare, Mr. Harvey.«
»Das bringt der Beruf mit sich«, erklärte er mit einem Augenzwinkern.
Emily Jean stieß ein hohes, zerbrechliches Lachen aus. »Wussten Sie, dass ich am Wilshire Playhouse die Rolle der Linda Loman gespielt habe? Noch heute kommen mir die Tränen, wenn ich den Monolog bei Willys Beerdigung höre. So ein starker, trauriger …«
»Du glaubst also«, unterbrach Helen sie mit einem herausfordernden ironischen Blick zu Ronald, »dass wir es ganz aufgeben sollten, Literatur zu unterrichten?«
Emily Jean wirkte nur einen Augenblick lang verletzt. Mit einem seltsamen Lächeln schlenderte sie zur Hintertür.
»Vielleicht nicht ganz«, sagte Ronald. »Aber die Lage würde sich bestimmt bessern, wenn man sich auf Lesestoff konzentrieren würde, der nicht meilenweit über den Horizont der Schüler hinausgeht.«
»Entschuldigt mich«, sagte Ian. Ohne eine Antwort abzuwarten, ging er zur Hintertür, schob sie auf und trat in den beleuchteten Innenhof.
Zu seiner Linken befand sich ein Klapptisch voller Papiertüten, nasser Löffel und aufgestapelter Plastikbecher. Flaschen mit Schnaps und Mixgetränken sowie Mayonnaisegläser und Glaskrüge mit selbstgemischten Drinks standen zwischen den Tüten.
Emily Jean kniete neben der Eistruhe auf dem Betonboden und hielt in einer Hand ihren Plastikbecher, während sie mit der anderen an dem Verschluss herumfummelte. Ian betrachtete sie, als er sein Glas auf dem Tisch abstellte. Die weiße Bluse hatte sich über dem Rücken gespannt, sodass sich darunter die schmalen Träger des BHs und die herausstehenden Höcker ihres Rückgrats abzeichneten. Sie wirkte verdammt zerbrechlich. Er legte ihr eine Hand auf die Schulter.
»Lassen Sie mich das für Sie machen«, sagte er.
»Danke, Mr. Collins.«
»Ist mir ein Vergnügen.« Er klappte die Truhe auf. »Wie viele Eiswürfel möchten Sie?«
»Mit dreien wäre ich schon zufrieden.«
Er warf drei Eiswürfel in ihren Plastikbecher, dann füllte er auch sein eigenes Glas und schloss die Truhe.
Sie standen auf. Sie waren allein im Innenhof. »Soll ich Ihnen einen Drink mixen?«, fragte Ian.
»Sehr aufmerksam, Mr. Collins, aber das habe ich schon erledigt.« Sie tippte mit dem Fingernagel auf den Deckel eines halbleeren Mayonnaiseglases. »Mein selbst gemachter Martini. Er geht langsam zur Neige. Ich bin ein ungezogenes Mädchen heute Abend. Oder etwa nicht?«
»Ach, das würde ich so nicht sagen.« Ian goss Wodka in sein Glas, während sie den Deckel aufschraubte.
»Und ich sollte es auch nicht sagen. Ich betrachte übermäßigen Gin-Genuss als lässliche Sünde und großen Trost. Mr. Collins, das mag einem jungen Mann mit Ihrer Energie und Ihrem Talent seltsam erscheinen, aber ich unterrichte seit achtundzwanzig Jahren und habe das Gefühl, mein Leben vergeudet zu haben.«
Sie warf Ian einen stolzen, leidvollen Blick zu, der ihn herausforderte, ihr zu widersprechen.
»Ich hätte so viele Dinge tun können. Ich hätte auf der Bühne bleiben können. Ich hätte Bücher schreiben können. Ich hätte in die Geschäftswelt einsteigen können. So viele Dinge, so viele Möglichkeiten. Alle weggeworfen, alle verloren.«
»Unterrichten ist nicht die erfüllendste Arbeit«, sagte Ian.
»So banal die Analogie auch klingen mag, Mr. Collins, Unterrichten ist, als würde man sein Leben auf dem Karussell im Freizeitpark unten am Pier verbringen. Ein Lehrer steigt auf sein Pferd und fährt im Kreis, immer wieder, Jahr für Jahr. Die Dampforgel spielt hübsche Musik, aber sie wiederholt sich. Sie spielt ständig dieselben paar Melodien. Die Umgebung ändert sich nie. Die Gesichter schon. Ja, die Gesichter wechseln, leider. Das gehört ebenfalls zur Tragödie. Einige Gesichter sind so charmant, andere so voller Schmerz und Bedürftigkeit. Manche lernt man sogar zu lieben. Aber nach einiger Zeit gehen sie alle weg, man bleibt auf seinem Pferd, dreht sich weiter im Kreis, und sie sind verschwunden.«
Sie starrte lange Zeit in ihren Becher. »All die goldenen Ringe, Mr. Collins, sind nur aus Messing. Und die Karussells sind schließlich auch nicht besonders ersprießlich.« Sie lachte traurig. »Das reimt sich, stimmt’s? Schließlich ersprießlich.«
»Haben Sie schon einmal daran gedacht, vom Pferd zu steigen?«, fragte Ian.
»Und was sollte ich dann tun?« Mit einem Mal wurde ihr Lächeln fröhlicher. »Ich habe eine Tochter. Wussten Sie das? Ich habe eine herrliche, schöne, talentierte Tochter. Sie steht auf der Bühne, wussten Sie das? Eine richtig gute Schauspielerin. May Beth Bonner? Vielleicht haben Sie gesehen, wie sie die Laura gespielt hat …«
Laura!
Der Name ließ sein Herz stocken, und er zuckte vor Schmerz und Verlangen zusammen.
»… in Die Glasmenagerie am Stage Door Theater?«
»Leider nicht«, sagte er mit einem gezwungenen Lächeln. »Aber ich würde sie gerne einmal auf der Bühne sehen.«
»Das würde mich freuen. Ich wünsche mir, dass jeder sie spielen sieht. Leider war vorige Woche die letzte Vorstellung. Wenn Sie sie als Laura sehen möchten …«
Wieder versetzte ihm der Name einen Stich ins Herz.
In seinem Kopf tauchte ein Bild von Lauras Gesicht über seinem eigenen auf, wie sie ihn anlächelte, während ihr weiches, kastanienbraunes Haar glatt herabhing, wie ein Vorhang ihr Gesicht einrahmte und sie beide von der Welt abschloss.
Komm darüber hinweg, sagte er sich.
Ich schaffe es nicht. Es hat nie eine andere gegeben, und es wird auch keine geben. Man bekommt in der Liebe nur eine Chance, und das war meine.
Nicht unbedingt, dachte er. Man kann nie wissen. Ich könnte morgen jemandem begegnen …
Aber niemandem wie Laura.
Hör auf damit.
Emily Jean öffnete ihre Handtasche, holte ihr Portemonnaie hervor und blätterte durch mehrere mattierte Plastikhüllen mit Fotos. »Ist sie nicht reizend?«
Ian betrachtete den Schnappschuss. Darauf war eine schlanke, attraktive Rothaarige Anfang zwanzig zu sehen. »Sie ist wunderschön«, sagte er. »Sie sieht Ihnen sehr ähnlich.«
Emily Jean kicherte leise. »Oh, Mr. Collins. Wer sagt denn, es gäbe keine Galanterie mehr? Allerdings muss ich zugeben, dass ich tatsächlich fast genau wie May Beth aussah, als ich noch jung war. Wir hätten Zwillinge sein können. Aber das ist lang her.«
»Also, Sie sind beide bemerkenswerte Frauen.«
»Auf May Beth trifft das sicher zu, in jeder Hinsicht. Dieses Foto wird ihr natürlich nicht gerecht. Glauben Sie nicht, dass sie auf der Kinoleinwand fantastisch aussehen würde?«
»Allerdings.«
»Eines Tages werde ich sie auf der Leinwand sehen. Wir alle werden sie sehen.«
»Hat sie irgendwelche Filmprojekte in Aussicht?«
»Ach, nicht dass ich wüsste. Ich glaube, es ist schrecklich schwierig, einen Fuß in die Tür zu bekommen. Schrecklich schwierig.«
»Das habe ich auch gehört«, sagte Ian.
»Aber eines Tages wird sie es schaffen. Das weiß ich.«
»Bestimmt.«
»Und ich sollte sehr stolz sein, oder? Meinen Sie nicht?«
»Doch, sehr.« Er blickte nachdenklich auf seinen Drink.
»Stimmt etwas nicht?«
»Ich … überlege nur. Ich kenne ein paar Leute im Filmgeschäft. Wenn Sie mir May Beths Telefonnummer geben würden …«
Lächelnd griff Emily Jean nach seinem Arm und drückte ihn. »Aber, Mr. Collins! Sie müssen doch keine Ausflüchte machen. Ich fände es absolut wundervoll, wenn Sie May Beth anrufen würden.«
»Mit Ausflüchten stehe ich auf Kriegsfuß«, sagte er.
»Ha! Ich verachte Verlogenheit ebenfalls.«
»Ich kenne wirklich einige Leute, die Ihrer Tochter helfen könnten, ins Filmgeschäft einzusteigen. Mal sehen, was ich tun kann. Vielleicht sind meine Bemühungen umsonst, aber …« Er zuckte die Achseln.
»Ich weiß jegliche Bemühungen in dieser Hinsicht zu schätzen, Mr. Collins.«
»Ich werde tun, was ich kann«, sagte er und zog einen Notizblock und einen Stift aus der Hemdtasche. »Wissen Sie ihre Telefonnummer?«, fragte er.
»Aber ja, natürlich. Sie wohnt zu Hause bei mir. Und meine eigene Telefonnummer werde ich wohl wissen.« Sie gluckste leise. »Es sei denn, meine Sinne sind vom Teufel Gin zu sehr vernebelt.«
Sie diktierte ihm die Nummer.
»Und ihr Name ist May Beth Bonner?«, fragte er.
»So ist es. Sollen wir einen Toast auf ihren Erfolg ausbringen?«
»Einverstanden«, sagte Ian.
Sie hoben die Gläser.
»Auf May Beth«, sagte Emily Jean. »Möge sie ein echter Kinostar werden.«
»Auf May Beth«, sagte Ian.
Sie stießen mit ihren Plastikbechern an und tranken.
7 NACHTEINSATZ
Albert wünschte, er könnte das Auto seines Vaters benutzen, doch es in der Garage anzulassen würde zu viel Lärm verursachen. Stattdessen nahm er sein Fahrrad, schob es aus der Garage, stieg auf und rollte die Zufahrt hinunter.
Zuerst war ihm kalt ohne seine Jacke. Der Rollkragen bot wenig Schutz gegen den kühlen Nachtwind. Doch seine einzige Jacke war knallgelb. Die Farbe war für eine Nachtoperation völlig ungeeignet.
Schon bald störte ihn die Kälte nicht mehr. Der Wind fühlte sich angenehm im Gesicht an. Er roch frisch und sauber wie Bettys Haar.