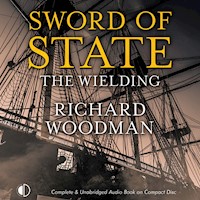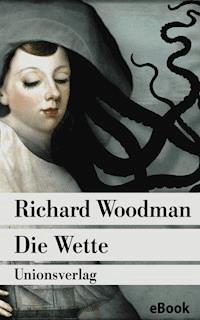1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Ein Nathaniel Drinkwater Roman
- Sprache: Deutsch
Ein Seeabenteuer im Eismeer zur Napoleonischen Zeit London, 1803: Commander Nathaniel Drinkwater scheut weder Gefahr noch Abenteuer, doch als er in die Arktische See entsandt wird, um dort den erschossenen Kapitän der »Melusine« zu ersetzen, ergreift selbst den erprobten Drinkwater die Ehrfurcht. Der Auftrag lautet: Die englischen Walfänger im Arktischen Ozean vor französischen Freibeutern schützen. Doch die von Franzosen gebaute 20-Kanonen-Korvette »Melusine« ist den Naturgewalten der Arktis keineswegs gewachsen. Bald schon fordern Eisgang und Sturm ihren Tribut. Gestrandet vor der Küste Grönlands, müssen Drinkwater und seine Mannschaft nicht nur gegen die Naturgewalten, sondern auch gegen unbekannte Gefahren kämpfen, die im ewigen Eis lauern … »Das bisher beste Buch der Reihe! Die Geschichte enthüllt mit packender Erzählkunst ein völlig neues Bild von Napoleons globalen Ambitionen und beleuchtet dabei wenig bekannte Details jener Epoche der Seefahrtsgeschichte.« Amazon-Leser Ein exzellent recherchierter Seefahrerroman für Fans von Patrick O'Brian und Mark P. Lorne. Alle Bände der Reihe: Band 1: Die Augen der Flotte – Feuertaufe auf der Fregatte Cyclops Band 2: »Kutterkorsaren – In geheimer Mission vor Frankreichs Küsten« Band 3: »Kurier zum Kap der Stürme – Auf Vorposten im Roten Meer« Band 4: »Die Mörser-Flottille – Die Schlacht von Kopenhagen« Band 5: »Die Korvette – Die Walfänger von Grönland« Die Bände sind unabhängig voneinander lesbar.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 399
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Über dieses Buch:
eBook-Neuausgabe August 2025
Die englische Originalausgabe erschien erstmals 1985 unter dem Originaltitel »The Corvette« bei John Murray Publishers Ltd., London. Die deutsche Erstausgabe erschien 1997 unter dem Titel »Die Korvette – Kapitän Drinkwater und die Walfänger von Grönland« im Verlag Ullstein GmbH, Frankfurt/M – Berlin
Copyright © der englischen Originalausgabe 1985 by Richard Woodman
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1987 by Verlag Ullstein GmbH, Frankfurt/M – Berlin
Copyright © der Neuausgabe 2025dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von Shutterstock/Melok, 4Zevar, paseven und AdobeStock/Bartek
eBook-Herstellung: dotbooks GmbH unter Verwendung von IGP (fe)
ISBN 978-3-69076-069-0
***
dotbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, einem Unternehmen der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt: www.egmont.com/support-children-and-young-people . Danke, dass Sie mit dem Kauf dieses eBooks dazu beitragen!
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected] . Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Bei diesem Roman handelt es sich um ein rein fiktives Werk, das vor dem Hintergrund einer bestimmten Zeit spielt oder geschrieben wurde – und als solches Dokument seiner Zeit von uns ohne nachträgliche Eingriffe neu veröffentlicht wird. In diesem eBook begegnen Sie daher möglicherweise Begrifflichkeiten, Weltanschauungen und Verhaltensweisen, die wir heute als unzeitgemäß oder diskriminierend verstehen. Diese Fiktion spiegelt nicht automatisch die Überzeugungen des Verlags wider oder die heutige Überzeugung der Autorinnen und Autoren, da sich diese seit der Erstveröffentlichung verändert haben können. Es ist außerdem möglich, dass dieses eBook Themenschilderungen enthält, die als belastend oder triggernd empfunden werden können. Bei genaueren Fragen zum Inhalt wenden Sie sich bitte an [email protected] .
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
Richard Woodman
Die Korvette – Die Walfänger von Grönland
Historischer Roman
Aus dem Englischen von Eckhardt Kiehl
FÜR MEINE MUTTER
TEIL EINS DER KONVOI
»Und es wurde gemeldet, daß die Franzosen beabsichtigten, über unsere Walfänger herzufallen ...«
Aus: ›The Man O’War’s Man‹ von Bill Truck
PROLOG
Mai 1803 London
»Was hat er?« Der Erste Lord der Admiralität, der eben noch gleichmütig zum Fenster hinausgesehen hatte, wandte sich abrupt um. Mit finsterem Blick musterte er den Sekretär, der ein Bündel Papiere mit den täglichen Routinemeldungen in der Hand hielt.
»Er hat den Dienst quittiert, Mylord.«
»Den Dienst quittiert? Soll ihn doch der Teufel holen, verdammt noch mal! Glaubt er etwa, er könne den Dienst in der Marine quittieren, wann es ihm paßt?«
Der Sekretär vermied es klugerweise, sich dazu zu äußern; der Earl St. Vincent überquerte mit wenigen Schritten den kleinen Teppich zwischen Fenster und Schreibtisch. Beide Hände auf die Platte gestützt, beugte er sich vor, wobei sein Gesicht fast die Farbe der Schärpe des Bath-Ordens annahm, den er für einen Morgenempfang bei Hof angelegt hatte. Er sah zu Templeton hoch, seinem Dritten Sekretär.
Obwohl erheblich größer als der Erste Lord, fühlte Mr. Templeton sich doch vor St. Vincent klein. An die Wutausbrüche Seiner Lordschaft war er zwar gewöhnt, aber die Macht, die dem Ersten Seelord zu Gebote stand, beeindruckte ihn immer von neuem. Als der Earl jetzt seine Tirade fortsetzte, sprach tiefe Frustration daraus.
»Als hätte ich nicht schon genug Probleme durch das Wiederaufflammen des Krieges und den miserablen Zustand der Werften! Jetzt muß ich auch noch einem verdammten Wichtigtuer beibringen, was seine Pflicht ist. Herrgott noch mal, Sir, mit der Marine kann man doch nicht so umspringen wie mit einem Regiment. Diese Einstellung ist nun wirklich allzusehr Mode geworden!«
St. Vincent stieß dieses Wort voll Verachtung aus. Seit dem Frieden von Amiens hatte er sich bemüht, die Korruption in den Werften auszumerzen; hatte versucht, dort Vorräte für die Marine anzulegen und den Veruntreuungen und der Mißwirtschaft ein Ende zu machen, die der Intendantur seines Rivalen, Sir Andrew Snape Hammond, Comptroller of the Navy und Vorsitzenden des mächtigen Navy Board, soviel Kummer bereiteten.
Die Meuterei im Cadiz-Geschwader niederzuschlagen, war ihm damals weitaus leichter gefallen. Er konnte doch nicht jeden langfingrigen Missetäter, der sich an den Vorratslagern Seiner Majestät vergriff, aufhängen lassen, oder jedem Profitgeier, der der Marine Seiner Majestät Material lieferte, das Handwerk legen. Doch die Sorge um die ihm anvertrauten Schiffe erforderte das eigentlich, und durch seinen ehrlichen Widerstand gegen die sehr weltliche Haltung der Londoner Politiker hatte er sich viele Feinde geschaffen.
Lord St. Vincent zog die Schultern hoch und putzte sich die Nase mit einem feinen Leinentaschentuch. Templeton kannte die Geste: St. Vincent gedachte, seine angestauten Frustrationen quasi durch das »Zündloch« seines Büros loszuwerden, da ihm die »Mündung« durch seine Gegner verstopft worden war.
»Seien Sie doch bitte so gut, Templeton, und vermerken Sie auf der Akte von Sir James Palgrave, daß er für die Dauer des jetzigen Krieges kein Kommando mehr bekommt.«
»Sehr wohl, Mylord.«
St. Vincent wandte sich wieder dem Fenster und der Betrachtung der schwankenden Baumgipfel im St. James Park zu. Das war jetzt sein einziger Ausblick auf den Himmel. Templeton wartete. St. Vincent dachte über die Torheit nach, einen Mann nur wegen seines Titels zum Vollkapitän zu machen. Er erinnerte sich an Palgrave: ein Lieutenant mit ziemlich durchschnittlichen Leistungen, aber mit einer Vorliebe für starke Weine und einem äußerst empfindlichen Ehrgefühl. Vielleicht lag das an der Belanglosigkeit seines Titels. St. Vincent, dessen Stellung auf persönlichen Verdiensten beruhte, hatte für ererbten Rang nichts übrig, wenn bessere Leute dadurch in den Schatten gestellt wurden. Eigentlich war es nicht Aufgabe des Ersten Seelords, sich um einen Nachfolger für Palgrave zu kümmern, doch war damit eine Angelegenheit von ziemlicher Bedeutung verbunden.
Templeton räusperte sich. »Und die Melusine, Mylord?« Da St. Vincent schwieg, fuhr er fort: »Wenn man die Dringlichkeit ihrer Befehle und die Nachrichten bedenkt, die ...«
»Warum hat Palgrave den Dienst quittiert, Templeton?« fragte St. Vincent plötzlich.
»Ich weiß es nicht, Mylord.« Es gehörte nicht zu den Aufgaben eines Dritten Sekretärs des Marineministers, Gerüchte weiterzugeben, so zuverlässig die Quelle auch sein mochte. Aber Sir James’ überstürzter Abschied rührte angeblich von einer Verletzung her, die er sich beim illegalen Duell mit dem Kapitän eines der Schiffe zugezogen hatte, für die er Geleitschutz fuhr.
Templeton versuchte, von diesem Thema abzulenken. »Und die Melusine, Mylord? Die Neubesetzung des Kommandos fällt doch wohl unter Ihre Zuständigkeit.«
St. Vincent sah ruckartig auf. Nur durch den Ausbruch einer Frühjahrsgrippe, die die meisten höheren Beamten einschließlich des Ersten Sekretärs Seiner Lordschaft erfaßt hatte, war Templeton die Möglichkeit geboten worden, dem Ersten Seelord täglich Vortrag halten zu dürfen.
Templeton wurde sich seiner Anmaßung bewußt und lief rot an. »Ich bitte um Entschuldigung, Mylord. Ich wollte nur auf die Nachrichten hinweisen ...
»Die Nachrichten sind mir nicht entgangen, Templeton«, sagte St. Vincent scharf. Ironisch fügte er hinzu: »Wen hatten Sie denn als Nachfolger im Sinn?«
»Niemand im besonderen, Mylord«, entgegnete der Sekretär verlegen; er fragte sich beunruhigt, ob der scheinbar allwissende alte Mann wohl von seiner Verbindung zu Francis Germaney, dem Ersten Offizier der Melusine, erfahren hatte.
»Na, wer hat sich denn beworben, Sir? Wir haben doch sicherlich keinen Mangel an Kommandanten, oder?«
Der Stich saß. »Durchaus nicht, Mylord.« Das Sekretariat wurde täglich mit Briefen und Einstellungsgesuchen von Kapitänen und Leutnants überflutet, die auf Halbsold untätig an Land saßen. Alle gingen aus dem Allerheiligsten des Ministers, wo Beförderung oder Ablehnung ihren mitleidlosen und parteiischen Lauf nahmen, säuberlich an die Absender zurück.
»Besorgen Sie mir die Namen der hartnäckigsten Bewerber im letzten Monat, Sir, und beeilen Sie sich gefälligst.«
Templeton entschwand mit der Behendigkeit eines gemaßregelten Kadetten, während St. Vincent auf die dicken Kumuluswolken starrte, die über den Schornsteinen von Downing Street dahinzogen, ohne sie eigentlich recht wahrzunehmen.
Seit der Wiederbeginn des Krieges vor zwei Wochen hatten sich die auf halben Sold gesetzten, unbeschäftigten Offiziere noch nachdrücklicher um neue Kommandos bemüht. Das Wartezimmer für Leutnants, direkt unter ihm, war eine wahre Bärengrube von Wünschen und Enttäuschungen, die den Ordonnanzen ein kleines Vermögen an Trinkgeld einbringen würde. Sollte diesen Kerlen doch die Pestilenz an den Hals fahren! St. Vincent seufzte bei dem Gedanken, daß gerade durch die von ihm eingeleitete Neuordnung der Marine ein gefährlicher Bruch in der nationalen Verteidigung entstanden war. Die Geschwindigkeit, mit der die Einheiten der Flotte wieder in Dienst gestellt wurden, ließ sich jetzt nur durch eine Rückkehr zu den alten Lastern der Bestechung, der Korruption und der stillschweigenden Duldung ermöglichen. St. Vincent machte diese Situation schwer zu schaffen, während seine weltlicher gesinnten Feinde, von der fanatischen Rechtschaffenheit des Ersten Seelords nicht mehr bedroht, nur noch ein zynisches Lächeln für ihn übrig hatten.
Templetons Rückkehr unterbrach den bitteren Tagtraum des alten Mannes. »Nun?«
»Drei, Mylord«, sagte Templeton etwas außer Atem. »Es sind drei, deren Hartnäckigkeit besonders ins Auge fiel.«
»Nun berichten Sie schon, Sir.«
»Erstens White, Mylord, Captain Richard White ...«
»Zu ranghoch für eine Korvette, aber er muß das nächste Linienschiff bekommen. Notieren Sie das bitte.«
»Sehr wohl, Mylord. Dann wäre da Yelland. Er hat sich bei Kopenhagen hervorragend geschlagen.«
St. Vincent schnaubte verächtlich. Was Yelland auch bei Kopenhagen geleistet hatte, es reichte nicht aus, um die vorgefaßte Meinung des Ersten Seelords zu erschüttern. Templeton, der es merkte, versuchte abzuschwächen: »Obwohl er natürlich nur Commander ist ...«
»Eben, eben, Templeton. Die Melusine ist ein Zwanzig-Kanonen-Schiff. Wer ist der Dritte?«
»Äh, Drinkwater, Mylord. Oh, ich bitte Eure Lordschaft um Verzeihung, auch er ist nur Commander.«
»Spielt keine Rolle.« St. Vincent dachte über den Namen nach und versuchte, ein Gesicht damit zu verbinden. »Drinkwater? Lesen Sie mir seine Akte vor. Vielleicht geben wir ihm nur ein Kommando auf Zeit und brauchen ihn dann nicht zum Post Captain 1 zu befördern.«
Templeton war mit den Nerven fast am Ende. Beim Versuch, die richtige Akte hervorzusuchen, machten sich einige Papiere selbständig und segelten auf den kostbaren Teppich hinunter. Er begann, seine Beförderung auf Zeit zu bedauern, und dankte seinen Sternen, daß er diesen Posten nur zeitweilig wahrnehmen mußte. Seinen Verwandten auf der Melusine hatte er inzwischen völlig vergessen.
»Äh, Nathaniel Drinkwater, Mylord, erhielt seine Bestallung zum Leutnant im Oktober 1797 nach Kampenduin. Wurde als Erster Offizier der Brigg Hellebore auf Befehl von Lord Nelson zu einem Sondereinsatz ins Rote Meer abgeordnet. Als Leutnant Befehlshaber der Bombarde Virago während des Flotteneinsatzes in der Ostsee; wegen seiner Verdienste vor und während der Schlacht von Kopenhagen auf Empfehlung von Parker und Nelson zum ›Master und Commander‹ befördert 2 . Später im selben Jahr unter Nelson bei der Bombardierung von Boulogne verwundet und deswegen aus dem aktiven Dienst entlassen, Mylord.«
St. Vincent nickte. »Jetzt weiß ich, wer er ist. Ich erinnere mich, daß er 1798 vor Cadiz zu Besuch auf die Victory kam, bevor Nelson sich das Mißfallen Ihrer Lordschaften zuzog, weil er diese Brigg Hellebore um ganz Afrika herumschickte. Hat er nicht die Antigone zurückgebracht?«
Templeton blätterte in den Akten. »Jawohl, Mylord. Antigone, französische Fregatte, wurde für die Marine erworben.«
»Hm.« St. Vincent dachte über die Sache nach. Er erinnerte sich, daß Mr. Drinkwater schon als Leutnant 1798 nicht mehr ganz jung gewesen war. Aber er war ihm schon damals aufgefallen: ein energischer Mund und ruhig blickende, graue Augen, die gelassene Kompetenz verrieten. Außerdem hatte Drinkwater sowohl Parker als auch Nelson beeindruckt, und das war bei den unterschiedlichen Charakteren dieser beiden keine geringe Leistung. Darüber hinaus kennzeichneten ihn seine bisherigen Verdienste und seine hartnäckig wiederholten Gesuche als einen energischen Offizier.
Reife und Energie war genau die Kombination, die er auf Melusine benötigen würde, wenn die Geheimberichte stimmten. St. Vincents Stimmung begann sich zu heben. Palgrave wäre sowieso nicht seine Wahl gewesen, denn er hatte die Melusine im Frieden befehligt, eine Tatsache, die mehr für seinen Einfluß als für seine Fähigkeiten sprach.
»Da wäre noch etwas, Mylord«, bemerkte Templeton, der sich wieder in ein besseres Licht setzen wollte.
»Was denn?«
»Drinkwater, Sir«, sagte der Sekretär, wobei er diese Tatsache aus den Akten fischte wie eine Trumpfkarte aus einem schlechten Spiel, »war schon früher mit Geheimaufträgen betraut: auf dem Kutter Kestrel, Mylord, der von Lord Dungarths Abteilung eingesetzt wurde.«
St. Vincents Augen leuchteten auf. »Damit ist die Sache besiegelt, Templeton. Lassen Sie einen Einstellungsbescheid aufsetzen, so daß ich ihn noch vor acht Glasen unterschreiben kann. Das ist Mittag, Templeton, Mittag! Und instruieren Sie Captain Drinkwater, er möge sich unverzüglich hier einfinden.« Er machte eine nachdenkliche Pause. »Ersuchen Sie ihn, am Freitag bei mir vorzusprechen.«
»Sehr wohl, Mylord.« Templeton bückte sich nach den zu Boden gefallenen Papieren.
St. Vincent ging zu seinem Fenster zurück. »Räuchert man eine Viper in ihrem Nest aus, Templeton?«
Der Sekretär sah auf. »Tut mir leid, Mylord, das weiß ich nicht.«
»Ist auch egal. Aber wir wollen mal sehen, was Captain Drinkwater zuwegebringt, oder?«
»Jawohl, Mylord.« Templeton sah vom Teppich auf, erleichtert, daß Seine Lordschaft nicht mehr ärgerlich mit ihm war. Er fragte sich, ob der ihm unbekannte Captain Drinkwater wußte, daß die Zeiten, zu denen der Erste Seelord Besucher empfing, etwas ausgefallen waren; wahrscheinlich nicht. Auf jeden Fall, dachte er, war das Wohlwollen eines so korrekten Ersten Seelords wie John Jervis Earl St. Vincent an gewisse Bedingungen geknüpft.
»Lassen Sie doch bitte meinen Wagen vorfahren, Templeton.«
Der Sekretär erhob sich, die Papiere an die Brust gepreßt. »Sofort, Mylord.« Im Geist formulierte er bereits den Brief an seinen Verwandten auf der Melusine: »Mein lieber Germaney, bei meinen täglichen Besprechungen mit Seiner Exzellenz, dem Ersten Seelord, habe ich dafür gesorgt, daß Captain Nathaniel Drinkwater Euer neuer Kommandant wird. Er wird nicht Post Captain, sondern nur ›Job Captain‹, so daß durchaus noch Hoffnung für Deine eigene Beförderung besteht ...«
ERSTES KAPITEL Der »Job-Captain«
Mai 1803
»Non, M’sieur, non ... Pardon.« Monsieur Bescond schlug sich mit der rechten Hand vor die Stirn und fuhr in stark akzentuiertem Englisch fort: »Die Schultär, mon Capitaine, sie muß sein ’öher. Mehr – wie sagt man – ’ochgezogen.«
Drinkwater biß die Zähne zusammen. Der Schmerz in seiner Schulter war immer noch ziemlich scheußlich, aber es war jetzt ein dumpfer Schmerz, mit dem er nach den Qualen, die ihm der zersplitterte Knochen und die zerfetzten Muskelstränge verursacht hatten, durchaus fertig werden konnte. Und Bescond konnte er keineswegs tadeln, denn er unterwarf sich ja freiwillig diesem rigorosen täglichen Fechttraining, um die verletzten Schultermuskeln zu stärken und zu dehnen. Die Narbe zog sich den ganzen rechten Arm hinunter und vereinigte sich am Gelenk mit den Spuren einer alten Verwundung, die ihm von dem französischen Agenten Santhonax beigebracht worden war. Das war vor sechs Jahren in einer dunklen Gasse in Sheerness gewesen, aber bei kaltem oder feuchtem Wetter wurde er durch einen ziehenden Schmerz immer noch daran erinnert.
Monsieur Bescond, der emigrierte Anwalt, der jetzt als Fechtmeister sein Brot verdiente, rief ihn und seinen Trainingspartner zur nächsten Runde auf. Drinkwater ging wieder in Fechtstellung und fühlte seinen rechten Arm vor Anstrengung zittern. Die Spitze seines Floretts schien heftig hin und her zu tanzen; während Bescond wieder beobachtend beiseite trat, machte er einen plötzlichen Ausfall, damit seinem Gegner das Zittern nicht auffiel.
Mr. Quilhampton war jedoch nicht ganz bei der Sache. Drinkwaters Florettspitze bog sich an seinem gepolsterten Brustschutz in höchst befriedigender Weise durch.
»Bravo, M’sieur, très bien ... Das war klassisch in seiner Einfachheit. Und Sie, M’sieur«, sagte Bescond, zu Quilhampton gewandt, »Sie müssen den Gegner jederzeit im Auge behalten.«
Sehr angetan von seinem unerwarteten Erfolg, beendete Drinkwater die Übungsstunde, indem er seine Maske abnahm. »Wurden Sie abgelenkt, James?« fragte er.
Quilhampton nahm ebenfalls die Maske ab und nickte in Richtung Tür.
Drinkwater drehte sich um. »Ja, Tregembo, was gibt’s?« Er schälte sich aus dem Plastron und zog den Fechthandschuh aus. Das Hemd klebte ihm am Körper, der nach der Verwundung immer noch ausgemergelt war. Einige Haarsträhnen hatten sich aus seinem Zopf gelöst.
»Ich bin sofort gekommen, als ich das Siegel sah, Sir«, brummte der alte Seemann aus Cornwall und übergab Drinkwater das Päckchen.
Quilhampton erhaschte einen Blick auf die rote Siegelmarke der Admiralität mit dem Emblem des unklaren Ankers und beobachtete seinen alten Kommandanten mit steigender Ungeduld. Er sah, wie die Farbe aus Drinkwaters Gesicht wich, so daß die dünne Narbe auf der linken Wange und die blauen Schmauchspuren über dem Auge plötzlich hervortraten.
»Was gibt’s, M’sieur? Hoffentlich keine schlechten Nachrichten?« Auch Bescond sah ihn besorgt an. Er hatte diesen hageren Marineoffizier mit der hängenden Schulter und seinen fast noch dünneren Kameraden mit der hölzernen linken Hand bewundern gelernt. Für Bescond verkörperten sie den verbissenen Widerstand seiner neuen Wahlheimat gegenüber den Ungeheuern jenseits des Kanals, die seine Eltern hingemetzelt und eine Forke in den Bauch seiner schwangeren Frau gestoßen hatten.
»Mr. Q«, begann Drinkwater mit plötzlicher Formalität, die Frage des Franzosen ignorierend.
»Sir?« entgegnete Quilhampton, dem bewußt wurde, daß der Inhalt des Päckchens die salle d’armes auf wundersame Weise in das Achterdeck eines Kriegsschiffs verwandelt hatte.
»Es sieht so aus, als hätten wir endlich ein Schiff«, fuhr Drinkwater fort. »Monsieur Bescond, meine besten Empfehlungen und einen guten Tag. Tregembo, meinen Mantel! Bei Gott, Mr. Q, ich bin zum Job-Captain ernannt und auf eine Sloop 3 kommandiert worden!«
Ein begeisterter James Quilhampton begleitete Drinkwater zu seinem Haus in der High Street von Petersfield. Seit seine verwitwete Mutter ihn dank der Fürsprache des damaligen Leutnants Drinkwater als Kadett auf der Brigg Hellebore unterbringen konnte, hatte sich Quilhampton seinem Vorgesetzten persönlich verbunden gefühlt. So gering Drinkwaters Einfluß auch sein mochte, Quilhampton war sich darüber klar, daß er keinen anderen Gönner hatte. Daher schenkte er Drinkwater seine absolute Loyalität. Durch die enge Verbundenheit seiner Mutter mit Elizabeth Drinkwater war er mit dem Haus in der High Street wohlvertraut und hatte Drinkwater damals auch – zusammen mit Mr. Lettsom, dem Schiffsarzt auf der Bombenketsch Virago – nach der fürchterlichen Verwundung vor Boulogne wieder nach Hause gebracht.
Quilhampton war im Drinkwaterschen Haushalt viel eher zu Hause als in der schäbigen Wohnung seiner Mutter. Louise Quilhampton, eine hübsche, redselige Witwe, half Elizabeth Drinkwater bei der Arbeit in einer Armenschule und war, da sich ihre Charaktereigenschaften in glücklicher Weise ergänzten, die meiste Zeit im Hause ihrer Freundin zu finden, wo ihr unbekümmertes Gerede auch die fünfjährige Charlotte Amelia und den jüngsten Zuwachs der Drinkwater-Familie, Richard Madoc, zu erfreuen schien.
James Quilhampton war genauso ein Teil der Familie geworden wie seine Mutter. Er hatte sich mit Charlotte Amelia beschäftigt und sie zurückgehalten, als ihr Vater dem französischen Kriegsgefangenen Gaston Bruilhac für ein Porträt Modell gesessen hatte; und er hatte ihr eine Tracht Prügel erspart, als sie die Würmchen aus gelber und brauner Ölfarbe aufessen wollte, die Bruilhac zur Darstellung der Epaulette benutzt hatte, die Drinkwaters neuen Rang als »Master und Commander« kennzeichnete. Das war im Herbst 1801 gewesen, als Drinkwater aus der Ostsee zurückgekehrt war und bevor er für den schicksalhaften Angriff auf Boulogne wieder zur Flotte Nelsons abkommandiert wurde. Quilhampton mußte lächeln, als er jetzt Bruilhacs durchaus gelungenes Porträt betrachtete und auf die Rückkehr Drinkwaters wartete, der seine Frau von ihrer unmittelbar bevorstehenden Abreise in Kenntnis setzen wollte.
Jene einzelne Epaulette, die die kleine Charlotte Amelia so fasziniert hatte, hätte eigentlich auf Drinkwaters rechte Schulter gehört, dachte Quilhampton. Ganz abgesehen davon, daß sie dann die hängende Schulter etwas kaschiert hätte, war es auch skandalös, daß Drinkwater nach allem, was er zur Rettung der Schiffe geleistet hatte, nachdem Nelsons verwegener Nachtangriff fehlgeschlagen war, nicht zum Post-Captain befördert worden war. Doch Ihre Lordschaften mochten Mißerfolge nicht, und sein Gönner hatte die Konsequenzen mittragen müssen.
Quilhampton schüttelte den Kopf, selbst jetzt noch verärgert darüber. Nun hatte man Commander Drinkwater also zu einem Job-Captain gemacht, der den Titel Captain nur aus Höflichkeit bekam, und ihm ein Kommando auf Zeit übertragen, weil der eigentliche Kommandant der Melusine sich absentiert hatte. Es war schon verdammt unfair, insbesondere nach der Verwundung, die Drinkwater vor Boulogne davongetragen hatte.
Der junge Offizier hatte dem fiebernden Drinkwater viele Stunden am Krankenbett vorgelesen. Kurz darauf war der Krieg durch einen unsicheren Waffenstillstand beendet worden, den nur wenige für dauerhaft hielten, der jedoch denjenigen, die dafür mit ihrer Gesundheit hatten bezahlen müssen, ihr persönliches Opfer sehr deutlich zu Bewußtsein brachte. Die erzwungene Inaktivität hatte allmählich den Rangunterschied zwischen den beiden Männern verwischt und sie zu Freunden gemacht. Fremde, die dem Rekonvaleszenten Drinkwater begegneten, wie er zusammen mit Quilhampton voller Energie den Butser Hill erklomm, hielten die beiden meist für Brüder. Vom Gipfel des Hügels aus beobachteten sie stundenlang den fernen Ärmelkanal, wobei Drinkwater dauernd von Quilhampton wissen wollte, was für Schiffe er mit seinem Teleskop ausmachen konnte.
Gaston Bruilhac hatte vor seiner Entlassung auch entzückende Porträts von Drinkwaters beiden Kindern gemalt und schließlich auch noch Elizabeth überredet, ihm Modell zu sitzen. Quilhampton wandte sich um und betrachtete das Gemälde. Die sanften braunen Augen und der große, schön geschwungene Mund schienen ihm zuzulächeln. Der Maler hatte sie sehr gut getroffen, dachte er, als die Tür aufging und Elizabeth hereinkam. Sie trug ein graues Kleid mit hoher Taille, und es war ihr deutlich anzumerken, daß sie von der Nachricht der bevorstehenden Abreise ihres Mannes völlig überrascht war.
»Soso, James«, sagte sie, »Sie sind also auch Teil dieser Verschwörung, die uns Frauen in dem Moment, da wieder Krieg ausbricht, einfach ignoriert.« Nachdenklich kaute sie auf ihrer Unterlippe, und Quilhampton murmelte wenig überzeugende Proteste. Sein Blick wanderte von Elizabeth zu Drinkwater, der hinter ihr ins Zimmer kam, das Gesicht ausdruckslos.
»Oh, ich weiß sehr wohl, was in euch vorgeht. Ihr seid wie Kinder ...« Ihre Stimme wurde sanfter. »Nein, ihr seid schlimmer als Kinder.« Sie wandte sich ihrem Mann zu. »Du siehst am besten mal nach, ob du nicht etwas zu trinken findest, damit wir auf dein neues Kommando anstoßen können.« Traurig lächelte sie, als Drinkwater plötzlich auf sie zutrat und ihre Hand an seine Lippen hob. Dann setzte sie sich, und er ging hinaus, um eine Flasche zu holen.
»Passen Sie gut auf ihn auf, James«, sagte sie leise. »Seine Wunde wird ihm noch viele Monate zu schaffen machen. Sie wissen ja, wie sie schmerzt, wenn wir Südwestwind und feuchteres Wetter bekommen.«
Quilhampton, den Elizabeths Bitte rührte, nickte stumm.
»Das ist die letzte Flasche von Dick Whites Malvasier.« Mit diesen Worten trat Drinkwater wieder ins Zimmer, wobei er den Staub von einer Flasche wischte. Dicht auf dem Fuß folgte ihm seine dunkelhaarige kleine Tochter, die aufgeregt herausplatzte: »Mama, Mama! Richard ist in den Tilbrook gefallen.«
»Was sagst du da?« Elizabeth erhob sich, und Drinkwater hielt beim Entkorken der Flasche inne.
»Ach, ist nicht weiter schlimm«, sagte Charlotte Amelia. »Susan hat ihn wieder rausgeholt. Aber er ist ganz naß ...«
»Gott sei Dank! Wie ist das passiert?«
»Och, er hat sich wie eine verdammte Landratte benommen, Mama.«
»Charlotte!« Elizabeth unterdrückte ein Lächeln, das sich jedoch ungehindert auf den Gesichtern der beiden Männer ausbreitete. »So redet eine junge Dame nicht!«
Charlotte Amelia schmollte, bis ihr Blick sich mit dem ihres Vaters traf.
»Vielleicht«, sagte Elizabeth, die merkte, woher der Wind wehte, »vielleicht wäre es wirklich besser, wenn ihr beide wieder zur See gehen würdet.« Dann begann sie Charlotte Amelia zu erklären, daß Papa von dem alten König George einen Brief aus Windsor erhalten habe und nun wieder in den Krieg ziehen und die Feinde des Königs bekämpfen müsse. Und James Quilhampton nippte, sich irgendwie schuldig fühlend, an dem zur Feier des Tages kredenzten Malvasier und spürte den unausgesprochenen Vorwurf in Elizabeths sanfter Beständigkeit.
Captain Drinkwater rückte die Jacke aus feinem Tuch zurecht. Das stärkere Schulterpolster, das der Schneider auf seinen Wunsch hin eingesetzt hatte, um die verkümmerten und überbeanspruchten Muskeln seines Nackens zu unterstützen, konnte die ungleiche Höhe seiner Schultern und die leichte Schiefstellung des Kopfes nicht ganz verbergen. Diese Entstellung wurde durch die schwere Epaulette noch hervorgehoben. Trotzdem nickte er seinem Spiegelbild zufrieden zu und zog seine Uhr aus der Westentasche. Es war Viertel vor sechs in der Frühe, und Earl St. Vincent saß schon seit einer Dreiviertelstunde an seinem Schreibtisch. Drinkwater trank den letzten Schluck Kaffee, schnallte den Degen um und warf den Mantel über die Schultern. Dann nahm er seinen Hut aus der Schachtel, blies die Kerze aus und verließ das Haus.
Drei Minuten später erreichte er den Strand und ging schnell durch den Schmutz, der die Straße bedeckte, in Richtung Whitehall, wobei er sich innerlich auf das kommende Gespräch mit dem Ersten Seelord vorbereitete. Er blieb nur einen Moment stehen, um sich die Schuhe von einem hageren Burschen schwärzen und mit einer alten Perücke polieren zu lassen.
Als die Uhr bei den Gardekavalleristen, der genaueste Zeitmesser in London, die sechste Stunde schlug, schritt er durch die Trennwand, die das Admiralitätsgebäude vor randalierenden Seeleuten schützen sollte, die es wegen ihres ausstehenden Soldes immer wieder belagerten. Die Ehrenbezeugung des Postens erwiderte er, indem er mit zwei Fingern an den Hutrand tippte.
Hinter den Glastüren blieb er stehen und hustete. Der Läufer der Admiralität erwachte abrupt aus seinem Halbschlaf und fiel beim Aufstehen fast hin, da er seine Füße nur mit Mühe aus dem unten am Stuhl angebrachten Wärmekasten befreien konnte. Er schaffte es jedoch, mit Würde davonzustolzieren, um Commander Nathaniel Drinkwater anzumelden.
Der Earl St. Vincent erhob sich, als Drinkwater in das große Büro trat. Er trug eine alte Interimsuniform, bei der die ihm verliehenen Ordenssterne nur aufgestickt waren.
»Captain Drinkwater, bitte nehmen Sie Platz.« Er deutete auf einen Stuhl und setzte sich wieder.
Drinkwater, etwas nervös, setzte sich ebenfalls, wobei er vage zwei oder drei Porträts wahrnahm, die würdevoll auf ihn herabstarrten; außerdem hing da das prächtige Gemälde einer Seeschlacht, die er für das Gefecht am Valentinstag vor Kap St. Vincent hielt.
»Ich darf Sie zu Ihrer Ernennung beglückwünschen, Captain.«
»Danke, Mylord. Sie kam unerwartet.«
»Aber nicht unverdient.«
»Eure Lordschaft sind sehr freundlich.« Drinkwater machte eine etwas ungeschickte Verbeugung und ließ den musternden Blick über sich ergehen. St. Vincent beglückwünschte sich zu der Wahl, die er getroffen hatte. Commander Drinkwater war seiner Schätzung nach ungefähr vierzig Jahre alt. An die grauen Augen konnte er sich noch von ihrer kurzen Begegnung her erinnern, ebenso an die hohe Stirn und den dichten Haarschopf, der ihm trotz einiger grauer Strähnen ein immer noch jugendliches Aussehen verlieh. Der Mund war leicht zusammengepreßt, so daß die Lippen weniger voll erschienen, als sie waren, und tiefe Furchen zogen sich von der Nase zu den Mundwinkeln. Drinkwaters wettergegerbte Haut wirkte ein wenig blaß und zeigte Spuren alter Kämpfe: eine feine Narbe auf der linken Wange, wahrscheinlich von einer Degenspitze, und bläuliche Verfärbungen durch Schießpulver über dem einen Auge.
»Sie haben sich von Ihrer Verwundung wieder erholt, Captain?«
»Völlig, Mylord.«
»Was waren die näheren Umstände, die zu Ihrer Verwundung führten?«
»Bei Lord Nelsons Angriff auf die Invasionsflotte im Dezember 1801 war ich Kommandant der Bombarde Virago, Mylord. Ich war in einem Beiboot vorausgefahren, um ihre Position zu erkunden, als eine Granate über dem Boot detonierte. Dabei verlor ich bedauerlicherweise einige Leute. Ich selbst hatte mehr Glück.« Drinkwater mußte daran denken, wie Mr. Matchett in seinen Armen gestorben war, während der Schmerz seiner eigenen Wunde mit einem merkwürdig gedämpften Schock in seinen Körper und sein Bewußtsein sickerte.
St. Vincent sah von seinen Papieren auf. Der Bericht über Commander Drinkwaters Bootsausflug nach Boulogne las sich darin weitaus dramatischer, aber das machte nichts. St. Vincent schätzte Bescheidenheit. Hundert andere Offiziere hätten sich dieser nächtlichen Unternehmung gerühmt und die Gefahr nach der Anzahl der Toten in ihrem Boot bemessen. Jedenfalls hätte Palgrave das ganz sicher getan. Dieser Gedanke bestärkte den alten Mann in der Richtigkeit seiner Wahl.
»Lord Dungarth hat eine gute Meinung von Ihnen, Captain.«
»Danke, Mylord.« Drinkwater begann sich unbehaglich zu fühlen; die Komplimente verunsicherten ihn, denn er war sich darüber klar, daß ein Offizier von St. Vincents Kaliber mit Lobreden sehr sparsam umging.
»Sie fragen sich vielleicht, warum ein gerade erst zum Kommandant einer Sloop ernannter Offizier vom Ersten Seelord interviewt wird, wie?«
Drinkwater nickte. »Das stimmt, Mylord.«
»Die Melusine ist eine feine Sloop, die wir 1799 den Franzosen vor Penmarch weggenommen haben, und sie ist bemerkenswert schnell. Die Franzosen bezeichnen sie als Korvette. Für ihren jetzigen Einsatz ist sie allerdings kein ideales Schiff.«
»Nein, Mylord?«
»Nein, Captain. Ihr voriges Schiff wäre vielleicht besser geeignet gewesen. Bombarden haben sich als außerordentlich brauchbar für arktische Gewässer erwiesen ...«
Drinkwater öffnete den Mund, hielt es dann jedoch für besser, nichts zu sagen, zumal St. Vincent schon weitersprach.
»Es ist jedoch nicht geplant, daß Sie sich längere Zeit in arktischen Gewässern aufhalten. Seit der Rede des Königs im März bestand kein Zweifel mehr daran, daß der Friede nicht von Dauer sein würde. Deshalb wurden wir von den Walfangreedereien ersucht, einen Begleitschutz für ihre Schiffe zu stellen. Während des letzten Krieges war es üblich, in den Sommermonaten einen Kreuzer vor dem Nordkap und einen zweiten bei den Faröerinseln zu stationieren. Nun werden wir zu dieser Praxis zurückkehren müssen. Der Walfang ist eben eine prekäre Sache. Ein kleiner Kreuzer – die Melusine, um das Kind beim Namen zu nennen – war schon lange für diese Aufgabe vorgesehen, hauptsächlich, weil sie auch während des Friedens nie außer Dienst gestellt worden war. Jetzt, da der Krieg wieder ausgebrochen ist, sind unsere Walfänger mehr als zuvor auf Schutz angewiesen. Die Schiffe vom Hull liegen schon auf dem Humber versammelt und warten nur darauf, daß ihr Geleitfahrzeug in See gehen kann. Die Melusine ist nämlich bereits dort. Ihr Kommandant hat kürzlich, äh, gesundheitlich etwas Schaden genommen, und so hat man Ihnen das Kommando übertragen ...«
Drinkwater nickte und wünschte insgeheim, er hätte gewußt, daß es in die Arktis gehen sollte, bevor er Tregembo und Quilhampton zum Einkaufen losschickte. Er spürte aber auch, daß dies nicht der einzige Grund war, weswegen man ihm befohlen hatte, dem Ersten Seelord seine Aufwartung zu machen.
»Während des Friedens«, fuhr St. Vincent fort, »haben die Franzosen eine Menge Freibeuterschiffe ausgeschickt. Meldungen über diese Kaperer kamen aus allen vier Himmelsrichtungen, die meisten bezeichnenderweise von den Routen der Indienfahrer. Die sollen uns jedoch heute nicht kümmern.« St. Vincent erhob sich und ging zum Fenster hinüber. Drinkwater betrachtete den schmalen, gekrümmten Rücken des Earl und versuchte, seine an die entfernten Baumwipfel des Parks gerichteten Bemerkungen zu verstehen.
»Wir glauben, daß einige dieser Kaperer Kurs auf die Grönlandsee genommen haben.« St. Vincent drehte sich abrupt um, eine Bewegung, die seinen Worten besondere Bedeutung verlieh. »Die Vernichtung unserer Fischereiflotte im Nordmeer würde hier Tausende ins Elend stürzen, von dem Verlust erstklassiger Seeleute gar nicht zu reden ...« Er sah Drinkwater vielsagend an. »Sie verstehen, Captain?«
»Aye, Mylord, ich denke schon.«
St. Vincent fuhr in etwas ruhigerem Ton fort: »Die Franzosen sind Meister im Kampf gegen Handelsschiffe, Captain, ob es sich nun um Indienfahrer oder Walfänger handelt. Das Ihnen übertragene Kommando ist beileibe keine Sinekure. Ich ersuche Sie, stets daran zu denken, daß Sie nicht nur gehalten sind, die nördliche Walfangflotte zu schützen, sondern auch jeden Versuch der Franzosen zu vereiteln, eine eigene Fischereiflotte zusammenzustellen. Ist das klar?«
»Jawohl, Mylord.«
»Gut. Ihre schriftlichen Befehle liegen vorn im Büro für Sie bereit. Sie sollen sich unverzüglich an Bord der Melusine begeben, aber Lord Dungarth würde Sie gern noch zum Frühstück in sein Büro einladen, bevor Sie sich auf den Weg machen. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag, Captain Drinkwater.«
Damit beugte er sich schon wieder über die Papiere auf seinem Schreibtisch.
Drinkwater erhob sich, machte eine knappe Verbeugung und begab sich zu Lord Dungarth.
»Nathaniel! Meine allerherzlichsten Glückwünsche zum neuen Kommando. Die Melusine ist ja eigentlich ein Schiff für einen Post-Captain, aber das ist für St. Vincent absolut kein Hinderungsgrund.« Lord Dungarth streckte ihm die Hand entgegen, wobei seine hellbraunen Augen freundlich funkelten. Er bot Drinkwater einen Stuhl an, schenkte den auf einem Beistelltisch stehenden Kaffee aus und hob den Deckel von einer Terrine. »Schinkenspeck oder Nieren, mein Bester?«
Nach alter Messetradition begannen sie, in vertraut kameradschaftlichem Schweigen ihr Frühstück einzunehmen. Dem Earl sah man jetzt langsam sein Alter an, aber in seinen Augen stand noch immer ein Feuer, das Drinkwater an den Marineoffizier erinnerte, der er einmal gewesen war: überschwenglich, energisch und von jener unerschütterlichen Selbstsicherheit seiner Klasse, die so häufig zu einer trägen Unwissenheit verkümmerte.
Lord Dungarth wischte sich den Mund mit der Serviette ab und lehnte sich im Stuhl zurück, während er am Kaffee nippte und seinen Besucher über den Rand der Porzellantasse betrachtete.
Als Drinkwater mit dem Essen fertig war und ein Diener abgeräumt hatte, bot Dungarth ihm einen Stumpen an.
»Feinstes Deli-Blatt, Nathaniel; so etwas werden Sie in London nicht mehr bekommen, solange dieser Krieg dauert.«
Doch Drinkwater lehnte ab. »Danke, Mylord, aber ich habe in meinem Leben kaum ein Dutzend mal geraucht.« Er hielt inne. Dungarth, der konzentriert seine lange Zigarre paffte, schien nicht geneigt, etwas zu sagen. »Darf ich fragen, ob Sie irgendetwas von einer, äh, bestimmten Person gehört haben, mit der uns ...«
»Ein gemeinsames Interesse verbindet?« murmelte Dungarth durch den Zigarrenrauch. »Ja, das habe ich. Es geht ihm gut, er hat einige Aufgaben für Worontzoff übernommen, der von seinen reiterlichen Fähigkeiten sehr beeindruckt ist und schreibt, daß er ihm bei der Auswahl englischer Vollblüter unschätzbare Dienste leistet.«
Drinkwater nickte erleichtert. Sein Bruder Edward, bei dessen Flucht vor dem Galgen er aktiv mitgewirkt hatte, fiel eben immer wieder auf die Füße. Im Dienst eines einflußreichen russischen Adligen würde er zweifellos reüssieren. Er konnte zwar niemals in sein Heimatland zurückkehren, aber, wie Dungarth angedeutet hatte, einen Teil seiner Schuld dadurch abtragen, daß er als Kurier arbeitete. Worontzoff, früher Botschafter am britischen Hof, war anglophil und eine gute Informationsquelle für die britische Regierung.
»Es tut mir leid, daß Sie nicht zum Post-Captain befördert worden sind, Nathaniel. Eigentlich hätte das ja schon vor Jahren geschehen müssen, aber die Dinge laufen nicht immer so, wie wir uns das wünschen.« Der Earl verfiel in Schweigen, und Drinkwater mußte an die makabren Geschehnisse denken, die diesen einst so liberalen Mann zu einem unversöhnlichen Feind der französischen Republik gemacht hatten. Bei der Rückkehr aus Italien, wo seine schöne junge Frau am Kindbettfieber gestorben war, hatte ihn der Mob in Frankreich als Aristokraten erkannt, den Sarg seiner Frau aufgebrochen und ihren Leichnam auf die Straße geworfen und geschändet.
Dungarth seufzte. »Das gibt einen langen Krieg, Nathaniel, denn Frankreich ist von rastloser Energie erfüllt und jetzt, da es sich von der Leidenschaft der republikanischen Begeisterung befreit hat, sehen wir uns einem Nationalismus gegenüber, der wohl kaum innerhalb seiner Grenzen bleiben wird, mögen sie nun natürlich oder aufgezwungen sein. Über allem erhebt sich jetzt wie ein Stern das Genie Bonapartes, der anscheinend als einziger über die Macht verfügt, das Volk zu einen. In einer Armee hungernder Männer Pflichtgefühle zu wecken und sich gleichzeitig das Einverständnis dieser Schweine in Paris zu sichern, dazu gehört wirklich Genie, Nathaniel. Wer außer einem vom Schicksal Auserkorenen hätte sich unserer Blockade in Ägypten entziehen und aus der Demütigung der Niederlage zurückkehren können, um Italien zu erobern und die Macht in Frankreich zu übernehmen, eh?«
Dungarth schüttelte den Kopf und stand auf. Er begann auf und ab zu gehen, wobei er gelegentlich mit dem Finger auf Drinkwater deutete, um seiner Rede Nachdruck zu verleihen.
»Es ist die Marine, Nathaniel, auf die wir bauen müssen, wenn wir Frankreich das Heft aus der Hand winden wollen. Wir müssen wieder seine Häfen blockieren und seine Flotten vernichten. Gegen seine Armeen können wir weiß Gott wenig unternehmen, wenn man von gelegentlichen gemeinsamen Operationen absieht – und die sind bislang bemerkenswert erfolglos geblieben. Aber mit der Marine können wir unseren unentschlossenen Verbündeten das Rückgrat stärken und sie dazu bringen, daß sie weiterhin gegenüber Paris fest bleiben.«
»Halten Sie es für wahrscheinlich, daß Österreich sich jemals mit einer Republik arrangieren würde?«
»Uns liegen Berichte vor, Nathaniel, daß Bonaparte beabsichtigt, sich zum König krönen zu lassen und eine Dynastie zu gründen. Weiß der Himmel, aber ein Mann wie er könnte es wirklich fertigbringen, sich von Josephine scheiden zu lassen und eine Hohenzollern oder eine Romanow zu heiraten, ja selbst eine Habsburg, wenn er in der Lage ist, die Friedensbedingungen zu diktieren. Sie selbst wissen doch nur zu gut, daß er sogar schon nach Indien gegriffen hat.« Dungarth sah Drinkwater etwas bekümmert an.
»Ja, Mylord, Sie haben recht.«
»Aber auf dem Kontinent wird Frankreich sich erschöpfen. Also ist es unsere Pflicht, es zu überdauern.«
»Trotzdem muß es auf dem Kontinent besiegt werden, Mylord. Und wenn unsere eigenen Kräfte ...«
Dungarth lachte. »Die britische Armee? Mein Gott, haben Sie den verlorenen Haufen gesehen, der aus Holland zurückkam? Nein, die Gardekavallerie wird nichts ausrichten. Wir müssen uns an Rußland halten, Nathaniel. An Rußland mit seinem unerschöpflichen Menschenpotential, unterstützt durch unsere Hilfsgelder und angespornt durch die Tatkraft Zar Alexanders.«
»Wollen Sie etwa Europas Freiheit mit Hilfe Rußlands wiederherstellen, Mylord?« Drinkwater war überrascht. Über Mütterchen Rußlands seltsame Mischung aus Kultiviertheit und Barbarei war genug bekannt. Russische Schiffe waren zusammen mit der Royal Navy in der Nordsee im Einsatz gewesen, wobei sich ihre adligen Offiziere gleichzeitig als geschmäcklerisch und inkompetent erwiesen hatten. Russische Truppen hatten den Feldzug in den Niederlanden mitgemacht, und die Beziehungen zwischen den beiden Armeen konnten nur als gespannt bezeichnet werden; Suworows Veteranen hatten sich in Norditalien einen Namen erworben, der genauso als Synonym für Terror gelten konnte wie jede Schändlichkeit, die man sich in Paris ausgedacht hatte. Es war erst zwei Jahre her, daß sich Alexanders Vater, der sadistische Zar Paul, gegen seine britischen Verbündeten gekehrt und mit Frankreich gemeinsame Sache gemacht hatte, getrieben von dem größenwahnsinnigen Verlangen, Europa zwischen sich und Bonaparte aufzuteilen. Obwohl Alexander sich nun als Freund Englands und als Kirchenfürst bezeichnete, stand er im Verdacht, ein Komplott zur Ermordung seines eigenen Vaters geschmiedet zu haben.
»Mir wurde gemeldet«, sagte Dungarth, »daß Zar Alexander für gewisse Sünden Wiedergutmachung leisten möchte.« Sein Ton war zynisch.
»Worontzoffs Mann macht sich also nützlich?«
Dungarth nickte. »Zusammen mit einer gewissen Gräfin Marie Narischkin ... Das alles hat jedoch nichts mit unseren gegenwärtigen Plänen zu tun, Nathaniel. St. Vincent hat sicher davon gesprochen, daß der jüngst unbeklagt verschiedene Frieden den Franzosen die besten Möglichkeiten verschafft hat, Kaperer gegen unsere Handelsschiffe auszuschicken. Das ist die gefährlichste Waffe, die sie gegen uns einsetzen können. Denken Sie nur an die Erfolge der Freibeuter in unserem Krieg mit Amerika: Yankees, Franzosen und Iren haben sich damals direkt vor unserer Haustür Prisen geschnappt, haben unsere Hafenstädte in die Armut getrieben, die Versicherungsraten in die Höhe schnellen lassen und unsere Kaufleute so zum Jammern gebracht, daß die Regierung durch ihr Gezeter erschüttert wurde. Der Kommandant eines Geleitfahrzeugs, wie Sie jetzt eins übernehmen, ist ähnlichen Belastungen ausgesetzt wie der Kommandant eines 74-Kanonen-Schiffes im Blockadedienst. Denken Sie an meine Worte, Nathaniel. Rückgang des Handels bedeutet Rückgang des Vertrauens in die Royal Navy, und angesichts der Anstrengungen, die wir in absehbarer Zukunft auf uns nehmen müssen, wäre das ein sehr schlechtes Omen.
Um aber auf den eigentlichen Kern der Sache zu kommen: Uns sind kürzlich von Gewährsleuten aus der Bretagne Gerüchte zugetragen worden, daß vor einem Jahr mehrere gut bewaffnete und ausgerüstete Schiffe nach Norden gesegelt sind. Sie sind bislang weder zurückgekehrt, noch hat man wieder von ihnen gehört. Die naheliegendste Erklärung ist, daß sie nach Kanada gelaufen sind, wo sie uns Ungelegenheiten bereiten können. Aber von den Loyalisten in New Brunswick, die ein wachsames Auge auf unsere Interessen haben, liegen uns keine Berichte vor. Auch in amerikanischen Gewässern sind sie nicht gesehen worden ...«
»Irland?«
»Vielleicht, doch auch von dort haben wir nichts gehört. Auch bietet die norwegische Küste Freibeutern sehr viele Zufluchtsmöglichkeiten, das haben sich ja schon die Dänen vor der Schlacht von Kopenhagen zunutze gemacht. Aber ich bin geneigt anzunehmen, daß diese Schiffe unseren Walfängern auflauern. Zwei von ihnen sind im letzten Sommer verschwunden, und obwohl ihr Verlust an sich nicht bemerkenswert ist – vielleicht haben sie auch nur im Eis überwintert –, so wollen die Leute aus Hull während der letzten Saison doch einige Schiffe gesichtet haben, die sie nicht für Walfänger hielten.«
»Wollen Sie damit andeuten, daß zwei von unseren Walfängern während des Friedens von französischen Kaperern aufgebracht worden sind?«
»Das weiß ich nicht, Nathaniel. Ich erzähle es Ihnen nur, weil man von diesen Franzosen nichts mehr gehört hat, seit sie Kurs gen Norden genommen haben. Wir müssen damit rechnen, daß sie an einem abgelegenen Ort, zum Beispiel in Spitzbergen, überwintert haben und nur darauf warten, nach Wiederaufnahme der Feindseligkeiten gegen unsere Walfangflotte loszuschlagen. Unwahrscheinlich ist das keineswegs, wir wußten alle, daß der Friede nicht von Dauer sein würde.«
»Wissen Sie, um wie viele Schiffe es sich handelt?«
»Nein, leider nicht.«
Drinkwater dachte nach, während Dungarth wieder Platz nahm. »Da gibt es noch eine Sache, die Sie wissen sollten«, unterbrach der Earl seine Überlegungen.
»Mylord?«
»Captain Palgrave hat sein Kommando nicht freiwillig abgegeben.«
»Ich hörte, daß er gesundheitlich nicht auf der Höhe ist.«
»Er wurde bei einem Duell verwundet. Eine sehr törichte Geschichte, die mir zu Ohren kam, weil einer der Sekretäre hier, der mit Ihrem künftigen Ersten Offizier verwandt ist, seine Zunge nicht im Zaum halten konnte. Anscheinend hatte Palgrave Streit mit dem Kapitän eines seiner Walfangschiffe. Die Sache wird natürlich unter den Teppich gekehrt; Palgrave kann sich einen Skandal nicht leisten und hat folglich seinen Abschied genommen. Aber es ist wirklich mehr als ungewöhnlich, daß ein Handelsschiffskapitän den Kommandanten eines Kriegsschiffes außer Gefecht setzt.«
»Vielleicht ging es um eine lokale Geschichte, Mylord, eine Beleidigung, eine Frau ...«
»Ich werde mit den Jahren immer mißtrauischer, Nathaniel.« Dungarth lächelte. »Aber da Sie gerade von Frauen reden: Wie geht es Elizabeth und Ihrer entzückenden kleinen Tochter? Und wie ich hörte, haben Sie inzwischen auch einen Erben ...«
ZWEITES KAPITEL Die Korvette
Mai 1803
Drinkwater beugte sich aus dem Fenster der Postkutsche, als die Pferde, die sie eben in Barnet gewechselt hatten, das Tempo beschleunigten. Schon senkte sich die Dämmerung über das Land; außer dem viereckigen Turm der Monken-Hadley-Kirche, deren Pfarrer ihn vor langer Zeit dem Kapitän der Cyclops empfohlen hatte, konnte er nur wenig von den Wahrzeichen seiner Jugend erkennen.
Über seinem Kopf ertönte plötzlich eine Stimme: »Wir stürmen ja dahin wie eine Fregatte bei raumem Wind, Sir.« Als er nach oben sah, erblickte er Mr. Quilhampton, dessen Gesicht über ihre Geschwindigkeit von acht oder neun Meilen pro Stunde vor Begeisterung strahlte.
Drinkwater lächelte und zog sich ins Wageninnere zurück. Seit seinem Frühstück bei Lord Dungarth hatte er mit Briefeschreiben und letzten Einkäufen zu tun gehabt. So hatte er ein Paar Pistolen erworben und einen neuen Chronometer, sowie den neuesten Sextanten von Hadley – notwendige Anschaffungen, die jetzt sorgfältig unter seinem Sitz verstaut waren. Ihr Hauptgepäck hatten sie zum »Schwarzen Schwan« nach Holborn schaffen lassen, von wo aus Tregembo es mit der langsameren Postkutsche der York-Linie nachbringen würde.
Er selbst und Quilhampton waren gerade noch rechtzeitig in der Lombard Street angekommen, um die Postkutsche nach Edinburgh zu erwischen, für die Quilhampton schon vorher Fahrkarten besorgt hatte.
Er mußte wieder lächeln, als er daran dachte, wie enthusiastisch Mr. Quilhampton die glänzenden, braun-schwarzen Postkutschen betrachtet hatte, die mit lautem Hufgetrappel am Posthof ankamen und wieder abfuhren; die einen von der langen Fahrt verstaubt, die anderen frisch geschmiert und gewaschen, bereit für die nächste Etappe der Reise.
Die ihm gegenübersitzende Dame erwiderte sein Lächeln, wobei sie ihren Kiepenhut abnahm; Drinkwater wurde verlegen, weil ihm plötzlich auffiel, daß er nicht nur wie ein Narr still vor sich hinlächelte, sondern daß sie auch seit einigen Minuten innigen Kniekontakt hatten.
»Sie sind auf dem Weg zu Ihrem Schiff, Captain?« Ihr Edinburger Akzent war unverkennbar und der kokette Ausdruck ihres Gesichts ebenso.
»So ist es, Madam.« Er hüstelte und rückte etwas beiseite. Die Frau war an die Sechzig und konnte doch nicht annehmen ...
»Catriona, meine Nichte hier«, mit diesen Worten tätschelte sie das Knie einer jungen Dame in Grau und Weiß neben ihr, »hat mich in London besucht, in unserer Villa in Lambeth. Wohnen Sie auch in London, Captain?«
Drinkwater warf einen Blick auf das Mädchen, aber der Schatten der Haube lag über ihrem Gesicht, und die Lichter würden erst beim nächsten Halt angezündet werden. Als sie einstieg, hatte er nur flüchtig registriert, daß sie groß und schlank war. Er neigte den Kopf höflich in ihre Richtung. »Nein, Madam, ich wohne woanders.«
»Darf man fragen wo, Sir?«
Drinkwater seufzte. Offenkundig war sie entschlossen, jedes Detail aus ihm herauszuholen; er hatte eine Abneigung dagegen, über private Dinge zu reden. So antwortete er ausweichend: »In Hampshire, Madam.«
»Ah, in Hampshire – eine vornehme Grafschaft.«
Während die Witwe MacEwan weiterplapperte, lächelte und nickte er an den passenden Stellen und musterte dabei die anderen Passagiere. Zu seiner Linken döste ein beleibter Mann in tabakbraunem Rock vor sich hin – oder tat nur so, um nicht von der Witwe ausgefragt zu werden; rechts war ein unauffällig gekleideter Geistlicher bemüht, trotz des schnell abnehmenden Tageslichts in seinem Brevier zu lesen. Drinkwater vermutete, daß auch er nur schauspielerte, um nicht ins Gespräch gezogen zu werden. Über den Zustand seines sechsten Reisegenossen bestand jedoch kein Zweifel: Vom Alkohol umnebelt, schnarchte er mit offenem Mund und rutschte langsam immer mehr in sich zusammen.
»Und beim Empfang, den Lady Rocheford gab, hatte Catriona das Glück ...« Die Nichtigkeiten der Witwe MacEwan begannen Drinkwater zu ärgern. Der überwältigende Strom ihres leeren Geschwätzes konnte einen auf den Gedanken bringen, daß alle Frauen derart oberflächlich waren. Zur Erholung dachte er an Elizabeth und die Kinder. »Und dann hat der Doktor der bedauernswerten Frau geraten, Brustwickel mit grünen Schierlingsblättern zu machen und so viele Tausendfüßler zu essen, wie ihr Magen nur vertragen konnte, worauf die Geschwulst ganz zurückging und die Frau wieder gesund wurde. Ist das nicht bemerkenswert, Captain? Sind Sie verheiratet, Sir?«
Drinkwater nickte etwas ermattet; dem Geistlichen neben ihm war das Buch in den Schoß gesunken, und sein Kopf neigte sich langsam immer tiefer auf die Brust.
»Aber natürlich, Sir, das habe ich Ihnen gleich angesehen; Sie machen ganz den Eindruck eines verheirateten Mannes und tapferen Offiziers. Mein Mann pflegte immer zu sagen ...«
Drinkwater schenkte den Lebensweisheiten des verstorbenen Mr. MacEwan keine Beachtung. Er hatte das erheiternde Bild seines Sohnes Richard vor Augen, wie er nackt dastand, nachdem er in den Tilbrook gefallen war und Susan Tregembo ihn trockenrieb.
»Aber ich versichere Ihnen, Captain, das war nicht zum Lachen. Sie starb innerhalb eines Monats an den Pocken und ließ das Kind als Waise zurück ...« Catrionas Knie wurde dabei ein zweites Mal getätschelt.
»Entschuldigen Sie, Madam, aber ich habe nicht über Ihre Geschichte gelächelt.«
Die Kutsche verlangsamte jetzt die Fahrt und hielt nach wenigen Minuten zum Pferdewechsel in Hatfield.
»Bitte entschuldigen Sie mich eine Weile, Madam.« Drinkwater erhob sich, stieß die Tür auf und begab sich auf die Suche nach einer Toilette. Nach seiner Rückkehr rief er zu Quilhampton hinauf: »Mr. Q, lassen Sie uns bis zur nächsten oder übernächsten Station die Plätze tauschen.«
»Aye, aye, Sir.« Quilhampton stieg herab. Die frischen Pferde wurden bereits angeschirrt, und der Postillon sah auf seine Uhr. »Eine halbe Minute noch, Gentlemen.«