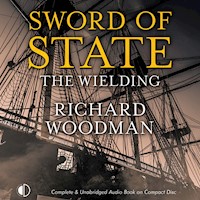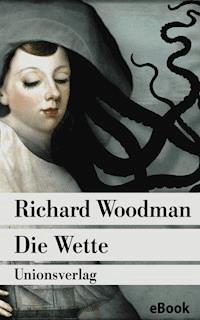Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Ein Nathaniel Drinkwater Roman
- Sprache: Deutsch
Auf hoher See zur Zeit der napoleonischen Kriege England, 1798: Leutnant Nathaniel Drinkwater erhält von Admiral Nelson den bisher wichtigsten Befehl seines Lebens: Er soll die Brigg »Hellebore« ins Rote Meer segeln, wo sich unter dem Schatten von Napoleons Ägyptenfeldzug ein neuer Konflikt zusammenbraut. Als er voller Tatendrang Kurs gen Süden aufnimmt, ahnt Drinkwater noch nicht, dass ihn nicht nur die französische Flotte erwartet, sondern auch sein unberechenbarer Erzfeind, Oberstleutnant Edouard Santhonax … Inmitten britischer Blockaden und des allgegenwärtigen Kaperkriegs wird die Jagd nach Santhonax für Drinkwater zur persönlichen Bewährungsprobe … Wird sich Drinkwater in den alles entscheidenden Seeschlachten vor Ägyptens Küste behaupten können – oder wird es ihn endgültig in die Tiefe reißen? »Absolut lesenswert, voller Action und Charakterentwicklung. Sie werden Nathaniel Drinkwater lieben!« Amazon-LeserEin exzellent recherchierter Seefahrerroman für Fans von Patrick O'Brian und Mark P. Lorne.Alle Bände der Reihe: Band 1: Die Augen der Flotte – Feuertaufe auf der Fregatte Cyclops Band 2: »Kutterkorsaren – In geheimer Mission vor Frankreichs Küsten« Band 3: »Kurier zum Kap der Stürme – Auf Vorposten im Roten Meer« Band 4: »Die Mörser-Flottille – Die Schlacht von Kopenhagen« Band 5: »Die Korvette – Die Walfänger von Grönland«Die Bände sind unabhängig voneinander lesbar.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 388
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
England, 1798: Leutnant Nathaniel Drinkwater erhält von Admiral Nelson den bisher wichtigsten Befehl seines Lebens: Er soll die Brigg »Hellebore« ins Rote Meer segeln, wo sich unter dem Schatten von Napoleons Ägyptenfeldzug ein neuer Konflikt zusammenbraut. Als er voller Tatendrang Kurs gen Süden aufnimmt, ahnt Drinkwater noch nicht, dass ihn nicht nur die französische Flotte erwartet, sondern auch sein unberechenbarer Erzfeind, Oberstleutnant Edouard Santhonax … Inmitten britischer Blockaden und des allgegenwärtigen Kaperkriegs wird die Jagd nach Santhonax für Drinkwater zur persönlichen Bewährungsprobe … Wird sich Drinkwater in den alles entscheidenden Seeschlachten vor Ägyptens Küste behaupten können – oder wird es ihn endgültig in die Tiefe reißen?
Über den Autor:
Richard Woodman (1944-2024) wurde mit 16 Jahren Fähnrich und fuhr auf einer Vielzahl von Schiffen, wo er vom Lehrling bis zum Kapitän aufstieg. Insgesamt verbrachte er über 30 Jahre seines Lebens auf hoher See. Neben seiner Arbeit als Seemann entdeckte er seine Leidenschaft für das Schreiben. Was mit kleinen Notizen in der Kajüte begann, entwickelte sich zu einer beeindruckenden Karriere als Autor. Er veröffentlichte über 50 Romane und 18 Sachbücher, darunter die gefeierte Seefahrer-Reihe um Nathaniel Drinkwater, die LeserInnen weltweit in den Bann zieht.
Bei dotbooks veröffentlichte der Autor die folgenden Bände seiner Nathaniel Drinkwater Reihe: »Die Augen der Flotte – Feuertaufe auf der Fregatte Cyclops«, »Kutterkorsaren – In geheimer Mission vor Frankreichs Küsten«, »Kurier zum Kap der Stürme – Auf Vorposten im Roten Meer«, »Die Mörser-Flottille – Die Schlacht von Kopenhagen« und »Die Korvette – Die Walfänger von Grönland«.
***
eBook-Neuausgabe Juni 2025
Die englische Originalausgabe erschien erstmals 1983 unter dem Originaltitel »A Brig of War« bei John Murray (Publishers) Ltd., London.
Copyright © der englischen Originalausgabe 1983 Richard Woodman
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1986 Verlag Ullstein GmbH, Frankfurt/M – Berlin – Wien
Copyright © der Neuausgabe 2025 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von Shutterstock/Sabelnik, 4Zevar, paseven und AdobeStock/AiArtVision
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ma)
ISBN 978-3-69076-067-6
***
dotbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, einem Unternehmen der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt: www.egmont.com/support-children-and-young-people. Danke, dass Sie mit dem Kauf dieses eBooks dazu beitragen!
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Bei diesem Roman handelt es sich um ein rein fiktives Werk, das vor dem Hintergrund einer bestimmten Zeit spielt oder geschrieben wurde – und als solches Dokument seiner Zeit von uns ohne nachträgliche Eingriffe neu veröffentlicht wird. In diesem eBook begegnen Sie daher möglicherweise Begrifflichkeiten, Weltanschauungen und Verhaltensweisen, die wir heute als unzeitgemäß oder diskriminierend verstehen. Diese Fiktion spiegelt nicht automatisch die Überzeugungen des Verlags wider oder die heutige Überzeugung der Autorinnen und Autoren, da sich diese seit der Erstveröffentlichung verändert haben können. Es ist außerdem möglich, dass dieses eBook Themenschilderungen enthält, die als belastend oder triggernd empfunden werden können. Bei genaueren Fragen zum Inhalt wenden Sie sich bitte an [email protected].
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Richard Woodman
Kurier zum Kap der Stürme - Auf Vorposten im Roten Meer
Historischer Roman | Ein Nathaniel Drinkwater Roman 3
Aus dem Englischen von Uwe D. Minge
dotbooks.
Widmung
Motto
PROLOG Paris
ERSTES KAPITEL: Geleitschutz
ZWEITES KAPITEL: Nelson
DRITTES KAPITEL: Die Brigg
VIERTES KAPITEL: Dunkle Wolken
FÜNFTES KAPITEL: Die Mistress Shore
SECHSTES KAPITEL: Das Kap der Stürme
SIEBTES KAPITEL: Der Fliegende Holländer
ACHTES KAPITEL: Der Ostindienfahrer
NEUNTES KAPITEL: Auf der Reede von Mocha
ZEHNTES KAPITEL: Dem Adler werden die Flügel gestutzt
ELFTES KAPITEL: Al Qusayr
ZWÖLFTES KAPITEL: Fisch stinkt
DREIZEHNTES KAPITEL: Rotes Meer
VIERZEHNTES KAPITEL: Allahs Wille
FÜNFZEHNTES KAPITEL: Santhonax
SECHZEHNTES KAPITEL: Der Sold der Admirale
SIEBZEHNTES KAPITEL: Eine Verkettung unglücklicher Umstände
ACHTZEHNTES KAPITEL: Morris
NEUNZEHNTES KAPITEL: Die Hand einer Frau
ZWANZIGSTES KAPITEL: Kriegsglück
EINUNDZWANZIGSTES KAPITEL: Wie ein Wunder
ZWEIUNDZWANZIGSTES KAPITEL: Das Kap der Guten Hoffnung
Nachwort
Lesetipps
Widmung
Für Christine
Motto
»Ich glaube fest, daß sie den üblen Plan, Alexandria zu erobern und Truppen nach Indien zu schaffen, nicht aufgegeben haben – ein Plan, der mit Tippu Sahib abgestimmt wurde und bei weitem nicht so schwer in die Tat umzusetzen ist, wie es zunächst erscheinen mag.«
Nelson 1798
PROLOGParis
Februar 1798
Regen schlug prasselnd gegen die Fensterscheiben. Der Kapitän zur See betrachtete die Trikolore, die drüben im Hof steif auswehte; sie hob sich bunt gegen die grauen Wolken ab, die über Paris dahinjagt. Vor seinem inneren Auge sah er die Auswirkungen des Sturms auf die grünen Wasser des Kanals und auf die düstere, regenverhangene englische Küste.
Hinter ihm standen zwei Sekretäre über die Pulte gebeugt, gelegentlich war das Rascheln von Papier zu vernehmen. Spannung lag in der Luft und wurde durch die geöffnete Tür noch erhöht. Dann wurden rasche Fußtritte im Korridor hörbar, die Schreiber beugten sich mit noch mehr Eifer über ihre Arbeit. Der Marineoffizier drehte sich halb um, wandte aber den Blick nicht von dem grauen Himmel.
Die Schritte wurden lauter, und schließlich schoß ein kleiner, dünner, bleicher junger Mann in den Raum. Sein langes Haar fiel über den hohen Stehkragen seiner zu großen Generalsuniform. Er wurde von einem Husaren begleitet, dessen reichbestickter Umhang nachlässig von der linken Schulter hing.
»Na, Bourienne!« begann der General plötzlich. Seine Stimme strahlte dieselbe Energie aus, die seine unruhige Wanderung durch den Raum ausdrückte. »Sind die Depeschen für die Generale Dommartin und Casarelli fertig? Gut, gut!« Er nahm die Papiere und überflog sie, dann nickte er befriedigt. »Es sieht gut aus, Androche«, wandte er sich an den Husaren. »Alles läuft gut. Damit ist das Englandprojekt gestorben.« Er drehte sich zum Fenster. »Wen haben wir da, Bourienne?«
»Das ist Fregattenkapitän Santhonax, General Bonaparte.«
»Aha!«
Bei der Erwähnung seines Namens drehte sich der Marineoffizier um. Er war bedeutend größer als der General, aber seine hübschen Gesichtszüge wurden durch eine Narbe verunstaltet, die von seinem Mundwinkel über die linke Wange nach oben lief. Er verbeugte sich leicht und hielt dem taxierenden Blick aus Bonapartes grauen Augen stand.
»So, so, Kapitän, Sie haben es also fertiggebracht, aus England zu entkommen.«
»Jawohl, Bürger General, ich bin seit drei Wochen in Paris.«
»Und haben schon geheiratet, nicht wahr?«
Santhonax nickte, er war sich bewußt, daß der Korse alles über ihn wußte. Der General setzte seinen Marsch fort, den Kopf gedankenvoll gesenkt.
»Ich komme gerade von einer Inspektion der Kanalhäfen zurück, wo ich mich über die Vorbereitungen zur Invasion informiert habe ...« Er blieb abrupt vor Santhonax stehen. »Was sind Ihre Ansichten über die Durchführbarkeit?«
»Ohne die Seeherrschaft im Kanal ist es unmöglich. Wenn wir nicht zumindest die örtliche Überlegenheit haben, ist jeder Versuch unweigerlich zum Scheitern verurteilt, Bürger General. Die Bedingungen im Kanal können sich schnell ändern, wir müssen ihn aber mindestens eine Woche lang für den Nachschub offenhalten. Die britische Flotte muß, wenn wir sie schon nicht überwältigen können, durch Tricks und Bedrohungen fortgelockt werden.«
»Genau! In diesem Sinne habe ich das Direktorium informiert. Haben wir die Mittel, diese örtliche Überlegenheit zu erreichen?«
»Nein, Bürger General.« Santhonax senkte die Augen vor dem durchdringenden Blick Bonapartes. Während dieser junge Mann die österreichischen Armeen aus Italien verjagt hatte, hatte er selbst vergeblich an dieser Aufgabe gearbeitet, indem er versucht hatte, die holländische Flotte nach Brest zu bringen. Dieser Versuch war vor vier Monaten bei Kampenduin von den Briten vereitelt worden.i
»Wir stimmen in allen Punkten überein, Kapitän«, rief Bonaparte aus. »Das ist ganz ausgezeichnet. Die englische Armee muß an anderer Stelle beschäftigt werden, nicht wahr, Androche?« Er wandte sich an den Husaren. »Das ist Androche Junot, Kapitän, ein alter Freund der Bonapartes.« Die beiden Männer verbeugten sich. »Wie beurteilen Sie die Engländer, Kapitän?«
Santhonax seufzte. »Sie sind eingeschworene Feinde der Revolution, General Bonaparte, und Gegner Frankreichs. Sie verfügen über außergewöhnliche Zähigkeit und dürfen keinesfalls unterschätzt werden.«
Bonaparte schnaubte unwillig. »Trotzdem sind Sie ihnen entkommen, oder? Wie paßt das in Ihre Beurteilung?«
»Nach meiner Ergreifung wurde ich ins Maidstone-Gefängnis gebracht. Einige Wochen später sollte ich nach Portsmouth auf die Gefangenenhulk gebracht werden. Da meine Uniform in der Schlacht bei Kampenduin sehr gelitten hatte, gelang es mir, einem meiner Wärter einen Zivilmantel abzuschwatzen. Während eines Pferdewechsels in Guildford konnte ich dann ausbrechen.«
»Und danach?«
Santhonax zuckte mit den Achseln. »Ich verschwand in der nächsten Gasse und setzte mich in der erstbesten Kneipe in eine Ecke. Ich spreche ein akzentfreies Englisch, Bürger General.«
»Und das?« Bonaparte zeigte auf die Narbe.
»Die Begleitmannschaft suchte nach einem Mann mit einem Gesichtsverband. Also nahm ich ihn ab und drückte mich in eine dunkle Ecke. Ich wurde nicht entdeckt.« Er machte eine Pause, dann setzte er hinzu: »Ich kenne einige Tricks.«
»Ja, ja, Kapitän, mir sind Ihre Verdienste um die Republik bekannt. Sie sind für Ihre Kühnheit und Unerschrockenheit berühmt. Admiral Briux hat eine hohe Meinung von Ihnen, auch wenn Sie zur Zeit beim Direktorium nicht gerade hoch im Kurs stehen.«
Santhonax errötete bei der Erinnerung an seinen Fehlschlag und schwieg.
»Admiral Briux hat Sie für dieses spezielle Kommando vorgeschlagen.« Der General blieb vor Santhonax stehen und blickte ihm direkt ins Gesicht: »Sie sind auf eine Fregatte beordert worden, nicht wahr, Kapitän?«
»Auf die Antigone, Bürger General. Sie wird zur Zeit in Rochefort für eine weite Reise ausgerüstet. Die Korvetten La Torride und Annette sind mir ebenfalls unterstellt. Ich werde den Verband als Kommodore führen, wenn ich meine endgültigen Befehle von Ihnen erhalten habe.«
»Gut, sehr gut.« Bonaparte streckte eine Hand nach dem Sekretär aus, und dieser übergab ihm ein versiegeltes Päckchen. »Die Briten unterhalten eine kleine Flottille im Roten Meer. Das sollte Sie aber nicht beunruhigen. Wie Sie wissen, wird die Armee unter meinem Kommando Ägypten besetzen. Wenn meine Veteranen die Küste des Roten Meeres erreichen, erwarte ich von Ihnen, daß Sie ausreichenden Schiffsraum bereithalten, örtliche Küstenfahrer natürlich, und einen Einschiffungshafen für eine Division hergerichtet haben. Sie werden diesen Verband nach Indien begleiten, Kapitän Santhonax. Kennen Sie sich dort aus?«
»Ich habe unter Suffren gedient, Bürger General. Also werden wir die Briten in Indien das Fürchten lehren!« Santhonax’ Augen leuchteten in neu erwachter Begeisterung.
»Sie werden die Vorhut anführen. Paris brennt mir unter den Sohlen, Kapitän. In Indien wartet das Imperium, das Alexander uns hinterlassen hat. Dort erringen wir uns Unsterblichkeit!«
Das war durchaus nicht die Sprache eines blinden Fanatikers; Bonapartes Begeisterung wirkte echt und ansteckend. Nach der Niederlage von Kampenduin und seiner Gefangennahme hatte sich Santhonax ausgebrannt gefühlt. Aber nun, mit den wenigen Worten des dynamischen kleinen Korsen, versank die Vergangenheit. Neue Visionen von Ruhm und Ehre eröffneten sich ihm, aufgezeigt von einem Mann, dem nichts unmöglich schien.
Abrupt hielt Bonaparte ihm das versiegelte Päckchen entgegen. Junot beugte sich vor und flüsterte ihm etwas ins Ohr.
»O ja, Androche erinnert mich gerade daran, daß Ihre Frau eine umschwärmte Schönheit ist. Gut, gut. Heirat bindet einen Mann an seine Heimat, und Schönheit stachelt unsere Ambitionen an, nicht wahr? Sie sollten Ihre Frau heute abend mit in die rue Victoire bringen, Kapitän, meine Frau gibt dort eine Soirée. Sie brauchen erst morgen früh nach Rochefort aufzubrechen. Das wäre alles, Kapitän.«
Als Santhonax den Raum verließ, diktierte General Bonaparte bereits seinem Sekretär.
ERSTES KAPITEL:Geleitschutz
Februar–Juni 1798
Flache Nebelschwaden hingen im Tal des Meon, die fahle Sonne des düsteren Wintertages war noch nicht bis dorthin gedrungen. Unter den tropfenden Ästen der Apfelbäume wanderte Leutnant Nathaniel Drinkwater auf und ab, fröstelnd in der Morgenkühle. Er hatte schlecht geschlafen, ein böser Traum hatte ihn gequält, ausgelöst von den schrecklichen Erlebnissen vor seiner Heimkehr. Die nächtliche Stille des Hauses war ihm nach zwei Monaten Aufenthalt immer noch fremd, er vermißte das vertraute Knarren des Kutters Kestrel. So war er leise aufgestanden, ohne seine Frau zu wecken. Nun wanderte er in dem kleinen Garten herum, und die Kälte ließ die Wunde in seinem rechten Arm schmerzen. Das erinnerte ihn wieder an seinen Traum.
Es war Edouard Santhonax gewesen, der ihm diese Wunde beigebracht und von dem er geträumt hatte. Nachdem er sich gesammelt hatte, machte er sich klar, daß Santhonax nun sicher verwahrt war, ein Kriegsgefangener. Was seine bezaubernde Geliebte Hortense Montholon anging, so war sie in Frankreich, wo sie um Brot betteln mußte – der Teufel sollte sie holen. Er fühlte, wie die Sonne durch den Nebel drang, seinen Rücken wärmte und die Schatten der Nacht vertrieb. Die Stürme der letzten Tage waren vorüber und hatten kühlem, aber sonnigem Wetter Platz gemacht. Ein Klicken der Tür rief Nat in Erinnerung, daß er sich in glücklicheren Umständen befand.
Dunkles Haar fiel über Elizabeths Gesicht, und ihre braunen Augen blickten besorgt.
»Geht es dir nicht gut, mein Lieber?« fragte sie zärtlich und legte ihre Hand auf seinen Arm. »Hast du nicht das Klopfen an der Vordertür gehört?«
»Mir geht’s gut, Bess. Wer war’s?«
»Mr. Jackson von der Post hat den jungen Will von Petersfield mit Briefen für dich geschickt. Sie liegen dort auf dem Tisch.«
»Ich bin ihm für seine Freundlichkeit sehr verpflichtet.« Er wollte ins Haus, aber sie hielt ihn zurück.
»Nat, was bedrückt dich?« Dann fuhr sie etwas leiser fort: »Habe ich dich etwa enttäuscht?«
Er umarmte und küßte sie, dann gingen sie hinein, um die Briefe zu lesen. Den mit dem Siegel der Admiralität öffnete er zuerst:
Sir, mit dem Erhalt dieses Schreibens werden Sie aufgefordert und angewiesen, sich unverzüglich ...
Also wurde er als Erster Offizier an Bord der Brigg Hellebore versetzt. Kommandant war Commander Griffiths. Ohne ein Wort gab er den Brief an Elizabeth weiter und nahm den zweiten Brief auf. Er erkannte die zittrige, aber immer noch schwungvolle Schrift.
Mein lieber Nathaniel,
ohne Zweifel werden Sie den Brief Ihrer Lordschaften schon erhalten haben, der Sie an Bord meines Schiffes beordert. Es ist ein neues Schiff und liegt in Deptford. Überstürzen Sie nichts. Ich bin schon an Bord und werde für Sie Dienst tun. Wenn Sie Ende des Monats hier eintrudeln, ist das früh genug. Unsere Besatzung ist fast vollzählig, weil es mir gelungen ist, Kestrels Mannschaft zum großen Teil zu übernehmen. Wir werden im Geleitdienst eingesetzt. Übermitteln Sie bitte meine besten Grüße an Ihre liebe Frau.
Ich verbleibe usw.Madoc Griffiths
P.S. Gestern erreichte mich die Nachricht, daß Monsieur Santhonax ausgebrochen ist und sich bereits seit einem Monat der Freiheit erfreut.
Drinkwater stand wie vom Donner gerührt. Der Alptraum der Nacht fiel ihm wieder ein. Elizabeth beobachtete ihn, die Augen voller Tränen.
»So bald schon, mein Liebling?«
Er lächelte wehmütig.
»Madoc hat meinen Urlaub noch ein wenig verlängert.« Er reichte ihr den zweiten Brief. »Er macht Dienst für mich, denn er hat kein Heim, wohin er gehen könnte.« Er legte einen Arm um ihre Hüfte, und sie küßten sich wieder.
»Komm, wir können die Einrichtung des Hauses in Petersfield noch vervollständigen und deine Köchin wird Ende der Woche eintreffen. Du wirst eine grande dame sein.«
»Nimmst du Tregembo mit?«
Er lachte. »Ich bezweifle, daß es in meiner Macht liegt, ihn von mir fernzuhalten.«
Sie verstummten. Elizabeth dachte an die langen vor ihr liegenden Monate der Einsamkeit. Drinkwater aber war schon in Gedanken auf der neuen Brigg. »Hellebore«, sagte er, »ist das nicht eine Blume oder so was Ähnliches? Elizabeth – warum, zum Teufel, lachst du?«
Leutnant Richard White hatte die Morgenwache an Bord der Victory. Sie führte die Flagge des Earl St. Vincent und stand mit kleinen Segeln auf nordwestlichem Kurs. Der Rest der Blockadeflotte folgte in Linie. Im Osten waren die Mole und der Leuchtturm von Cadiz schwach im Sonnenlicht zu sehen, aber White hatte sein Fernglas auf einen Kutter gerichtet, an dessen Mast ein Signal gesetzt war. Die Flaggen besagten, daß im Norden Segel in Sicht seien.
Ein kleiner Fähnrich kam zu ihm gelaufen. »Das wird der Konvoi sein, Sir.«
»Danke, Mr. Lee. Haben Sie bitte die Freundlichkeit, Ihre Lordschaft und den Kommandanten zu informieren.«
Mr. Lee war zehn Jahre alt und hatte sich White an die Rockschöße gehängt, weil der Leutnant der einzige Offizier an Bord war, der noch kleiner war als er selbst. Unwillkürlich musterte White das Deck, um sicher zu sein, daß jede Leine sauber aufgeschossen an ihrem Platz war, sich jeder Mann auf seiner Station befand und jedes Segel absolut richtig stand, bevor die wachsamen Augen St. Vincents das alles überprüften.
»Guten Morgen, Mylord«, sagte White und wechselte zur Leeseite, als der Admiral wegen des besseren Überblicks auf das Poopdeck kletterte.
»Guten Morgen, Sir«, antwortete der Admiral mit der ihm eigenen vollendeten Höflichkeit, die seine gelegentlichen strengen Verweise um so eindringlicher machte.
Kapitän Grey und Sir Robert Calder, der Kommodore, kamen nun ebenfalls an Deck, sie wurden vom Ersten Offizier und weiteren Leutnants begleitet. Jede Begegnung mit einem anderen Schiff versprach Abwechslung durch Briefe, Neuigkeiten und Küstenklatsch aus der Heimat.
Der Konvoi war nun klar zu erkennen. Er bestand aus sechs Transportern unter dem Schutz einer Brigg. Vom Mast der Brigg wehte die bunte Reihe eines Flaggensignals aus. Mr. Lee quiekte die Zahlen des Signals in Mr. Whites Ohren, dann verstummte er, weil er das Signalbuch wälzte.
»Briggslup Hellebore, Sir, neu in Dienst gestellt unter Commander Griffiths.«
»Danke, Mr. Lee. Brigg Hellebore, Kapitän Griffiths, Mylord, mit Geleit.«
»Danke, Mr. White. Haben Sie die Freundlichkeit, ihn zu bitten, ein Boot mit einem Offizier zu schicken.«
»Aye, aye, Mylord.« White wandte sich an Lee, der aber schon eifrig das Signal auf seine Tafel kritzelte und die Flaggennummern an den Signalgast weitergab.
White überlegte, wo er den Namen Griffiths schon gehört hatte. Es dauerte nicht lange, bis er die Antwort bekam. Denn als das Boot der Brigg an den Rüsten der Victory festmachte, erkannte er den Offizier, der das Fallreep heraufkam.
»Nathaniel, mein Lieber, also bist du immer noch bei Griffiths. Ich freue mich riesig, dich zu sehen. Und du hast dich herausgemacht.« Er deutete auf den goldenen Ärmelstreifen des Leutnants, als der ihm im Überschwang des Willkommens die Hand schüttelte. »Verdammt, bin ich froh! Aber komm nach achtern, St. Vincent wird unser Geschwätz hier nicht schätzen.«
Drinkwater folgte seinem alten Freund. Es war viele Jahre her, daß er über das Deck eines Flaggschiffs gegangen war. Die geordnete Präzision an Bord der Victory ließ die kleinere, ausgepowerte und vom Wetter zerschlagene Venerable, sein letztes Flaggschiff, von Admiral Duncan armselig erscheinen.
Drinkwater machte eine kleine und, wie er hoffte, elegante Verbeugung, als er von White dem Earl vorgestellt wurde. Er fühlte sich von einem Paar scharfer alter Augen durchleuchtet, die in einem Gesicht brannten, das jeden Augenblick von Zustimmung zu Ablehnung übergehen konnte.
Lord St. Vincent studierte den Mann, der vor ihm stand. Er war vierunddreißig, schlank und von mittlerer Größe. Sein Gesicht war wettergegerbt, und um Mund und Augen zeigten sich die ersten Falten; über die linke Wange zog sich die weiße Linie einer alten Narbe. Über den Augenbrauen waren blaue Pulverspuren eingebrannt, sie wirkten wie zufällige Tintenspritzer. Das Haar war immer noch von kräftigem Braun und wurde in einem langen Zopf gebändigt. Vielleicht kein Offizier für ein Flaggschiff, entschied der Admiral, aber sicher ein guter, wenn man dem festen, energischen Mund und den entschlossenen Augen trauen konnte. Der Mund war dem Lord Nelsons nicht unähnlich, dachte er in schmerzlicher Erinnerung. Und dieser Nelson hatte sich als eine verdammte Plage erwiesen, seit er seine eigene Flagge hatte setzen dürfen. »Sind Sie verheiratet, Sir?« fragte St. Vincent scharf.
»Äh, jawohl, Mylord«, erwiderte Drinkwater verwundert.
»Schade, Sir, schade. Ein verheirateter Offizier geht dem Dienst zeitweise verloren. Kommen Sie, lassen Sie uns in meine Kajüte gehen und die Befehle für Ihren Konvoi besprechen. Sir Robert, würden Sie uns eine Minute Ihrer Zeit opfern ...«
Nachdem die Flottengeschäfte erledigt waren, konnte Drinkwater Neuigkeiten mit White austauschen. Währenddessen setzte Victory ihre Großmarssegel back und rief Hellebores Boot längsseits.
»Wie geht es Elizabeth, mein Freund?«
»Es geht ihr prächtig, und wenn sie gewußt hätte, daß wir uns treffen, hätte sie dich sicher grüßen lassen.«
»Wann wurde deine Beförderung bekanntgegeben, Nat?«
»Nach Kampenduin.«
»Aha, du warst also dabei? Das gibt dir den Vorteil, daß du dich mit der Teilnahme an einer Seeschlacht brüsten kannst.« White grinste. »Sind noch andere alte Kumpane außer Griffiths an Bord eurer Brigg?«
»Aye, Tregembo, an den du dich sicher erinnern wirst, und der alte Appleby.«
»Was, der alte Windbeutel Appleby! Ich will verdammt sein! Übrigens scheint es ein schnelles, handiges Schiffchen zu sein, Nat.« Er deutete mit dem Kopf auf die Brigg.
»Es ist gut genug, aber du hast mir doch einiges voraus«, erwiderte Drinkwater, mit einer ausholenden Handbewegung die Victory und ihr zahlreiches Personal umfassend. »Geleitschutz ist nicht die Gelegenheit, bei der man Lorbeeren ernten kann.«
»Nein, Nat, aber ich wette, daß ihr ins Mittelmeer beordert seid.« Als Drinkwater nickte, fuhr White fort: »Dort steht Nelson vor Toulon, und wo Nelson ist, da warten Ruhm und Ehre.« Whites Augen glänzten. »Wußtest du, daß St. Vincent ihn wieder ins Mittelmeer geschickt hat, obwohl wir es erst letztes Jahr geräumt haben? Vorigen Monat hat er ihn sogar mit Troubridges Küstengeschwader verstärkt. Er hat das ganze Geschwader von der Hafeneinfahrt abgezogen, noch bevor die Verstärkungen unter Curtis eingetroffen waren. Die verfluchten Donsii haben nicht mal gemerkt, daß das Küstengeschwader gewechselt hat. Wie findest du das?« Ohne eine Antwort abzuwarten, tätschelte er gönnerhaft Drinkwaters Arm. »Das Mittelmeer ist der richtige Platz für dich, Nat, Nelson wird eine Schlacht erzwingen.«
»Ich geleite nur einen Konvoi mit einer Brigg, Richard.«
White lachte wieder und streckte ihm die Hand entgegen. »Viel Glück, mein Freund, denn davon hängt letztlich doch alles ab. Das weißt du so gut wie ich.«
Sie schüttelten sich die Hände, Drinkwater stieg in das Boot, das von Mr. Quilhampton befehligt wurde. Der war zwar um zwei Jahre älter als Mr. Lee, hatte aber nur einen Bruchteil von dessen Erfahrung. Überwältigt von dem mächtigen Rumpf der Victory, verpatzte er das Ablegemanöver.
»Nur ruhig, Mr. Q. Lassen Sie vorne absetzen, legen Sie jetzt das Ruder hart über – und nun Riemen bei! So geht es ganz leicht, sehen Sie«, sagte Drinkwater geduldig; er blickte zurück auf die Victory, deren Großmarssegel sich bereits wieder füllte. Vor ihm wiegte sich die kleine, zerbrechlich wirkende Hellebore im Schwell der langen flachen Atlantikdünung. Die See glänzte blaugolden im Sonnenlicht, leichte westliche Winde kräuselten die Oberfläche. Dankbar spürte Nat die Sonnenwärme in den Muskeln seines verwundeten rechten Arms.
»Hecuba und Molly werden uns ins Mittelmeer begleiten, Sir, zu Nelson nach Toulon. Wir sollen so schnell wie möglich versegeln, Sir.« Drinkwater blickte Griffiths an, der sich schwer gegen die Reling legte und auf die stattliche Linie der britischen Kriegsschiffe im Osten starrte.
»Prydferth, bach, wunderbar, mein Junge«, murmelte der Waliser. Drinkwater blickte zurück auf ihre Konvoischiffe, deren Marssegel unordentlich backstanden, während sie darauf warteten, ihr Schicksal zu erfahren. Boote näherten sich der Brigg.
»Ich habe die Kapitäne rufen lassen«, erklärte Griffiths.
»Wie geht es heute Ihrem Bein, Sir?« fragte Drinkwater.
Der weißhaarige Alte blickte voll Abscheu auf das krumme, steife Bein herab, das er auf die Lafette einer Kanone gelegt hatte. »Ach, der Teufel soll es holen, es ist eine verdammte Plage. Und jetzt sagt mir Appleby, daß es die Gicht sei. Aber bevor Sie nun die Sprache auf meinen Alkoholkonsum bringen«, fuhr er fort, »möchte ich betonen, daß ich ohne meine Flasche nicht zu ertragen wäre, klar?«
Sie grinsten sich an. Ihre Vertrautheit stand in starkem Kontrast zur Förmlichkeit an Deck der Victory. Sie fuhren jetzt seit sechs Jahren zusammen, und ihre Beziehung beruhte auf fester Freundschaft und beruflicher Achtung. Griffiths war ein gebrechlicher Mann, der zeitweise von Malariaanfällen heimgesucht wurde. Er hatte das Kommando als Belohnung für gute Dienste erhalten, die er dem britischen Geheimdienst erwiesen hatte. Ohne Hellebore wäre er einsam an Land versauert, ein verbitterter Junggeselle in einer namenlosen Pension. Er hatte Drinkwater als Ersten Offizier angefordert, teils aus Dankbarkeit und teils aus Freundschaft. Obwohl er wußte, daß er damit seine eigene Position absicherte, weil er alles beruhigt an Drinkwater delegieren konnte, beschwichtigte er sein Gewissen damit, daß er dem jungen Mann auch einen Gefallen erwies.
»Sie vergessen, Mr. Drinkwater, daß Sie Kestrel nicht in der Schlacht von Kampenduin kommandiert hätten, wenn ich mir nicht das Bein gebrochen hätte.« Drinkwater mußte zustimmen, aber weitere Erörterungen unterblieben, da die Kapitäne der Versorgungsschiffe angekommen waren.
An Steuerbord glühten die braunen Ausläufer des Atlasgebirges im Abendrot. An Backbord liefen die Hügel Südspaniens im Vorgebirge von Tarifa aus. Vor dem Bugspriet der Brigg lag das nachtdunkle Mittelmeer. Das waagrecht einfallende Abendlicht hob alle Einzelheiten ihres Riggs scharf hervor: die scharfen Linien des stehenden und laufenden Gutes, die Blöcke, das rötliche Segeltuch und den unnatürlichen Glanz ihrer Bemalung. Achteraus folgten ihr zu beiden Seiten die dunklen Silhouetten von Hecuba und Molly. Drinkwater unterbrach seine Wanderung, als der winzige Fähnrich ihm den Weg verstellte.
»Ja, Mr. Q?« Die Offiziere der HM Brigg Hellebore hatten es längst aufgegeben, ihre Zungen an dem Namen Quilhampton zu verbiegen. Der Name war bei weitem zu anspruchsvoll für diesen Winzling. Wieder einmal rief der Anblick des Jungen in Drinkwater die Erinnerung an Elizabeth wach, denn er hatte ihm den Platz an Bord auf Drängen seiner Frau verschafft. Mrs. Quilhampton war eine junge adrette Witwe, die seiner Frau gelegentlich in der Schule half. Drinkwater war amüsiert und geschmeichelt gewesen, daß sie ihm genug Einfluß zutraute, einen Günstling unterzubringen, hatte seine Einwilligung unter einem Tarnmantel von Befürchtungen gegeben und war dafür von der Mutter mit einer Umarmung belohnt worden, die an die Grenze des Schicklichen ging. Nun ärgerte ihn das beflissene Gesicht des Jungen, das in ihm immer wieder Erinnerungen weckte.
»Ja«, sagte er kurz angebunden, »was wollen Sie?«
»Verzeihung, Sir, aber Mr. Appleby läßt höflichst fragen, wohin wir bestimmt sind.«
»Wissen Sie das nicht, Mr. Q?« fragte Drinkwater, schon wieder weich werdend.
»Nee ... nein, Sir.«
»Also, was sehen Sie dort an Steuerbord?«
»An Steuerbord, nun, das ist Land, Sir.«
»Und an Backbord?«
»Das ist auch Land, Sir.«
»Aye, Mr. Q, an Steuerbord liegt Afrika und an Backbord Europa. Und was liegt Ihrer Meinung nach dazwischen? Was hat Ihnen Mrs. Drinkwater zu diesem Thema beigebracht?«
»Könnte es das Mi ... das Mittelmeer sein, Sir?«
»Das ist es tatsächlich, Mr. Q«, erwiderte Drinkwater mit einem Lächeln. »Und wissen Sie auch, wer im Mittelmeer das Kommando hat?«
»Natürlich, Sir. Sir Horatio Nelson, Sir«, antwortete der Junge eifrig.
»Sehr gut, Mr. Q. Sie werden jetzt auf kürzestem Weg Mr. Appleby aufsuchen, ihm diese Fakten mitteilen und ihm sagen, daß wir vom Earl St. Vincent Befehl erhalten haben, diese zwei Halunken da hinten bei Konteradmiral Nelson vor Toulon abzuliefern.«
»Aye, aye, Sir.«
»Und, Mr. Q ...«
»Sir?«
»Informieren Sie bitte Mr. Appleby, daß er einen Becher Roten für mich bereithalten soll, wenn ich bei acht Glasen herunterkomme.«
Drinkwater schaute dem aufgeregten Jungen nach, der hinunterflitzte. Er selbst war genauso neugierig auf Nelson wie der Fähnrich, den Mann, den nach seinem verwegenen Manöver in der Schlacht beim Kap St. Vincent jeder Schuljunge in England kannte. Es gab viele Offiziere, die erwarteten, daß Nelson über kurz oder lang wegen Nichtbeachtung eines Befehls erschossen werden würde. Andere warfen ihm vor, daß er kein Seemann sei. Nun hatte er zwar tatsächlich nicht die Fähigkeiten eines Pellew oder Keats, aber er war ein dynamischer Mann, dessen Fehler mit dem Mantel der Nächstenliebe zugedeckt wurden. Doch wie dem auch sei, Drinkwater kam zu dem Schluß, daß – ganz gleich, was White sagte – Hellebore als Brigg zu kaum mehr als ihrer jetzigen Aufgabe taugte.
Er setzte seinen Marsch in der zunehmenden Dunkelheit fort.
ZWEITES KAPITEL:Nelson
Juli 1798
»Sie hat das Signal nicht bestätigt, Sir. Soll ich einen Schuß nach Backbord abgeben lassen?«
Griffiths starrte nach achtern auf die Hecuba, deren vorderer Notmast beredt von dem schlechten Wetter draußen zeugte. Sie hinkte in die Bucht.
»Nein, Mr. Drinkwater. Vergessen Sie nicht, daß es sich um einen Frachter handelt, der nur ein Viertel unserer Besatzung hat. Und genau jetzt, bach, wird dort jeder alle Hände voll zu tun haben.«
Drinkwater ärgerte die milde Zurechtweisung, aber er schwieg. Diese Woche des Leidens war ohnehin bald vorbei. Südlich von Menorca, wo sie sich am Wind in Richtung Toulon vorangekämpft hatten, waren sie vom Mistral aus Norden mit ungewöhnlicher Stärke überfallen worden. Hecubas Fockmast war über Bord gegangen, deshalb waren sie abgefallen und hatten bei Korsika Schutz gesucht. Drinkwater betrachtete die düstere Küstenlinie der Insel. Die scharfen Umrisse der Berge hoben sich dunkel gegen die Morgendämmerung ab. An Backbord bot Kap Morsetta schon etwas Schutz. Langsam schlichen sie ostwärts in die Crovani-Bucht hinein.
»An Deck! Masten recht voraus, Sir!«
Der Ruf kam vom Masttopp, beide Männer hoben sofort ihre Ferngläser. Im Schatten der Küste lag ein dreimastiges Fahrzeug, an seinen Spieren war kein Segel angeschlagen, es ritt den Sturm vor Anker ab.
»Eine Polaccra«, brummte Griffiths. »Wir werden sie untersuchen, wenn diese lahme Ente erst vor Anker liegt.« Er zeigte über die Schulter.
Der Konvoi lief weiter in die Bucht ein. Bald konnte man einzelne Pinien an Land unterscheiden, die gerade und hoch gewachsen waren und hervorragende Masten abgeben würden.
»Bringen Sie das Schiff an den Wind, Mr. Lestock«, befahl Griffiths dem Navigator, einem kleinen, unruhigen Mann, der ständig einen aufgebrachten Eindruck machte.
»Sie können Ihre Kanone abfeuern, wenn unser Buganker fällt, Mr. Drinkwater.«
»Aye, aye, Sir.«
Lestock schrie in sein Sprachrohr, die Männer rannten an die Brassen, dankbar, daß sie endlich in Lee des Landes waren, wo das Deck von Hellebore einigermaßen waagrecht blieb. Das Großmarssegel schlug back und übertrug seinen Druck über den Mast und das stehende Gut auf den Rumpf. Hellebore kam zum Stehen und nahm langsam Fahrt über den Achtersteven auf.
»Laß fallen!«
Die Axt des Zimmermanns blitzte einmal auf, dann hob sich der Bug der Brigg kurz an, als er vom Gewicht des Ankers befreit war. Sein Klatschen ging im Knall des Sechspfünders unter. Während Lestock und seine Maaten die Segel aufgeien ließen, suchte Drinkwater mit seinem Glas die Bucht ab. Molly machte schon Fahrt achteraus, und er sah das Aufspritzen unter ihrem schwerfälligen Bug; ihr Anker war also gefallen. Aber Hecuba lief weiter auf die Küste zu, während ihre Besatzung sich bemühte, die Fock aufzugeien. Weil er wegen der Havarie nicht mit den Marssegeln manövrieren konnte, hatte sich ihr Kapitän wohl entschlossen, das große Segel so lange wie möglich stehen zu lassen, und jetzt war etwas schiefgelaufen.
»Warum läßt er das verdammte Ding nicht einfach back kommen«, murmelte Drinkwater vor sich hin. Neben ihm brüllte Lestock: »Aufentern und wegstauen!«
Die Matrosen sprangen eifrig in die Takelage, um die Segel der Brigg ordentlich zu bergen, damit sie schnell von ihren Stationen abtreten konnten.
Endlich begann Hecuba in den Wind zu drehen; ihr Großsegel legte sich so in Falten, als ob eine Wäscherin ihre Röcke raffte. Es drückte gegen das Rigg, und vor ihrem Bug klatschte der Anker ins Wasser.
»Der Konvoi liegt vor Anker, Sir«, meldete Drinkwater.
Der Commander nickte. »Es scheint, als habe Ihr Schuß noch weitere Folgen gehabt.« Griffiths deutete auf die Polaccra, die näher am Ufer ankerte, und Drinkwater betrachtete die ihm unbekannte Flagge, die jetzt an ihrem Masttopp auswehte.
»Die Flagge Ragusas, Mr. Drinkwater. Ich möchte schwören, daß Sie sie nicht von der großtürkischen unterscheiden können.«
Drinkwater spürte, wie die Spannung von ihm abfiel. »Sie haben recht, Sir.«
Lestock salutierte vor Griffiths. »Anker hält, Sir, und die Segel sind beschlagen.«
»Sehr gut, Mr. Lestock. Lassen Sie bitte die Männer zum Frühstück pfeifen. Danach soll sich eine Gruppe unter Mr. Rogers’ Kommando bereit halten, um der Hecuba beim Aufriggen zu helfen. Schicken Sie Ihre beiden Maaten mit hinüber. Ach ja, Mr. Dalziell kann mitgehen. Ich möchte zu gern wissen, ob dieser junge Gentleman uns doch noch von Nutzen sein kann.«
»Aye, aye, Sir. Was ist mit Mr. Quilhampton, Sir? Er ist ebenfalls noch unerfahren.«
Griffiths blickte Lestock mit wachsender Abneigung an.
»Mr. Quilhampton soll mit dem Zimmermann eine Arbeitsgruppe an Land führen. Ich denke, daß uns einige dieser Pinien da drüben sehr willkommen sein werden. Oder sind Sie da anderer Meinung, Mr. Drinkwater?«
»Eine gute Idee, Sir. Was machen wir mit dem Schiff aus Ragusa?«
»Mr. Qs erste Aufgabe wird es sein, den Schiffer um einen Besuch bei mir zu bitten. Und nun, Mr. Drinkwater, Sie waren die ganze Nacht auf den Beinen, wollen Sie mit mir frühstücken, bevor Sie sich aufs Ohr legen?«
Eine halbe Stunde später dehnte sich Drinkwater wohlig mit vollem Bauch; er war noch zu faul, um sich auf den Weg in seine Kammer zu machen.
Griffiths tupfte sich den Mund mit einer gestärkten Serviette ab.
»Ich denke, daß Rogers die Arbeiten auf Hecuba überwachen kann«, sagte er.
»Hoffentlich, Sir«, gähnte Drinkwater. »Er legt jedenfalls keine übertriebene Bescheidenheit hinsichtlich seiner Fähigkeiten an den Tag.«
»Und auch nicht bezüglich seiner Kritik an den Fähigkeiten anderer, Nathaniel«, sagte Griffiths ruhig.
Drinkwater nickte. Der Zweite Offizier strotzte schlicht vor Überheblichkeit; vor einem so alten Hasen wie Griffiths ließ sich das nicht verbergen.
»Das wäre nicht so schlimm, wenn Substanz hinter der Fassade steckte.«
Drinkwater stimmte schläfrig zu, er konnte die Augen kaum noch offenhalten.
»Ich bin viel besorgter wegen Mr. Dalziell.«
Drinkwater zwang sich zur Aufmerksamkeit. »Ja, Sir. Es gibt zwar nichts, wo man ansetzen könnte, aber ...« Der Satz blieb unvollendet, sein Hirn verweigerte weitere Anstrengungen.
Griffiths rief, und sofort erschien Merrick in dem kleinen rechteckigen Gelaß, das den Offizieren der Brigg als Messe diente.
»Begleiten Sie Mr. Drinkwater in seine Unterkunft, Merrick!«
»Es geht schon, Sir.« Drinkwater erhob sich langsam und steuerte die Tür seiner Kammer an; dabei stieß er gegen die füllige Gestalt des Arztes.
Griffiths betrachtete lächelnd die Ausweichmanöver der beiden; der eine war schlaftrunken ungeschickt, der andere beflissen hilfsbereit. Schließlich setzte sich Appleby an den Tisch.
»Guten Morgen, Sir. Das war eine schreckliche Nacht ...« Der Schiffsarzt verfiel in eine längere Abhandlung über die Bewegungen einer Brigg im Vergleich zu denen eines Linienschiffes, unter Berücksichtigung ihrer Auswirkungen auf die menschliche Gemütsverfassung. Griffiths hatte längst gelernt, die Tiraden des Arztes über sich ergehen zu lassen, die mit zunehmendem Alter immer häufiger wurden. Griffiths erinnerte sich an ihre frühere gegenseitige Abneigung. Aber das hatte sich alles geändert. Nachdem Griffiths in Great Yarmouth im Herbst des vergangenen Jahres hatte an Land bleiben müssen, war es Appleby gewesen, der ihn dort besucht hatte, als Kestrel außer Dienst gestellt worden war.
Es war ebenfalls Appleby gewesen, der die Unfähigkeit der dortigen Ärzte verflucht hatte und beinahe ein Duell mit einem gewissen Dr. Spriggs ausgetragen hätte, weil er mit der Art, wie dieser Griffiths’ Oberschenkelknochen gerichtet hatte, nicht einverstanden war. Appleby hätte den Knochen am liebsten wieder gebrochen und neu zusammengefügt, aber das hatte Griffiths verhindert, der das Gefühl hatte, daß ihm die Dinge etwas aus der Hand zu gleiten drohten.
Vor Wut schäumend, hatte Appleby einen Brief an Lord Dungarth geschrieben, in dem er auf die wertvollen Dienste hinwies, die ihm Griffiths als Kommandant des Kutters Kestrel geleistet hatte. Daraufhin wurde der auf Halbsold gesetzte Commander mit dem lahmen Bein auf der Brigg Hellebore wiederverwendet. Das mindeste, was Griffiths danach tun konnte war, Appleby die Stelle des Schiffsarztes anzubieten, und so waren sie sich in den verflossenen Wochen recht nahe gekommen.
Aber Lord Dungarth hatte die Gelegenheit wahrgenommen, ihnen Mr. Dalziell als Fähnrich aufzubürden. Es wurde bald deutlich, warum der Earl den Jungen nicht auf eine schneidige Fregatte geschickt hatte, obwohl er der Familie Dalziell offenbar verpflichtet war. Griffiths seufzte. Glücklicherweise war Mr. Dalziell nur ein kleines Licht und würde ihm wohl nicht allzuviel Kopfzerbrechen bereiten. Er goß sich neuen Kaffee ein, als Appleby endlich zum Ende kam.
»Und deshalb bin ich überzeugt, Sir, daß die lebhaften Bewegungen einer Brigg zwar eine Vielzahl kleiner Prellungen hervorrufen, aber gleichzeitig dafür sorgen, daß mehr Muskeln produziert und die Körpersäfte besser angeregt werden als beispielsweise auf einem Schiff der ersten Klasse. Dessen schwerfällige Bewegungen können eine Erschlaffung bewirken, die durch den Blockadedienst noch verstärkt wird und so zur Erkrankung und Langeweile führt, den unvermeidlichen Begleiterscheinungen eines solchen Einsatzes. Sie stimmen mir doch zu, Sir?«
»Wie? Oh, Sie haben zweifellos recht, Mr. Appleby. Aber um ehrlich zu sein, ich frage mich, was mit diesen gelehrten Spekulationen zu bewirken ist.«
Appleby seufzte. »Nun ja, Sir, es spielt ja auch keine große Rolle ... Wie lange werden wir hier bleiben?«
»Nur so lange, wie Mr. Rogers braucht, um der Hecuba beim Setzen eines neuen Vormastes zu helfen. Gemessen an den Umständen haben die Burschen sich prächtig gehalten.«
»Gewiß. Ich habe nachgedacht, Sir. Nathaniel meinte, man könnte eine Leine mit einer Rakete hinüberschießen, wenn das ginge ...« Appleby brach ab, als sich der Kopf von Mr. Q um die Ecke schob.
»Entschuldigung, Sir, aber der Kapitän des Schiffes aus Ra ... Rag ...«
»Ragusa«, ergänzte Griffiths.
»Jawohl, Sir. Also, er ist hier, Sir.«
»Dann führe ihn herein, Junge.«
Griffiths ließ Drinkwater gegen Mittag aus tiefem Schlaf wecken. Die kleine Kommandantenkajüte war mit Karten übersät, und Lestock stand in nervöser Bereitschaft mittendrin.
»Ah, Mr. Drinkwater, bitte schenken Sie sich ein Glas ein.« Griffiths deutete auf eine Karaffe, die sein geliebtes sercial enthielt. Während der Leutnant dieser Aufforderung nachkam, gab Griffiths eine Zusammenfassung der Ereignisse vom Morgen.
»Der Mistral, der verhinderte, daß wir nach Toulon weiterlaufen konnten, war ein Glück im Unglück.« Drinkwater sah Lestock weise Zustimmung nicken. »Daß wir ablaufen mußten, hat wahrscheinlich verhindert, daß wir in die Hände der Franzosen fielen.«
Immer noch müde, runzelte Drinkwater ungläubig die Stirn. Nelson blockierte doch Toulon, worauf, zum Teufel, wollte Griffiths hinaus?
»Die Franzosen sind draußen, irgendwo im östlichen Mittelmeer. Die Polaccra hatte bei Kap Passaro am 21. Juni mit Nelson Verbindung, also vor zwei Wochen. Sie ist auf dem Weg nach Barcelona und wurde vom Admiral nach dem Verbleib der französischen Armada befragt.«
»Armada, Sir? Sie meinen eine Invasionsflotte?«
Griffiths nickte. »Genau das meine ich, bach. Myndiawl, sie sind Nelson entwischt!«
»Konnte der Raguser Sir Horatio irgendwelche Hinweise liefern?«
»Doch, das konnte er. Die Polaccra hat die gesamte Flotte passiert. Sie lag auf Ostkurs ...«
»Nach Osten? Und Nelson ist ihr umgehend gefolgt?«
»Ja, natürlich. Und wir müssen ihm folgen.«
Drinkwater mußte die Neuigkeit erst verdauen. Nach Osten? Während seines ganzen bisherigen Dienstes hatte sich die Royal Navy bemüht, eine Vereinigung der französischen Mittelmeerflotte aus Toulon mit der Atlantikflotte in Brest zu verhindern. Solch eine Flottenkonzentration im Kanal durfte nicht geduldet werden, und auch sein gesamter Einsatz auf Kestrel hatte diesem Ziel gedient. Aber nach Osten? Das ergab keinen Sinn, außer man deutete es als großangelegte Finte. Die Franzosen gewannen Zeit, sie konnten im östlichen Mittelmeer ihre Besatzungen drillen und Nelson hinter sich herlocken – ein so ungestümer Offizier würde sich nicht abwartend verhalten. Dann konnten sie hoffen, nach Westen zu entkommen, durch die Straße von Gibraltar zu schlüpfen, St. Vincent vor Cadiz zu überraschen und sich mit der spanischen Flotte zu vereinigen.
»Weiß Ihr Informant, wer der französische Oberbefehlshaber war, Sir?«
»Kein geringerer als Bonaparte«, antwortete Lestock ruhig.
»Bonaparte! Aber wir haben doch in der Zeitung gelesen, daß Bonaparte die Englandarmee kommandiert. Ich erinnere mich, daß Appleby spottete, die englische Armee habe schon lange auf solch ein militärisches Talent gewartet.«
»Mr. Applebys Witze können einem das Blut in den Adern gerinnen lassen, Mr. Drinkwater«, sagte Lestock ohne die Spur eines Lächelns.
Drinkwater wandte sich wieder an Griffiths.
»Sie sagten, wir wollen Nelson folgen. Zu welchem Treffpunkt, Sir?«
»Was würden Sie vorschlagen, Mr. Drinkwater? Mr. Lestock?«
Lestock begann nervös: »Nun, Sir, ich, äh ... meine, da wir keinen vereinbarten Treffpunkt haben, sollten wir, äh ...«
»Nach Malta, Sir!« unterbrach ihn Drinkwater abrupt. »Wenn die Franzosen wieder zum Atlantik durchbrechen wollen, haben wir da Platzvorteile. Außerdem dürften dort zweifellos Befehle für uns deponiert sein.«
»Nein, Mr. Drinkwater. Ihre Überlegungen sind zwar völlig richtig, aber der Raguser hat uns erzählt, daß Malta inzwischen von den Franzosen besetzt worden ist.« Griffiths stellte sein Glas ab und nahm den Zirkel auf, um ihn als Zeigestock zu benutzen. »Wir werden nach Süden gehen, durch die Straße von Bonifacio, und nach Neapel segeln. Dort werden vielleicht Neuigkeiten für uns bereitliegen – oder hier in Messina – oder hier in Syrakus.«
Aber in Neapel gab es keine Neuigkeiten für sie, wenn man davon absah, daß Nelsons Flotte am 17. Juni dort haltgemacht hatte. Doch diese Nachricht war älter als die der Polaccra. Also ging Griffiths nicht erst vor Anker, und seine Männer konnten nur gierig den legendären Hafen anstarren. Die ockerfarbenen Paläste und Wohnhäuser boten aus der Ferne einen einladenden Eindruck, und die Seebrise erlaubte ihnen einen atemberaubenden Blick über die blauen Wasser der Bucht bis zum schwarzen Massiv des Vesuvs im Hintergrund.
»Bei Gott, da möchte ich mal eine Nacht durchmachen«, grübelte Rogers, der sich beim Wiederaufriggen der Hecuba bewährt hatte und nun wohl der Meinung war, daß er sich Ausschweifungen in Neapel verdient hätte.
Appleby, der in Hörweite stand und das Grinsen der Seeleute sah, bemerkte: »Seien Sie froh, daß Sie einen weisen Kommandanten haben, Mr. Rogers. Die neapolitanischen Pocken sind als sehr ansteckend bekannt und wegen ihrer Unheilbarkeit gefürchtet.«
Rogers wurde bleich wie die Wand, und die Männer schossen die Fallen mit ungewohnter Hast auf.
Hellebore arbeitete sich nun langsam nach Süden vor, durch die Inseln des Tyrrhenischen Meeres und die enge Straße von Messina. Aber keine Nachrichten über Nelsons Verbleib erreichten sie – oder über den der Franzosen. Am 16. Juli lief der Konvoi in die Bucht von Syrakus ein, um Holz und Wasser zu übernehmen. Sie wurden herzlich empfangen. Durch die Vermittlung des britischen Botschafters am Hofe Beider Sizilien, Sir William Hamilton, wurde den Briten die Möglichkeit gegeben, ihre Schiffe auszurüsten und zu verproviantieren.
»Es scheint«, sagte Griffiths zu den versammelten Offizieren, »daß Sir Horatio Syrakus als Basis gewählt hat. Wir brauchen nur abzuwarten.«
Sie warteten drei Tage. Kurz vor Mittag des Neunzehnten stand die britische Flotte mit Leander an der Spitze vor der Hafeneinfahrt. Drei Minuten nach drei Uhr nachmittags hatten die vierzehn Linienschiffe unter dem Kommando von Konteradmiral Nelson geankert, und innerhalb einer Stunde waren ihre Boote über die Bucht ausgeschwärmt. Die Besatzungen schleppten sich mit Holz und Wasserfässern ab, die Zahlmeister durchstreiften die Märkte nach Gemüse und Fleisch.
Hellebores Beiboot wurde zielstrebig durch das Durcheinander der Boote gerudert, bedrängt von örtlichen Bumbooten, die auf gute Geschäfte mit der Flotte hofften. Die Burschen der Offiziere erstanden Hühnchen, um die Mahlzeiten ihrer Herren aufzubessern, und daneben entwickelte sich ein schwungvoller, heimlicher Handel mit eingeweidezerfressendem Schnaps. Die Geschäftigkeit hatte eine Zielstrebigkeit an sich, die ansteckend wirkte, und Drinkwater mußte sich zwingen, eine fast kindliche freudige Erregung zu unterdrücken. Neben ihm saß Griffiths mit steinernem Gesicht. Weiße, unordentliche Haarsträhnen lugten unter seinem neuen, glänzenden Dreispitz hervor. Drinkwater fühlte eine Welle der Sympathie für den alten Mann mit der einzelnen glitzernden Epaulette. Griffiths fuhr seit einem halben Jahrhundert zur See. Er hatte als Steuermann auf Sklavenschiffen gedient, bevor er zur Kriegsmarine gepreßt worden war. Er war alt, erfahren und fähig genug, um das Kommando über diese ganze Flotte zu führen, aber der Mann, der sie tatsächlich befehligte, war nur wenige Jahre älter als Drinkwater.
»Sie kommen besser mit mir«, hatte Griffiths gesagt, als er seinem Ersten Offizier erlaubte, ihn an Bord der Vanguard zu begleiten. »Ich sehe doch, daß Sie ganz versessen darauf sind, einen Blick auf diesen Nelson zu werfen.«
Drinkwater schaute Quilhampton an, der seine Neugier teilte. Mr. Qs Hand lag nervös auf der Pinne des Bootes. Der Junge wirkte konzentriert, er kümmerte sich nicht um den prachtvollen Anblick britischer Seemacht, die ihn umgab.
»Boot ahoi!« Der Ruf kam vom Deck des Flaggschiffes, das über ihnen aufragte. Spieren und Rigg zeichneten sich schwarz gegen den leuchtenden Himmel ab, am Besanmast flatterte die blaue Flagge eines Konteradmirals. Drinkwater wollte Quilhampton schon ermahnen, als der Junge sich erhob, sich räusperte und mit wohlklingendem Sopran: »Hellebore!« herausschmetterte. Damit wurde die Anwesenheit eines Kommandanten gemeldet. Quilhampton bemerkte erfreut das kleine zufriedene Lächeln, das ihm Mr. Drinkwater zukommen ließ.
An der Eingangspforte begrüßten vier weißbehandschuhte Decksläufer und ein Bootsmannsmaat den Commander und seinen Ersten Offizier. Der Wachoffizier bat sie achtern, sich etwas zu gedulden, während er sie dem Halbgott meldete, der unter der Poop residierte. Neugierig blickte sich Drinkwater um. Vanguard war kleiner als Nelsons frühere Victory, nur ein Zweidecker mit vierundsiebzig Kanonen, aber es herrschte dieselbe präzise Ordnung, allerdings gemischt mit noch etwas anderem. Man spürte es an der Art, wie die Leute ihrer Arbeit nachgingen; wie die Seeleute mittschiffs die leeren Wasserfässer zur Gangway rollten, wie ein Geschützführer auf dem Quarterdeck die Feuersteine der achteren Karronaden auswechselte. Alle schienen sich bewußt, daß sie an einer großen Aufgabe mitarbeiteten. Später erinnerte sich Drinkwater noch oft an diesen Eindruck, diesen Eigenantrieb, der die Anstrengungen vervielfältigte und bekannt wurde als Nelson touch. Dies beeindruckte ihn mehr als das berühmte, vielbeschriebene Manöver sieben Jahre später bei Trafalgar, das Nelson die Unsterblichkeit brachte.
»Sir Horatio wünscht Sie jetzt zu sehen, Sir«, teilte ihnen der Leutnant bei seiner Rückkehr mit. Drinkwater folgte Griffiths, die zurückweisende Handbewegung des Diensttuenden übersehend. Sie traten unter einer Reihe lederner Feuerpützen hindurch in den Schatten der Poop, kamen an der Kapitänskajüte mit ihrem stocksteifen Wachsoldaten vorbei und betraten die Kajüte des Admirals. Sir Horatio Nelson erhob sich hinter seinem Schreibtisch, und Griffiths stellte Drinkwater vor, der sich höflich verbeugte.
Die kleine Statur Nelsons enttäuschte Drinkwater zunächst, er hatte ihn sich anders vorgestellt. Enttäuschend war auch der abgetragene Uniformrock und der unordentliche Schopf ergrauenden Haares. Aber bald verlor sich diese erste Enttäuschung, als der Admiral Griffiths über die Ausrüstung von Hecuba und Molly befragte. Seiner Sprache fehlte die übliche Förmlichkeit, er strahlte Vertrauen aus, das er sogleich auf andere übertrug. Eine Aura des Besonderen umgab den kleinen Mann. Er wirkte weitaus älter als neununddreißig Jahre, seine Gesichtszüge waren fein geschnitten, die Haut wirkte über den Wangenknochen fast durchsichtig. Seine große Nase und der breite, bewegliche Mund schienen irgendwie überdimensioniert im Vergleich zum übrigen Körper. Das verbliebene Auge war von blauer Farbe und blickte scharf und aufmerksam, der leere Jackenärmel legte Zeugnis für Nelsons Unerschrockenheit ab.
»Wissen Sie etwas über meine Fregatten, Kapitän?« fragte er Griffiths. »Der Mangel an Fregatten macht mich ganz verrückt. Die Franzosen sind mir entwischt, Sir, und ich habe nur eine Brigg zur Verfügung, als Aufklärer für eine ganze Flotte.«