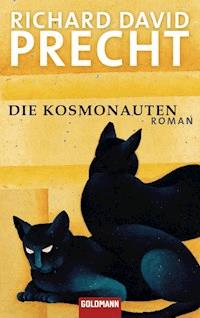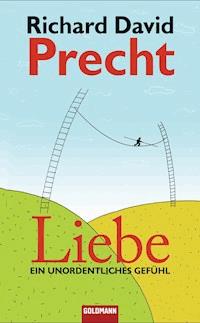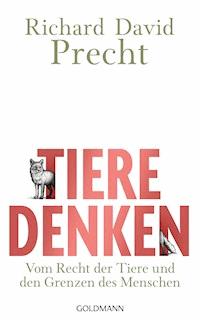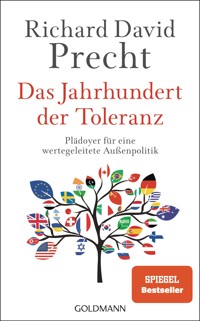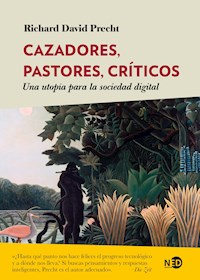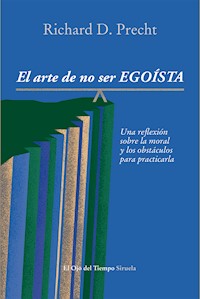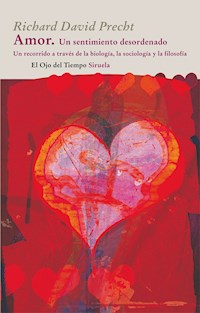Inhaltsverzeichnis
Buch
Autor
Widmung
Erster Teil - Der Weg in den Kosmos
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Copyright
Buch
Deutschland im Jahr nach der Wiedervereinigung: Die Geschichte ist gerade zu Ende gegangen, mit ihrem Ende aber fängt eine andere, kleinere Geschichte an. Gerade sind sich Georg & Rosalie in der Kölner Straßenbahn begegnet, schon beschließen sie, dass sie den selben Weg haben, und ziehen nach Berlin; um der Allgemeinheit zu entkommen und ihre Liebe und Freiheit zu leben - am richtigen Ort, zur richtigen Zeit. Die zur Flüchtigkeit der Boheme-Existenz passende Altbauwohnung in Mitte ist schnell gefunden. Während hoch über ihnen im Weltraum der letzte sowjetische Kosmonaut einsam seine Runden dreht, erkunden Georg und Rosalie die Stadt wie einen fremden Planeten, drücken schwere Haustore auf, bestaunen die abgeblätterten Altanstriche der Treppenhäuser im Halbdunkel. Doch als nach Monaten des Provisoriums das Gesparte aufgebraucht ist, sind sie gezwungen, der Wirklichkeit einen gewissen Ernst beizumengen. Der sich allen Karriereansprüchen verweigernde Georg nimmt einen Job als Hilfstierpfleger im Tierpark Ost an. Rosalie dagegen entscheidet sich für die Arbeit in einer Werbeagentur, die Berlin als innovatives Produkt vermarktet. Die Zeit der Schwerelosigkeit scheint für die beiden ein für alle Mal vorbei.
Überaus zärtlich und sprachlich originell verknüpft Precht das Schicksal eines Liebespaares mit einer Liebeserklärung an eine Stadt im Wandel.
Autor
Richard David Precht, Philosoph, Publizist und Autor, wurde 1964 in Solingen geboren. Er promovierte 1994 an der Universität Köln und arbeitet seitdem als Journalist für nahezu alle großen deutschen Zeitungen und Sendeanstalten. Precht war Fellow bei der Chicago Tribune. Im Jahr 2000 wurde er mit dem Publizistikpreis für Biomedizin ausgezeichnet. Er schreibt überaus erfolgreiche Sachbücher und Romane. Die Autobiographie seiner Kindheit »Lenin kam nur bis Lüdenscheidt« wurde für das Kino verfilmt. Richard David Precht lebt in Köln und Luxemburg.
Von Richard David Precht sind im Goldmann Verlag außerdem lieferbar: Wer bin ich - und wenn ja wie viele? Eine philosophische Reise (geb., 31143) Liebe. Ein unordentliches Gefühl (geb., 31184) Gemeinsam mit Georg Jonathan Precht: Die Instrumente des Herrn Jørgensen. Roman (47115)
Die Originalausgabe erschien 2003 unter dem Titel »Die Kosmonauten« bei Kiepenheuer&Witsch, Köln.
Für Uwe und Jens
Erster Teil
Der Weg in den Kosmos
1
Östlich des Aralsees, am westlichen Rand der Hungersteppe, etwa vierhundert Kilometer südwestlich von Baikonur, liegt Tjuratam. Die Sommer sind heiß und trocken, die Winter kalt und trocken und stürmisch. Hier, inmitten der endlosen Einöde Kasachstans, befindet sich das Kosmodrom Baikonur, das größte Forschungs-, Entwicklungs- und Startzentrum der Welt. Dieser Standort des Weltraumbahnhofs der Sowjetunion war lange Zeit ein wohlgehütetes Geheimnis.
Das Städtchen Tjuratam war einst eine Eisenbahnstation auf der Strecke Taschkent-Aralsk-Orenburg, doch dann kamen die Ingenieure und ihre Arbeiter und sperrten das Gebiet mit einem vierfachen Gürtel ab, errichteten Industriekombinate und Montagehallen und eine eigene Fabrik für die Herstellung von flüssigem Sauerstoff. Die alte Eisenbahnstation ist nun eine riesige Verschiebestelle und zugleich Hauptbahnhof der Stadt Leninsk. Etwa zehn bis zwölf lange Güterzüge versorgen Tag für Tag zehntausende Menschen in den kleinen verfallenenen Baracken der 50er Jahre, den stolzen graublauen Silos der 60er und 70er. Hochgeschossige Wohngebäude, Schulen und Verwaltungsbauten; irdische Zeichen himmlischen Strebens, ragen die Termitenbauten des Sowjetmenschen in die kalte kasachische Wüstennacht.
Im elften Stock wälzt sich Sergej Krikaljow in seiner blasskarierten Bettwäsche. Es geht ihm gut, weil er schon mal im All war und noch am Leben ist und weil er heute wieder in den Kosmos fliegen wird, auch wenn er die Nacht zuvor ein bisschen unregelmäßig atmet in seiner kleinen Wohnung, was Elena, seine Frau, ein wenig stört, aber sie versteht es.
Scharren. Kratzen.
Krikaljow schnauft, und Elena im rosa Nachthemd geht zum Fenster und macht es auf.
Kurze Ruhe.
Dann wieder das Kratzen: Sandflughühner, die nichts in den Kosmos zieht. Immer wieder kommen sie in der Morgendämmerung auf das Blechdach zurück und lassen sich von der schräg stehenden Sonne wärmen.
Sie schließt das Fenster und öffnet den Mund:
»Es ist Zeit, Serjoscha.«
Im Sommer bewachen violettblaue Stiefmütterchen die Beete. »Studentinnen der Arbeiterfakultät«, wie Genosse Ilja gesagt hat, aber jetzt ist Winter, und Krikaljow hat nicht einmal einen Blick für den Park, wo kalt und riesig ein Mann steht, breitbeinig auf der grünen Wiese vor den Hochhäusern, als wolle er den vielen Wassersprinklern ringsum zeigen, wie man einen Rasen nässt. Darunter steht: Jurij Gagarin. Sowjetbürger und Kommunist. Krikaljow fragt sich nicht, ob irgendwo viele tausend Meilen entfernt ein anderer kalter Riese mit einer Unterschrift steht: Neil Armstrong. US-Bürger und Kapitalist. Er denkt an Elena, dass sie sich eine neue Küche wünscht und dass er sie fast ein halbes Jahr nicht sehen wird, weshalb es ein schwerer Abschied war, so wie schon beim letzten Mal. Aber er diskutiert nicht über seinen Beruf, auch nicht mit Elena. Es ist ein langer Weg zu den Startanlagen in der Mitte des Geländes, achtunddrei ßig Kilometer nördlich des Hauptbahnhofs. Es ist ein längerer Weg durch die Schleusen und Kammern, durch Umkleidekabinen und anderes bis an Bord der Rakete. Und es ist ein noch viel längerer Weg der Mission SOJUS TM 12 zur Raumstation MIR, die alte Stammbesatzung abzulösen. Kollege Arzebarskij steht schon da, müde und blass, man könnte ihn unmöglich mit einem der Kosmonauten verwechseln, die in den Schulbüchern lächeln. Auch diese Engländerin ist da, die heute das erste Mal mitkommt, selbst wenn Elena tobt. Als wenn sie sich dadurch abhalten ließen, die bleibt sowieso nur eine Woche. Nicht mal an derselben Tube würde sie lutschen, und auch die Außenbordarbeiten zur Reparatur der Antenne oder des Annäherungssystems KURS am QUANT-Modul blieben streng einsam.
Stunden später sitzen sie zu dritt in der Sojus-Kapsel, erst nebeln die dichten Atmosphärenschichten, dann überfliegen sie einen der breiten sibirischen Ströme. Krikaljow unterscheidet deutlich die kleinen, von der Morgensonne beschienenen waldigen Inseln und die Ufer, und der Brechreiz ist nahezu unerträglich, wie schon beim letzten Mal. Nur nicht in die Kapsel kotzen. Auch der Druck auf die Augen wächst weiter, Arzebarskijs Gesicht ist nur noch Teig. In zwei Tagen, vier Myriaden Kilometer über der freien Erde, werden sie es eingeholt haben, dieses winzige schnelle Licht im Sternenmeer. Krikaljow trinkt kalten Tee, wartet ab, wartet weiter, bis Arzebarskij nicht mehr hinter seinem Rücken in das winzige Klo pinkelt, denkt nicht an Arzebarskij, denkt auch nicht an die Engländerin, lieber an Elena, an ihr rosa Nachthemd, und blickt, sein Gesicht ist bleich wie Kreide, in die unendliche Freiheit.
2
Mit dem Himmel fängt es an, dem hellen Grau, das über der Straße liegt. Zu erwähnen sind: die herkömmliche Nässe des Herbstes, der dichte vierspurige Verkehr zwischen den verchromten Häusern der Banken und Versicherungen, die große Betonbrücke über die Straße mit den Bahngleisen in der Mitte und schließlich vereinzelt dunkle Punkte, die gefrorene, stillgestellte Unruhe der Menschen an einer Stra ßenbahnhaltestelle.
Es war nichts Feierliches in diesem Tag, eher etwas Schwermütiges, der dritte Oktober hatte kein gutes Wetter beschert. Georg war früh aufgestanden an diesem Morgen, so wie jeden Morgen, aber ein Morgen wie jeder andere war das nicht. Er hatte soeben seine Arbeit gekündigt.
Nun stand er in schwarzen Jeans und schwarzem Wollpullover an der Haltestelle in die Stadt, lehnte an einer Tafel mit Leuchtreklame, die Arme verschränkt, und fragte sich, wie es ist, wenn man ein altes Leben beendet und ein neues anfängt. Leicht zu sagen war es nicht. Auf der Leuchtreklame zogen Rentiere durch glitzerndes Wasser. Benzindunst lag in der Luft, und die Straßen sahen aus, als wenn sie sich langweilten. Auf den Amseln perlten Tropfen; nass wie Regenschirme hockten sie auf der Laterne, bevor sie fortfahren würden zu singen oder zu sterben. Unentwegt zischten die Autos durch die Pfützen, in gleichem Abstand, wie auf einem Rollband.
Er dachte: immerhin hat diese Strömung mich vorwärts gespült, also war es nicht nur vertane Zeit. Wie gut, dass es vorbei ist, dass es tatsächlich vorbei ist. Er dachte an die Passfotogesichter seiner Kollegen im Büro, wie sie jetzt ihre Rechner anstellten, ihre Kaffeetassen füllten, in Telefonhörer redeten, bis die graue Straße wieder zurückkam, die Autos, die Leuchtreklame, die Menschen und diese junge Frau wenige Schritte entfernt; ihr rotbraunes Haar flatterte ein bisschen. Die große Zeichenmappe unter ihrem Arm hielt sie fest und zusammen, der Oktoberwind konnte ihr wenig anhaben, sie war ernst und ruhig.
Sie sah ihn nicht an, blickte stumm in die Richtung, aus der in wenigen Minuten die Straßenbahn kommen musste. Sie sah sicher aus, unbeirrbar durch den Niesel, die Autos, so als wenn sie in Gedanken gar nicht hier war an dieser Haltestelle.
Georg ging zwei Schritte nach vorn, rückte ein Stück näher an sie heran, stellte den linken Fuß vor; die Leuchtreklame verschwand aus seinem Rücken, er rieb sich das Gesicht, es gab Leichteres, als jetzt beiläufig zu wirken, unbeteiligt an seinem eigenen Blick.
Sie hatte sich geschminkt, sehr dezent, und der Mantel sah teuer aus, ebenso die Schuhe mit den schlanken Absätzen; ihr dichtes Haar aber war wild, als würde es nur vom Wind gekämmt, so als konnte es vielleicht gar nicht gekämmt werden, außer vom Wind.
Er ging jetzt ein paar weitere Schritte, nicht zu ihr hin, sondern gerade nach vorn zum Gleis, um nach der Bahn zu schauen. Erst dann drehte er sich kurz um.
Sah sie an.
In ihr Gesicht.
Sie hatte ihn bemerkt. Sie mochte noch so versunken auf die Straße geschaut haben, sie hatte ihn bemerkt.
Das flüchtige Lächeln, das ihn streifte, war warm.
Rosalie hatte soeben gelächelt.
Sie hatte den Kopf schräg gelegt, ihre grünen Augen leuchteten im Regen. Sie hätte ein schwindsüchtiges expressionistisches Mädchen im Pariser Herbst sein mögen, aber sie stand sicher und fest hier an der Haltestelle in Köln. Von draußen drangen Rauschen und Autohupen, drang der Lärm der Straße in ihren Kopf. Sie stand schon länger als zehn Minuten in diesem dichten Nebel aus kalter Nässe, die Straßenbahn wollte nicht kommen.
Sie hatte gelächelt, einen Fremden angelächelt, der sich nach ihr umgedreht hatte. Er war groß, und er war schlank, er hatte kurzes dunkles Haar, etwas Jungenhaftes.
Sie hatte ihn schon vorher bemerkt, wie er an seinen Rentieren vorbei in die Unendlichkeit geschaut hatte.
Sie drehte den Kopf weg und blickte zurück auf die Stra ße. Es war einer dieser Männer, die sie nie ansprachen, die irgendwelche anderen Frauen ansprachen, warum auch immer.
Na ja, auf jeden Fall, er hatte gelächelt.
Rosalie fröstelte.
Wenn die Wolken so tief hängen, ist der Weltraum sehr fern. Die Straßenbahn tauchte aus dem Nebel auf wie ein Raumschiff; die Falttüren pufften auf, sie stieg ein, ihre Absätze schabten auf den Trittstufen, sie setzte sich auf eine Bank ans Fenster; auf dem Sitz neben ihr war Platz.
Sie hatte sich nicht umgedreht, sie brauchte sich nicht umzudrehen.
Er war ihr gefolgt und mühte sich vor ihr am Fahrkartenautomaten. Er schien viel Kleingeld zu haben, das er ausgerechnet jetzt loswerden wollte. Kleines Geld in engen Jeanstaschen und dann auch noch den Pulli darüber.
Er hatte sie vorhin beobachtet.
Rosalie blickte durch die Scheibe. Büsche und Bäume, abgewischt am Fenster.
Er hatte seinen Fahrschein.
Fünf Schritte zu ihr.
Er kam.
Setzte sich neben sie.
Er setzte sich tatsächlich neben sie. Rosalie drehte flüchtig den Kopf.
Er lächelte. Ein wirklich schöner Mann. Ganz eigene Augen, hellblau mit etwas Schiefergrau darin. Das gefiel ihr. Und dann gefiel ihr, was er sagte:
»Ich glaube fast, wir haben denselben Weg.«
Sie hatten denselben Weg. Aus der Vorstadt in die Straßenbahn, aus der Straßenbahn in die Stadt. Die Stadt huschte an den Fenstern vorbei, überall erste Stockwerke. Schienengerumpel. Straßenbahngeklingel. Die Häuser verschwanden hinter Rosalies Gesicht. Er sprach sehr vorsichtig hinein, sehr langsam, als habe er Angst, sie zu verletzen. Rosalie lächelte, sie fing seine Worte auf, leicht und sicher und fragte: »Wann musst du aussteigen?«
Es war ein ungewöhnlicher Tag, und das verlangte ungewöhnliche Entscheidungen. Georg war fest entschlossen, überhaupt nicht auszusteigen, wenn Rosalie es so wollte.
»Ich steige am Dom aus«, sagte sie.
»Steigen wir am Dom aus.«
»Und dann?«
»Ich weiß nicht. Was schlägst du vor?«
Rosalie schlug nichts vor. Sie stiegen am Dom aus und standen anschließend eine ganze Zeit lang auf der Domplatte, aufgeregt und unschlüssig. Sie kannten sich eine Viertelstunde, und Rosalie wusste, dass sie jetzt wohl nicht gleich in die Galerie gehen würde an diesem Morgen. Es war das Einzige, dessen sie sich sicher war, und da ihr nichts anderes einfiel, kommentierte sie beiläufig die Arbeit der Pflastermaler. Sie war Kunsthistorikerin, und sie wusste viel zu sagen. Georg wollte ihr länger zuhören, er sah ihre schlanken braunen Hände, die auf das Pflaster zeigten, und schlug das Museum vor.
Das Museum war neu, ein Backsteinbau mit silbernen Stahlhauben. Es musste sehr schön ausgesehen haben, als es noch ein Modell war; jetzt versperrte es ein bisschen den Blick auf den Dom. Gleich hinter dem Eingang lag eine Verkaufsstelle für Kunstpostkarten und Bücher; ein Anziehungspunkt, der alle anderen des Museums übertraf. Schon oft war Georg aufgefallen, dass die Menschen ganz offensichtlich lieber Kopien betrachteten als Originale. Von sich selbst kannte er immerhin die unstillbare Sehnsucht nach genau den Bildern, die es in diesem Museum nicht gab. Kaum hatte man einen der ausgestellten Maler des sechzehnten Jahrhunderts im Museumsshop nachgeschlagen, fand man auf einmal die dunklen Spanier des siebzehnten viel interessanter, die in Amsterdam hingen oder in London. Und hatte man eben noch die feine pastellene Pinselführung in Aristokratengesichtern bewundert, so entbrannte ganz unvermittelt eine geradezu leidenschaftliche Faszination für die großgemalten brennenden Farbtafeln irgendwelcher Amerikaner in New York, deren Katalog man kaufte, mit nach Hause nahm und nie wieder darin blätterte.
Rosalie lächelte, als Georg so wortreich davon erzählte. Sie lösten ihre Eintrittskarten und gingen die breite Treppe hinunter und durch große weiße Räume. Rosalie hatte gezögert, als sie im ersten Raum gestanden hatten, aber schon im zweiten deutete sie auf einige ausgewählte Bilder, die Georg nie aufgefallen wären, wenn sie ihn nicht darauf hingewiesen hätte.
»Die sind ungeheuer.«
Das Bild vor ihnen zeigte einen Mann, war aber auf dem Kopf gemalt, oder verkehrt herum aufgehängt worden.
Georg staunte.
Rosalie mochte am liebsten Bilder mit Menschen, Portraits mit allen Drehungen und Ausschnitten. Er bewunderte ihre Urteile. Bislang hatte er gemeint, dass es schon außerhalb der Bilder genug Menschen gab, und dass er eigentlich viel lieber Stillleben mochte. Jetzt aber sah er am liebsten in Rosalies Gesicht, viel lieber als in jedes andere Gesicht im ganzen Museum.
Im zweiten Stock wurden Georgs Beine schwer; erstaunlich, wie anstrengend es war, durch ein Museum zu gehen. Auch seine Konzentration hatte nachgelassen, wahrscheinlich waren Beine und Geist durch irgendeinen schlecht erforschten Nerv miteinander verbunden. Rosalie hingegen bewegte sich leicht und geschmeidig, trotz ihrer Absätze, betrachtete Bilder mit Händen in den Hüften, rustikal wie ein Sportlehrer, ein anderes Mal ging sie vor und zurück, wobei sie mal die rechte und mal die linke Hand in die Hüfte legte, was unbeschreiblich elegant aussah.
»Was bedeutet das?«, fragte Georg, als sie vor einem Bild standen, das eine amerikanische Fahne darstellte oder eine war.
»Warum sollte es etwas bedeuten?«
»Ich meine, ist es ein Bild, oder ist es eine Fahne?«
»Genau das bedeutet es.«
»Ein Bild oder eine Fahne?«
»Die Frage«, sagte Rosalie. »Es bedeutet, wenn man das so sagen kann, dass man sich diese Frage stellt.«
»Und dann?«
»Nichts dann. Das ist die Erfahrung.«
»Das heißt, wann immer ich Lust dazu habe, mir diese Frage zu stellen, gehe ich hier ins Museum und schaue mir dieses Bild an?«
»So ungefähr. Noch Fragen?« lächelte sie.
»Tausend Fragen«, sagte Georg. »Was denkst du, jetzt zum Beispiel und ansonsten, wo bist du aufgewachsen, bist du ein mittleres Kind, wie roch es in deinem Kinderzimmer, welches ist dein Sternzeichen, deine Lieblingsfarbe, die Lieblingsfarbe deiner Eltern, was denkst du, wenn du beim Zahnarzt sitzt …«
»Trinken wir einen Kaffee?«
Sie kannten sich vier Stunden, als sie in der Cafeteria des Museums saßen und einen Kaffee nach dem anderen tranken, obwohl jeder Kaffee ganz bestimmt der letzte hatte sein sollen.
Es gab keinen letzten Kaffee. Sie sahen sich an, redeten, sahen sich wieder an. Sie redeten über Filme und Bücher, die sie mochten, was sie an den Menschen liebten und was nicht. Rosalie liebte Margaret Atwood und T.C. Boyle und warmen Rotwein im Winter in kalten Ateliers. Sie lachte in den unmöglichsten Situationen, vor allem dann, wenn es allen Umstehenden peinlich war. Und sie hatte einen Hund, der Rüdiger hieß.
Georg liebte die Filme von Cocteau und die Super-8-Filme aus seiner Kindheit. Im Sommer saß er gern auf der hei ßen Teerpappe vor seinem Dachfenster, philosophierte über die Tauben und das Leben und plante kleinere Abenteuer im Dickicht der Häuser. Rosalie beobachtete sein Gesicht, während er sprach. Sie blickte sanft und sah ihn lange an.
»Du hattest Trotz in den Augen.«
»Trotz?«
»Ja, vorhin. An der Haltstelle. Als ich das erste Mal zu dir rübergeschaut habe, hast du finster geblickt, irgendwie abwesend, aber auch trotzig.«
»Du hast zu mir rübergeschaut?«
»Na ja, nur kurz. Wie deutlich hätte ich denn gucken sollen?« Rosalie lächelte. »Also, wie war das mit dem Trotz? Ich dachte, das hätte etwas bedeutet, irgend etwas, das dich sehr beschäftigt hat.«
»Es bedeutete, dass mit klar war, in welcher Situation ich mich befunden hatte. Es bedeutete, dass vieles schiefgelaufen war in meinem Leben und dass es richtig ist, alles zu ändern.«
»Dein Leben ändern?«
»Das Leben, das ich bisher gelebt habe. Das Leben eines Verrückten. Jeden Tag halb sieben, jeden Tag Anzug oder Sakko, jeden Tag Rasierwasser. Weißt du, ich habe meinen Job geschmissen heute Morgen. Ein Tag länger in diesem Leben, und es wäre mein Ende gewesen. In zwei Monaten werde ich achtundzwanzig.«
»Und das heißt?«
»Dass ich ein anderes Leben führen werde.« Seine Stimme war heiser und etwas rau, eine seltsame Traurigkeit lag darin, die Rosalie erfasste wie eine schöne schwermütige Musik. Bislang hatte sie Georg sehr lustig gefunden, locker und leicht, aber diese heisere und raue Stimme spielte eine andere Melodie.
»Weißt du schon, wo du hingehen willst?«
»Nach Berlin, glaube ich.«
»Berlin? Hm.«
»Ist doch ein gutes Ziel. Findest du nicht?«
»Doch, doch.« Rosalie nickte. Berlin. Mit der Schulklasse war sie dort gewesen, hatte die Linden gesehen, die Kirche am Zoo, die Mauer, Nofretete natürlich und das Schloss Charlottenburg. An ihrem einzigen unbewachten Tag war Rosalie mit Freundinnen über Flohmärkte gegangen; in Kreuzberg hatte sie sich ein violettes PLO-Tuch gekauft, es hatte hübsch ausgesehen zu ihren dunklen Haaren und all den besetzten Häusern ringsum. Und in der Nacht waren sie gemeinsam im Sound gewesen. Acht Jahre war das jetzt her. Es sollte wieder viel los sein in Berlin, jetzt.
Georg hatte andere Gründe. Er mochte die Stadt, weil sie so einen schönen Fernsehturm hatte, und den Fernsehturm, weil er ihn an einen anderen erinnerte, einen kleinen Plastikfernsehturm, den er an regnerischen Sonntagnachmittagen auf dem Filzfliesenteppich seines Zimmers aufgebaut hatte, um von hier aus fremden Galaxien geheime Botschaften zuzufunken.
Rosalie legte den Kopf schräg.
Georg als kleiner Junge; sie hätte ihn gerne gesehen mit seinem Fernsehturm. »Aber das ist nicht alles?«
»Nein, natürlich nicht. Es passiert jetzt so viel in der Stadt.« Rosalie seufzte.
Die Stadt, in der sie lebte, war nicht schlecht, aber als sie an Georg dachte und an Berlin, wurde sie ihr schnell gleichgültig. Sie kannte ihn nicht, konnte ihn nicht kennen, und doch ertappte sie sich dabei, daran zu denken, wie es wohl war, ein Teil von Georgs neuem Leben zu sein, seinem Leben in Berlin; eine schöne Vorstellung, wahrscheinlich fürchterlich unrealistisch, aber trotzdem sehr schön. Vielleicht sollte sie sich davor schützen. Vielleicht auch nicht.
Es war früher Abend, das Museum würde gleich schließen, sie stellten die Kaffeetassen auf den Tabletthalter. Sie waren die letzten.
Der dünne Regen hielt sie nicht davon ab, zum Rhein zu gehen. Als sie die gepflasterten Stufen hinuntergingen, nahm sie das erste Mal seine Hand.
Er griff sofort zu, fasste die ihre wie eine wunderschöne am Strand gefundene Muschel. Er würde sie von nun an gegen nichts eintauschen. Hand in Hand tauschten sie stattdessen Meinungen über ihr Leben. Sie gingen sehr dicht nebeneinander und spazierten die ganze öde Promenade hinauf und herunter, ohne sich ein einziges Mal loszulassen.
»Weißt du, dass ich das wirklich klasse finde?«, sagte Rosalie.
»Was?«
»Na, sein Leben zu ändern. Von heute auf morgen, einfach so. Manchmal denke ich, ich müsste das vielleicht genauso machen, manchmal ist alles, was man so tut, einfach so zufällig.«
Georg sah sie an. Es fiel nicht schwer, ihr zuzustimmen, an so einem Tag. Er hatte seinen Job geschmissen, und er hatte die wunderbarste Frau der Welt kennen gelernt. Wenn das kein Zeichen war.
Eine Weile sagten sie nichts. Sie gingen eng nebeneinander, Hand in Hand, aber sie sahen sich nicht an.
Warum sagte sie jetzt nichts mehr? Georg blickte hoch in den Schwarm von Möwen, Lachmöwen mit braunen Fliegerkappen.
Rosalie dachte hin und her. Er interessierte sich jetzt mehr für Vögel. Sie wich den Pfützen aus und achtete auf ihre Schritte. Es wurde Zeit, dass sie jetzt wieder realistischer wurde, dass sie nicht weiter fortfuhr, Träume für wahr zu halten, nur weil sie es war, die sie im Augenblick hatte, und weil sie vielleicht schön waren.
Sehr schön.
Er ließ ihre Hand los und deutete tatsächlich auf die Möwen. »Im Winter werden die Köpfe hellgrau, dann sehe ich sie in Berlin, wie sie wieder über mich hinwegkreischen.« Er blickte sie an. Dann legte er den Arm um ihre Schulter. »Hast du Lust, sie zu sehen?«
»In Berlin?« Rosalie lächelte.
Er wünschte sich, dass sie nicht damit aufhörte. Fand es faszinierend, wie sie dastehen und lächeln konnte und dass sie ihn meinte damit.
Der Regen wurde stärker, sie gingen jetzt schneller. An der Bastei stiegen sie die Treppen zur Straße hoch, und wenig später standen sie geschützt in einem Hauseingang. Rosalie fühlte sich mit einem Mal schuldig. Sie hatte einen Freund, an den sie nicht denken durfte, damit es schön blieb.
»Ich glaube, wir sollten jetzt nach Hause gehen.«
»Und wohin?«
Rosalie wusste nicht wohin, sie wollte auch gar nicht weggehen, jedenfalls nicht von Georg. Sie wollte einfach nur gehen, und sie gingen zusammen durch die Straßen, und der Regen lief ihnen übers Gesicht. Sie war glücklich, dass sie hilflos sein konnte, hilflos gegenüber ihren eigenen Gefühlen.
Rosalies Freund war nicht zu Hause, er war für einige Tage mit Rüdiger bei den Eltern auf dem Land; auch ihre Wohnung war Georg somit schutzlos ausgeliefert. Der Regen hatte Rosalie völlig durchnässt, er kräuselte ihre Haare, und sie dachte noch eine kleine Weile hin und her, aber nicht wirklich.
Auch Georg hatte eine Freundin, Isabell, an die er jetzt nicht gern dachte, lieber dachte er an Rosalie, die es gut fand, wenn er den Rest der Nacht mit ihr verbrachte.
Sie klimperte lange mit dem Schlüssel vor dem Haus, sah Georg an, suchte das Schloss und blickte wieder zu Georg. Ich gehe mit einem wildfremden Mann nach Hause, dachte Rosalie, aber Georg war nicht wildfremd, und wenn, dann jedenfalls nur die schöne Seite von wildfremd.
Ein winzige Sekunde zögerte sie. Dann öffnete sie sehr energisch die schwere Haustür. Vom Treppenhaus sah Georg nur ihr bezauberndes wohliges Lächeln, das ihn in irgendeinen Stock zog, in dem sich eine andere Tür hinter ihm schloss. Er war heillos erregt und verzichtete darauf, die Spuren von Rosalies Freund von den ihren zu unterscheiden. Die Wohnung war Neuschnee, jedenfalls für ihn; die silber-schwarzen Stahlrohrmöbel, das dicht gefüllte Ikea-Regal, die Fotos an der Wand, die großen sehr grünen Pflanzen. Sie führte ihn ins Schlafzimmer, orangefarbene Wände, in der Mitte der Futon.
Georg, der auch im Raum stand.
Rosalie wechselte die Bettwäsche und lächelte ihn komplizenhaft an. Sie hockte sich vor die Stereoanlage; aus den Boxen sang Prince Purple Rain. Im Kühlschrank fand sich eine angebrochene Flasche Sekt. Sie klirrten mit ihren Gläsern, fanden aber kaum Zeit zu trinken.
»Es ist unglaublich, was uns passiert ist. Einfach unglaublich«, sagte Rosalie und sah Georg lange an.
Kurz bevor sie übereinander herfielen, kam sie noch einmal auf ihren Freund.
»Immerhin, er war zuerst da.«
»Nicht die Reihenfolge entscheidet«, sagte Georg. »Liebe ist kein Zieleinlauf. Was zählt, ist allein das Gefühl.«
»Solange man keine Verpflichtungen hat«, sagte Rosalie.
»Solange man keine Verpflichtungen hat«, sagte Georg.
3
Es war eine große, eine heroische Nacht. Sie verbrachten sie, ohne zu schlafen, jedenfalls nicht ohne miteinander.
In dieser Nacht vereinigte sich zugleich das ganze Land, vereinigte sich im Blitzlichtgewitter und im Leuchten der vielen hundert in ihm aufgestellten Scheinwerfer.
Rosalie sah das erst am nächsten Tag im Fernsehen, ohne Ton, in der Auslage eines Hifi-Ladens; da war es schon eine Wiederholung, aber die helle Aufregung war noch ganz deutlich zu sehen. Es war bestimmt alles anders von nun an, und es fing auch schon gleich anders an. Das Brandenburger Tor war ganz blau, und auf einer Würstchenbude zappelte eine schwarzweißrote Fahne, die sie nicht kannte. Das sah sehr aggressiv aus, aber ein so wichtiges Ende wie das Ende der Geschichte konnte ja auch nicht einfach so vor sich hin plätschern, es gehörten schon Menschen dazu, wahrscheinlich sogar gerade solche, die Fahnen schwenkten und sich trunken in den Armen lagen.
Auf jeden Fall war alles sorgsam gefilmt worden, und Rosalie hatte nichts verpasst. Trotzdem brauchte es schon einige weitere Tage, bis sie begriff, was in dieser Nacht passiert war. Es war etwas Großes geschehen. Die Geschichte war tatsächlich Geschichte geworden. Bis dahin hatte es nur Geschichten gegeben. Nun aber waren sie zu einer einzigen großen Erzählung vereint.
Rosalie ging nicht wieder zurück an ihre Arbeit. Den ganzen Tag über spazierte sie durch die Parks, zählte Fixer und Berber, die herabfallenden Kastanien, die auffliegenden grünen Papageien. Noch am späten Abend schlenderte sie durch die Stadt. Das Verbundpflaster unter ihren Schuhen, die grell erleuchteten Schaufenster: Sie nahm sie nicht wahr. Zum Wasser ging sie zurück. Der Rhein schimmerte im Licht der Straßenlaterne; es war eine lange, eine kalte Nacht.
Sie hatte Georg kennen gelernt, und sie wusste nicht, ob sie jemals einen Mann getroffen hatte, der ihr so gefallen hatte wie er. Er war groß, er hatte schöne Augen, eine sanfte heisere Stimme; aber das war es nicht, nicht allein. Er war zielstrebig gewesen, er hatte sie angesprochen, einfach so in der Straßenbahn. Rosalie konnte sich nicht erinnern, je auf vergleichbare Weise angesprochen worden zu sein, von unscheinbaren, unangenehmen Männern vielleicht, die nichts zu verlieren gehabt hatten, aber sie waren nicht einmal Erinnerungen geblieben. Georg war anders, er war ohnehin anders als die Männer, die sie kannte; anders auch als ihr Freund, der zuverlässig war und auffiel, wenn er im Oberseminar nahezu druckreif formulierte, und der sie studiert hatte und noch immer studierte, mit seinem beharrlichen Blick und Worten voll Klugheit und ohne Überraschungen. Übrig geblieben in ihrer Beziehung war nur seine Sprache, die Fremdwörter und Abstraktionen, die er wie einen Dialekt sprach, den man auch in den zarten Momenten nicht los wird, und der alles färbt, was man gemeinsam erlebt und denkt; er hatte ihre Reisen gefärbt, die Ausflüge ins Gebirge in Korsika und die heißen Stunden am Strand. Sie hatte seine Stimme im Ohr, wenn sie an ihn dachte, seine Redewendungen, aber nicht seinen Geruch in der Nase, nicht einmal sein Gesicht vor Augen. Er hatte sie ausgesucht, das junge Ding, das sie vor drei Jahren noch war, und es hatte ihr geschmeichelt, dass ein viele Jahre älterer Mann, der so klug war, sich für sie interessierte. Sie hatte sich nicht lange gefragt, ob er ihr gefiel; er hatte Rosalie ausgesucht, die nicht einmal eine Stelle an der Uni gehabt hatte. Nun aber wurde ihr flau, wenn sie daran dachte, wie er in ein paar Jahren sein würde, wenn das letzte Jungenhafte aus seinen Gesichtszügen verschwunden war, herausgedacht in langen Abhandlungen und abgeheftet in den Ordnern seines Assistentenzimmers. Vielleicht würde er dann tatsächlich sein wie jene Professoren, die Grabnelken, über die sie sich so oft gemeinsam lustig gemacht hatten. Vielleicht würde es dann gar nicht mehr auffallen, dass er beim Sex erst die Hose und dann das Hemd auszog.
Merkwürdig, dass es darauf ankam.
Es kam darauf an. Georg hatte erst das Hemd ausgezogen, dann die Hose. Er hatte nicht lange gedacht, nicht geredet. Aber Georg würde weggehen, nach Berlin; er würde in jedem Fall gehen, mit ihr oder ohne sie.
Eine Katze huschte vor ihr über die Steine, unter den Bauwagen hindurch ins Gebüsch. Aus den Wagen kam Licht, leises Gekicher, aber keinem fiel die junge Frau auf, die gerade vorbeiging, den Zettel mit der Telefonnummer in der Hand. Die Bauwagen verschwanden.
Georg. Georg.
Sie sagte sich den Namen, murmelte ihn hörbar. Er hatte eine Bedeutung, ein Zeichen, das sie noch nicht enträtselt hatte, das sie vielleicht nie enträtseln würde. Es konnte kein Zufall sein, oder es sollte keiner sein. Man hat mehr vom Leben, wenn man nicht an Zufälle glaubt. Rosalie war zu klug, um an Vorsehung zu glauben, die geheimen Verbindungen der Esoteriker oder Gottesurteile in der Größenordnung von vier Richtigen im Lotto, aber sie erkannte ein Zeichen, wenn sie es sah, und Georg war ein solches Zeichen, ohne Frage.
Georg.
Es war da. Nicht wegzudenken. Entweder sie würde ihre Hoffnungen fahren lassen oder ihren Freund. Und während sie darüber nachdachte und sich die Frage so stellte, wie sie sie stellte, wusste sie bereits, dass sie ihr bisheriges Leben der Illusion einer gemeinsamen Ordnung unterworfen hatte, ermuntert durch das allmähliche Anwachsen des Geldes, der Möbel und der Erinnerungen.
Die leeren Ausflugsschiffe wiegten sich mühevoll, schwanger vom Regen und auch sonst zu schwer. Sie ging gerade daran vorbei; sie hörte das Ächzen nicht, noch sah sie die Möwen. Aber selbst wenn sie sie gesehen hätte, ihre Schnäbel ins Gefieder geschoben wie Joghurtlöffel: Sie wäre nicht stehen geblieben, nicht in dieser Nacht, die die Rheinbrücken leuchten ließ, undeutlich in unbestimmter Ferne.
Sie war viel zu glücklich.
Den Zettel in ihrer Hand hielt sie sehr fest.
4
Die Geschichte war zu Ende gegangen. Mit ihrem Ende aber fing eine andere, eine kleinere Geschichte an: die Geschichte von Georg & Rosalie.
Er war zeitig aufgestanden an diesem Morgen, hatte das Deckbett aufgeschüttelt, war ins Badezimmer getreten und hatte rot-weiß gestreifte Zahnpaste ordentlich auf die Zahnbürste gelegt. Die Bürste im Mund, blickte er auf den Zeitungsausschnitt über dem Spiegel; er brauchte ihn nicht zu lesen, er war immer da, immer derselbe Text, der Nachruf auf seinen Vater. Vier Monate war das her, die Zeitung war gelblich und wellig, kein Foto, nur eine Notiz. Der Krieg hatte dem Vater schon in der Jugend ein Bein genommen, es war besser ohne Foto. Die haltlose Begeisterung für Sport hatte dem Vater den Artikel eingebracht, er war Schiedsrichter gewesen, Vereinsvize und Mitorganisator von Kleinwettkämpfen, aber seine größte Leidenschaft waren die Laufdisziplinen, wo er sich allerorten unentbehrlich gemacht hatte durch ein selbstentwickeltes Windmessgerät. So stand es im Nachruf: Seine besondere Aufgabe war die Betätigung des Windmessgeräts.
Der Satz würde also bleiben.
Der Vater war es gewesen, der ihn nach Mutters Tod allein erzogen hatte. Er hatte wenige Bilder von ihr, eine schöne junge Frau war sie in seiner Erinnerung geblieben, eine schöne junge Frau mit traurigen Augen. Sie war siebenundzwanzig, als sie starb, so alt wie er jetzt, und es war nicht leicht zu sagen, was er in ihr sah, seine Mutter oder eine junge Frau, in die er sich, würde er sie heute treffen, womöglich verliebte. Niemals hatte sie mit ihm über ihre Krankheit gesprochen, sie war eines Morgens nicht in der Küche gewesen, der Vater hatte geweint und getrunken, er war bereits völlig hinüber, als Georg in die Küche kam, um seine Haferflocken zu löffeln. Es gab keine Haferflocken, es gab überhaupt nie mehr Haferflocken.
Von nun an hatte sein Vater jeden Tag getrunken, bis auf die Sonntage, an denen die Turniere waren. An diesen Tagen war er so nüchtern wie ein normaler Mensch; schon in aller Frühe baute er das Windmessgerät auf dem Balkon auf und sah nach, ob es funktionierte. Mit Krücken und im Trainingsanzug war er mit dem Gerät im Gepäck aus dem Haus gegangen, um erst am Abend mit einer Fahne zurückzukommen. Der Vater taugte nicht zum Vater, hin und wieder sah er es selbst so, wenn er mit glasigen Augen am Küchentisch saß und auf seinen Sohn einredete, süßlich und einfältig wie auf ein schläfriges Haustier.
Manchmal hatte Georg sich gewünscht, sein Vater würde sterben oder eines Sonntags einfach nicht mehr wiederkommen, der Vater und das Messgerät; vielleicht fing dann ein neues Leben an, ein ganz anderes Leben. Aber auf eine gewisse Weise hatte er ihn zugleich stark gemacht, der unvollständige Vater, der nur dazu da war, zu trinken und Wind zu messen; er hatte seine Sehnsucht genährt, ein ordentlicher Bestandteil der Gesellschaft zu sein, nicht außen vor, wie ein Kind vor einem Spielzeuggeschäft. Georg hatte beschlossen, sich nicht länger die Nase platt zu drücken, und er war gut gewesen in der Schule und im Studium. Sofort danach hatte er in dem Konzern angefangen und gut gearbeitet, vor allem im Einkauf, Aluminium, aber seine Vorgesetzten hatten ihm misstraut, seine Kollegen mochten ihn kaum, er war ihnen oft fremd vorgekommen, und alle hatten mit ihrer Vorsicht recht gehabt. Georg hatte gefühlt, dass er nicht wirklich in die Firma gehörte, und doch war er geblieben, wo gehörte man schon hin, bis sein Vater gestorben war.
Drei Monate später hatte er seinen Entschluss gefasst.
»Haben Sie sich das wirklich gut überlegt?«, hatte der Geschäftsführer zum Abschied gesagt. »Sie waren ein interessanter Mann für uns. Sehen Sie das nicht auch so?«
Georg hatte das nicht so gesehen. Er wusste überhaupt nicht, ob er in diesem Augenblick etwas anderes gesehen hatte als das abgestorbene Gesicht des Geschäftsführers, und schon gar nicht so; jedenfalls nicht dieses so, das der Geschäftsführer gemeint hatte.
»Nicht eigentlich interessant, wenn Sie verstehen, was ich meine«, hatte der Geschäftsführer verbessert. »Sie waren ja schon ein wenig anders.«
Georg hatte nicht verstanden, was der Geschäftsführer meinte. Er hatte so abfällig über sein eigenes Bedauern geredet, dass Georg sich freute, auf diese Weise in seiner Ansicht bestärkt zu werden, sich am falschen Ort befunden zu haben, falls Freude hier das richtige Wort war. Auch Georg bedauerte ein wenig, vornehmlich die netteren seiner Kollegen, die vielleicht nie vergleichbar eindrucksvoll erfahren sollten, wie unwichtig sie der Firma waren.
Drei Wochen war das jetzt her; er stellte die Zahnbürste zurück ins Glas. Erst drei Wochen, dass er sich nicht weiterhin damit abgefunden hatte, sein Leben fortzusetzen wie bisher, drei Wochen, dass er Rosalie getroffen hatte.
Rosalie.
Es war undenkbar, dass er sich nicht in sie verliebt hätte, unmöglich, ihr zu widerstehen, ihrem lauten Lachen, der Begeisterung in ihren Augen, unmöglich, nicht glücklich zu sein, so glücklich wie noch nie in seinem Leben.
Er trank Kaffee, frühstückte und lief seine sechs Kilometer, das erste Mal seit zwei Jahren nicht am frühen Abend, sondern morgens. Er duschte kalt und kurz, trank ein gro ßes Glas Vitaminsaft, von dem alle früheren Freundinnen immer gemeint hatten, dass er weniger tauge als frisches Gemüse und Obst; sicher war es nur die Abkürzung zu den Vitaminen, die sie ihm nicht verziehen. Als er die leere Sporttasche zurück in den Schrank gestellt hatte, sah er ein letztes Mal auf seine aufgereihten Anzüge, hübsch nebeneinander, zum Erbrechen ordentlich.
Er legte die Anzüge sorgfältig übereinander in einen Karton.
Es klingelte, lang und bestimmt; so klingelte nur Rosalie.
Sie war sehr lebhaft, sehr beschwingt, und schon beim Hereinkommen fuhr sie sich ständig durchs klatschnasse Haar. Sie hatte nichts davon gesagt, dass sie heute kommen würde; es war ihre Art, einfach so vorbeizukommen. Ab und zu rief sie vorher an, meistens nicht.
»Bin mit dem Fahrrad da.«
Georg wollte ihr einen Kaffee anbieten, fand aber keinen. Sie war schon aus der Küche. Der Regen vor dem Küchenfenster verschwand, ein bisschen Sonne erschien. Georg kam ins Zimmer, die Teedose in der Hand.
Rosalie hatte den Mantel angelassen. Sie ging durch die Wohnung und verweilte vor dem Karton mit den Anzügen. »Was ist mit denen? Wo kommen die hin?«
»Ich brauche sie nicht mehr«, lächelte Georg.
Rosalie hatte sich hingehockt. »Ziemlich gute Stoffe. Sieht alles aus wie neu.« Sie prüfte die Anzüge mit den Fingern.
»Sie kommen weg.«
»In den Keller?« Rosalie sah ihn an, sein entschlossenes Gesicht, die gekrauste Stirn.
»Ganz weg.«
Rosalie hob die Brauen. Doch schon wenig später auf dem Weg zur Heilsarmee dachte sie, wie schön es war, dass Georg sich so einfach von seinem früheren Leben trennen konnte. Auch sein Auto hatte er verkauft; sie stiegen in die U-Bahn, alles voller Menschen, die Sitze besetzt, die Gänge gefüllt, Verkäuferinnen, Angestellte, den Arm hochgereckt, die Hand in der Deckenschlaufe: Freiheitsstatuen auf dem Weg zur Arbeit. Als sie zehn Minuten darauf in den kleinen dunklen Laden traten, fand Rosalie Georgs Entschluss großartig.
»Die sind wirklich für uns?« Das Fräulein, adrett und gescheitelt, bestaunte den Inhalt des Kartons.
Rosalie lachte, griff die Anzüge vom Tisch und hängte einen nach dem anderen auf schmale Metallbügel.
Georg beobachtete sie in ihrem enggeschnittenen Kleid, wie sie sich geschmeidig streckte und in der langen Reihe aus Altmänneranzügen energisch Platz für seine Klamotten schaffte. Ihr Lachen und ihre Solidarität waren überwältigend.
Kurze Zeit darauf saßen sie in einem Café in der Südstadt. Der Trotz in Georgs Augen war geschmolzen, sie waren jetzt weich und völlig offen. Rosalie erzählte ihren Morgen; mit einem Mal legte sie ihre Kuchengabel aus der Hand und schwieg. Sie hatte nicht nach Isabell gefragt, und Georg nicht nach Rosalies Freund.
Sie waren trotzdem da. Irgendwo. Freund und Freundin saßen im Büro, in der Mensa oder der Kantine, gingen gedankenverloren durch Straßen, spielten abends mit der Fernbedienung, tranken Bier oder Wein, riefen an und lagen nachts schlaflos in Betten; sie dachten nach, sicher rätselten sie und sorgten sich.
Georg & Rosalie sahen sich fast jeden Abend, täglich fieberten sie den Momenten ihres Wiedersehens entgegen. Sie spazierten durch Parks und raschelten mit dem Laub, saßen auf Brückengeländern, auf den Schottersteinen am Rhein und in den langen lauten Nächten der Kneipen. Manchmal warf Rosalie das Deckbett zur Seite und ging spät in der Nacht nach Hause; manchmal auch nicht.
»Du musst dich entscheiden«, sagte Rosalie, die Kuchengabel wieder in der Hand.
»Ich habe mich entschieden«, sagte Georg. »Längst und sofort. Du bist es, die sich entscheiden muss.«
»Ich habe mich entschieden. Wie war das, das da gerade?«
»Was?«
»Was du gesagt hast. Längst...«
»Längst und sofort.«
»Längst und sofort«, sagte Rosalie.
Zwei Tage später verließ Rosalie ihren Freund, ohne daran zu denken, dass sie ihn nicht wiedersehen würde. Er würde nicht fehlen. Sie hatte jetzt verstanden, woraus ihr Leben bestand. Ihr Leben war das, was ihr passiert war, während sie darüber nachdachte, ihre Zukunftspläne zu verwirklichen.
Rosalie wusste, dass ihr Freund wusste, dass sie ihn betrogen hatte, und Rosalies Freund wusste, dass sie wusste, dass er es wusste. Man brauchte das nicht zu vertiefen; sie überließ ihn dem Hund.
»Es ist sicher besser, wenn wir uns eine lange Zeit nicht sehen.«
Diese lange Zeit, sie wusste es zu gut, würde wie im Flug vergehen.
Mit Georg.
Rosalie lachte, weinte ein wenig und dachte nach. In dieser Reihenfolge. Am Ende lachte sie wieder. Es war das erste Mal, dass sie einen Traum hatte, in dem sie selber vorkam.
Georg hatte in derselben Firma gearbeitet wie Isabell. Er hatte ihre ruhige unaufdringliche Art gemocht, bis er Rosalie getroffen hatte. Bis dahin hatte Georg geglaubt, dass es nicht wirklich schadete, dass sie auf ihren Spaziergängen in der Heide am Stadtrand wenig miteinander sprachen, dass sie schwiegen, wenn sie gemeinsam im Café saßen, dass Isabell keine Fragen nach der Zukunft stellte und dass sie sich vielleicht tatsächlich keine Gedanken darüber machte. Sie hatten sich im Büro gesehen, in der Kantine, und nur an den Wochenenden verabredet; er hatte sie trotz allem geschätzt.
Die Trennung von Isabell war beschlossen, gleichwohl fiel sie ihm schwer. Sie durfte nicht zu beiläufig geschehen und nicht unvollständig.
Er hatte Rosalie nie genau erzählt, wie es gewesen war. Es musste reichen, dass er sich trennte.
Vielleicht verschiebt er das Erzählen auf einen richtigen Zeitpunkt, dachte Rosalie. Aber es gab keinen richtigen Zeitpunkt, und sie fragte nicht nach. Sie dachte daran, dass Menschen sich nur deswegen ihre Vergangenheit erzählen, weil ihnen zu ihrer Gegenwart nichts einfällt. Liebesgeschichten sind oft voll von unerledigten Angelegenheiten.
5
In der Ecke des alten Schlafzimmers standen die Umzugskartons. Ein paar Kinderbücher waren darin gestapelt, unendlich weit entfernt: Das Rätsel der Sternenfahrer und Peterchens Mondfahrt. Dann die Bücher aus dem Studium, eines davon lag obenauf: Die postmoderne Konstellation. Rosalie nahm es heraus; auf die erste Seite hatte sie mit weicher runder Schrift einen Satz aus dem Inhalt geschrieben: »Wir müssen nicht entdecken, wer wir sind, sondern die uns zugeschriebene Identität verweigern.«
Das war erst drei Jahre her, sie erinnerte sich daran; sie hatte gerade ihre erste Hauptseminararbeit geschrieben. Nun aber kam es ihr vor, als legte ihr das Leben ganz unvermittelt eine Hand aufs Knie. Sie wusste nicht, ob sie sich dagegen wehren oder stillhalten sollte, im nachtweichen Unterhemd, das Buch der Erinnerungen in der Hand. Sie mochte im fünften oder sechsten Semester gewesen sein, und ein Gespenst war umgegangen, das sich das neue französische Denken nannte. Es war gar nicht mehr leicht zu sagen, was das gewesen war. Zu Anfang ihres Studiums hatte sie geglaubt, dass Bilder und Bücher einen Sinn hatten, und wer malte oder schrieb, tat das mit einer Absicht; doch sie lernte schnell, dass es auf diese Absicht gar nicht ankam, sondern auf etwas Unbestimmtes und Vieldeutiges, das sehr kompliziert beschrieben werden musste. Sinn und Wahrheit waren dadurch viel schwieriger geworden, aber immerhin gab es sie noch.
Dann jedoch kamen auf einmal die ganz neuen französischen Theorien, eine ungewöhnliche und faszinierende Erotik. Nicht auf den Sinn kam es an, sondern auf die Sprache selbst. Die starre Abfolge der Geschehnisse schien aufgebrochen, das Lebendige freigesetzt. Wenn es keine Wahrheit mehr gab und keinen Sinn, nur noch gleitende Bedeutungen, so war alles Denken unbeschwert und aufregend. Selbst die Träume wurden wach; gespiegelt im Labyrinth schillernder Bedeutungen taumelten sie als neue Zauberzeichen hervor. Besonders schön daran war, dass, wer auf diese Weise zeitgemäß dachte, allen anderen Menschen immer einen Schritt voraus war. »Ich träume von dem Intellektuellen als dem Zerstörer, der in den Trägheitsmomenten und Zwängen der Gegenwart die Schwachstellen, Öffnungen und Kraftlinien kenntlich macht, der fortwährend seinen Ort wechselt, nicht sicher weiß, wo er morgen sein noch was er denken wird, weil seine Aufmerksamkeit allein der Gegenwart gilt.« Dieses Bekenntnis hatte ein großer französischer Denker abgelegt, und Rosalie folgte ihm wie alle anderen Studenten im Seminar, die begriffen hatten. Und obwohl sie nicht wussten, wo sie am nächsten Tag sein würden, geschweige denn, was sie dort denken würden, trafen sie sich schon am Tag darauf, wie an allen nächsten Tagen, auf dem Campus wieder und dachten nicht selten das Immergleiche. Es waren auch wirklich sehr schöne Gedanken. Der Frühling ergoss sich über die Landschaft, die Schlagschatten des großen Universitätsbaus spendeten schwarze Wiesen. Als es wärmer wurde, zogen sie sich dorthin zurück, dachten freizügig im Dunklen, verloren sich ein bisschen in einem unsichtbaren Paris. Der Hauch eines tatenlosen Mai lag in der Luft, eines gedachten schwebenden Mai, eines Tumultes innerer Freiheit: Man verliebte sich beim Fahrradschieben, traf sich im Biergarten am See und schaute dem stillen Wachsen und Vergehen des Sinns zu, wie dem leise knackenden Atem der Schilfrohre.
Am nächsten Morgen wanderten sie wieder in die fensterlosen Seminarräume, die Trägheit der frühen Katerstunden verflüchtigte sich. Rosalie erinnerte sich kaum, jemals so lebhaft gedacht und geredet zu haben. Sie diskutierten die Gleitmittel der Sprache mit Professoren in blauen Busfahreranzügen, die sich erstaunlich dankbar am zweiten Frühling der Gedanken beteiligten. Und sie diskutierten über Revolutionen, ob sie der Mühe wert waren und vor allem - welche?
Das Eigentümliche daran war nur: Irgendwann hatte dann tatsächlich eine Revolution stattgefunden, jedenfalls eine Mühe, die man für eine solche halten sollte. Während Rosalie in der Bibliothek saß, ihr Examen vorbereitete und dabei sehr geschmeidig nachdachte, für welche Revolution sich das Leben aufs Spiel setzen ließe, waren in Berlin die Grenzübergänge geöffnet und bald darauf die Mauer erklettert worden. Und die Revolution wurde bereits von Leuten beurteilt und gewonnen, die nichts aufs Spiel gesetzt hatten.
Für Rosalie war das sehr unbefriedigend; es war kaum eine echte Revolution gewesen, sie hatte nicht einmal eine eigene Mode hervorgebracht, nichts als Jeansjacken und Schnäuzer, besonders verführerisch war das nicht. Hatte man einen äußeren Zusammenhang gewonnen, so hatte man den inneren verloren. Was sollte man nun denken und tun?
Sie war hilflos. Nicht nur das Dafür war ihr verloren gegangen, das hatte sie klug und biegsam gemacht, sondern auch das Dagegen. Noch in den ersten beiden Semestern hatte sie ihr verhasstes Jurastudium in löchrigen Jeans abgesessen, den trotzigen schwarzen Rollkragenpullover darüber. Und dann, nach dem Wechsel, hatte sie nicht wenig Gefallen daran gefunden, im Kostüm vor Philosophen und hinter kunsthistorischen Holzbänken zu sitzen, die Haare hochgesteckt. Erst das neue französische Denken hatte sie gelehrt, dass die wahre Rebellion in Verschiebungen bestand, dem Blick hinter die Kulissen der Sprache, und das hatte sie befreit von allem vordergründigen Protest. Nicht einmal für den Erhalt der Professorenstellen hatte sie sich noch stark gemacht, die sich, einem Ministerbeschluss folgend, langsam ausdünnten.
Bedauerlicherweise gab es nun auch im Alltag kein Argument mehr für oder gegen etwas, und das verunsicherte Rosalie nach ihrem Studium, als sie ein paar sehr wichtige Entscheidungen treffen musste. Sie fühlte sich ein wenig betrogen, wie früher vom Buddhismus, bei dem auch nicht das herausgekommen war, was sie gesucht hatte. Zu ihrer großen Überraschung freilich schien niemand außer ihr sich daran zu stören. Ihre Professoren machten jetzt Kulturwissenschaft, die neuen Theorien verschwanden aus den Lehrveranstaltungen. Wohin hatte sich der Morgentau verflüchtigt, zu was war er kondensiert: sich bereit zu halten, ohne etwas zu wollen, auf alles vorbereitet zu sein, ohne einzugreifen, alles zu können, um dann gelassen darauf zu verzichten, es zu tun?
Für viele ihrer begeisterten Mitstreiter hingegen schien das Ende geradezu eine Erlösung zu sein, von der sie bei der ersten Berührung mit der Wirklichkeit Gebrauch gemacht hatten. Das neue Denken ging fast über Nacht an Selbstermüdung zugrunde. Die Nomaden des Geistes rasteten jetzt in den Karawansereien, arbeiteten in Werbefirmen und PR-Agenturen. Auf diese Weise versorgt und genährt, bedachten sie nun ausgerechnet das neue Denken mit jenem wissenden Lächeln, zu dem es ihnen einst verholfen hatte.
Rosalie hätte sich über diesen Verrat empören können. Empören darüber, wie alles Gleiten zu längst bekannter fertiger Grammatik geworden war. Jeder unstete Geist war verflogen, Moral und Analyse wieder für Sonntagsfragen reserviert, nicht anders als schon in der Generation ihrer Eltern.
Sie stand vor ihren Büchern, betrachtete nachdenklich die beriebenen Einbände, die vielen Zettel in den Seiten und dachte, dass sie eigentlich überhaupt nichts mehr verstand. Die französischen Theorien waren untergegangen, und Rosalie war noch übrig. Und so hatte sie nach ihrem Studium etwas ideenlos in der Galerie gejobbt, und nach einer Weile war sie schon fast selbst auf dem Weg in die Allgemeinheit gewesen, bis Georg sich in der Straßenbahn neben sie setzte.
Georg.
Sie stand da, noch immer in ihrem Unterhemd, rieb sich in den erwachenden Morgenstrahlen die Füße und kehrte zurück in die Welt, wo sie sechsundzwanzig Jahre alt war und sehen musste, wie es weiterging.
Während sie den Kaffee aufsetzte, wusste sie, wie viel Kraft es ihr gab, in ihrem Gefühl zu Georg zu ankern. Ein einziger Haltepunkt im Meeresgrund würde ihr genügen, den Wellen zu trotzen.
Piratin des Augenblicks - das gefiel ihr.
6
Wenige Tage später kamen Georg & Rosalie in Berlin an. Man hatte aufgegeben, die Welt an die Wirklichkeit anzupassen. Die Zeitungen schrieben von einer Aufbruchstimmung. Es war schon viel passiert mit der Stadt, was man ihr ansah, und es würde nun wieder viel Neues geschehen.
Für zwei Nächte bot ihnen Georgs Großtante in Wilmersdorf Quartier. Sie verließen die Wohnung nach dem Frühstück und nahmen die S-Bahn zum Marx-Engels-Platz. Die Straßen in Mitte lagen wie ausgestorben da, es fehlten die Autos. Das Leben zeigte seine Licht- und Schattenseiten, besonders jetzt im Winter. Es roch nach Dorf. Die Häuser waren nicht sehr hoch, das Kopfsteinpflaster abgetreten wie die Bürgersteige; aus einer Wohnung ragten Äste.
»Weißt du, ich glaube wirklich, es ist der richtige Ort zur richtigen Zeit«, sagte Rosalie, als sie zwischen dem Grauputz und den Glasbausteinen des Bezirksamtes hindurch ins Freie traten. Sie hatte dem Sachbearbeiter getrotzt, der lange die Achseln gezuckt hatte, sie hatte die Wohnberechtigungsscheine unübersehbar auf dem Tisch ausgelegt, sie hatte auf der Wohnung bestanden mit klarer und fester Stimme. Unbeirrbar.
Der Sachbearbeiter hatte zwei Tassen Kaffee getrunken und mit seinem Kugelschreiber gespielt.
Georg war nach Aufstehen gewesen, vielleicht nach Gehen. Rosalie war sitzen geblieben.
Der Sachbearbeiter war in den Nebenraum verschwunden, gedämpfte Töne durch die geschlossene Tür, kaum zu verorten, wie aus einer anderen Welt.
Stille.
Rosalie hatte Georg angelächelt; Georg die Brauen gehoben.
Der Sachbearbeiter war zurückgekommen in den Raum, Minuten später, ohne sie eines Blickes zu würdigen. Er hatte sich gestreckt und einen Mietvertrag ausgefüllt: Krausnickstraße, Hausnummer, Stockwerk. Rosalie hatte Georg angestoßen, sie hatte gestrahlt und den Vertrag in die Handtasche gesteckt.
Georg hatte sie im Flur umarmt. Durch die großen Fenster hinter hellbraunen Gardinen hatte man die Zukunft sehen können, Wintersonne auf verschneiten Dächern, der Fernsehturm. Der Paternoster hatte sie nach unten gebracht.
Der Himmel vor dem Bezirksamt weitete sich grenzenlos. Rosalie strahlte. Sie trug Pumps zum Schnee, was sehr hübsch aussah. Natürlich sah es auch so aus, als ob sie hier fremd oder neu war, das war sie ja auch, aber das würde sich ändern. Sie hatten ihr erstes Rendezvous mit der Stadt, und es war sehr vielversprechend. Reif auf den Straßen, die Spree vereist, auf schmiedeeisernem Geländer lagen dünne Decken; verschneite Helden hockten auf eisigen Brücken, eingehüllt in weiße Mäntel. Tauben wateten durch die Winterkälte, schichtweise deckten die dicken Flocken die dunklen Dächer; darüber schwammen die Wolken, manche wie mit dem Pastellstift gemacht, andere, die aquarelliert waren; es gab eine ganze Ausstellung verschiedener Stile zu sehen: die Wolken der venezianischen Maler, barocke Wolken, vermischt mit expressionistischen Wolken, mit Tintenflecken gekleckst, dann Wolkenplastik, die Wolken von Brancusi, vollkommene, fromme Wolken, schlecht gezeichnete, von der Natur schlecht gemachte.
Das Schönste an allem war, dass Georg dabei war. Georg, der seinen warmen Mantel um ihre Schultern legte, Georg, der neben ihr Nebelwölkchen durch die Straßen blies, Georg, der mit leiser und rauer Stimme sprach und schwärmte, vom Fernsehturm natürlich, der hoch über ihnen blinkte, und von den leeren Hinterhöfen rechts und links, in die sich gut blicken ließ.
»Man könnte im Sommer Fußball darin spielen, zwei Parteien auf ein Tor.«
Sie spazierten die Oranienburger Straße entlang, die Friedrichstraße und die Linden zum Reichstag. Der Reichstag war wichtig, man würde sich das Gebäude merken müssen; es scharte viele Telefonzellen um sich, die einzigen weit und breit. Die Telefonhäuschen, mit Graffiti beschmiert, schimmerten in der Wintersonne wie Postkarten; der Reichstag kondolierte dem deutschen Volke in Großbuchstaben. Ein Betrunkener lehnte in einer Nische und pinkelte dampfende Anagramme in den Schnee.
»Wohin gehen wir?«
Sie entschieden sich für einen weiten Bogen, die schnörkellosen Trümmerfelder der Luisenstraße türmten sich zwischen leergeschossenen Ruinen, gleich mussten die letzten Überlebenden den Häuserkampf einstellen, sich selbst und ihre Waffen den Russen ausliefern.
In der Friedrichstraße herrschte schon Weltfrieden in Tränen- und Tanzpalästen, und Rosalie erzählte Georg von ihren Ballettstunden.
»Und so hat es angefangen?«
»Was angefangen?«
»Dein Leben mit Kunst und Bildern.«
»So und so ähnlich«, sagte Rosalie und redete über ihren ehrgeizigen Vater, vom Klavierunterricht und ihrer Mutter, die die Achtziger auf dem Sofa verbracht hatte, in stilvollem
1. Auflage Taschenbuchausgabe Oktober 2009 Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Copyright © 2009 by Richard David Precht Copyright © dieser Ausgabe 2009 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München
Umschlagmotiv: Artkey/Corbis mb · Herstellung: Str.
eISBN : 978-3-641-03430-6
www.goldmann-verlag.de
Leseprobe
www.randomhouse.de