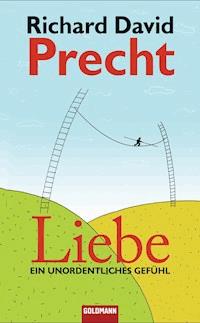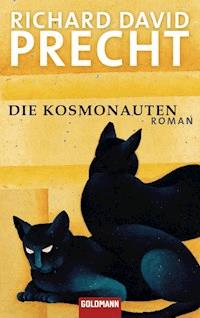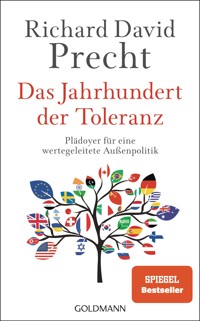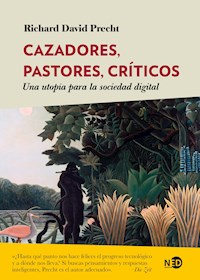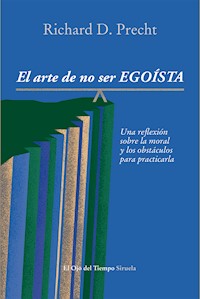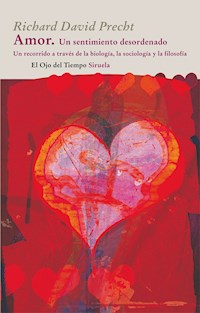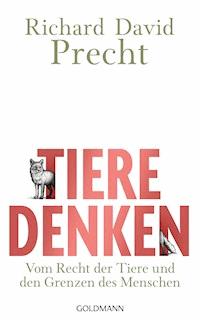
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Basierend auf dem 1997 erschienenen Titel „Noahs Erbe“ – von den Lesern lange erwartet.
Wie sollen wir mit Tieren umgehen? Wir lieben und wir hassen, wir verzärteln und wir essen sie. Doch ist unser Umgang mit Tieren richtig und moralisch vertretbar? Richard David Precht untersucht mit Scharfsinn, Witz und Kenntnisreichtum quer durch alle Disziplinen die Strukturen unserer Denkmodelle. Ist der Mensch nicht auch ein Tier – und was trennt ihn dann von anderen Tieren? Welche Konsequenzen hat das für uns? Precht schlägt einen großen Bogen von der Evolution und Verhaltensforschung über Religion und Philosophie bis zur Rechtsprechung und zu unserem Verhalten im Alltag. Dürfen wir Tiere jagen und essen, sie in Käfige sperren und für Experimente benutzen? Am Ende dieses Streifzugs steht eine aufrüttelnde Bilanz. Ein Buch, das uns dazu anregt, Tiere neu zu denken und unser Verhalten zu ändern!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 672
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Text zum Buch
Wie sollen wir mit Tieren umgehen? Wir lieben und wir hassen, wir verzärteln und wir essen sie. Doch ist unser Umgang mit Tieren richtig und moralisch vertretbar? Richard David Precht untersucht mit Scharfsinn, Witz und Kenntnisreichtum quer durch alle Disziplinen die Strukturen unserer Denkmodelle. Ist der Mensch nicht auch ein Tier – und was trennt ihn dann von anderen Tieren? Welche Konsequenzen hat das für uns? Precht schlägt einen großen Bogen von der Evolution und Verhaltensforschung über Religion und Philosophie bis zur Rechtsprechung und zu unserem Verhalten im Alltag. Dürfen wir Tiere jagen und essen, sie in Käfige sperren und für Experimente benutzen? Am Ende dieses Streifzugs steht eine aufrüttelnde Bilanz. Ein Buch, das uns dazu anregt, Tiere neu zu denken und unser Verhalten zu ändern!
Weitere Informationen zu Richard David Precht sowie zu lieferbaren Titeln des Autors finden Sie am Ende des Buches.
Richard David Precht
Tiere denken
Vom Recht der Tiereund den Grenzen des Menschen
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © der Originalausgabe 2016
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Covergestaltung: Uno Werbeagentur, München
Covermotiv: FinePic®, München
Illustrationen im Innenteil: Oliver Seibt, designambulanz
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-19808-4 V005
www.goldmann-verlag.de
Für Paul und Hagen, Elvira, Asterix & Kriemhild, die dicke Nolpa, Frank-Walter & Angela und all die anderen, die unter meinen unsachkundigen Händen lebten und hoffentlich wenig haben leiden müssen. Und natürlich für Artus!
Inhalt
Vorwort
Einleitung
Das Menschentier
Die Ordnung der Schöpfung
Wie menschlich ist die Evolution?
Der Primat
Was ist ein Mensch?
Der aufrechte Affe
Was macht den Menschen zum Menschen?
Sinn und Sinnlichkeit
Was trennt Mensch und Affe?
Eins Komma sechs Prozent
Sind Menschenaffen Menschen?
Die Tücke des Subjekts
Über die Schwierigkeit, Tiere zu denken
Das Tier im Auge des Menschen
Die Tundra des Gewissens
Wie die Religion unsere Nabelschnur kappte
»Ich habe kein Tier misshandelt«
Das Tier im Alten Ägypten
Hirten und Herrscher
Das Tier im alten Judentum
Das verlorene Paradies
Das Tier in der Antike
»Kümmert sich Gott etwa um die Ochsen?«
Das Tier in Christentum und Islam
Scheinheilige Kühe
Das Tier bei Hindus und Buddhisten
Die Denker und das liebe Vieh
Das Tier im Barock und in der Aufklärung
»Können sie leiden?«
Die Rückkehr des Mitleids
Eine neue Tierethik
Das eiserne Tor
Wege zu einer modernen Tierethik
Schutz oder Recht?
Die Ethik der Befreiung
Eine artgerechte Moral
Menschen – Tiere – Ethik
Gut, besser, am besten
Die Ethik des Nichtwissens
Was tun?
Lieben – Hassen – Essen
Unser alltägliches Chaos im Umgang mit Tieren
Ein kurzer Text über das Töten
Das Tier und das Gesetz
Naturschutz oder Lustmord?
Dürfen wir Tiere jagen?
Jenseits von Wurst und Käse
Dürfen wir Tiere essen?
Das Tier als Dummy
Sind Tierversuche legitim?
Alcatraz oder Psychotop?
Vom Nutzen und Nachteil der Tiergärten für das Tierleben
Das Zeitalter der Einsamkeit
Die Ethik der Bewahrung
Das unversöhnliche Triumvirat
Tierschutz, Tierrecht und Artenschutz
Schopenhauers Treppe
Die Pragmatik des Nichtwissens
Anhang
Anmerkungen
Ausgewählte Literatur
Dank
Personenregister
Zitatnachweis
Vorwort
Dieses Buch handelt nicht von denkenden Tieren, sondern nur von einem einzigen denkenden Tier – dem Menschen. Es handelt von der Schwierigkeit, die dieses denkende Tier hat, wenn es sich eine Vorstellung vom Innenleben anderer Tiere macht. Und davon, wie schwer wir uns im Nachdenken und Handeln tun, anderen Tieren gerecht zu werden.
Diese Frage ist so etwas wie mein Lebensthema. Tiere haben mich schon immer fasziniert. Ich erinnere mich gut daran, wie ich mit meinem Großvater in ungezählten Ferien den Zoo in Hannover besucht habe. Es waren jahreszeitenlose Frühlingstage im Herbst; sie durften nie enden. Ich fasste damals den Berufswunsch, Zoodirektor zu werden, und ein schöneres Leben schien mir nicht vorstellbar. Meine Helden waren Bernhard Grzimek und Heinrich Dathe, die beiden großen Zoodirektoren in West und Ost. Um zu üben und um mir die Vorfreude zu erhalten, holte ich mir nach und nach viele Tiere in mein kleines Kinderzimmer: Meerschweinchen, Fische, Eidechsen und Molche. Die Meerschweinchen bekamen Koliken, die Eidechsen lebten nicht lange, und die Fische hausten in viel zu vielen Arten in einem viel zu kleinen Aquarium. Meine Faszination paarte sich mit einem schlechten Gewissen. Sie umschlangen einander sehr eng und waren selten zu trennen.
Ich wurde kein Zoodirektor. Der schlechte Biologieunterricht in der Schule zerstörte mir meinen Traum. Vielleicht war es auch gut so. Der frühere Kölner Zoodirektor Gunther Nogge sagte zu mir: »Seien Sie froh, dass Sie es nicht geworden sind!« So erhielt ich mir meine Faszination für Tiere, aber auch mein schlechtes Gewissen.
Beides war noch wach, als in der Mitte der Neunzigerjahre der BSE-Skandal und gleich darauf das Klonschaf Dolly die Bevölkerung aufschreckten. Ich schrieb einen Essay über Tierethik und ein Dossier über Zoologische Gärten für Die Zeit; die Poesie des Herzens, die nur das Beste für alle Tiere wollte hier, die Prosa der Verhältnisse eines barbarischen und problematischen Umgangs mit dem Tier in der Gesellschaft dort.
Im Februar 1997 verschlug mich der Zufall nach Braunschweig zu einem Kongress über »Tiere – Rechte – Ethik«. Für mich war es eine Art intellektuelles Woodstock einer neuen Bewegung. Menschen aus dem ganzen Bundesgebiet waren angereist, und auch die Braunschweiger Bevölkerung nahm sehr regen Anteil. Ich lernte Manuela Linnemann kennen, die Geheime Rätin der Tierrechtsbewegung, die den Kongress glänzend organisiert hatte. Der Schriftsteller Hans Wollschläger predigte in der St.-Andreas-Kirche fulminante Worte über den Paradiesgarten und die abtrünnige Menschheit. Der sympathische Schweizer Philosoph Jean-Claude Wolf gehörte bereits zu den versierteren Denkern auf diesem Gebiet, der Philosoph Michael Hauskeller, ebenso jung wie ich, noch zu den Neueren. Mit dem Biologen und Philosophen Hans Werner Ingensiep, einem der spannendsten Denker, die mir je begegnet sind, und seiner Lebensgefährtin, der Theologin Heike Baranzke, verbindet mich seitdem eine lange Freundschaft. Auch die Frontkämpfer fehlten nicht. Die Tierrechtsorganisation Animal Peaceerlebte gerade einen Boom an Spendern, und der Tierrechtler Helmut Kaplan befeuerte die Aktivisten mit radikalen Schriften und kühnen Sprüchen.
Die Gedanken, die wir in Vorträgen und Gesprächen verkündeten, diskutierten und überdachten, hatten damals noch etwas sehr Neues. Zwar hatte der australische Philosoph Peter Singer bereits 1975 sein berühmtes Buch über Die Befreiung der Tiere geschrieben. Aber eine Tierrechtsbewegung entstand, anders als in England und den USA, in Deutschland erst langsam in den späten Achtzigerjahren. Nun, in der Mitte der Neunzigerjahre, war das Thema endlich gesellschaftlich relevant geworden: Können wir unseren alltäglichen Umgang mit Tieren weiterhin moralisch rechtfertigen? Die Massenmedien griffen das Thema auf. Der Journalist Manfred Karremann drehte Filme über Massentierhaltung, Schlachthäuser und Tiertransporte und brachte das Elend der Tiere damit in die deutschen Wohnzimmer. Die inzwischen eingestellte Zeitung Die Woche nahm dagegen den radikalen Flügel der Bewegung ins Visier. Sie berichtete über angesägte Hochsitze, eingeschlagene Schaufenster von Metzgereien und warnte auf einer Doppelseite vor »Tierschutzterrorismus«.
In diesem Klima erschien im Herbst 1997 mein Buch Noahs Erbe. Seine Zustimmung und Ablehnung verlief, wie ich es mir erhofft hatte, oft quer zu den etablierten Freund-Feind-Linien zwischen Tierschützern, Artenschützern und Tierrechtlern. Bedauert habe ich dabei eigentlich nur jene Kritiken, die mir von einem pathologischen Menschenbild bis hin zu einer »ökofaschistischen« Gesinnung so ziemlich alles unterstellten, wovon ich selbst in den finstersten Winkeln meines Wirbeltiergehirns niemals geträumt hatte.
Seitdem ist viel und wenig geschehen. Seit November 1999 erfreuen sich die Menschenaffen in Neuseeland, und waren es damals auch nur acht an der Zahl, eines unantastbaren Rechts auf Leben. Der Tierschutz wurde 2002 als Staatsziel im deutschen Grundgesetz verankert. Die gravierendste Veränderung aber sind ohne Zweifel die vielen Menschen, die sich fleischlos oder vegan ernähren. Das Wort »vegan«, in den Neunzigern noch etwas höchst Obskures, das nur von wenigen seltsam blutleeren Bio-Vampiren betrieben wurde, ist heute in aller Munde. Ein veganes Kochbuch erreichte jüngst eine Millionenauflage. Und nahezu jeder kennt einen Veganer oder häufiger eine Veganerin. Nach einer Umfrage des Allensbacher Instituts aus dem Jahr 2015 gibt es in Deutschland inzwischen 7,8 Millionen Vegetarier und 900 000 Veganer.1
In den westlichen Industrienationen steigt die Sensibilität im Umgang mit Tieren unaufhaltsam an, insbesondere bei jungen Frauen. Doch diese Haltung hat zugleich etwas sehr Privates. Schönheit, Fitness, Gesundheit und Tierliebe sind meist auf einen Nahhorizont beschränkt. Waren der Kampf für Tierrechte und die vegane Ernährung früher fast untrennbar miteinander verbunden gewesen, so hat sich das eine heute vom anderen gelöst. In Westeuropa gibt es inzwischen mehr Massentierhaltung, mehr Legebatterien und mehr industrielles Tierelend als je zuvor. Gut versteckt vor der Öffentlichkeit, arbeitet diese Maschinerie, trotz gelegentlichen Protesten, heftiger denn je. Noch nie war die Kluft so groß, die das, was Menschen im Umgang mit Tieren für richtig halten, und das, was tatsächlich praktiziert wird, voneinander trennt. Solange wir unsere Ernährung und unser persönliches Verhältnis zu Tieren als Privatsache auffassen, so lange wird die millionenfache Grausamkeit gegen Tiere weiterhin gesellschaftlich akzeptiert.
In dieser Lage stellen sich manche Fragen, die in Noahs Erbe behandelt wurden, anders und neu. Auch viele Zahlen sind, wie könnte es auch anders sein, veraltet. In den Wissenschaften, wie der Paläoanthropologie, der Primatologie und der Verhaltensökologie, ist in den letzten beiden Jahrzehnten einiges geschehen, das es zu berücksichtigen gilt. Die historische Forschung über das Verhältnis von Mensch und Tier hat manches Neue zutage gefördert, ebenso in den Religionen wie in der Philosophie. Die akademische Debatte über eine angemessene »Tierethik« hat stark an Fahrt aufgenommen. Und nicht zuletzt hat meine eigene Beschäftigung mit dem Wesen und den Spielregeln moralischen Handelns zu mancher neuen Einschätzung und Bewertung geführt. Manches von dem, was Menschen tun oder lassen, erscheint mir mit über fünfzig in einem anderen Licht als mit Anfang dreißig …
Einleitung
Wir haben nicht zwei Herzen – eins für die Tiere und eins für die Menschen.
Alphonse de Lamartine
Es gibt zwei Kategorien von Tieren. Die eine glaubt, dass es zwei Kategorien von Tieren gibt, und die andere hat darunter zu leiden. Die eine nennt sich selbst »Menschen« und die andere sind eben »nur Tiere«. Die eine besitzt eine Menge großartiger Fähigkeiten: Sie hat eine Sprache, gebraucht Werkzeuge und kann aufrecht durchs Leben schreiten. Die andere kann nur einen Teil davon. Sie ist folglich dümmer, irgendwie mangelhaft und entsprechend rechtlos.
Manche Unterschiede machen einen Unterschied, und manche tun dies nicht. In der gegenwärtigen Moral und Rechtsordnung ist der Unterschied zwischen Schimpanse und Mensch größer als jener zwischen Schimpanse und Blattlaus. Die Rechte des Menschen regeln die Verfassung und das Bürgerliche Gesetzbuch, der Schimpanse hingegen hat überhaupt keine Rechte. Seine Belange regelt ebenso wie jene des Maulwurfs das Tierschutzgesetz. Maulwürfe und Schimpansen sind keine Rechtssubjekte. Man darf sie in enge Käfige einpferchen, man darf sie mit Elektroschocks foltern, mit tödlichen Keimen infizieren, sie am lebendigen Leib verätzen, sie verstümmeln und vergiften.
Das vernünftige und sittliche Leben und das unvernünftige, rohe Leben teilen die Welt in zwei Herrschaftsbereiche. Einer davon besitzt ein moralisches Siegel. Der andere dagegen ist ein nahezu unbeschriebenes Blatt. Fast hundertsechzig Jahre ist es her, dass der britische Naturforscher Charles Darwin den gemeinsamen Ursprung, die fließenden Übergänge und zarten Verästelungen allen Lebens bewies. Doch Menschen gelten weder alltagssprachlich noch rechtlich als Tiere. Eine alte Gewohnheit trennt den Menschen von seinen animalischen Verwandten. Es gehört zu den eigentümlichen Folgen der Darwin’schen Wende, dass sie, mit einigen kleineren Korrekturen, das anthropozentrische Weltbild unangetastet ließ. Kaum jemand dürfte sich als jener Trockennasenprimat in der Verwandtschaft von Menschenaffen, Meerkatzen und Pavianen sehen, als den uns die Zoologie klassifiziert. Stattdessen definieren wir uns als Menschen und geben uns alle Mühe, unsere animalische Natur zu vergessen und zu verbergen.
Das Band zu den anderen Tieren haben wir vor langer Zeit zerschnitten. Vor etwa 10 000 Jahren hat der Mensch gelernt, die Rohstoffreserve »Tier« planmäßig zu züchten. Er hält sie von nun an in Form eines lebenden Versorgungsvorrats zum eigenen Nutzen und Frommen. In den Anfängen der Tierzucht legten manche sesshaft gewordenen Jäger gestorbene Hunde in dafür vorgesehene Gruben und bestatteten sogar Mutter, Kind und Rinder gemeinsam. Welten klaffen zwischen dem animistischen Glauben der ersten Viehzüchter und der materialistischen Massentierhaltung der modernen Gesellschaft. Mit dem Ende der Konkurrenz schwand die Notwendigkeit, sich mit dem Tier als einem Lebewesen auseinanderzusetzen. Heute nutzen wir die Ressource »Tier« völlig fraglos für die Ansprüche des Menschen. Das Gemeinsame von Tier und Mensch trat in den Hintergrund. Zwar lebte das Tier noch immer in der kulturellen Fantasie fort, als magische oder fantastische Gestalt, als Freund, Gefährte oder Bedrohung. Doch die Bedeutung in der Alltagswelt ermattete auf Schwundstufen der Natur wie Schoßhund, Zierguppy, Legehenne und Zirkuspferd. Grenzenlos überlegen und unabhängig gegenüber den Tieren seiner Umwelt, entwickelte sich im menschlichen Bewusstsein ein völlig entfremdetes Verhältnis. Nicht nur radikale Ausnutzung und Sadismus, auch falsch verstandene Liebe, Denaturierung und unfreiwillige Quälerei bestimmen seither den menschlichen Umgang mit dem Tier.
Bis ins frühe Mittelalter überwog die Zahl der wilden Tiere die Anzahl der Nutz- und Haustiere, die der Mensch in seinen Dienst gestellt hatte. Doch spätestens mit dem Siegeszug des Kapitalismus in Westeuropa und Nordamerika verschwanden die Reste der Ehrfurcht in die Märchenbücher und Zirkusdarbietungen. Moderne Agrarunternehmen, Industriemetropolen, Autobahnen und Hochspannungsmasten bilden das Ornament unserer Umwelt, die wir seit mehreren hundert Jahren »Landschaft« nennen. Nirgendwo in der Alltagswelt eines Menschen der westlichen Zivilisation begegnet uns das Tier noch als Konkurrent: nicht bei der Ernährung, nicht im Kampf um den Lebensraum und nicht als Fressfeind, dessen Zähne und Klauen ernsthaft Furcht erregen könnten. Das einzig Bedrohliche, das heute bleibt, sind ausgerechnet ein paar kleine Tiere, etwa Ratten und Mäuse, die letzten gefährlichen Fresskonkurrenten des Menschen. Dazu kommen Insekten, Mikroben und Viren.
Das Band zwischen uns und den anderen Tieren wuchs auch nicht dadurch wieder zusammen, dass wir die Tiere über die Wissenschaft als Verwandte wiederentdeckten. Seit mehr als zweitausend Jahren sieht sich der Mensch als legitimer Herrscher über eine beherrschbare Umwelt, dazu geschaffen, sie zu nutzen und auszubeuten. Unsere Evolution hat sich dabei rasant beschleunigt. Längst findet sie kaum noch in unserem Körper statt, sondern vor allem in unserer Technik und Kultur. Und schon lange dient sie nicht mehr dazu, sich der Natur anzupassen. Sie dient einer immer wieder neu geschaffenen menschlichen Kultur. Anpassung bedeutet heute, sich an den eigenen Fortschritt anzupassen mit all den bekannten Folgen für unsere Umwelt. Dramatische Klimawechsel, die Zerstörung der schützenden Ozonschicht, die Versteppung weiter Landstriche auf allen Südkontinenten und die Vergiftung der Meere vernichten nicht nur die nichtmenschliche Tierwelt, sie betreffen mehr und mehr den Menschen selbst.
In atemberaubendem Tempo beschleunigte das industrialisierte 20. Jahrhundert die Beherrschung und Ausbeutung der Natur und mit ihr die der Tiere. Schon in den vergangenen Jahrtausenden hatte Homo sapiens den gesamten Planeten in Besitz genommen. Kein größeres Wirbeltier besitzt ein solches Verbreitungsgebiet, bewohnt Wüsten, Regenwälder und Polarregionen gleichermaßen. Und kein größeres Wirbeltier hat sich zu Milliarden vermehrt. Rücksichtslose Plünderung der Rohstoffe und ein ungeheures Bevölkerungswachstum der Spezies Homo sapiens schaffen einen erdgeschichtlichen Ausnahmezustand.
Der Mensch beherrscht heute den Planeten, aber offensichtlich nicht sich selbst. Es könnte daran liegen, dass es »den Menschen« gar nicht gibt. Stattdessen gibt es mehr als sieben Milliarden unterschiedliche Individuen. Und niemand davon ist für die Menschheit zuständig. Sie ist eine Gemeinde, der anzugehören nicht dazu verpflichtet, sich um das Ganze zu sorgen und zu kümmern.
Zu herrschen bedeutet, Ordnungen zu etablieren und Regeln dafür aufzustellen, was wichtig ist und unwichtig, richtig oder falsch. Jahrhundertelang sah die Moral der abendländischen Zivilisation in der Ausrottung der Wildtiere und Ausbeutung der Nutztiere nahezu kein Problem. Eine klare Grenzziehung erlaubte jeden Umgang mit dem Tier, von der Liebe bis zur Folter, von der Zucht bis zur Tötung. Das Argument war schlicht: Der Mensch ist eine Sonderanfertigung Gottes und mit dem Tier gerade mal durch den losen Faden der göttlichen Schöpfungstat verbunden. So kam, in den Worten des deutsch-französischen Theologen und Arztes Albert Schweitzer, »die Ansicht auf, dass es wertloses Leben gäbe, dessen Schädigung und Vernichtung nichts auf sich habe. Unter wertlosem Leben werden dann, je nach den Umständen, Arten von Insekten oder primitive Völker verstanden.«2 (Eine Klientel, die sich überdies noch um Frauen erweitern ließe.)
Diese Grenze wurde und wird in der abendländischen Kulturgeschichte variantenreich verteidigt. Doch je genauer wir sie betrachten, umso seltsamer erscheint sie uns. Denn sie lässt sich immer schlechter begründen, und zwar sowohl philosophisch als auch biologisch. Seit etwa vierzig Jahren besteht in der Gesellschaft eine Debatte, die unseren Umgang mit Tieren grundsätzlich infrage stellt. Tierethiker wie Peter Singer und sein US-amerikanischer Philosophenkollege Tom Regan fordern Rechte auch für Tiere. Der Ausschluss der Tiere aus der Ethik sei ein moralischer Skandal. Das Tier heute moralisch draußen vor der Tür zu lassen sei das Erbe eines religiösen Aberglaubens. Da der Mensch keine Sonderanfertigung Gottes sei, sondern ein intelligentes Tier, müssten wir die Reichweite der Moral ebenso auf die »anderen Tiere« ausdehnen. Haben wir nicht nach und nach gelernt, die Sklaverei zu ächten und Frauen als gleichberechtigte Menschen zu achten? Und ist es nun nicht an der Zeit, neu über Tiere nachzudenken und sie moralisch angemessen zu beurteilen?
Doch wie könnte ein solcher angemessener Umgang mit den anderen Tieren aussehen? Den Menschen als ein Tier unter anderen anzusehen könnte ja auch bedeuten, ihn abzuwerten, statt die Tiere moralisch ernster zu nehmen. Das Unheil des Sozialdarwinismus und der barbarischen Rassentheorie steht uns mahnend vor Augen. Und was ist überhaupt das Kriterium dafür, Tiere moralisch zu achten? Ist es ihre Leidensfähigkeit, ihr Lebenswille oder ihre Intelligenz? Haben kluge Tiere ein höheres Lebensrecht als dümmere? Das Verhältnis des Menschen zu den anderen Tieren neu zu bewerten ist eine große und schwierige Aufgabe.
Ich möchte in diesem Buch versuchen, diese Fragen neu zu stellen und zu durchdenken. Dabei betrachte ich den Menschen als ein besonderes Tier unter vielen auf andere Weise besonderen Tieren. Ich möchte mich nicht darauf festlegen, den Menschen allgemein über bestimmte Eigenschaften zu definieren, die ihn ethisch wertvoll machen sollen. Ich möchte ihm aber auch nicht im Umkehrschluss alle gemeinhin als »menschlich« bezeichneten Eigenschaften absprechen, weil nicht alle Menschen Träger all dieser Eigenschaften sind. Vielleicht ist bereits das Suchen nach solchen exklusiven Eigenschaften der falsche Weg. Der Denkfehler könnte bereits darin liegen, eigenständige Disziplinen wie »Anthropologie« oder »Moralphilosophie« betreiben zu wollen, die eine solche enge Definition des Menschen voraussetzen. Wäre es nicht besser, die Enge des Begriffs zu sprengen? Statt Anthropologie zu betreiben, sollte man sich lieber mit einer Anthrozoologie beschäftigen – eine Lehre vom Menschentier und den anderen Tieren.
Der Begriff ist neu, er wurde erst vor wenigen Jahren unter anderem von dem US-amerikanischen Psychologen Hal Herzog eingeführt.3 Die neue Disziplin der Human-Animal Studies konzentriert sich weitreichend darauf, was Menschen und andere Tiere verbindet. Dabei verwende ich den Begriff »Anthrozoologie« allerdings etwas anders als Herzog und die Vertreter der Human-Animal Studies. Es ist ein etwas eintöniger Sport, alles, was gemeinhin als »menschlich« betrachtet wird, als Mythos zu entzaubern. Ich möchte es lieber anders einbetten und bewerten. Denn ich meine, dass die Vertreter der Human-Animal Studies ihre Definition des Menschen als ein Tier unter Tieren nicht ganz zu Ende denken. Denn wäre der Mensch durch nichts Menschliches grundsätzlich vom Tier unterschieden, wie sie annehmen, so ließe sich auch nicht einfordern, dass Menschen sich aus vernünftiger Einsicht angemessen gegenüber Tieren verhalten sollen!
Um menschliches Handeln zu verstehen, müssen wir verstehen, in welchem Rahmen Menschen die Welt sehen, sich orientieren und handeln. Die beiden ersten Teile des Buches skizzieren diesen biologischen und den kulturellen Rahmen. In ihnen möchte ich zeigen, auf welche Art und Weise Menschen sich unter Tieren verhielten und verhalten. Dabei beschäftigt sich der erste Teil mit der Frage, was für ein spezielles Tier der Mensch eigentlich ist. Wie ist seine Rolle in der Evolution? Und nach welchen Denkmustern haben Menschen diese Chronik unserer selbst seit der Antike geschrieben? (Die Ordnung der Schöpfung). Welche Stellung hat sich Homo sapiens in der Natur dadurch gesichert, dass er sie sich zuschrieb? (Der Primat).
In jeder menschlichen Wissenschaft vom Leben besteht bis heute, stillschweigend oder lauthals verkündet, zwischen Mensch und Tier eine Grenze. Doch weiß weder die Evolutionsbiologie noch die Paläoanthropologie mit Gewissheit zu sagen, an welchem Punkt sich nur animalisches von menschlichem Leben scheidet. Was haben Paläoanthropologen in den letzten hundert Jahren darüber geglaubt? Und was denken sie heute? (Der aufrechte Affe). Dabei werden wir sehen, dass es mit der Grenze zwischen dem Menschen und den anderen Tieren eine äußerst komplizierte Sache ist. Seit Jahrzehnten messen und vergleichen Verhaltensforscher die kognitiven Leistungen von Tieren mit jenen des Menschen, mit dem überraschenden Ergebnis, dass Tiere in nahezu allen »wichtigen« Punkten unterlegen sind: bei Kulturleistungen wie Werkzeuggebrauch und Religion ebenso wie beim Erwerb der menschlichen Sprache. Doch haben wir bei solchen Messungen tatsächlich den richtigen, den fairen Maßstab? Ist es sinnvoll, die Intelligenz von Menschenaffen mit uns zu vergleichen? (Sinn und Sinnlichkeit).
Die Molekulargenetik zeigt uns, dass Menschen biologisch Schimpansen sind. Welche Konsequenzen ziehen wir daraus? (Eins Komma sechs Prozent). Nachdem wir den Menschen auf diese Weise biologisch eingekreist haben, werfen wir noch einen Blick darauf, wie objektiv unser Wissen vom Menschen und den anderen Tieren ist. Was können wir überhaupt über das Bewusstsein anderer Tiere wissen? Stellt es nicht eine so große Barriere dar, dass wir zugeben müssen, nichts Definitives sagen zu können? (Die Tücke des Subjekts).
Im zweiten Teil werfe ich einen Blick in die Kulturgeschichte des Mensch-Tier-Verhältnisses. Was haben Menschen zu welcher Zeit über Tiere gedacht und warum? Wie hat man sie behandelt? Und welche Sensibilität oder Kälte setzte sich warum durch? Was wissen wir darüber aus der Jungsteinzeit? (Die Tundra des Gewissens). Was glaubten und dachten die alten Ägypter? (»Ich habe kein Tier misshandelt«). Und warum entzauberte das alte Judentum die Tiere? (Hirten und Herrscher).
In der abendländischen Philosophie gibt es seit der Antike sehr unterschiedliche Deutungen von Tieren. Mal sehen die Denker eine große spirituelle oder naturgeschichtliche Nähe, mal erheben sie den Menschen qua seiner Vernunft zum uneingeschränkten Weltenherrscher. (Das verlorene Paradies). In der christlichen Religion dagegen werden Menschen und Tiere deutlich voneinander geschieden: eine Sonderanfertigung hier, eine Dreingabe dort. Das Christentum entfernt die tierfreundlichen Momente der jüdischen Religion aus den Glaubenslehren. (»Kümmert sich Gott etwa um die Ochsen?«). Anders verläuft der Weg in Indien, China und Südostasien. Das Weltbild und die Tierethik von Hindus und Buddhisten unterscheiden sich von der unseren. (Scheinheilige Kühe). Im Abendland dagegen dominiert in der Nachfolge des französischen Philosophen René Descartes eine »rationalistische« kalte Perspektive auf das Tier. Tiere, weil sie nicht vernunftfähig seien, werden kaum noch als Lebewesen wahrgenommen – eine Position, die im 18. Jahrhundert allerdings ziemlich kontrovers diskutiert wird. (Die Denker und das liebe Vieh). Nach und nach entstehen im späten 18. Jahrhundert eine neue Mitleidsethik und sogar erste Forderungen nach Rechten für Tiere. (»Können sie leiden?«).
Im dritten Teil möchte ich eine eigene ethische Haltung entwickeln. Zunächst werden Theorien von Philosophen des 20. Jahrhunderts vorgestellt, die, wie Albert Schweitzer, »Ehrfurcht vor dem Leben« verlangen oder Tieren einen hohen moralischen Status zusprechen, wie Peter Singer und Tom Regan. (Das eiserne Tor). Diese Positionen zwingen dazu, grundsätzlicher darüber nachzudenken, was das »Tierrecht« vom »Tierschutz« unterscheiden soll. (Schutz oder Recht?). Anschließend möchte ich die Schwachstellen der gängigen Tierrechtsphilosophien herausarbeiten und zeigen, warum ich sie weder dem Menschen für angemessen halte noch für allgemein praktikabel. (Eine artgerechte Moral). Daran schließen sich meine Überlegungen an, was ein angemessener Umgang mit Tieren sein könnte. (Gut, besser, am besten).
Solchermaßen gerüstet, können wir uns im vierten Teil mit den vielen Problemen befassen, die sich im Alltag stellen. Das erste dieser Kapitel bilanziert das alltägliche Chaos im Umgang mit Tieren. (Lieben– Hassen– Essen). Danach wenden wir den Blick auf die rechtliche Situation und unterziehen die Logik unseres Tierschutzgesetzes einer genaueren Prüfung. (Ein kurzer Text über das Töten). Das nächste Kapitel gilt der Jagd. Ist Jagen arttypisches Verhalten des Menschen oder eine staatlich legitimierte Perversion? (Naturschutz oder Lustmord?). Und wie sieht es mit unserer Ernährung aus? Welche Argumente sprechen dafür, dass Menschen in unseren heutigen westlichen Gesellschaften noch Tiere töten dürfen, um sich von ihnen zu ernähren? Und welche Argumente sprechen dagegen? Vielleicht gibt es sogar schon in Kürze einen Ausweg, der uns endlich hilft, die Massentierhaltung zu beseitigen. (Jenseits von Wurst und Käse). Ebenso stellt sich die Frage, unter welchen Umständen Tierversuche zukünftig erlaubt sein sollten und unter welchen nicht. (Das Tier als Dummy). Ist es moralisch vertretbar, Tiere in Zoologischen Gärten zu halten? Und wenn ja, welche und welche nicht? (Alcatraz oder Psychotop?). Zoos verstehen sich heute als »Naturschutzzentren«, die Tiere erhalten, die in ihren Heimatländern vom Aussterben bedroht sind. Wie ist dies zu bewerten? (Das Zeitalter der Einsamkeit). Dabei stoßen wir auf die Schwierigkeit, dass Tierschutz, Tierrecht und Artenschutz keine natürlichen Verbündeten sind, sondern sich in ihrer Philosophie, ihrer Weltanschauung und ihren Zielsetzungen stark unterscheiden. (Das unversöhnliche Triumvirat). Das Schlusswort bilanziert diese Erkenntnisse und fragt, was wir aus alledem pragmatisch folgern sollten und in welchen Schritten es geschehen könnte. (Schopenhauers Treppe).
Das Menschentier
Die Ordnung der Schöpfung
Wie menschlich ist die Evolution?
Nicht das, was du nicht weißt, bringt dich in Schwierigkeiten, sondern das, was du sicher zu wissen glaubst, obwohl es gar nicht wahr ist.
Mark Twain
Es gab einmal eine Welt, da weideten sich schwerfällige Apathosaurier am saftigen Grün der Farne und Schachtelhalme; Trilobiten krabbelten bäuchlings über den Meeressand, Tyrannosaurier wateten hungrig durchs Gesümpf.
Wir leben nicht in dieser Welt. Wir leben in unserer Welt. Unsere Welt ist das Hier und Jetzt, begrenzt durch unseren Verstand, eingezäunt durch die Märchenhecke der Kultur. Was immer wir über die Dinosaurier zu wissen glauben, wir müssen uns ihre Welt, die wir nicht erleben, erst konstruieren. Wir müssen sie ausmalen mit den Buntstiften unserer Fantasie. Die Welt der Kreide und des Jura, die vor rund zweihundert Millionen Jahre begann –, dies alles ist ein Bild unserer Vorstellung, ein wahrscheinliches Bild vielleicht, etwas, das wir geneigt sind, für Wahrheit zu halten. Aber dieses Bild hat sich schon oft verändert, und es wird sich gewiss noch weiter verändern.
Menschen neigen dazu, die Welt, in der sie leben, aufzuräumen. Es ist eine ziemlich arttypische Verhaltensweise. Wir sortieren die alltäglichen Dinge unseres Lebens, und ebenso sortieren wir die Gedanken über die Welt, die uns umgibt. Jede Ordnung, auch die der Natur, ist also ein menschlicher Entwurf. Und allem Anschein nach entstand das Bedürfnis, die Welt zu ordnen, in unserer Entwicklungsgeschichte parallel zur Entwicklung der Sprache. Denn ohne die künstliche Aufräumarbeit der Sprache wäre die Vorstellung von einer »Ordnung der Schöpfung« oder der »Natur« nicht möglich.
Wer auf die Ordnung angewiesen ist, bewegt sich gern in den sicheren Grenzen eines Systems. Nur innerhalb eines solchen Ordnungsgefüges fragt man nach Wahrheit und Geltung, Richtigkeit, Methode und Bedeutung. Zu leicht übersieht der Ordner dann die künstliche Behausung und die selbst gezimmerten Regale, in die er die Welt so sorgfältig hineinsortiert. Selten gelingt ihm ein Blick aus dem Fenster in die ungewisse Landschaft, die ihn umgibt. Und nur ein gewaltiger Sturm, ein Blitzschlag oder eine Erschütterung zwingt den Verwalter der Welt, die sichere Wohnstatt zu verlassen und sich ein anderes Haus zu bauen, das den Anfeindungen des neuen Klimas widersteht.
Erst im Rückblick auf die vielen Irrtümer der Vergangenheit erkennen wir dann unsere eigene Unzulänglichkeit beim Aufräumen. In der Gegenwart erscheint uns die jeweilige Ordnung meistens so selbstverständlich, dass wir gern über jede Möglichkeit der Veränderung lächeln. So haben Menschen mit völliger Gewissheit angenommen, dass die Erde eine Scheibe ist und dass Frauen und Sklaven keine Rechte zustehen. Und mit einem ebensolchen Lächeln betrachten wir heute die Gründe, mit denen Menschen sich im Laufe der Jahrhunderte von den Tieren zu unterscheiden glaubten.
Schon die alten Griechen, insbesondere Aristoteles (384 v. Chr. – 322 v. Chr.), haben sich für die Geschichte und das in vielen Details verborgene System der Natur interessiert. Er teilt die Tiere in Klassen ein, versucht zu ergründen, was Leben ist, und schafft damit die Grundlagen der Zoologie. Aber Aristoteles kennt nur wenige hundert Tiere. Eine »vollständige Naturgeschichte« wird das erste Mal im 18. Jahrhundert geschrieben – und auch sie ist äußerst unvollständig. Seitdem verfügen wir nicht nur über einen reichen Vorrat an gedachten Ordnungen von den Schöpfungsmythen bis hin zur Molekularbiologie. Wir kennen auch eine Wissenschaft, die sich »Taxonomie« nennt und jede Pflanze und jedes Tier systematisch in eine Inventarliste der Natur einträgt.
Dabei verraten die Denkschemata der Naturforscher nicht nur etwas über die klassifizierte Natur selbst, sondern ebenso über das Ordnungsbedürfnis und die Pfiffigkeit des menschlichen Geistes. Das 18. Jahrhundert ist eine Zeit, in der das Bürgertum an die Macht drängt und sich zunehmend gegen den Adel auflehnt. Seine schärfste Waffe ist etwas, das man »Vernunft« oder »Rationalität« nennt und das man gegen den Glauben ins Feld führt. Für die Philosophen der Rationalität ist die Welt keine vorgefundene Schöpfung mit fester Ordnung, sondern etwas, dass man geistig durchdringen und auf seine Logik und Widersprüche untersuchen kann. Dabei geben zunächst die Physik und die Mathematik das Schema vor, nach dem alle Erkenntnis, auch jene von Pflanzen und Tieren, funktionieren soll. Die Systematiker der Naturgeschichte suchen nach unverrückbaren Kriterien, objektiven Gesetzmäßigkeiten und logischen Verbindungen, um die unübersichtliche Welt der Lebewesen ihrer »wahren Anordnung« gemäß einzuteilen. Aber nicht alle Naturforscher glauben, dass ein solches Vorhaben tatsächlich gelingen kann. Manche halten die Natur für zu reichhaltig, um sie auf diese Weise zu klassifizieren. Weltanschauungen treffen aufeinander: auf der einen Seite der Glaube an ein vom Menschen prinzipiell völlig durchschaubares Natursystem; auf der anderen Seite eine unergründliche Schöpfung, in der der Mensch sich immer nur tastend fortbewegt.
Die erste Variante gilt im 18. Jahrhundert als der modernere Ansatz. Man orientiert sich dabei an einem Rationalismus, den René Descartes (1596 – 1650) schon hundert Jahre zuvor neu begründet hat. Dieser Rationalismus orientiert sich an der Mechanik. Die Schöpfung Gottes erscheint als eine einzige klug ausgetüftelte Maschine, die der Mensch Stück für Stück zu beherrschen lernt. Und das Universum besteht aus Materie in Bewegung, organisiert nach mathematischen Gesetzen. Obgleich das 18. Jahrhundert zentrale Spekulationen des Philosophen widerlegt, orientiert es sich in vielem an Descartes’ mechanistischer Denkweise. Sie tut dies vorzugsweise in jenen Disziplinen, deren Erkenntnisfortschritt zunächst gering bleibt. Und nirgendwo trifft dies in einem solchen Maß zu wie bei der Erforschung der biologischen Natur.
Doch dieses Weltbild hat problematische Folgen. Wer die Welt konsequent nach mechanistischen Grundsätzen betrachtet, hat für den Bereich der nichtmenschlichen Natur wenig Verständnis. Für Descartes sind Tiere nichts als Maschinen. Es macht keinen Unterschied, ob eine Maschine die äußere Gestalt und die inneren Organe eines Affen hat, oder ob es sich dabei tatsächlich um ein lebendes Tier handelt. Denn relevantes Leben kommt für den Denker nicht durch zirkulierendes Blut und Reizempfindungen in den Körper. Sondern bedeutsames Leben garantieren einzig und allein der erleuchtete Geist und seine Sprache.
Descartes’ Zeit kennt weder den Begriff des »Organismus«, die Besonderheit des Lebens noch die Evolution, sondern eben nur die Mechanik. Trotzdem ist seine Theorie von den Tieren als seelenlose Automaten im 17. und 18. Jahrhundert äußerst umstritten. Französische Philosophen schreiben Buch um Buch über die Tier-Frage und befehden sich dabei über mehr als hundert Jahre. Noch weiß man nichts von einer »Biologie«. Man betreibt eine neue Disziplin, die sich »Naturgeschichte« nennt und damit aufräumt, die Geschichte von Lebewesen als eine wahllose Sammlung von Erzählungen anzusehen. Bisher schrieben Autoren umstandslos von der Fangweise der Tiere, ihrer Anatomie, ihrer biblischen und allegorischen Bedeutung, ihrem praktischen Gebrauch, ihrer Vermehrung, ihren Stimmen und Sprachen, ihren Bewegungen, ihrem Alter und von der Sympathie oder Antipathie des Verfassers. Auch Kochrezepte wurden von Fall zu Fall hinzugefügt.
Ein zoologisches System ist zu Anfang des 18. Jahrhunderts weitgehend unbekannt, die Verwandtschaftsverhältnisse der Pflanzen und Tiere sind diffus geahnt und werden eher nach Lebensräumen bestimmt als nach körperlichen Merkmalen: Tiere, die nachts jagen, stehen dabei ebenso in einem Ordnungsgefüge wie Tiere, die fliegen können, im Wald oder in einem See leben. Bereits die Priesterschrift der biblischen Genesis hatte die Welt der Tiere und Pflanzen nicht nach anatomischen Merkmalen unterteilt, sondern in Bezug auf den Lebensraum: Pflanzen und Tiere des Meeres, der Luft und der Erde. Über mehr als tausend Jahre kannten auch der Islam und die Hindus Ordnungssysteme, die Tiere in ihrem Ökosystem verankerten.
In der hinduistischen Samkhya-Tradition existieren vierzehn Klassen unterschiedlicher Lebewesen, eingeteilt in acht Formen himmlischer und sechs irdischer Lebewesen, zu denen auch der Mensch gehört. Als weiteres Unterscheidungsmerkmal dient die Art und Weise der Geburt. Im großen indischen Nationalepos aus dem 4. Jahrhundert, dem Mahabharata, heißt es: »Auf dieser Erde gibt es zwei Arten von Lebewesen, die Beweglichen und die Unbeweglichen. Die Beweglichen haben einen dreifachen Schoß: Sie sind aus dem Ei, aus feuchter Hitze und Lebendig-Geborene. Von allen beweglichen Lebewesen wiederum sind diejenigen, die lebendig geboren sind … die besten. Die besten unter den lebendig Geborenen sind die, die zum Menschengeschlecht gehören, und die Nutztiere.«4
Die neuen Systeme des 18. Jahrhunderts befreien die Naturgeschichte von allem, was sich mit den Methoden der Zeit nicht wissenschaftlich exakt beschreiben lässt. Kochrezepte fallen sowieso unter den Tisch, aber auch manche Verhaltensbeobachtungen und vormals wichtige Eigenschaften wie zum Beispiel der Geruch. Geforscht wird mit Lupe und Mikroskop, Lineal und Pinzette. Der wichtigste Mann auf diesem Gebiet ist der schwedische Naturforscher Carl von Linné (1707 – 1778). Er orientiert sich an Aristoteles, den er bewundert, nicht an Descartes. Geradezu revolutionär demokratisch entwickelt der aufgeklärte Schwede im 18. Jahrhundert ein beschreibendes System der Natur, frei vom theologischen Firlefanz seiner Zeit. Mit der Akribie eines Briefmarkensammlers, dem Vollständigkeit mehr bedeutet als das Bestaunen einzelner Werte, ordnet er die belebte Natur nach Arten, Gattungen, Ordnungen und Klassen. Vier Variablen: die Form der Elemente, ihre Anzahl, die räumliche Anordnung der Elemente und ihre relative Größe, bestimmten von nun an den Platz im System.
Unter der Leitdisziplin der Botanik wandelt sich die Naturgeschichte in eine geordnete Welt aus Linien und Flächen. Entscheidend sind die sichtbaren Unterscheidungsmerkmale wie Blüten und Staubgefäße, Blätter und Früchte, Füße und Hufe, Federn und Flossen. So setzt Linné für jede Pflanzen- und Tierklasse, jede Ordnung und Gattung bestimmte Merkmale fest, die er als die wichtigeren erachtet. Denn nur unter der Annahme solcher privilegierter Strukturen ist es ihm möglich, die verschiedenen Spezies im Gesamtsystem unmissverständlich zu rastern. Der menschliche Ordner beschreibt also nicht einfach die belebte Natur. Er fügt ihr auch etwas hinzu: die Entscheidung nämlich, was in der Formenvielfalt der Lebewesen wichtige Merkmale sind und was nicht.
Wie alle damaligen Naturforscher nimmt Linné an, dass die Einteilungen, die der menschliche Verstand macht, tatsächlich einer objektiven Ordnung der Natur entsprechen. Doch Linnés System ist, wie er selbst weiß, nicht »natürlich«. Seine Strukturen sind keine, die er in der Natur als Unterscheidungskriterien vorfindet. Denn was sich am Schreibtisch nun mühsam in Ordnungen pressen lässt, liegt, wie der französische Naturforscher Michel Adanson (1727 – 1806) feststellt, in der Wildnis wie Kraut und Rüben durcheinander: »… eine konfuse Mischung aus Wesen … die der Zufall einander angenähert zu haben scheint. Hier wird das Gold mit einem anderen Metall, mit einem Stein oder mit Erde gemischt. Dort wächst die Eiche neben dem Veilchen. Unter diesen Pflanzen irren ebenfalls der Vierfüßler, das Reptil und das Insekt umher. Die Fische mischen sich sozusagen mit dem wässrigen Element, in dem sie schwimmen, und mit den Pflanzen, die auf dem Grunde der Gewässer wachsen … Diese Mischung ist sogar so allgemein und so vielfältig, dass sie eines der Naturgesetze zu sein scheint.«5
Der Widerspruch zwischen einer taxonomischen und einer ökologischen Ordnung der Natur ist offensichtlich. Er findet sich noch heute in der Diskussion um die Ästhetik von Zooanlagen. Soll man die Tiere nach Verwandtschaftsverhältnissen sammeln, also in Raubtierhäusern, Antilopenhäusern und Hirschanlagen, sodass der Besucher zwischen den anatomischen Besonderheiten der Arten– mitunter sogar den geografischen Varianten einer einzigen Art– zu unterscheiden lernt? Oder gewährt die Nachgestaltung eines Naturbiotops, einer afrikanischen Savanne oder eines alpinen Panoramas den wichtigeren Einblick in die Ordnung der Natur?
Zwar steht für Linné und seine Kollegen fest, dass die »wahre Ordnung« der Natur sich an den körperlichen Merkmalen zu orientieren hat, doch muss eine Erklärung dafür gefunden werden, warum diese Ordnung in der freien Natur nicht von allein sichtbar wird. Ohne Zweifel ist das System der Natur keine zeitlose Schöpfung, sondern durch Veränderungen gekennzeichnet, die sich in der Erdgeschichte ereignet haben. Parallel mehren sich die Funde von Fossilien, also von Tieren, die mutmaßlich ausgestorben sind. Es hat allem Anschein nach größere geologische Katastrophen in unbekannter Zahl gegeben, denen viele Arten zum Opfer gefallen sind. Doch haben diese Desaster auch zur Entstehung von neuen Formen geführt?
Um den Faktor der Zeit und seine Folgen für das System der Natur einzuschätzen, gibt es viele Möglichkeiten. Die einfachste und menschlichste aller zeitlichen Ordnungsvorstellungen ist die Idee, alles folge einem Plan und sei auf ein Ziel hin ausgerichtet (Teleologie). Religionen, Philosophien und Ideologien funktionieren nahezu allesamt zielgerichtet: Es geht um ein besseres Leben auf Erden, im Jenseits, in einem gerechten Staat, um die Herrschaft über die anderen, über die Produktionsmittel oder das Böse. Selbst unser Alltag gestaltet sich weitgehend teleologisch, durchtränkt von zukünftiger Erwartung. Motor jedweder Teleologie ist der Fortschrittsgedanke. Sein imaginäres Ziel ist der vollkommene Zustand. So glauben christlich-abendländische Gesellschaften gern an eine ständige Verbesserung durch Anstrengung; eine Tugend, die nach calvinistischer Tradition im Himmel wie auf Erden von Gott materiell entlohnt wird. Wie naheliegend also, auch in der Natur die Entstehung »höherer« Lebensformen durch Fortschritt erkennen zu wollen mit dem Endziel des Menschen.
Die Unordnung der Schöpfung mit einem göttlichen Fortschrittsplan in Einklang zu bringen, ist das Lebenswerk des Schweizer Naturforschers und Philosophen Charles Bonnet (1720 – 1793). Für Bonnet ist die Zahl der Arten und ihre äußere Gestalt von Gott ein für alle Mal festgelegt. Doch kann sich ein jedes Lebewesen perfektionieren. Der Weg vom simplen Gemüt zur genialischen Leistung ist vom Schöpfer vorgezeichnet. Und alle Tiere beschreiten ihn zeitlich versetzt nach dem gleichen Muster, das der Mensch ihnen vorgelebt hat: »Es wird einen mehr oder weniger langsamen und kontinuierlichen Fortschritt aller Arten zu einer höheren Vervollkommnung geben, sodass alle Grade der Stufenleiter in einer determinierenden und konstanten Beziehung fortgesetzt variabel sein werden … Es wird unter den Affen Leute wie Newton und unter Bibern wie (den Festungsbaumeister, R.D.P.) Vauban geben. Die Austern und die Polypen werden in Beziehung zu den höchsten Arten das sein, was die Vögel für die Vierfüßler im Verhältnis zum Menschen sind.«6
Seit Bonnet ist die Vorstellung von der »Leiter der Natur«, der Scala naturae, ein wichtiges Inventar des naturgeschichtlichen Denkens. Fortschritt, Vervollkommnung und göttlicher Plan – diese drei Größen bestimmen die Vorstellung vom Werden der Natur vom 18. Jahrhundert bis in die Gegenwart hinein. Das Prinzip, nach dem die Evolution Leben hervorbringt, sei unvermeidlich und von Anfang an vorherbestimmt. Nicht wenige Evolutionstheoretiker haben dies ebenfalls geglaubt, und zwar mit beachtlicher Kontinuität. Der englische Naturforscher Alfred Russel Wallace (1823 – 1913), der gemeinsam mit Darwin die Theorie der natürlichen Selektion entwickelt hatte, hielt nicht nur den menschlichen Geist und sein Moralempfinden, sondern zudem auch die weiche, nackte, empfindsame Haut des Menschen für das Resultat einer notwendigen Entwicklung.
Doch schon im 18. Jahrhundert regten sich zugleich vorsichtige Zweifel an der Stimmigkeit einer solchen Vorgeformtheit. Denn wie sollte man Naturkatastrophen bewerten? Während die meisten Naturforscher sie als Teil des göttlichen Schöpfungsplans interpretierten, zogen andere vergleichsweise finstere Schlüsse. Und so wurde tatsächlich ein großes Erdbeben zum indirekten Auslöser der Evolutionstheorie, nämlich jenes von Lissabon im Jahr 1755. Wer über die Katastrophe nachdachte, konnte starken Zweifel daran hegen, dass die Weltordnung ausgeklügelt und harmonisch sei.
Die weitestreichenden Schlussfolgerungen zog der englische Pfarrer und Nationalökonom Thomas Robert Malthus (1766 – 1834). Nicht nur die geologische Natur und ihr Gefahrenrisiko, sondern auch die Vermehrung der Bevölkerung wurde nun als Übel erkannt. Im Jahr 1798 publizierte Malthus seinen Essay on the Principle of Population (Das Bevölkerungsgesetz), die erste Mahnschrift vor den Gefahren einer Bevölkerungsexplosion. Bei einer Verdoppelungsrate der Weltbevölkerung innerhalb von fünfundzwanzig Jahren, errechnete Malthus, werde ihr exponentielles Anwachsen aufgrund der von der Umwelt gesetzten Grenzen notwendig zu Armut, Katastrophen und Tod führen. Der biblische Auftrag »Seid fruchtbar und mehret euch« erschien mit einem Mal als ein Fluch. Ein gnadenloser »Kampf ums Dasein« (struggle for life) war entfesselt. Das Einzige, was blieb, war die Hoffnung, die katastrophalen Folgen der göttlichen Anweisung so weit wie möglich eindämmen zu können.
In einer Zeit, als die Gesellschaftstheorie noch der Biologie den Leuchter voran und nicht wie heute die Schleppe hinterherträgt, begeistert sich vor allem ein englischer Dorfpfarrer, Charles Darwin (1809 – 1882), für die Malthus’schen Gesetze. Denn wenn es richtig ist, dass sich ein Tier mit einer so geringen Vermehrungsrate wie der Mensch gegenüber seinen Artgenossen durchsetzte, so gab es sichtlich andere Kriterien für die Überlebensfähigkeit einer Population als die Zahl ihrer Geburten. Der Maßstab für den Erfolg einer Spezies war ihr Durchsetzungsvermögen oder, wie Darwin es später in den Prinzipien der Biologie des jungen Philosophen Herbert Spencer (1820 – 1903) lesen konnte, »the survival of the fittest«.
Darwins naturkundliche Studien waren ursprünglich von dem Gedanken beseelt, die nichtanimalische Identität des Menschen zu beweisen. Erst der Sieg des Entdeckerstolzes über das Entsetzen verlieh ihm schließlich den Mut, den berühmten Satz zu schreiben: »Und ich bin beinahe überzeugt (der Meinung, mit der ich an die Frage herangetreten bin, völlig entgegengesetzt), dass die Spezies (mir ist es, als gestände ich einen Mord ein) nicht unveränderlich sind.«7
Darwins kühne Vermutung war nicht ganz neu. Bereits ein halbes Jahrhundert zuvor hatten der französische Naturforscher Georges-Louis Leclerc, Comte de Buffon (1707 – 1788) und der Philosoph Denis Diderot (1713 – 1784) über eine Veränderung der Arten spekuliert. Besonders Jean-Baptiste de Lamarck (1744 – 1829) behauptete die allmähliche Entwicklung der Arten aus primitiveren Vorformen, die sogenannte Transmutation. Lamarck war nicht nur ein Pionier, der mit Jahrmillionen hantierte, als alle Welt die Erde noch einige tausend bis hunderttausend Jahre jung wähnte, sondern er prägte (zur gleichen Zeit wie zwei deutsche Naturforscher) das Wort Biologie. Bei ihm wandelten sich die Lebewesen dadurch, dass sich ihre körperlichen Anstrengungen auf ihr Erbgut auswirken. Dabei nahm er allerdings nicht an, dass die Arten auseinander hervorgehen, wie Darwin es später tat. Lamarcks Theorie ist näher an jener von Bonnet. Für ihn vervollkommnen die einzelnen Tierarten im Laufe der Zeit ihre Anlagen und entwickeln sich dadurch immer höher. Besonders vollkommene Tiere, wie der Mensch, sind demnach sehr alt, denn sie haben einen weiten Weg von einem primitiven Organismus bis hin zur heutigen Gestalt hinter sich gelassen. Andere, wie der primitive Süßwasserpolyp, haben ihre Reise durch die Zeit gerade erst angefangen.
Lamarck war kein Charismatiker, und die zoologische Allmacht seines Vorgesetzten am Jardin des Plantes in Paris, des Barons George Cuvier (1769 – 1832), verhinderte, dass man sich allzu sehr mit seinen Theorien beschäftigte. Cuvier war ein bedeutender Mann. An die Stelle einer nach botanischem Muster verfahrenden Zoologie setzte er eine neue Wissenschaft, die sich weniger an äußeren Merkmalen als am Organismus der Tiere orientierte. Doch was die Transmutation anbelangte, blieb der Oberaufseher der protestantisch-theologischen Fakultäten Frankreichs beim konservativen Modell. Er verbreitete weiterhin, eine Kette von Naturkatastrophen habe als modifizierte Sintfluten ganzen Klassen von Tieren den Garaus gemacht. Diese Theorie ist weitgehend richtig, allerdings schließt sie die Transmutation nicht aus.
Das wirklich Revolutionäre an Lamarck war die Idee, die Geschichte der Natur nicht vom Menschen aus bis hinunter zur Bakterie zu schreiben, sondern umgekehrt von der Bakterie zum Menschen. Aus einem Modell der räumlichen Hierarchie wurde ein Modell der zeitlichen Entwicklung. Lamarck erkannte zudem, dass das Bewusstsein eines Tieres an die Physiologie und Neurologie seines Körpers gebunden ist. Demnach ist jeder Geist erstens begrenzt und zweitens veränderlich.
Die philosophische Konsequenz aus Lamarcks Denken ist so radikal, dass sie fast einhundertfünfzig Jahre lang von niemandem ernsthaft in Betracht gezogen wurde. Wie kann ein Geist, der den Gesetzen der Evolution unterworfen ist, sich eigentlich anmaßen, die Natur der Welt so zu erkennen, wie sie »an sich« ist? Von dieser Schlussfolgerung wollte die Biologie allerdings bis weit ins 20. Jahrhundert hinein nicht viel wissen.
Auch Darwins Theorie von der natürlichen Selektion der Lebewesen im Ringen um ihr Leben und mit der Umwelt entwickelte sich weiter. Gewitzten Zeitgenossen wie Karl Marx (1818 – 1883) war aufgefallen, wie stark Darwins Denken dem Zeitgeist des Viktorianischen Zeitalters verhaftet war: »Es ist merkwürdig, wie Darwin unter Bestien und Pflanzen seine englische Gesellschaft mit ihrer Teilung der Arbeit, Konkurrenz, Aufschluss neuer Märkte, ›Erfindungen‹ und Malthusschem ›Kampf ums Dasein‹ wiedererkennt.«8 Die Betonung des Malthus’schen Kampfes von jedem gegen jeden und auch der Fortschrittsglaube in Darwins Denken zeigen ihn stark seiner Zeit verhaftet.
Eine andere Kritik kam aus der Biologie selbst. Darwin hatte noch nichts von Genen gewusst. So konnte er nicht erklären, was sich biochemisch ereignete, wenn Arten sich veränderten. Der »Darwinismus« der Jahrhundertwende gab schließlich die Hoffnung auf, die Evolution ließe sich allein durch die natürliche Selektion der Arten nach Maßgabe ihrer Anpassungsfähigkeit an die Umwelt begründen. Man entdeckte die Rolle der Genetik, und zum neuen Erklärungsprinzip wurde das Modell der zwei Konstrukteure. Das Spiel des Lebens erhielt einen Würfel: zufällige Veränderungen im Genmaterial, also sogenannte Mutationen. Im Trial-and-Error-Verfahren entstehen im Erbgut gelegentlich Abweichungen, die dann erfolgreich sind, wenn sie sich in der Umwelt bewähren. Damit war die Idee vom Tisch, dass sich neu erworbene Eigenschaften oder »die anatomischen Auswirkungen körperlicher Anstrengungen«, wie Lamarck meinte, vererben könnten. Noch Darwin hatte dies für denkbar gehalten. So vertraute er Erzählungen, wonach bei jenen Volksgruppen, zu deren Riten die regelmäßige Beschneidung der Penisvorhaut gehört, sich die Vorhaut allmählich verkürzte. Das hätte zwar die Beschneidung überflüssig gemacht, aber Darwin hatte gerade anderes Gewichtiges zu bedenken, als darüber nachzusinnen.
Die Verkürzung der Vorhaut blieb im Wissensschatz der Darwinisten, bis August Weismann (1834 – 1914) im späten 19. Jahrhundert nachwies, dass ein solcher Informationsfluss vom äußeren Erscheinungsbild zum Erbmaterial nicht möglich sei. Über fünf Generationen kürzte Weismann einem Stamm von Mäusen ihre Schwänze, ohne dass eine Nachricht über diesen Eingriff die Keimbahnen der Mäuse erreichte. Denn siehe da: Auch die Schwänze der nachfolgenden Mäusegenerationen blieben gleich lang. Da bedurfte es schon der Spitzfindigkeit des irischen Dichters George Bernard Shaw (1856 – 1950), der Weismanns schneidende Widerlegung der Lamarck’schen Theorie leichtfertig vom Seziertisch wischte. Die Mäuse, bemerkte der Dichter, hätten gar keine Anstrengungen unternommen, ihre Schwänze zu verlieren, während sich die Tiere bei Lamarck ja darum bemüht hätten, sich zu verändern.
Im Nachhinein also war es der pädagogische Optimismus, der Lamarck in die Irre geführt haben sollte. So machte die Hoffnung auf einen ethisch ansprechenden Evolutionsverlauf – die Erwartung, die Menschheit entwickle sich qua Anpassung an das soziale Milieu durch Selbsterziehung zum Besseren – nur noch eine etwas abseitige Karriere im staatssozialistischen Biologieunterricht der Sowjetunion. Wie kalt dagegen der überlegene »Kampf ums Dasein«, der ja ein Kampf um die Fleischtöpfe ist, ohne Hoffnung, der Mensch werde den kühnen Geist statt seines materialistischen Gierhalses nach Höherem strecken. Und einzig die Kirche bewahrte unverdrossen einen lamarckistischen Gedanken – allerdings einen pessimistischen und keinen optimistischen. In bester Schützenhilfe für den französischen Chevalier verteidigt sie bis heute ihr molekulargenetisch bedenkliches Dogma, Adams Ungehorsam im Garten Eden habe zu einer »Erbsünde« geführt, die daraufhin auf alle zukünftigen Generationen übergegangen sei.
Immerhin sind in den beiden letzten Jahrzehnten einige Biologen wieder etwas offener dafür geworden, der Vererbung erworbener Eigenschaften einen Platz in der Genetik zu lassen. Zwar vererben sich psychische und physische Lebenserfahrungen nicht durch veränderte Gene. Aber es könnte doch sein, dass jene Schalter, die darüber bestimmen, welche genetische Information weitergegeben wird und welche nicht, durch Umwelteinflüsse verändert werden. Überlegungen wie diese beschäftigen sogenannte Epigenetiker seit einiger Zeit, sie haben einen wachsenden Einfluss auf unsere Vorstellung von der Evolution.
Die heutige Leitdisziplin, die uns die Verwandtschaft des Lebens entschlüsseln soll, ist die Genetik. Wir untersuchen die Summe aller genetischen Informationen und registrieren dabei Übereinstimmungen und Abweichungen mit anderen Arten. Doch der Prozess, die Natur unserer Natur zu erkennen, ist noch lange nicht abgeschlossen und wird wohl auch nie abgeschlossen sein. Wir wenden Ordnungsschemata auf Theorien und Theorien auf Beobachtungen an. Nur so kommen wir zu Kausalitäten und Gesetzen. Doch ihre Bedeutung verändert sich in dem Maße, wie wir den Blickpunkt unserer Aufmerksamkeit wieder verlagern. Dieser Vorgang des Entdeckens und des Verdeckens durch neue Denkschemata ist prinzipiell nicht abschließbar, denn selbst gegenwärtige Evolutionstheorien unterliegen weiterhin der Evolution.
Erstaunlicherweise hat die moderne Evolutionstheorie nur zu einer geringfügigen Korrektur alter Denkschemata geführt. Wie früher in der Naturgeschichte erkennen wir heute in der Biologie überall Regelhaftigkeit, Notwendigkeit und Vorteile. Doch bei näherer Sicht erweist sich die Evolution geradezu als Herrschaftsgebiet der Ausnahmen über die Regeln. Sie ist eine »Zweckmäßigkeit ohne Zweck«, wenn auch allein für die 0,1 Prozent der heute noch – oder gerade – existierenden Spezies, nicht aber für die 99,9 Prozent, die in den Urfluten, dem Ordovizium, dem Perm, der Kreide oder dem Tertiär, das Weltliche segneten. Evolutionsbiologen suchen in der Geschichte der Natur überall nach Vorteilen, die das Überleben von Arten erklären sollen. Dabei vermengen sie oft zwei verschiedene Vorteilsbegriffe. Einmal geht es um Mutationen, die situativ vorteilhafte Eigenschaften für eine Tierart hervorgebracht haben sollen. Eine größere Statur, ein pompöseres Geweih, ein stärkeres Gebiss sollen Weibchen beeindrucken und die Nachkommenschaft erhöhen. Da diese Eigenschaften aber oft nichts nützen, wenn der Zufall die Spielregeln der Umwelt ändert, gibt es einen zweiten Vorteilsbegriff. Danach ist das vorteilhaft in der Evolution, was vom Ende her betrachtet dazu geführt hat, dass eine Art überlebt. Nach dieser Sichtweise kann der mickrigste Pavian auf dem Felsen seine Gene weitergeben, wenn die stärkeren Konkurrenten bei einem Erdbeben ums Leben gekommen sind.
Angesichts zweier so unterschiedlicher Bedeutungen von »Vorteil«, fragt es sich, ob der Begriff in der Evolutionstheorie überhaupt sinnvoll verwendet werden kann. Tatsächlich ist er ein Erbe der Theologie des 17. und 18. Jahrhunderts, die überall in der Natur nach der klugen Vernunft Gottes suchte. Darwin kannte diese Tradition gut. Als Student verehrte er den Theologen William Paley (1743 – 1805), der, naturkundlich beschlagen, die göttliche Voraussicht auf den neuesten Stand gebracht hatte. Als Darwin sich von Gott verabschiedete und die natürliche Selektion erkannte, ersetzte er überall, wo Paley »God does« geschrieben hatte, den Satz durch »Nature does«. An Paleys Vorstellung, dass die Natur zweckmäßig eingerichtet sei und Vorteile belohne, hielt Darwin ebenso fest wie viele spätere Evolutionstheoretiker.
Die Frage ist deshalb wichtig, weil sie zeigt, wie eng unsere Vorstellung von der Natur bis hinein in die moderne Evolutionstheorie von sehr menschlichen Vorstellungen durchsetzt ist. Statt Vorteile zu benennen, würde es nämlich auch ausreichen zu sagen, dass alles in der Natur überleben kann, das für eine Art keinen tödlichen Nachteil hatte. Vermutlich überlebt in der Evolution nicht nur Zweckmäßiges, sondern jede Veränderung, die zumindest nicht zum Aussterben führt, und möglicherweise liegt gerade hierin der Grund für eine große Artenvielfalt.
Die traditionell verengte Sichtweise gilt insbesondere bei der Betrachtung des Menschen. Evolutionsbiologen können zahlreiche Vorteile benennen, die erklären, warum die menschliche Art so erfolgreich ist. Menschen sind äußerst anpassungsfähig und besiedeln fast alle Lebensräume, sie sind Allesfresser mit einer großen Nahrungsbandbreite, sie haben eine flexible Sozialstruktur und verfügen über ein Selbstbewusstsein, das es ihnen ermöglicht, ihr Verhalten zu korrigieren. So gesehen ist der Mensch gleichsam das optimalste aller Tiere. Doch alldem zum Trotz existieren Menschen der Gattung Homo sapiens erst seit rund 100 000 Jahren, und ihre langfristigen Zukunftschancen stehen schlecht. Denn mit all den vorteilhaften Eigenschaften haben Menschen in Rekordzeit ihre Umwelt zerstört und das langfristige Überleben der Spezies dramatisch infrage gestellt. Die mit weniger spektakulären Vorteilen ausgestatteten Dinosaurier existierten auf unserem Planeten hundertfünfzig Millionen Jahre, ganz zu schweigen von den seit über vierhundert Millionen Jahren nahezu unveränderten Nautiliden und Urschnecken.
Gesichert in der Evolutionstheorie ist, dass keine ihrer Annahmen gesichert ist. Evolutionsbiologen, die ihre Sache ernst nehmen, müssen immer auch die Evolutionsbedingtheit ihres eigenen Erkenntnisapparats reflektieren, also mithin die Evolution aller menschlichen Erkenntnis. »Letztlich ist«, wie der Neurobiologe Gerhard Roth schreibt, »jedes Nachdenken über die objektive Realität, sei es wissenschaftlich oder nicht, an die Bedingungen menschlichen Denkens, Sprechens und Handelns gebunden und muss sich darin bewähren«.9
Man muss reflektieren, dass die unvermeidlichen Ordnungsmittel des Geistes, das Denken und die Sprache, nicht die Wirklichkeit »an sich« aufräumen. Sie sind Modelle, die die unverfügbare Wirklichkeit nach Maßgabe der eigenen Spielregeln erklären. Nicht erst seit Erforschung der Evolution in den letzten zweihundert Jahren müht sich der menschliche Geist, dem Lauf der Welt einen– nach menschlichem Ermessen– »vernünftigen« Sinn zu geben. Doch das Paradoxe der Geschichte liegt darin, dass der menschliche Geist selbst Produkt evolutionärer Prozesse ist. Er ist Maßstab und Gemessenes zugleich.
An eine tatsächlich objektive Erkenntnis der Evolution wäre nur halbwegs sinnvoll zu denken, wenn die Evolution des Menschen abgeschlossen ist und damit die Stufe der größtmöglichen Vollkommenheit erreicht hat. In den Zeiten vor Lamarck und Darwin haben das nicht nur Theologen, sondern auch die Naturforscher fast allesamt geglaubt: Das menschliche Bewusstsein sei die unübertroffene Spitzenleistung des Schöpfergottes, geschaffen, die Welt so zu erkennen, wie sie »an sich« ist. Seinen schönsten Ausdruck fand diese Sicht in einem Ausspruch des jungen Philosophen Friedrich Wilhelm Joseph Schelling (1775 – 1854). Er meinte, dass der Mensch jenes Wesen sei, »in dem die Natur das Auge aufschlägt« und sich damit ihrer selbst bewusst wird. Ein hübscher Satz, aber doch viel zu pathetisch formuliert. Von der vollen Erkenntnis der Natur und unserer selbst sind wir noch immer weit entfernt. Aber wir können darüber staunen, dass die Evolution mit uns ein Lebewesen hervorgebracht hat, in dem die Natur sich für sich selbst faszinierbar gemacht hat. Wie hatte es dazu kommen können?
• Der Primat. Was ist ein Mensch?
Der Primat
Was ist ein Mensch?
Ordnung PRIMATES (Herrentiere)III: Unterordnung: ANTHROPOIDEA (Menschenähnliche)Überfamilie Hominoidae (Menschen)Unterfamilie Australopithecinae (Urmenschen)Unterfamilie HomininaeGattung HomoSpezies sapiens
Leichte Vögel, welke Blätter dahingetrieben vom Wind. Über den Akazienbäumen leuchtet trocken der Morgen. Wenige Stunden – und die Luft ist gesättigt vom Summen der Insekten. Die meisten Mitglieder der Horde liegen nach wie vor still und zusammengerollt im Wipfel des Baumes; nur allmählich klettern die ersten aus den Schlafnestern heraus. Tief unten im Tal rumoren die Geysire und heißen Quellen, Dämpfe umnebeln das nachtfeuchte Unterholz. Ein heißer Tag wartet hinter den Bergen darauf, die Erde zu sengen.
Hunderttausend Generationen später werden die Schlafnester verwaist sein. Die Menschheit wird erwacht sein und die Welt jenes Gesicht erhalten haben, das uns gegenwärtig erscheint. Doch wie sah das aus, als die Natur das erste Mal in einem affenähnlichen Wesen die Augen aufschlug? War es auf einer Waldwiese, in einem Hain, an einem Berghang oder auf einer Lichtung? War das erleuchtete Wesen ein Männchen oder ein Weibchen? Ging es den ganzen Tag aufrecht, oder saß es noch gerne in der Hocke, eng gekauert an seine Brüder und Schwestern? Und war es eine Eingebung, ein Blitzschlag, als das Selbstbewusstsein das erste Mal die Fesseln des Primatengehirns sprengte?
Wir wissen nicht, woran Schelling dachte, als er meinte, die Natur habe im Menschen ihr Auge aufgeschlagen. Sicher dachte er nicht an einen einzigen Moment, dem Millionen andere folgten. Er dachte an den »Menschen an sich«. Und er wusste nichts vom ostafrikanischen Great Rift Valley und von haarigen Vormenschen, die dort einst hausten. Er lebte in Jena und in München, und einen Menschenaffen hatte Schelling nie gesehen. Der einzigartige Moment, in dem die Natur sich ihrer selbst bewusst wird, bleibt eine Metapher.
Doch wie wurde der Mensch nun tatsächlich zum Menschen? Die Formulierung ist doppeldeutig. Denn wie der Mensch zum Menschen wurde – das ist nicht ein evolutionärer Prozess auf der leeren Weltbühne, sondern ein Spiel von Beobachter und Beobachtetem, Schauspieler und Zuschauer. Geschichte, auch Entwicklungsgeschichte, ist nichts Vorgefundenes. Der Mensch, schrieb der französische Philosoph Jean-Paul Sartre (1905 – 1980), macht sich selbst, wie der Romanschriftsteller, seine Figuren. Er ist gefertigt aus biologischen (anatomischen, neurologischen und physiologischen) Bestandteilen, zuallermeist jedoch durch jene wenig biologischen Weisheiten, mit denen sich diese Substanzen selbst zum »Menschen« erkoren.
Das Gleiche gilt für die menschliche Stammesgeschichte. Auch sie ist zunächst einmal eine Geschichte. Ihre Ursprünge liegen im alten Griechenland, als Aristoteles den Menschen und den Affen verwandtschaftlich naherückt: »Manche Tiere stehen zwischen Mensch und Vierfüßler in ihrem Wesen, wie Affen, Meerkatzen und Paviane … Ihr Gesicht hat viele Ähnlichkeiten mit dem des Menschen, Nase und Ohren gleichen den seinen, und Zähne hat er auch wie ein Mensch, die Vorderzähne wie die Backenzähne.«10 Auch Aristoteles’ Schüler Theophrast (ca. 370 v. Chr. – ca. 288 v. Chr.) besteht auf der Ähnlichkeit zwischen Menschen und Tieren. Er lehnt es sogar ab, Fleisch zu essen oder Tiere zu opfern, da man seine Verwandten nicht verspeise.
Aristoteles und Theophrast stellten den Menschen zwar neben den Affen – Menschenaffen kannte man noch nicht –, aber die alten Griechen hatten ihn nur sehr ungefähr zu einem Tier unter Tieren erklärt. Den nächsten Schritt machte mehr als zweitausend Jahre später Carl von Linné. An der Zugehörigkeit des Menschen zu den Säugetieren bestand für den Schweden kein Zweifel; die Behaarung und das Stillen der Jungen belehrten unmissverständlich darüber. Auch die Verwandtschaft mit Affen und Menschenaffen stand außer Frage. Hier waren es die flachen Finger- und Fußnägel statt der Klauen, der abgespreizte Daumen, die Greifhände, die zwei Zitzen der Weibchen und der frei herunterhängende, statt am Unterleib anliegende Penis – Merkmale, die größtenteils auch schon Aristoteles aufgefallen waren.
Doch Linné zögerte vor der Konsequenz. Händeringend suchte der gottesfürchtige Anatom nach einem Unterschied zwischen dem Menschen und den übrigen von ihm sogenannten »Primaten«: »Ich verlange«, schrieb er 1747 seinem deutschen Freund Johann Georg Gmelin, »von Ihnen und von der ganzen Welt, dass Sie mir ein Gattungsmerkmal zeigen … aufgrund dessen man zwischen Mensch und Affe unterscheiden kann. Ich weiß selbst mit äußerster Gewissheit von keinem.«11
Nach seinen Kriterien hätte Linné den Menschen zumindest mit dem Schimpansen gemeinsam in dieselbe Gattung einordnen müssen. Der Gedanke schwebte zeitgleich auch dem Philosophen Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778) vor, als er Schimpansen, Orang-Utans und Menschen sogar als Vertreter der Spezies Mensch ansah. Rousseau hatte nie einen Menschenaffen gesehen. Aber die Berichte, die er von Expeditionen nach Afrika und Südostasien las, ließen in ihm keinen Zweifel, dass die darin beschriebenen Menschenaffen »weder Tiere noch Götter, sondern Menschen« seien.12 Für den Aufklärer waren Menschenaffen edle Wilde, die von keiner Zivilisation in ihrem friedfertigen Wesen zerstört seien, anders als die Menschen in Europa. Ebenso dachte wenig später der schottische Sprachforscher James Burnett, Lord Monboddo (1714 – 1799). Auch er betrachtete den Orang-Utan als einen Menschen, nämlich als einen »sprachlosen Wilden«.
Interpretationen, wie Rousseau sie in Paris und Burnett bald darauf in Kincardineshire wagten, waren Linné im schwedischen Uppsala fremd. Den Menschen ins Tierreich einzuordnen war in den Augen der strengen protestantischen Kirche Sünde genug, und Linné zögerte, den letzten Schritt zu tun. In seiner Not sortierte er 1758 achselzuckend Mensch und Schimpanse in unterschiedliche Gattungen, zusammengefasst in der Ordnung der Primaten, in der sie auch heute noch mehr schlecht als recht hübsch getrennt nebeneinanderhocken: Homo sapiens, der »intelligible Mensch«, und Pan troglodytes, der »höhlenbewohnende Faun«.
So weit, so schön. Der Mensch wurde der oberste Primat, das höchste »Herrentier«, Linné bekam keinen Ärger mit der Kirche und die Naturwissenschaft den großen Wurf des Linné’schen Systems. Wenn nur diese Nachbarn nicht wären. Seit Bekanntwerden der Menschenaffen bemühten sich Wissenschaftler und Theologen immer wieder um den Versuch, den kleinen Graben mit großen Wassern zu füllen, der Homo sapiens und Pan troglodytes bei ihrer ordnungsgemäßen Vergesellschaftung auf der Affeninsel trennt. Sie evakuierten den Menschen vom Primatenfelsen und schufen ihm eine eigene Ordnung.