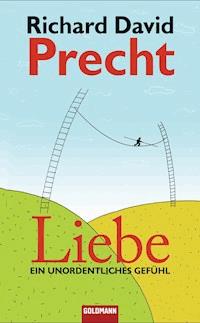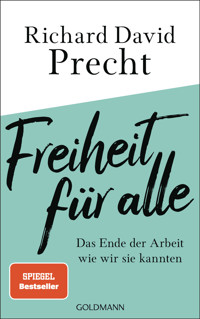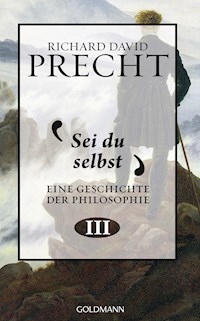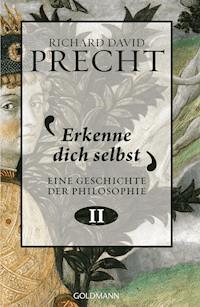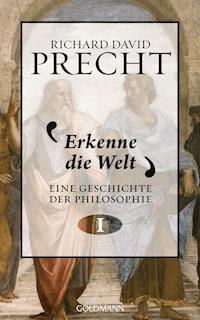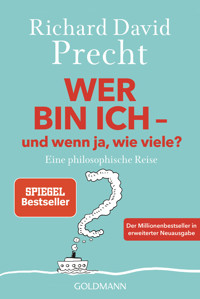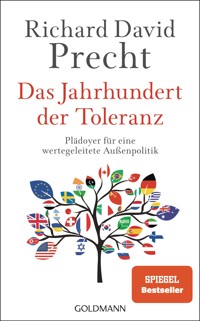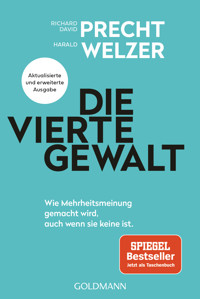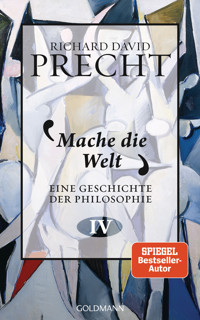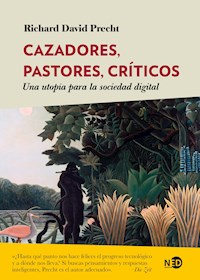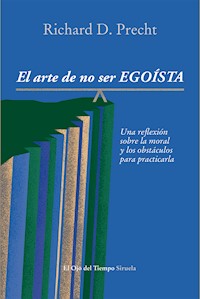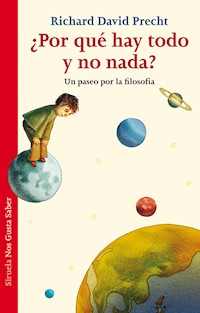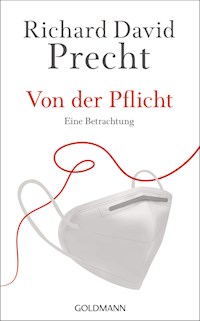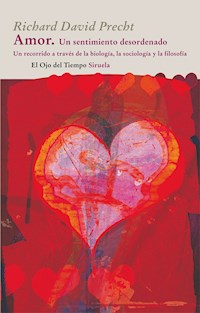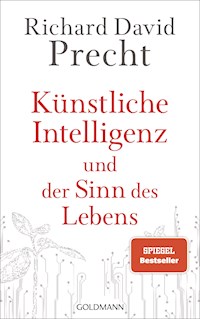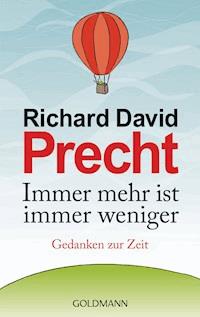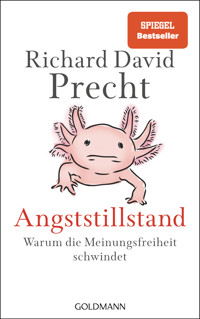
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
»Das Thema Meinungsfreiheit ist zu wichtig und zu dringend, um es den Rechtspopulisten zu überlassen.«
Studien zufolge ist mehr als die Hälfte der deutschen Bevölkerung der Ansicht, ihre Meinung nicht mehr frei äußern zu können. Woran liegt das? Je mehr Menschen heute ihre Individualität ausdehnen und die Dinge ›persönlich‹ nehmen, umso leichter fühlen sie sich gekränkt. Beschleunigt durch Social Media und die Möglichkeiten des Shitstorms wird das Risiko freier Meinungsäußerungen immer größer und die sozialen Kosten steigen gefährlich an. In der Folge gerät unsere Gesellschaft in einen Angststillstand. Denn wie sollen eine beherzte Politik, eine provozierende Kunst und eine gesellschaftskritische Kultur noch möglich sein, wenn immer jemand empört oder verletzt reagiert?
Richard David Precht entwickelt ein gesellschaftliches Psychogramm und nimmt uns in die Pflicht, das »Wir« wieder in den Vordergrund zu stellen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 208
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Buch
»Die Schärfe gegenüber Menschen, die bestimmte Narrative nicht teilen, steht unserer Demokratie alles andere als gut zu Gesicht. Warum sollen Menschen zu den staatlichen Maßnahmen gegen die Covid-19-Pandemie nicht unterschiedliche Meinungen haben dürfen? Warum sollen sie den russischen Angriff auf die Ukraine nicht verschieden einordnen und bewerten? Eine liberale Demokratie, die vom möglichst freien Wettbewerb der Meinungen lebt, kann dies nicht nur aushalten – sie muss.
Aus dieser Sorge heraus wurde vorliegender Essay geschrieben. Denn das Ignorieren des Problems ist weitaus gefährlicher, als es zu analysieren. Dabei werden wir tief in die Struktur unserer Gegenwartsgesellschaft eindringen. Wir müssen lernen, was viele bislang nicht gerne lernen wollen: dass wichtige fortschrittliche und emanzipatorische Entwicklungen, die sehr zu begrüßen sind, Schatten werfen, über die wir bislang viel zu wenig nachgedacht haben.«
Autor*in
Richard David Precht, geboren 1964, ist Philosoph, Publizist und Autor und einer der profiliertesten Intellektuellen im deutschsprachigen Raum. Er ist Honorarprofessor für Philosophie und Ästhetik an der Hochschule für Musik Hanns Eisler in Berlin. Seit 2012 moderiert er die Philosophiesendung »Precht« im ZDF und diskutiert seit 2021 zusammen mit Markus Lanz im Nr.1-Podcast LANZ & PRECHT im wöchentlichen Rhythmus gesellschaftliche, politische und philosophische Entwicklungen.
Seit Wer bin ich – und wenn ja, wie viele? waren alle seine Bücher große Bestseller und wurden in mehr als 40 Sprachen übersetzt. Zuletzt erschien Das Jahrhundert der Toleranz.
Richard David Precht
Angststillstand
Warum die Meinungsfreiheit schwindet
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Folgenden auf die gleichzeitige Verwendung weiblicher und männlicher Sprachformen verzichtet und das generische Maskulinum verwendet. Diese Formulierungen schließen gleichermaßen weibliche und männliche Personen mit ein; alle sind damit selbstverständlich gleichberechtigt angesprochen und gemeint.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Originalausgabe Oktober 2025
Copyright © 2025: Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
(Vorstehende Angaben sind zugleich Pflichtinformationen nach GPSR.)
Redaktion: Regina Carstensen
Umschlag: Uno Werbeagentur, München
Umschlagmotiv: FinePic®, München
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
IJ ∙ CF
ISBN 978-3-641-33542-7V001
www.goldmann-verlag.de
Ist der Anpassungsdruck der modernen kapitalistischen Leistungsgesellschaft so stark, dass Toleranz und Meinungsfreiheit keine verändernden, sondern nur noch therapeutische Funktionen haben?
Karl-Hermann Flach Noch eine Chance für die Liberalen? Oder die Zukunft der Freiheit (1971)
Inhalt
I. Ein beispielloses Phänomen
Warum schwindet die subjektive Meinungsfreiheit?
II. Falsche Fronten
Warum es nicht einfach nur um die Guten gegen die Ewiggestrigen geht
III. Anders sein als die anderen
Wie sich unsere Gesellschaft verändert hat
IV. Axolotlisierung
Wie wir immer authentischer und zugleich infantiler werden
V. Das Seerosen-Dilemma
Wie sich unsere Sensibilitäten wechselseitig die Freiheit rauben
VI. Schamlosigkeit und Beschämung
Wie die sozialen Medien Sitten und Gebräuche verändern
VII. »Desinformation« und »Hassrede«
Auf welche Gefahren die Politik reagiert und welche sie dadurch selbst erzeugt
VIII. Empörungskultur
Wie Politik und Leitmedien mitspielen
IX. Unbefleckte Biografien
Wie eine völlig unrealistische puritanische Erwartungshaltung zu Daueranklagen führt
X. Angststillstand
Warum Kultur und Kunst einknicken und nicht mehr provozieren können
XI. Das Tabu und seine Profiteure
Warum es gefährlich ist, sich dem Freiheitsverlust nicht zu stellen
XII. Gleichheit, Freiheit, keine Brüderlichkeit
Warum wir uns mit dem, was uns verbindet, heute so schwertun
XIII. Rückkehr zur Resilienz
Wie wir das Meinungsklima wieder verbessern
Dank
Anmerkungen
I. Ein beispielloses Phänomen
Warum schwindet die subjektive Meinungsfreiheit?
Das Phänomen ist so ungewöhnlich, dass es sich bislang jeder Erklärung zu entziehen scheint. Kein Wunder, dass es nur selten öffentlich thematisiert wird. Wie kann es sein, dass die Meinungsfreiheit in liberalen Gesellschaften, wie jener in Deutschland, schwindet? Und das, obwohl dieser Freiheitsentzug doch keineswegs von einer Regierung verantwortet und auch nicht durch Unterdrückung erzwungen wird?
Seit über siebzig Jahren stellt das Institut für Demoskopie Allensbach den Menschen in Deutschland jedes Jahr die Frage: »Kann man heute in Deutschland noch frei seine Meinung äußern oder sollte man besser vorsichtig sein?« Das Ergebnis war über Jahrzehnte so konstant wie verständlich. Stets war der weitaus größte Teil der deutschen Bevölkerung der Ansicht, dass man sehr wohl in Deutschland frei seine Meinung sagen könne. Seit Anfang der Siebzigerjahre bewegte sich dieser Wert lange um die 83 Prozent – doch im Laufe der Neunzigerjahre begann sich die Zahl abzuschwächen bis hin zu einer sich beschleunigenden Talfahrt in den 2000er-Jahren und einem ganz heftigen Absturz zur Zeit der Covid-19-Pandemie. Im Jahr 2019 waren nur noch 45 Prozent, weniger als die Hälfte der deutschen Bevölkerung, der Ansicht, ihre Meinung frei äußern zu können. Und obwohl die Pandemie inzwischen ausgestanden ist und die staatlichen Maßnahmen aufgehoben wurden, sank die Zahl zuletzt weiter; im Jahr 2023 auf gerade einmal 40 Prozent![1]
Ein derart geringes Vertrauen in die Meinungsfreiheit ist ein alarmierender Wert für eine liberale Demokratie. Umso erstaunlicher, dass es so selten öffentlich als Problem herausgestellt wird. Während sich viele Menschen hier mit halben Worten verstehen, greifen Politik und Leitmedien das Thema nur äußerst selten auf – und wenn, dann meist nur eine Partei: die AfD. Die Frage nach der Meinungsfreiheit erscheint dann als das wehleidige Lamento einer Partei, die sich darüber mokiert, ihre Vorurteile, Lügen und Halbwahrheiten nicht unwidersprochen verbreiten zu dürfen. Die viel größere Frage dahinter, wie es denn sein kann, dass weit mehr als die Hälfte der deutschen Bevölkerung – in etwa dreimal so viele Menschen wie jene, die AfD wählen – ein erhöhtes Risiko bei ihrer Meinungsäußerung beklagen, wird dagegen so gut wie nie gestellt.
Wie ist es um eine Demokratie bestellt, in der so viele Bürger glauben, nicht mehr frei sprechen zu können oder vorsichtig sein zu müssen? Selbst wenn sie sich dabei irren sollten – was, wie ich zeigen möchte, nicht der Fall ist –, wäre es ein hochinteressantes Phänomen, das zwingend analysiert werden muss. Woher käme dann diese massenhafte Illusion? Völlig grundlos kann der Vertrauensverlust in keinem Fall sein. Doch diese Entwicklung, die heute eine Mehrheit der Menschen in Deutschland sagen lässt, dass es besser sei, im Hinblick auf die eigene Meinung »vorsichtig zu sein«, ist bislang kaum zureichend beschrieben. Denn mit einfachen Schuldzuweisungen ist es, wie wir sehen werden, nicht getan. Vielmehr, und das ist das Bestürzende, kommt die Dynamik aus der Entwicklung liberaler Gesellschaften selbst – und das ist so neu und bislang so schlecht verstanden, dass es sich lohnt, diesen Prozess genauer zu beschreiben.
Es gibt in Deutschland kaum staatliche Repressionen, keine stark freiheitseinschränkenden Gesetze, keine allgemeinen Zensurbehörden und kein staatliches Spitzelsystem. Der Rechtsstaat hat sich im vergangenen Jahrzehnt nicht grundlegend verändert. Die vorbildlichen liberalen Grundsätze der Bundesrepublik sind die gleichen wie seit Jahrzehnten. Und das Grundgesetz legt in Artikel 5 unverändert fest: »Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre.«[2] Dazu kommt ein Bildungssystem, das den kritischen Geist, die eigenständige Urteilsbildung, den Mut zum Widerspruch und die Diskussionskultur ausdrücklich fördern will. Schülerinnen und Schüler sollen befähigt werden, am politischen Leben teilzunehmen. »Sie sollen lernen, die eigene Meinung zu vertreten und die Meinung anderer zu achten.«[3]
Wer von der Meinungsfreiheit im Sinne von Artikel 5 Gebrauch macht, ist nicht dazu verpflichtet, nur das zu äußern, was gerade gesellschaftlicher Mainstream ist. Auch stark abweichende Meinungen werden in Deutschland nicht mit Haftstrafen bedroht. Wer dafür eintritt, dass Frauen lieber nicht berufstätig sein sollten, wer gleichgeschlechtliche Ehen ablehnt, wer meint, Deutschland solle seinen politischen Kompass eher an Russland ausrichten als an den USA oder wer die Maßnahmen der Regierung während der Covid-19-Pandemie für maßlos überzogen hält, macht sich mit solchen medial höchst unpopulären Meinungen nicht strafbar. Freiheitsentzug droht nur bei schweren Beleidigungen, der klaren Verletzung von Persönlichkeitsrechten, öffentlichen Aufrufen zu Gewalt oder der öffentlichen Leugnung der deutschen Verbrechen bei der Shoa.
Also alles gut und kein Grund zur Sorge? Keineswegs. Denn völlig unbeleuchtet bei dieser rein juristischen Betrachtung bleibt das, was Richard Traunmüller, Professor für Empirische Demokratieforschung an der Universität Mannheim, die »subjektive Meinungsfreiheit« nennt.[4] Die Kosten der freien Meinungsäußerung – und das ist wichtig – beginnen nicht erst dort, wo eine verlautbarte Meinung justiziabel ist. Man muss auch fragen: »Wann ist es günstig, sich zu äußern?« Das ist dann der Fall, wenn »die Wahrscheinlichkeit, dass die Äußerungen sanktioniert werden, gering ist und wenn die Sanktionen selbst geringe Kosten mit sich bringen«.[5] Die Grenzen der Meinungsfreiheit fangen also nicht erst bei der Zensur an, sondern bereits vorher bei der Selbstzensur. Wer damit rechnen muss, mit seiner Meinung vielfach heftigen Widerspruch zu ernten oder als Person der Öffentlichkeit medial an den Pranger gestellt zu werden, der überlegt sich mehr als dreimal, ob er das, was er über eine bestimmte Sache denkt, laut äußert oder es lieber bleiben lässt. Nur die wenigsten Menschen fühlen sich wohl, wenn sie einem extremen »Rand« oder einem befremdlichen »Lager« zugerechnet werden. Private wie öffentliche Ächtung sind gefährliche Waffen, auch dort, wo eine Meinung nicht strafbar ist. Zu der juristischen Inkriminierung kommt die soziale und mediale Inkriminierung – und vor allem sie entscheidet darüber, wie es um die subjektive Meinungsfreiheit bestellt ist.
Nach Traunmüller lässt sich die Meinungsfreiheit ziemlich exakt vermessen: Je geringer die Wahrscheinlichkeit ist, für seine Meinungen in irgendeiner Form sanktioniert zu werden, umso größer ist die Meinungsfreiheit. Eine plausible Formel, aber keine, die Messungen leicht macht. Was soll hier gemessen werden? Die »reale« Meinungsfreiheit ist keine empirische Größe. Wenn Meinungsfreiheit nicht nur durch Gesetze und die Staatsgewalt beeinträchtigt wird, sondern auch durch die Angst vor negativen Konsequenzen auf allen erdenklichen Ebenen, wird es schwierig. Denn diese Angst ist nicht präzise »real« messbar, sondern eben nur »gefühlt«, wie etwa bei der Allensbach-Umfrage.
Empirisch betrachtet, ist die subjektive Meinungsfreiheit ein Gespenst. Kein Wunder, dass von den vielen Freiheitsindizes, die versuchen, den Freiheitsgrad eines Landes zu messen, fast keiner die subjektive Freiheit berücksichtigt. Im Mittelpunkt stehen vielmehr die politisch-juristische Freiheit, also die Gesetze, und die wirtschaftliche Freiheit. Vor allem US-amerikanische Denkfabriken messen Letzterer einen hohen Stellenwert bei. Wie offen sind die Märkte und wie viele Menschen haben Zugang zu ihnen? Wie frei kann sich Unternehmertum entwickeln? In solchen Listen ist die Meinungsfreiheit meist nur ein Faktor unter mehreren, und nicht die subjektive Freiheit wird gemessen, sondern die Rechtslage.
Es verwundert daher auch kaum, dass sich die Wissenschaft mit unserem Thema so selten beschäftigt. Was sie mit ihren Netzen nicht fangen kann, kann kein Fisch sein. Und das ist fast schon skandalös. Wenn nur noch 40 Prozent der Menschen in unserem Land meinen, ihre Meinung frei äußern zu können, ist nicht nur offensichtlich die Meinungsfreiheit in Gefahr, sondern mit ihr die Demokratie. Für Traunmüller sind »Meinungsfreiheit und Demokratie … eigentlich deckungsgleich. Und wenn die Meinungsfreiheit in der Diskussion ist, dann gilt das auch für die Demokratie.«[6]
In diesem Satz steckt keine Übertreibung. Man muss sich nur ausmalen, was es mit den Bürgern eines Landes macht, wenn sie glauben, sich nicht mehr frei äußern zu können. Man überlegt sich lange und genau, was man sagt und was nicht. Der Konformitätsdruck sorgt für eine Schere in vielen Köpfen und erst recht bei Meinungsäußerungen. Das aber widerspricht ohne Zweifel dem Gedanken unserer liberalen Demokratien. Die Freiheit der Rede ist ihnen ein hohes Gut. Denn was liegt der liberalen Demokratie anderes zugrunde als das Konzept, dass über gesellschaftliche Themen breit und kontrovers diskutiert werden soll? Ihrem Ideal nach ist die Demokratie der Sieg der besten Ideen im fairen und ungezwungenen Wettstreit um das beste Argument. Deliberation und Partizipation lauten die entsprechenden Schlüsselbegriffe. Liberale Gesellschaften sind Gesellschaften breiter Teilhabe. Und sie fordern, ihrer grundlegenden Idee nach, eine rege Beteiligung in Worten und Taten.
Wenn heute in der Bundesrepublik die subjektive Meinungsfreiheit stark abgenommen hat, dann stehen wir vor einer ganz neuen Herausforderung. Einer Herausforderung ohne Beispiel. Denn gibt es dafür in der Geschichte irgendeine Vorlage oder ein Muster? Hat jemals eine liberale Demokratie aus sich selbst heraus – nicht durch einen Regimewechsel – ihre Freiheitsspielräume in einer längeren Entwicklung immer weiter verengt? Die Beispiele, die einem einfallen, das Ungarn Viktor Orbáns oder das Polen der Kaczyńskis, sind keine – denn in beiden Fällen gab und gibt es entscheidende Repressionen vonseiten der Regierung. Wann immer wir von der Verengung des Meinungskorridors in liberalen Demokratien sprechen, kam die Entwicklung von oben. Und stets haben wir es mit einer Einschränkung der Rechte und mit staatlich angeordneten Eingriffen zu tun.
Trotz des einen oder anderen Gesetzes, auf die ich vor allem im siebten Kapitel dieses Essays eingehen werde, kann davon in Deutschland wenig die Rede sein. Der Freiheitsverlust, von dem ich im Folgenden spreche, ist in seiner Struktur historisch einmalig. Er entspringt keiner Willkür oder Usurpation, keinem Regimewechsel und keiner staatlichen Repressionsstrategie. Stattdessen nötigt er uns ab, uns mit der jüngeren Entwicklung unserer Gesellschaft zu beschäftigen. Wir müssen die internen strukturellen Mechanismen verstehen, die zur Entwicklung schwindender Meinungsfreiheit geführt haben. So geht es nicht um Schuldzuweisungen, sondern um Mustererkennung. Welche Strukturen bewirken, dass Deutschland zwar eine große Meinungsfreiheit, aber eine im Vergleich dazu sehr viel geringere Meinungstoleranz hat? Wie kam es zur Explosion von Normen, die eine klare Mehrheit der Menschen in der Bundesrepublik heute sagen lässt, dass es besser sei, mit seinen politischen und gesellschaftlichen Meinungsäußerungen vorsichtig zu sein? Wo kommen diese Normen her, wer bestimmt sie, und wer nutzt sie zu seinem Vorteil?
Ich möchte dazu anregen, diese Entwicklungen ernst zu nehmen und sie nicht leichter Hand vom Tisch zu wischen. Unbehandelte, unterschätzte und weggeredete Konflikte sind Entzündungsherde. Werden sie ignoriert, können sich diese Konflikte für die Gesellschaft immer toxischer entwickeln. Aus Konfliktlinien erwachsen, wie bereits häufig geschehen, verhärtete Freund-Feind-Schemata. Das Misstrauen in die Demokratie wächst, Gruppen radikalisieren sich, und der Streit wird lauter und unversöhnlicher. Parallel dazu steigen die Angst und die Selbstzensur. Der gesellschaftlich verschärfte Tonfall, insbesondere in den sozialen Medien, macht viele vorsichtig, um ja nicht in Mithaft genommen zu werden. Gerade politisch komplizierte Themen, die eigentlich eine möglichst breite Diskussion erfordern, werden so öffentlich kaum noch vorurteilsfrei und in allen Facetten diskutiert. In Windeseile formatieren sich stattdessen Narrative, die eine ganz bestimmte Sichtweise als politisch und moralisch korrekt behaupten und alternative Sichtweisen entsprechend stigmatisieren. Auf der anderen Seite bilden sich Gegennarrative mit großer Resonanz in den sozialen Medien und entsprechender Ächtung in den Leitmedien. Die Folge aus alledem ist: Selbstverständlich darf man in Deutschland heute alles sagen – aber es war noch nie so leicht, mit seiner Meinung anzuecken und dafür angeprangert zu werden.
Die Schärfe gegenüber Menschen, die bestimmte Narrative nicht teilen, steht unserer Demokratie alles andere als gut zu Gesicht; zumal kaum erkennbar ist, warum sie, wie oft behauptet, zur Verteidigung unserer Demokratie notwendig sein soll. Warum sollen Menschen zu den staatlichen Maßnahmen gegen die Covid-19-Pandemie nicht stark unterschiedliche Meinungen haben dürfen? Warum sollen sie den russischen Angriff auf die Ukraine nicht verschieden einordnen und bewerten? Warum sollen die Bürger der Bundesrepublik nicht ihre je eigene Meinung zum Nahostkonflikt und zum Vorgehen des Staates Israel haben? Eine liberale Demokratie, die vom möglichst freien Wettbewerb der Meinungen lebt, kann dies nicht nur aushalten – sie muss es auch, um eine vorbildliche liberale Demokratie zu sein. »Eine Demokratie, in der nicht gestritten wird«, meinte einst Helmut Schmidt, »ist keine.«[7]
Aus dieser Sorge heraus wurde vorliegender Essay geschrieben. Denn das Ignorieren des Problems ist sicher weitaus gefährlicher, als es zu analysieren. Dabei werden wir tief in die Struktur unserer Gegenwartsgesellschaft eindringen. Wir müssen lernen, was viele bislang nicht gerne lernen wollen: dass wichtige fortschrittliche und emanzipatorische Entwicklungen, die sehr zu begrüßen sind, Schatten werfen, über die wir bislang viel zu wenig nachgedacht haben.
II. Falsche Fronten
Warum es nicht einfach nur um die Guten gegen die Ewiggestrigen geht
Wenn der Titel einmal gedruckt dasteht, kann man durchaus zugeben, dass er falsch ist. »Dürfen wir WIRKLICH nichts mehr sagen?«, lautete die letzte Ausgabe der ORF-Talkshow IMZENTRUM. Das war im Dezember 2024, und diskutiert wurde über Meinungsfreiheit, vornehmlich in Österreich und in Deutschland. Falsch war der Titel, insofern niemand der vier Gäste, mich eingenommen, ernsthaft die idiotische These vertrat, man dürfe in den genannten Ländern »nichts mehr sagen«. Denn dann hätte die Talkshow gar nicht stattgefunden.
Entsprechend wohlfeil war die Aussage der jungen Vertreterin der österreichischen Grünen, die Freiheit sei in Ländern wie Russland, China oder Afghanistan eingeschränkt, nicht aber in den freiheitlichen Gesellschaften des Westens. Und in der Tat, jeder Vergleich von Diktaturen und Unterdrückungsregimes mit den Verhältnissen in Österreich und Deutschland ist so abwegig, dass die Diskussion darüber nicht lohnt. Aber folgt daraus wirklich, dass es bei uns keinerlei Verengung des als zulässig empfundenen Spektrums öffentlicher Meinungsäußerungen gibt? Für die Grünen-Vertreterin schien es so zu sein, für mich nicht.
Was ich für eine Frage problematisch veränderter Normen und Umgangsformen hielt, hielt die Politikerin schlichtweg für einen Kampf zwischen zwei Lagern. Auf der einen Seite stünden diejenigen, die für die Menschenwürde einstünden, also gegen stark zunehmenden Rassismus, Sexismus und Aufrufen zur Gewalt. Und auf der anderen Seite jene, die das mit der Würde offensichtlich ganz anders sähen: die Rechtspopulisten und Rechtsextremisten.
Schützenhilfe in ihrem binären Weltbild erhielt die Politikerin von einer Journalistin, die genau die gleiche Frontstellung ausmachte. Auf der einen Seite die »Menschen, die einfach nur Würde einfordern«, und auf der anderen Seite all diejenigen, die diese als »woke« pauschal verunglimpfen und sich mit dem Vorwurf »Man darf ja nichts mehr sagen« über die vermeintlich allgegenwärtige Cancel Culture mokieren. Und sie vergaß nicht hinzuzufügen, dass die Haltung der zweiten Gruppe Ausdruck einer »denkfaulen Gesellschaft« sei, der es an Differenzierungsvermögen mangele.
Tatsächlich ist der Vorwurf der »Denkfaulheit« eine Steilvorlage. Denn ist die Einteilung der Debatte in eine saubere Frontstellung von den Verteidigern der Würde gegenüber denjenigen, denen diese offensichtlich wenig bedeutet, nicht selbst reichlich denkfaul? Man denke nur an die großen gesellschaftlichen Debatten der letzten Jahre – die Covid-19-Pandemie, den Ukrainekrieg und den Krieg im Nahen Osten –, jene gesellschaftlichen Streitthemen, bei deren Diskussion eine Verengung des Meinungskorridors beklagt wurde. Wo ging es dort um die Verteidigung der Menschenwürde gegenüber einem Lager, das diese bestritt oder bekämpfte? Die Frage nach der richtigen Haltung in allen drei Konflikten verlief nicht entfernt entlang der Freund-Feind-Linie von Würde auf der einen Seite und deren Missachtung auf der anderen. Und selbst die weit weniger wichtige, wenngleich hoch emotionalisierte Frage über das Gendern in der Sprache ist wohl kaum eine Debatte, bei der eine der beiden Meinungsfraktionen die Menschenwürde verteidigt, wohingegen die andere diese anzweifelt oder verletzt. Wer für das Gendern eintritt, ist damit nicht zwangsläufig mit der Menschenwürde im Bunde, und wer Gendern für ein ungeeignetes Instrument der Emanzipation hält, stellt weder diese noch die Menschenwürde grundsätzlich infrage.
Dass es sich bei der Frage nach der Meinungsfreiheit um ein einfaches binäres Schema handele, geht an den Tatsachen ziemlich scharf vorbei. Weder stehen hier moralisch und unmoralisch noch progressiv und konservativ noch links und rechts einander gegenüber. Und sicher geht es auch nicht schlicht um Menschen, die einen sensiblen, rücksichtsvollen Umgang mit Sprache und Anschuldigungen pflegen, gegenüber solchen, die meinen, alles sagen und jeden wahllos diffamieren zu dürfen. Man kann nicht bestreiten, dass es solche passionierten Pöbler gibt – aber sehr wohl, dass sie für die Diskussion um die Meinungsfreiheit in Deutschland besonders relevant sind.
Gemeinhin lernen die allermeisten Menschen im Laufe ihrer Sozialisation, sich zu überlegen, was sie anderen sagen und was sie besser für sich behalten. Sie lernen, nicht jede Emotion deutlich zu zeigen und jeden affektiven Gedanken ungebremst zu äußern. Die Gefühle und Interpretationen der anderen zu berücksichtigen, ist eine feste Regel des sozialen Schachs, das wir miteinander spielen. Gerade deswegen fallen uns Menschen als bizarr und oft auch als komisch auf, die (selbst wenn sie nicht betrunken sind) über keine Denk-/Sprechschranke verfügen. Man denke hier nur an Klaus Kinski, dessen Interviews stets zu einer grotesken Farce verkamen; nicht etwa, weil Kinski dumm oder geistlos war, sondern weil er seine Gefühle stets unmittelbar und ohne irgendeine Rücksicht verbalisierte. Sein Verhalten war ein solcher Ausfall gegen die kulturelle Norm, dass im Vergleich deutlich wird, dass normale Menschen so etwas fast nie tun. Wer ist schon dazu bereit, den enormen sozialen Preis zu zahlen?
Schon die antiken Griechen und Römer legten großen Wert darauf, Meinungsfreiheit nicht mit Zügellosigkeit zu verwechseln. Eleutheria und libertas waren hehre Güter, aber exousia und licentia, die Hemmungslosigkeit in Rede und Tat, waren es nicht. Wenn jeder maßlos und frei von Selbstdisziplin seine Freiheit auslebt, muss jede Gemeinschaft scheitern. Die Freiheit der Rede macht dabei keine Ausnahme von der Freiheit im Allgemeinen. Kein Wunder, dass jede menschliche Zivilisation Wert auf die wohl gewählte Dosierung von Aussagen und einzelnen Worten (»Affektmodulation«) legt. Uneingeschränkte Freiheit gibt es nicht einmal bei unseren nächsten Verwandten, den Primaten. Überall existieren soziale Regeln, die ein geregeltes Miteinander möglich machen. Der »paläolibertär« genannte Gedanke, dass jeder immer sagen und tun dürfe, was er denke, ist also nicht paläo – er geht nicht auf irgendeine Vorzeit zurück. Und was ist unsere gesamte Rechtsprechung anderes als der Versuch, durch Gesetze sinnvolle und begründete Regeln gegen Willkür und Chaos zu schaffen; Regeln, die bei unseren nächsten Verwandten intuitiv und zu kleineren Teilen auch kulturell vermittelt werden?
Wer analysiert, wie unsere heutige Gesellschaft den öffentlichen Meinungskorridor verengt hat, plädiert damit nicht für einen Freiheitsabsolutismus. Er redet weder der Zügellosigkeit noch dem Grobianismus das Wort. Aber die viel wichtigere Kritik am binären Schema meiner ORF-Gesprächspartnerinnen und vieler ihnen Gleichgesinnter zielt auf etwas anderes. Es ist die irrige Vorstellung von zwei einander entgegengesetzten »Lagern« in der Gesellschaft. Die Soziologen Steffen Mau, Thomas Lux und Linus Westheuser schreiben in ihrem Buch Triggerpunkte über vierhundert Seiten voll, um zu beweisen, dass die Vorstellung einer mutmaßlichen Zwei-Lager-Gesellschaft in Deutschland an der Realität vorbeisieht. Die Bundesrepublik ist keine polarisierte Gesellschaft. »Die Selbstgewissheit, mit der sich diese These im öffentlichen Diskurs behauptet, steht in nur schwachem Zusammenhang zu ihrer Trittfestigkeit, wenn sie empirischen Boden berührt … Ob sich … tatsächlich zwei konturierte Lager herausgebildet haben, darf angezweifelt werden.«[8] Denn weder stehen sich zwei geschlossene, klar identifizierbare Milieus gegenüber noch sieht sich die große Mehrheit der Gesellschaft auf der einen oder anderen Seite. Die meisten bevorzugen eine Position irgendwo in der Mitte. So darf man mit Mau und seinen Kollegen annehmen, »dass das häufig gezeichnete Bild einer gespaltenen Gesellschaft nicht zutrifft. Konflikte sind zwar nicht ›strukturlos‹, aber eben auch nicht durch ein klares Gegeneinander unterschiedlicher Sozialstrukturgruppen geprägt.«[9]
Man kann sich diesen sorgfältig belegten Befund gar nicht oft genug auf den Schreibtisch legen. Ernähren sich unsere politische Rhetorik und unsere journalistische Aufmerksamkeitsökonomie nicht geradezu davon, die Welt manichäisch zu verkürzen: hier die einen, dort die anderen? Wir gegen die? Gut gegen Böse? Anders als in der historischen Auseinandersetzung zwischen Kapitalismus und Sozialismus, aus der auch unser ergrautes Rechts-Links-Schema stammt, bekämpfen sich heute keine Lager, oder soziologisch formuliert, keine »soziostrukturellen Großgruppen«. Wo sollten diese in unserer Lebenswelt auch herkommen? Wer schließt sich denn heute noch mit anderen zu weltanschaulichen Massenlagern zusammen und fühlt sich darin pudelwohl? Wer sieht sich heroisch auf der Seite der Revolution oder ebenso heroisch auf jener einer Konterrevolution? Selbst wenn es richtig ist, dass die gesellschaftliche Weltkarte in sächsischen Kleinstädten eine andere Topografie hat als jene in einem Slow-Food-Laden in Berlin-Mitte, so werden daraus nicht im Handumdrehen zwei gesellschaftliche Großgruppen mit homogenen Identitäten. Das »Wimmelbild« der heutigen Gesellschaft, wie Mau und seine Kollegen es nennen, mag nicht völlig strukturlos sein wie Pieter Bruegels des Älteren Gemälde Der Kampf zwischen Karneval und Fasten – wohlgeordnet entlang der gesellschaftlichen Frontlinien wird es dadurch noch lange nicht.