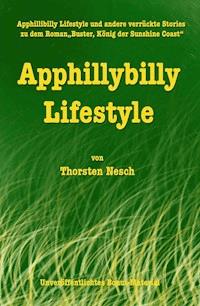9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Seinen Vater hat Jörn nie kennengelernt, und seine Mutter hat auch kein gutes Haar an seinem Erzeuger gelassen. Und trotzdem soll Jörn jetzt den letzten Willen des verstorbenen Vaters erfüllen und dessen Asche gut getarnt in einem Rainmaker zu seinem Geburtsort in Italien bringen. Um an den Ort der Bestimmung zu gelangen, hat der Vater ihm auch noch ein Ticket für eine Kreuzfahrt hinterlassen, außerdem einen Brief für jeden Tag der Reise. Obwohl Jörn das alles ziemlich absurd vorkommt, wünscht er sich doch, diese ewige Leerstelle in seinem Leben zu füllen. Die Suche nach seinen Wurzeln gestaltet sich zu einem abenteuerlichen «Road»-Trip auf den Weltmeeren und zu einer zarten, ganz unerwarteten Liebesgeschichte ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 349
Ähnliche
Thorsten Nesch
Die Kreuzfahrt mit der Asche meines verdammten Vaters
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Über Thorsten Nesch
Inhaltsübersicht
Sommer
You either run from things, or you face them
Jesse (Breaking Bad)
Am Ende meiner Angelschnur lag der bunte Schwimmer reglos auf dem See. Windstill spiegelte die glatte Wasseroberfläche die grauen Wolken wider, die sich über mir gegen ihren Willen ostwärts quälten. Selten schaffte es eine Böe hinunter in den Trichter des Baggersees, sodass mein Haken mit dem Wurm kaum abgetrieben wurde und ich bisher nicht ein Mal neu hatte auswerfen müssen.
15 Grad mitten im Sommer und meistens Regen. Wenn das so weiterging, würde es nichts werden mit der Fahrradtour nach Holland, zelten mit David, solange das Geld reicht, vielleicht eine ganze Woche.
Schwere Schritte knirschten auf dem feuchten Kiesweg hinter mir. Seit heute Mittag hatte ich alleine hier am See gesessen und meinen Blick über das Wasser und das Ufer schweifen lassen. Die zwanzig Meter steil in die Höhe ragenden Hänge waren von überall gut einzusehen, nirgends Bäume oder Sträucher. Oben säumte ein Kranz aus wildem Weizen den Rand des Baggerlochs. Am Wasser entlang die schmale Laufspur der Angler, die sie auf ihrer Suche nach der besten Stelle über Jahrzehnte platt getreten hatten.
Herr Gregor stapfte mit seinem zwölfjährigen Sohn Gottfried im Schlepptau auf mich zu. Wie konnte jemand sein Kind bloß Gottfried nennen? Als hätten sie den nächsten Papst zeugen wollen.
Die beiden waren der Werbeseite einer Anglerzeitschrift entsprungen – wobei die Natur es nicht ganz so gut gemeint hatte wie mit den Hochglanzmodels. Sie trugen die neueste Mode und schleppten die teuerste Ausrüstung. Herr Gregor besaß eine Zeitarbeitsfirma – und wie kommt man am leichtesten zu viel Geld? Durch die Arbeit anderer.
Auf Vereinstreffen prahlte er gerne damit, die älteste Zeitarbeitsfirma Deutschlands zu führen. Gleich nach der gesetzlichen Zulassung durch die Politik sei er zum Amt gelaufen und habe sich den Stempel geben lassen; anders als die nörgelnden Verlierer hätte er damals die Zeichen der Zeit erkannt. Nun konnte er täglich um vier Uhr mit seinem Sohn angeln gehen und dauernd neue Klamotten tragen. Wahrscheinlich verbrannten sie die getragenen Sachen nach jedem gefangenen Fisch rituell.
Der Sklaventreiber und sein Geschöpf blieben bei mir stehen.
«Petri Heil, Jörn», begrüßte mich Herr Gregor mit seinem sonoren Chef-Bass. Auch die Lippen des Papstes bewegten sich stumm.
«Guten Tag», sagte ich freundlich und tippte mir an den Schirm meines Caps.
«Ich sehe dich ja jetzt jeden Tag hier.»
«Sind halt Ferien.»
«Trainierst wohl auf das große Nachtangeln?»
In einer Woche würde der jährliche Nachtangelwettbewerb unseres Vereins stattfinden, dem ersten Platz winkte ein 500-Euro-Gutschein für Angelausrüstung. Den konnte ich gut gebrauchen.
«Hätte nichts gegen den ersten Preis.»
«Na, der dritte wäre für dich doch auch schon recht gut.» Herr Gregor grinste jovial. Wahrscheinlich fand er, dass für einen wie mich ein leerer Angelkoffer mit Vereinsemblem völlig ausreichend wäre.
Er nickte zum Schwimmer. «Auf Karpfen?»
«Jo.»
Der Papst spielte mit der losen Lasche seines Schulterriemens.
«Hat schon was gebissen?», fragte Herr Gregor
«Noch nich …»
«Ist auch keine gute Stelle hier», unterbrach er mich bereits mitten im zweiten Wort. Natürlich meinte er zu wissen, was ich sagen wollte, bevor ich Luft geholt hatte, meine eigentliche Antwort spielte keine Rolle. «Bei dem Wetter stehen die Fische dahinten in der Bucht im tiefen Gras.»
Daher sparte ich mir, für meine nächste Bemerkung auch nur einen sinnvollen Gedanken zu fassen. «Hmh.»
«Oder etwa nicht?»
Oder etwa nicht! Er wollte hören, wie recht er hatte, er konnte mein neutrales Hmh nicht einfach akzeptieren, der Sklaventreiber musste die sixtinischen Glocken der Selbstbestätigung klingen hören, obwohl das erniedrigende Gebuckel seiner Knechte im Büro doch eigentlich für zehn Despoten reichen sollte.
Den Gefallen konnte ich ihm nicht tun. «Tja, vielleicht hat ein Karpfen gerade keinen Bock auf die anderen und schwimmt hier alleine rum.»
Er lachte meine Bemerkung geschäftsmäßig weg, der Papst gluckste heiser.
«Na, viel Glück, wir fangen uns dahinten einen für zu Hause, du kannst hier weiter deine Köder baden.»
«Ja-ha-ha», zwängte ich an die Luft. Anglerspruch, Grundkurs.
Ich schaute ihnen nach, wie sie mit ihren Ruten, Dosen und Campingstühlen beladen dem schmalen Pfad folgten, Don Quichote und Sancho Pansa.
Meine Gedanken wurden von der Breaking Bad-Titelmelodie meines Samsungs jäh unterbrochen, ich nahm den Anruf von Mama nur an, weil ich eine Bewerbung beim Bund zur Ausbildung zum Mechatroniker laufen hatte. «Jo? Post vom Bund?»
«Jörn, komm bitte nach Hause.»
Keine Begrüßung, kein Nein, kein Ja, sie klang anders, nach nichts Gutem. «Ist was? Ist alles okay, ist was … mit Lea?»
Meine kleine Schwester.
«Nee, ja …»
«Oder Chris?»
Mein älterer Bruder arbeitete gerade in China, wo er Maschinen aufbaute, die er in Deutschland zuvor abgebaut hatte.
«Nee, alles in Ordnung, komm einfach bitte ganz schnell nach Hause, ja?!»
«Warum denn? Ich angele.»
«Frag nicht, komm.»
«Hat das nicht Zeit bis heute a…»
«Nein, hat es nicht, hier ist Besuch für dich.»
«Besuch? Wer?»
Kurze Stille.
«Ein Bekannter deines Vaters.»
Darum druckste sie so herum. Und alleine die Tatsache, dass sie ihn nicht Kriechtier nannte, war bemerkenswert, wahrscheinlich konnte der Bekannte sie hören. Die wenigen Male, wenn ein Gespräch zwischen uns auf meinen Vater, den großen Unbekannten, zusteuerte, betitelte sie ihn als Kriechtier. Kennengelernt hatte ich ihn nie, er war noch vor meiner Geburt davongekrochen.
Zumindest das hatten mir meine beiden Geschwister voraus; sie kannten ihre Väter, die mehr oder weniger Kontakt mit ihnen hielten; vor allem Lea verbrachte fast jedes zweite Wochenende bei Rüdiger. Mama sagte immer, außer ihr gäbe es keine Zweite, die so viel Pech mit Männern hätte.
«Was will er?» Ich klang schroffer, als ich wollte.
«Das erfährst du hier.»
«Kann er das nicht jetzt am Telefon klären?»
«Nein.»
Mir gingen die Argumente aus. Das helle Sirren der gregorianischen Angeln zerschnitt die Stille über dem See, leises Platschen und das Klacken der Bremsen. Die beiden standen gute hundert Meter weiter nebeneinander, so aufrecht, als würden sie den Segen eines Fernsehpriesters empfangen.
«Jörn?»
«Jo.»
«Bis gleich, ja?»
«Jo, jo. Bis gleich.»
Sie drückte das Gespräch weg. Tief sog ich die frische Luft ein, und mein Blick folgte einem Raben, der quer über den Baggersee flog. Das helle Gelächter der Gregors unterbrach meine Gedanken, ich nahm meine Angel auf und holte den Haken ein. Gut geölt schnurrte die Rolle.
Ein Bekannter meines Vaters. Was konnte das bedeuten? Wollte er nach all den Jahren endlich Kontakt zu mir aufnehmen und war einfach zu feige, selbst zu erscheinen? Das könnte ich glatt verstehen. Ein paar Monate vor meinem achtzehnten Geburtstag. Was sollte das? Eine Überraschung? Hatte er das nicht gezahlte Unterhaltsgeld heimlich gespart und wollte mir nun Führerschein und Kleinwagen spendieren? Kleiner Scherz, so viel finanzielles Glück war meiner Familie nicht beschieden.
Kaum hatte ich die Angel eingeholt, da kräuselte sich das Wasser zehn Meter vor mir.
«Da gründelt doch einer», flüsterte ich. Einen letzten Wurf wäre es wert. Der angebliche Bekannte meines Vaters konnte ruhig eine Viertelstunde länger warten, das sollte ja wohl locker drin sein. Nach fast achtzehn Jahren. Ich öffnete die Bremse und warf aus. Allerdings nicht ganz konzentriert, denn die Schnur verfing sich für den Bruchteil einer Sekunde an einem der Büsche hinter mir – ich hörte es kurz rascheln –, und der Angelhaken schlug mit der Wucht des Auswurfs in meinen Nacken ein.
Stöhnend fiel ich auf die Knie und ließ die Angel fallen. Sterne explodierten vor meinen Augen. Der stechende Schmerz zog vom Kopf den Rücken runter, als hätte ich ein Schwert geschluckt, mir blieb fast die Luft weg. Der Schwimmer lag im Sand neben mir. Zitternd tastete ich entlang der losen Schnur am Vorfach vorbei nach hinten, bis ich den Haken berührte und ein Stromstoß mich durchzuckte. Ein Quieken entwich meinen Stimmbändern, Schweiß lief über meine Stirn.
«Oooh, f…» Im Dreck kniend, blinzelte ich zu dem Sklaventreiber und seinem Miniaturpapst, dessen Angel sich durchbog wie bei einem Belastungstest. Herr Gregor stand hinter ihm und haute ihm auf die Schulter, als wollte er seinen Sohn in den Boden treiben. Ich hörte seine Anweisungen für den Drill, von meiner Misere hatten sie nichts mitgekriegt.
Ihr Fisch sprang aus dem Wasser, und ohne zu überlegen, riss ich im gleichen Moment den Haken aus meinem Nacken, wobei ich die Wunde vergrößern musste wegen des Widerhakens. Ich hoffte, mein Aufschrei würde in dem Bauchplatscher des springenden Fisches untergehen.
Irrtum.
Sie drehten ihre Köpfe in meine Richtung, und ich hielt mit einem verrückten Grinsen meine blutbesudelten Daumen in die Höhe.
Ich wurde auf meinem Fahrrad kräftig durchgerüttelt, als ich mit vor Schmerz verzerrtem Gesicht über den Feldweg durch die Gelbsenffelder raste. Hinten in den Taschen und auf dem Gepäckträger schepperten die Angelsachen lose durcheinander. Mein kariertes Hemd und die alte Fleecejacke meines Bruders, die ich beim Angeln immer trug, waren von Blut völlig verklebt.
Sobald ich die erste Seitenstraße erreicht hatte, konnte ich schneller fahren, und der Fahrtwind kühlte meine Wunde. Außerdem hatte ich eine Hand frei, um David eine Textmessage zu schreiben: Hey D, was geht? Haste mit deinen Eltis gespoken wegen Holland nächste Woche? Mit meinen Alten geht alles klar. wird hammer, ciao Jojo.
Mein bester Kumpel Basti hatte nach dem Abschlusszeugnis erst mal die Biege nach Kanada gemacht, und Mezut war bei seinen Großeltern in der Türkei, deshalb hatten David und ich überlegt, zumindest einen Fahrradtrip zu machen, Richtung Holland, zelten, Party, solange das Geld reichen würde. Er musste sich nur noch das Okay seiner Eltern einholen, meine Mutter hatte ich bereits gefragt.
Die wartete jetzt zu Hause mit einem fremden Typen, der meinen Vater kannte und mich sprechen wollte. Ich ließ mir das auf der Zunge zergehen. Was wusste ich schon von meinem Vater?
In der Grundschule war die Tatsache, dass ich keinen Vater hatte, bei den anderen Kindern immer auf Unverständnis gestoßen, deshalb hatte ich kurzerhand behauptet, Eddie, der Vater von Chris, wäre auch meiner. Danach hatte ich Ruhe, bis meine Klassenlehrerin das mitbekam und bei meiner Mutter anrief, ob ich irgendwelche Probleme hätte, weil ich diese Lügen auftischen würde – das war ihre Wortwahl, sie stand kurz vor ihrer Pensionierung. Nach dem Telefonat hatte sich Mama mit mir an den Küchentisch gesetzt und gesagt, ich könnte sie alles fragen.
«Wie heißt mein Vater?»
«Rocco.»
Nach dem Nachnamen hatte ich dann nicht weiter gefragt.
«Wo ist er?»
«Er hat sich vom Acker gemacht, das Kriechtier.»
Den Ausdruck benutzte sie damals zum ersten Mal, zumindest soweit ich mich daran erinnern konnte.
«Wie sieht er aus?»
«Keine Ahnung, ist lange her.»
«Hast du ein Foto?»
«Nein.»
Nachdem das abgehakt war, fragte ich nach anderen Gegenständen von ihm, Geschenke, egal was, aber sie schüttelte den Kopf, ich hätte mehr von ihm als sie, ich hätte seine Gene, zum Glück die wenigen guten.
Und damit war das Thema für viele Jahre gegessen. Ich musste ihr nur versprechen, Eddie nicht wieder ins Spiel zu bringen.
Was gab es danach noch zu fragen? So war es eben. Und mittlerweile hatten meine Schulfreunde mächtig Ärger zu Hause mit ihren Alten, und sie meinten, ich könnte mich glücklich schätzen, und wenn ihre Geschichten nur zur Hälfte wahr waren, dann hatten sie damit recht.
Als ich vierzehn war, habe ich Mama dann noch einmal auf meinen Vater angesprochen, weil ich nicht die Sneakers bekam, die ich mir wünschte. Grund: Zu wenig Geld in der Kasse. Grund: Das Kriechtier zahlte keinen Unterhalt. Grund: Er war ein Kriechtier, dieser Rocco Capoccia – immerhin kannte ich nun den Namen! Danach war er nur noch das «Kriechtier».
Vermisst hatte ich meinen Vater nie. Unsere Wohnung war immer voll gewesen, Langeweile gab es nicht. Es war ja noch gar nicht so lange her, dass Chris ausgezogen war, da hatte Oma noch gelebt, und vorher hatte Rüdiger eine Zeitlang bei uns gewohnt.
Ein Auto hupte, ich erschrak, verriss beinahe den Lenker, fluchte ihm hinterher. Als Nächstes blinkte mich von vorne ein weiterer Wagen an. Ich wollte ihm den Finger zeigen und drehte mich dazu um. Da wusste ich, was die Fahrer meinten: Die Rute ragte einen Meter auf die Fahrbahn, der Schwimmer pendelte wild über dem Asphalt. Die Angel musste sich auf der holprigen Fahrt gelöst haben. Ich hielt an und verstaute sie erneut mit meinen blutbraunen Fingern.
Sobald ich den Schlüssel im Schloss unserer Wohnungstür drehte, hörte ich die kleinen Füße meiner Schwester über den Flurboden laufen. Scheinbar ungebremst knallte sie gegen die Tür, als ich diese öffnete.
«Jörn-Jörn-Jörn ist zu Hause», sang sie ungerührt, klammerte sich an mein Bein und rieb ihre Rotznase in meiner Hose trocken, während ich meine Angelsachen abstellte und die Tür mit dem Fuß zuschob.
«Vorsicht, ich …»
Sie hörte auf zu springen und schaute an mir hoch, Falten zwischen ihren Kulleraugen, ihr Pferdeschwanz mit der rosa Schleife baumelnd. «Hast du dir weh getan?»
«Es geht.»
«Hast du dir doll weh getan?»
Mein Hals musste schlimm aussehen. Das getrocknete Blut an meinen Fingern hielt sie wohl für Dreck.
«Na ja …», machte ich.
«Du hast dir doll weh getan. Stirbst du?»
Ich versuchte, mein Bein aus ihrem Würgegriff zu befreien, ohne sie mit meinen besudelten Fingern anfassen zu müssen. «Irgendwann schon, aber jetzt noch nicht.»
Mit tief betroffener Stimme fragte sie: «Wie Oma?»
Oma war einen Monat nach Chris’ Auszug eines Morgens einfach nicht mehr aufgewacht.
«Natürlich nicht! Du musst dich schon noch etwas gedulden, bis du mein Zimmer bekommst.»
«War das ein Fisch?» Sie kräuselte ihre Stupsnase.
«Jo.»
«Ein großer Fisch?»
«Jo.» Ich humpelte mit ihr am Bein durch den Flur zum Wohnzimmer, wo ich meine Mutter mit unserem Gast vermutete.
«Hast du mit Moby Dick gekämpft? Mit dem weißen Wal, dem großen weißen Wal?» Sie plusterte die Wangen auf.
«Jo.»
Jetzt ließ sie los und peste vor mir ins Wohnzimmer, wo sie von der Türschwelle absprang, um in einer Art Karatehaltung zu landen und zu verkünden: «Mein Bruder hat mit Moby Dick gekämpft!»
Ich linste um den Türpfosten. Meine Mutter und der Bekannte meines Vaters saßen am Tisch bei einer Tasse Kaffee, zwischen ihnen ein Paket, daneben Zucker, Kekse und Milchkännchen. Unsere automatische Kaffeemaschine hatte vor einigen Wochen den Geist aufgegeben.
«Hallo zusammen, ich wasche mir kurz die Hände, dann komme ich.»
«Da bist du ja endli… J-Jörn, was ist denn mit dir passiert?»
Die Stimmung meiner Mutter schien binnen einer Sekunde von einer in die andere umzuschlagen. Auch der Gast verzog das Gesicht, selbst einige der hundert Kinderzeichnungen an den Wänden aus unseren Kindergarten- und Grundschuljahren schienen mit mir zu leiden. Die Strichmännchen und Eierköpfe, Saurier und Sonnenblumen beäugten einen von allen Seiten. Ungerahmt hatte Mama sie nach und nach mit Tesafilm an die Wände geklebt, bis sie sich an einigen Stellen überlappten. Auf Besucher musste es ziemlich chaotisch wirken.
«Er hat mit Moby Dick gekämpft, UAAAAAAH!» Lea propellerte sich auf die hochgeklappte Schlafcouch und rang mit einem Kissen.
«Geht schon, sieht wilder aus, als es ist, ich bin gleich da, ich wasche mich kurz, so viel Zeit wird ja wohl sein. Guten Tag», die letzten Worte richtete ich an den Gast.
«Hallo», erwiderte er mit einer weichen Stimme, die ich bei einem Typen wie ihm nicht auf den ersten Blick vermutet hätte.
Meine Mutter stand auf, und ich beeilte mich auf dem Weg zum Bad. Ihre Schritte hinter mir. Ich wollte das Waschbecken erreichen, bevor sie … zu spät, ihre Hand an meinem Oberarm.
«Jörn, mein Gott, wie siehst du aus, es ist ja alles voll … was ist denn passiert?» Sie flüsterte, als ob es ein Geheimnis vor unserem Gast zu hüten galt.
«Ein Angelhaken, ist in meinem Nacken gelandet.»
«Wie das denn?»
«Vom Wind oder ein Ast oder beides.»
«Willst du zum Arzt?»
«Dann wäre ich jetzt nicht hier.»
Sie schüttelte den Kopf. «Soll ich mal gucken?»
«Da gibt es nichts zu gucken, ich habe den Haken rausgekriegt. Sieht halt schlimmer aus, als es ist.»
Sie drängelte sich an mir vorbei ins Bad, holte die rote Erste-Hilfe-Kiste aus dem Hängeschrank und stellte sie neben dem Waschbecken ab. «Da ist Jod drin. Das desinfiziert.»
Ihr Telefon zwitscherte in der Hosentasche, jemand hatte ihr eine Nachricht geschrieben.
«Falls du Hilfe brauchst …»
«Rufe ich Lea.»
Wir hörten ihren Harpunierschrei und das hohle Gelächter des Fremden, der wohl als Wal herhalten musste. Schüchtern war sie nicht.
«Ich muss ins … wenn du Hilfe …», sagte meine Mutter wieder.
«Jo, jo.»
Ganz leise schob sie hinterher: «Er hat hier schon vor der Tür gewartet, als ich mit Lea vom Kindergarten kam.»
«Siebzehn Jahre habe ich nichts von meinem Vater gehört, da kommt es auf ein paar Minuten auch nicht an.»
Unsere Blicke verfingen sich, ein Moment, wie wir ihn einige Male im Jahr hatten, ein gegenseitiges Verstehen, wobei ich mich in dem Glauben wähnte, ihr aus der Seele gesprochen zu haben, aber ein Flackern in ihren Augen verscheuchte das vertraute Gefühl. Sie wollte etwas sagen, doch Lea kam ihr zuvor.
«UAAAAAH!»
Badezimmertür zu. Durchatmen. Ich legte mein Breaking Bad-Cap mit dem Los Pollos Hermanos-Print neben den Wasserhahn, zog mir vorsichtig das Hemd aus und das T-Shirt über den Kopf. Eine Kruste hatte das Blut noch nicht gebildet, verklebt mit dem Stoff war zumindest nichts. Auf dem blau-grau-grün karierten Hemd war das Blut zum Glück nicht allzu deutlich zu sehen, sonst hätte man mich wohl unterwegs auf dem Fahrrad angehalten.
Das T-Shirt dagegen sah richtig übel aus, wie nach einem verlorenen Showdown. Einen Augenblick überlegte ich, dann stopfte ich beide Kleidungsstücke in den Mülleimer unter dem Waschbecken.
Ich wusch mir gründlich die Hände und tupfte mit einem Lappen umständlich den Bereich um die Wunde ab. Die Verrenkungen, die ich dafür vor dem Spiegel machen musste, verursachten höllische Schmerzen, und der Spalt in meiner Haut begann wieder zu bluten. Schließlich hielt ich den Lappen einfach unter die Wunde und wartete, bis die Blutung nachließ.
Den Waschlappen warf ich dann einfach in das Becken, um die roten Spritzer überall würde ich mich später kümmern. Erst mal schnitt ich mit der Nagelschere einen zwei Finger breiten Streifen Pflaster von dem laufenden Meter ab, sprühte Jod darauf und platzierte es vorsichtig über der Wunde. Wieder atmete ich durch, geschafft.
Ich wusch den Lappen aus und schrubbte mir mit Seife die Arme, die Brust und das Gesicht. Die Anspannung hatte mich in Schweiß ausbrechen lassen. Ich schaute in den Spiegel, Ringe unter den Augen, nasse Haare, blass. Sah man mir den Blutverlust an? Ich machte meine Jesse-Miene aus Breaking Bad und nickte meinem Spiegelbild zu.
Nachdem ich mein schwarzes Yo Mr. White-T-Shirt zurechtgezupft hatte, betrat ich das Wohnzimmer. Auf dem dunklen Stoff konnte man das Blut nicht sehen, sollte es durch das Pflaster sickern. Im Fernseher schlugen sich zwei Zeichentrickfiguren leise die Schädel ein, Lea saß ungewöhnlich nah davor, grinsend und ohne zu blinzeln, näher als Mama es sonst erlaubte.
Die beiden beobachteten Lea still vom Tisch aus mit ihren Kaffeetassen – oder vielleicht glotzten sie auch die Cartoons, gerade ärgerte Tweety die Katze Sylvester. Ich wollte schon einen Kommentar loswerden, da stand der Mann auf und reichte mir die Hand, ein großer Typ, mindestens 1,90. «Hi Jörn, ich heiße Fares.»
Er trug eine dunkle Jeans von der Stange, ebenso das blaue Polohemd, beides No-Name und so neu, dass ich glaubte, den Discounter herausriechen zu können. Nur der breite Silberring, den eine Schildkröte zierte, passte nicht zu ihm.
«Guten Tag, Herr Fares.»
Fester Händedruck.
«Nein, Fares ist mein Vorname, du kannst mich duzen», sagte er freundlich mit einem beinahe priesterwürdigen Lächeln.
Ich schwang mich auf den Stuhl ihm gegenüber, Mutter saß am Kopfende. Beide schauten mich an, als wäre ich derjenige, der etwas zu sagen hatte. Das Päckchen auf dem Tisch entpuppte sich als eine Art Schuhkarton, vielleicht war es auch einer, wenn ja, dann einer mir unbekannten Marke.
«Und?» Ich klatschte in die Hände. «Was will das Kriechtier auf einmal von mir?»
Fares tat so, als hätte ich ihn angespuckt, verblüfft schaute er meine Mutter an.
Sie wischte sich übers Gesicht. «Jörn», sie schloss die Augen und öffnete sie langsam wieder. «Es geht um deinen Vater.»
«Äh, jo?»
Dass sie von ihren sonstigen Bezeichnungen absah, hatte wohl mit unserem Besuch zu tun, er war ja angeblich ein Freund von ihm. Na ja, wegen mir sollte er ruhig wissen, was wir von seinem tollen Freund hielten.
«Das hast du mir am Telefon gesagt.»
Sie warf einen Blick zu diesem Fares, der jedoch keine Anstalten machte, etwas zu sagen. Offenbar hatten sich die beiden in meiner Abwesenheit darüber geeinigt, wer von ihnen mit der Sprache herausrücken sollte. Zumindest senkte Fares den Kopf mit der Entschlossenheit eines Schweigenden, der ausschließlich zuhören würde.
Meine Mutter seufzte leise, dann holte sie ungewöhnlich tief Luft für die nächsten vier Worte und sagte, nicht ohne noch einmal zu unserem Gast geschaut zu haben: «Dein Vater ist gestorben.»
Im selben Augenblick pfiff ihr Handy. Eine ihrer Facebook-Freundinnen hatte etwas gepostet.
Von Fares kam ein gehauchtes «Mein Beileid.»
Die entfernten Geräusche der Cartoons waren die einzigen im Raum.
Ich hätte still in Tränen ausbrechen können, laut aufschreien, vor Schmerz schluchzen, den Kopf schütteln im Unglauben des harschen Schicksals, mich in die Arme meiner Mutter stürzen, in meinem Zimmer verbarrikadieren oder einfach mit den Achseln zucken, nach dem weiteren Vorgehen fragen, sachlich, männlich, nüchtern die Diskussion zu Ende führen; ich hätte mich auch darüber lustig machen können, einen zynischen Witz reißen, mit Humor dem Tod meines unbekannten leiblichen Vaters begegnen, der sich nie hatte blicken lassen, und den unumstößlichen Fakt weglachen; ich hätte mir jede Zahl aus dem Gefühlsroulette auswählen dürfen, wenn schon kein anderer, so hätte ich das Recht dazu gehabt, ohne dass mir jemand hätte Vorwürfe machen dürfen, aber ich wartete auf eine nicht steuerbare Reaktion, auf eine Stimme von innen, ein Zeichen, und als es kam, war ich so überrascht wie sprachlos wie ein Wissenschaftler angesichts einer neuen, vorher unbekannten Spezies: ein zartes Zucken im Magen wie von zehn Volt Strom ausgelöst.
In der Vergangenheit hatte ich mir gelegentlich den Tod meiner Lieben vorgestellt: von Chris, von meinem Kumpel Basti, am häufigsten den meiner Mutter. Was wäre, wenn das passieren würde, wie würde ich reagieren, wie die anderen? Wie würde ich es erfahren, auf welche Art und Weise wäre es geschehen? Wie sähen die Stunden danach aus, die Tage, die Wochen, das Leben? Ja, ich hatte mir sogar meinen eigenen Tod ausgemalt, tragisch, oft draufgängerisch, am liebsten heroisch, als Opfer für ein höheres Wesen, zum Beispiel Anna aus der Parallelklasse, weil ich sie vor einer Horde Neonazis rettete und dabei feige und hinterrücks von den Glatzen erschlagen wurde. Danach folgten die Trauer meiner Mutter, post mortem Bundesverdienstkreuz für mich, Umbenennung meiner Schule, Gründung einer Stiftung, Bronzestatue und Heiligsprechung; ich sah alles vor mir, die Gerichtsverhandlung für die Glatzen und wie sie nur mit Bewährungsstrafen feixend das Gericht verließen, ich sah jedes Detail.
Ich fühlte den Schmerz der anderen bei meinem Tod, und ich fühlte meinen Schmerz bei ihrem. Ich spürte die Trauer so sehr, dass ich mir einige Male verkneifen musste, nicht durch meine Phantasien in Tränen auszubrechen, lebhafte Todesphantasien. Krank eigentlich. Mit Basti hatte ich nie darüber gesprochen, ich war sicherlich der Einzige auf der Welt, der so dämlich tickte, vielleicht weil in meinem Kopf ein unentdeckter pampelmusengroßer Tumor auf den Stirnlappen drückte.
Doch ich hatte mir nie den Tod meines leiblichen Vaters vorgestellt. Rocco. Wozu auch? Sein Tod hätte keinen Effekt auf mich und mein Leben, nichts wäre unverrückbar anders danach, lediglich mein leiblicher Vater würde irgendwo umkippen wie ein Sack Reis in China, und die Welt würde sich normal weiterdrehen.
Boioioioing tönte es aus dem Fernseher, und Lea lachte hell auf.
Das nahm ich als Signal, endlich «Aha» zu machen.
Ich betonte es mit Respekt, gefasst und offen. In diesem Aha schwangen siebzehn vergessene Jahre mit und meine Neugier, was sein Tod für mich bedeutete. Meine Mutter war offensichtlich froh, dass ich überhaupt eine Reaktion gezeigt hatte, denn sie nickte kurz und entspannte sich sichtlich. Fares sah mich an, als wollte er schlau aus mir werden, als gäbe es irgendein größeres Geheimnis hinter meinem undurchdringlichen Pokergesicht, als würde ich etwas verbergen. Aber die Zähne kriegten beide immer noch nicht auseinander.
Was kam als Nächstes? Wann würde er beerdigt werden? Oder war er es schon? Und wo? Sollte ich etwas erben? Wo er doch nie Unterhalt bezahlt hatte, weil er angeblich nicht genug verdiente? Wahrscheinlich hatte er mir Schulden hinterlassen, das würde ihm ähnlich sehen. Dann müsste ich das Erbe ausschlagen. Den Begriff hatte ich schon mal gehört.
Und da stand noch dieser Schuhkarton. Den musste Fares mitgebracht haben. Waren da seine persönlichen Gegenstände drin, die mir feierlich überreicht werden sollten? Persönliche Gegenstände, die mir rein gar nichts bedeuteten? Ich verband ja nichts mit ihnen.
Lea lachte und klatschte den Cartoons Beifall.
Das Schweigen ging mir auf den Geist, ich zeigte auf den Karton. «Was ist da drin?»
«Er», sagte Fares, als hätte er nur auf meine Frage gewartet. Wenn es überhaupt möglich war, dann schaute er mich noch forschender an.
Die flatternden Augenlider meiner Mutter verrieten mir, dass dieser Fares das ernst meinte.
Ich fragte dennoch nach. «Er?»
«Seine Asche», sagte Fares.
Seine Asche? Mit anderen Worten: Vor mir sollten die sterblichen Überreste meines leiblichen Vaters auf unserem Wohnzimmertisch stehen?
Ein beklemmendes Gefühl machte sich in meiner Brust breit. Aber selbst, wenn es sich um einen Fremden gehandelt hätte, hätte sich mir alles zusammengezogen, denn dort, auf dem Wohnzimmertisch neben dem Zuckerstreuer, lag ein Toter. Seine Asche.
Roch es nicht sogar verbrannt? Ein kurzer Anflug von Schwindel.
«Aha», machte ich wieder.
Meine Mutter griff nach meiner Hand. «Wie fühlst du dich?»
«Wie soll ich mich fühlen?» Ich aalte meine Hand aus ihrer prähistorischen Geste und lehnte mich zurück, als bräuchte ich Abstand zu dem Pappsarg. «Und jetzt? Was sollen wir damit?»
Fares setzte sich gerade auf und sagte ruhig: «Rocco wollte, dass du seine Asche in seiner Heimat beisetzt.»
«Beisetzt?», fragte ich zurück, als wüsste ich nicht, was das bedeutete.
«Beerdigst, ja, in Viaggio, Italien, wo er geboren wurde.»
Mama verfolgte unser Gespräch wie ein Tennismatch.
«Ich?»
«Ja. Wenn du vom Hafen mit dem Bus nach Viaggio fährst, dann ist es die erste Haltestelle nach dem Marktplatz. Dort ist ein Olivenbaum. Darunter.»
«Unter einem Olivenbaum?»
«Ja.»
«Kein Friedhof?»
«Nein.»
«Ah», konnte ich nur machen.
«Es war sein Wunsch, sein letzter Wunsch.»
«Was?», presste ich durch meine Zähne und stand vom Tisch auf.
«Jörn», mahnte meine Mutter, ich sollte ruhig bleiben.
Ich setzte mich wieder. Sie rieb sich die Stirn.
Lea kam angelaufen. «Mama, Mama, die Katze hat dem Hund gesagt, er soll nicht kommen, aber er kommt immer, böser Hund, böser Hund.»
«Ja», sagte meine Mutter. «Magst du noch etwas fernsehgucken.»
«Aber der böse Hund hat gesagt …» Sie nieste, gelbgrüne Schleimspuren glänzten bis zum Kinn. Ihre Zunge schnellte hervor.
«Nicht, warte!», rief Mama und putzte Leas Nase mit einem hervorgezauberten Tempotuch. «So ist gut.» Sie steckte das Papiertaschentuch weg, dann sah sie erschrocken zum Fernseher. «Huch, guck mal, der Hund jagt das arme Kätzchen!»
Lea flitzte zum Bildschirm und schmiss sich einen Meter davor auf die Knie. Zunächst schauten wir ihr alle nach, auch noch als sie schon längst auf dem Teppich hockte, als wollten wir ebenfalls ihrer Sendung folgen, allemal besser als dem aktuellen Gesprächsthema. Dann verhakten sich unsere Blicke wieder über dem Tisch.
«Sein letzter Wunsch?», fragte ich diesen Fares. «Sein letzter Wunsch? Und was war mit meinen Wünschen all die Jahre?»
Ich wusste gar nicht, wo das herkam.
«Ich kann mir vorstellen, das kommt für dich jetzt sehr überraschend.»
«Ich glaube nicht, dass Sie sich das vorstellen können.» Ich wandte mich an meine Mutter. «Was sagst du dazu? Er hat dir doch sicherlich alles erzählt, beim Kaffee, vorhin.»
Meine Wunde im Nacken schmerzte.
Sie räusperte sich. «Ich habe ihm gesagt, wie wir zu deinem Vater stehen. Standen.»
Stumm guckten wir alle den Schuhkarton an, als könnte die Antwort von dort kommen.
Die Titelmelodie von Dr. House trällerte los, doch Mama drückte das Gespräch weg.
«Jörn, ich tue nur, um was Rocco mich gebeten hat. Ich will dir nix. Das ist nicht meine Idee. Es war sein letzter Wunsch an mich, dir seine Asche und die Briefe zu überreichen.»
«Welche Briefe?»
«Da sind auch Briefe drin, zehn.»
«Zehn Briefe, warum? Und … wie soll ich bitte schön überhaupt nach Italien kommen?»
«Dafür hat er gesorgt.» Fares nahm einen Umschlag, der auf seiner Seite am Karton gelehnt haben musste, denn ich hatte ihn vorher nicht bemerkt, und reichte ihn mir. «Das ist dein Ticket für deinen Urlaub, inklusive Flug, Essen und Trinken.» Er betonte den Urlaub besonders. «Eine zehntägige Kreuzfahrt mit Stopp in Civitavecchia, bei Rom, nahe Viaggio. Und die zehn Briefe hier drin … da sollst du jeden Tag einen aufmachen auf der Reise.»
Ich stierte auf das herausgezogene Ticket, aber ich brachte keinen Sinn in die Zahlen und Daten darauf.
«Und wann soll das losgehen?»
«Steht oben rechts.»
«Abreise … das wäre morgen. Freitag, oder?»
«Ja.»
«Wir fahren morgen …?» Ich schaute meine Mutter an.
«Nein, nur du», sagte sie.
«Nur ich? Wie, nur ich?»
Fares fühlte sich angesprochen. «Ihr wisst ja, Rocco hatte nie viel Geld …»
«Genug wohl, um mir eine Kreuzfahrt zu spendieren!»
«Das war ein Geschenk des Unternehmens, als er … nicht mehr arbeiten konnte. Als Dank für die Jahre auf See und dafür, zuverlässiger Teil des Teams gewesen zu sein. Aber er wollte sie selber nicht, er rief an und ließ das Ticket auf deinen Namen ausstellen und die Reise verlegen … auf die Zeit nach … ähm … nach der Zeit, die ihm die Ärzte noch gegeben hatten.»
Mein Blick klebte auf dem Schuhkarton, meine Gedanken flatterten durch den Raum, einfangen konnte ich keinen. Ich? Was soll ich? Und geflogen bin ich auch noch nie.
Meine Mutter meinte: «Er ist durcheinander, das ist zu viel auf einmal, da kann er nicht morgen einfach los.»
«Warum bringen Sie seine Asche nicht nach Vi… Vi… Rom? Sie waren sein Freund.»
«Aber nicht sein Sohn, und es war nicht sein letzter Wunsch.»
Fares’ nette Fassade bröckelte, ihm war anzumerken, dass er hier genauso wenig sitzen wollte wie ich.
«Ich … kann nicht, ich will mit David nach Holland, mit dem Fahrrad nächste Woche.»
Er zog die Augenbrauen hoch.
«Außerdem ist der Nachtangelwettbewerb.»
Fares schaute zu meiner Mutter, die eine Geste machte à la Hab-ich-doch-gleich-gesagt.
«Der kann doch nicht einfach erwarten, dass ich von heute auf morgen so etwas mache. Das kann er doch nicht», sagte ich zum Schuhkarton, zu Fares, zu mir selbst.
«Rocco hatte länger gelebt, als die Ärzte erwartet hatten. Er war zäh, er hing am Leben. Und an seinem Job …»
Aber nicht an mir.
Mein Vater war zur See gefahren? «Er war Matrose?»
«Nein, er war einer der Musiker an Bord.»
«Musiker?»
«Gitarre und Gesang, Entertainment, immer auf Kreuzfahrtschiffen.»
«Damit lässt sich Geld verdienen?»
«Nicht viel. Aber man hat weniger Fixkosten, muss keine Wohnung haben und so.»
Ich raufte mir die Haare. Im Fernsehen lief Werbung.
«Und warum soll ich das von meinem Supervater annehmen?»
«Nur aus dem einen Grund, es war sein letzter Wunsch.»
So einfach war das für ihn. Mein Samsung quakte, eine Textmessage. Während ich es aus der Tasche fummelte, fragte ich: «Und Sie würden das?»
«Selbst wenn es ein Fremder wäre, würde ich das tun.»
Fares sagte das in einem sehr bestimmten Ton, der seine Einstellung zum Thema verdeutlichte, bar der Wärme und Weichheit in seiner Stimme, unumstößlich, wie der Böse in einem Superheldenfilm.
Mein Vater hatte zu Lebzeiten offensichtlich Freunde gehabt, die für ihn vieles tun würden. Warum wollte er dann, dass sein unbekannter Sohn diesen letzten Willen erfüllt, ohne zu fragen, ohne sich vorher zu melden, ohne einen Anruf?
Ich las die Nachricht auf dem Display, von David: Sorry, alter, shit, goodbye Holland, Eltis machen Aufstand, no way, haste am WE zeit? D.
Ich steckte das Handy weg und sah bestimmt aus wie dieser ehemalige US-Präsident, als er die Nachricht von 9/11 ins Ohr geflüstert bekommen hat, während er in einer Grundschule saß. Innerlich war es dem damals sicherlich nicht anders gegangen.
«Jörn, du musst nicht, wenn du nicht willst», sagte meine Mutter leise.
Sie konnte wohl mehr aus meinem Gesicht lesen. Ich weiß noch, wie David großkotzig gesagt hatte, machen wir, alles klar, Alter, das winken meine Eltern durch, wir beide mit dem Fahrrad nach Holland, zelten, geil, ey, Party, Party, Party. Von wegen Party, Party, Party: Heiße Luft, heiße Luft, heiße Luft. Wenn mir eins auf den Zeiger ging, waren das Leute, die den Mund zu voll nahmen. Erst auf dicke Hose machen und labern, und dann, wenn es darauf ankommt, ziehen sie den Schwanz ein. Soll der doch nicht so tun, als wüsste er, wie seine Eltern ticken.
Und mein Vater wusste nicht, wie ich ticke.
«F… und was ist, wenn ich jetzt ‹Gut, ich mach das› sage?»
Fares’ Gesicht hellte sich auf. «Ich würde mich freuen, für Rocco und für dich.»
«Aber er ist doch erst 17. Da darf er doch noch nicht alleine reisen», wandte meine Mutter ein.
«Mit der Einwilligung der … mit Ihrer Einwilligung schon, schriftlich natürlich.»
«Auf so einem Schiff geht es fein zu, zu fein, soll ich etwa mit ihm heute noch mal eben feine Sachen shoppen gehen, oder was?» Meine Mutter schnaubte.
«Kein Problem, auf der Athene ist alles locker, Casual Wear, keine Kleiderordnung, nur ordentlich muss sie sein.»
Athene, der Name des Schiffes.
«Also wenn ich jetzt zusage, mich aber morgen früh dagegen entscheide … geht das?»
«Geht alles. Dann komme ich noch mal vorbei, ich bin bis morgen in der Stadt.»
«Und dann?»
«Nehme ich seine Asche mit. Ich bin auf der Nordroute, Spitzbergen, dann werde ich seine Asche in die Nordsee streuen.»
Unerwartet traf mich ein weiterer kleiner Stromstoß im Magen. Das war keine italienische Erde, das war nicht mal Erde.
«War das sein zweiter Wunsch?», fragte ich vorsichtig. Gab es überhaupt einen Zweitwunsch bei so was?
«Nein, aber dann geht es eben nicht anders. Ich bin unter Vertrag und kann nicht nach Italien.»
Die Nordsee war nicht Italien. Nun fragte ich mich, ob ich das nicht auch für einen Fremden tun würde. Für einen fremden Vater allemal.
«Die Briefe behältst du selbstverständlich», sagte Fares, als müsste er noch einen Trumpf ausspielen, um mich zu überzeugen.
Lea nieste.
«Näschen putzen?», fragte meine Mutter.
Keine Antwort, ihr Blick klebte auf dem Bildschirm.
«Wohl nicht», sagte sie leise zu sich und wischte mit der flachen Hand unsichtbaren Staub vom Tisch, bevor sie sich an Fares wandte. «Ist das überhaupt erlaubt, die Asche eines Menschen einfach so zu transportieren, auf einem Schiff oder ganz generell?»
«Nein. Ich würde damit nicht hausieren gehen.»
«Dann macht sich Jörn also strafbar?»
«Nicht wenn er nicht erwischt wird.»
«Also …»
«Er wird nicht erwischt. Es gibt nur die Gepäckkontrolle am Flughafen und am Schiff, und Asche wird da nicht mit Plastiksprengstoff verwechselt.»
«Und wie kamen Sie so einfach an die Asche?»
«Rocco hatte Freunde, gute Freunde.»
«Und Freundinnen», giftete meine Mutter.
«Gut», sagte ich. «Ich mach das.»
So formulierte ich das. Als hätte ich selbst davor Angst, es laut auszusprechen, dass ich die Asche meines verdammten Vaters in seiner Geburtsstadt begraben würde. Dass ich mich morgen mit seiner Urne auf die Reise auf einem Schiff begeben würde, auf dem er früher gearbeitet hatte, mein Vater, Rocco, der dauerabgebrannte Musiker, Partyheld und Kriechtier.
«Dem müsste ich dann zustimmen?», fragte meine Mutter.
«Ja», sagte Fares irritiert. «Ist das ein Problem?»
«Und wenn ich nicht zustimme?»
Er schaute zu mir.
«Das hast du doch gehört», antwortete ich. «Nordsee.»
Ihr war das sichtlich nicht recht. Warum, wusste ich nicht.
«Er braucht doch Geld», sagte sie zu Fares.
«Es sind auch 240 Euro dabei, Taschengeld, das sollte reichen, er hat ja all inclusive.»
Ob sie damit gerechnet hatte, ich würde auf jeden Fall ablehnen? Wie konnte sie da so sicher sein? Und warum sollte sie es nicht zulassen?
«Was spricht denn dagegen?», fragte ich sie.
In ihr schien es zu brodeln, sie beherrschte sich nur, weil Fares am Tisch saß. War sie neidisch auf die Kreuzfahrt?
«Der große Spaß wird es nicht», sagte ich. «Das sind schwimmende Hotels, Supermarktmalls, alles voll Rentner.»
«Mh-mmh», machte sie.
«Mama?»
Sie wollte gerade etwas sagen, da nieste Lea zweimal und schrie auf. «Iiiiiiiiih, Mamaaaaaaa …»
Ihre Hand schlug auf den Tisch, als sie aufstand, und mit der anderen winkte sie ab in meine Richtung. «Macht doch, was ihr wollt.»
Mit dem Taschentuch in der Hand eilte sie mit großen Schritten zu Lea, die sich den Schaden besah, der zwischen ihren Händen und ihrem Gesicht schwabbelte.
Fares schaute mich fragend an.
«So sagt sie ja», meinte ich.
Er nickte zufrieden, für ihn zählte nur das Ergebnis.
«Dann mach mal den Karton auf», sagte er.
Nachdem ich die Klebestreifen gelöst hatte, hob ich den Deckel an. Ich spürte mein Herz in der Brust schlagen. Gleich würde ich die Urne mit der Asche in der Hand halten.
Dieses intensive Gefühl verflog, als ich den ersten Blick hineinwerfen konnte. Achtlos legte ich den Deckel neben das Päckchen, als hätte alles an Wert verloren.
«Was ist das denn? Sie haben doch gesagt, da ist seine Urne drin?»
Diagonal lag im Päckchen ein unterarmdickes Stück Holz mit zwei stumpfen Enden, wie abgesägt. Das glänzend lackierte Holz selbst war hell mit dunklen Maserungen und zahllosen winzigen schwarzen Punkten, wie der Schatten eines Bartes. Darunter schaute ein Umschlag hervor, darin waren wohl die Briefe.
«Ich habe gesagt, seine Asche! Von einer Urne war nicht die Rede. Wir haben die Asche umgefüllt. In einen Rainmaker. Damit es nicht auffällt, eine Urne könnte auffallen bei der Security, Urnen sind aus Metall und … Urnen eben, auffällig. Du sollst ja keine Schwierigkeiten bekommen.»
Ich hatte keine Ahnung, was ein Rainmaker war.
Meine Mutter stand mittlerweile wieder neben uns. «Den Knüppel hätte ich damals haben sollen, als er sich auf und davon gemacht hat. Dann hätten wir heute den Ärger nicht.»
Fares zwinkerte kurz und sagte: «Nimm ihn mal raus.»
Zögerlich umschlossen meine Finger das glatte Holz. Als ich es anheben wollte, musste ich das Päckchen festhalten, so passgenau fügte sich der Rainmaker in die Ecken ein. Plötzlich begann der Prügel zu rasseln, und ich ließ ihn zurück in die Kiste fallen. Mir lief ein Schauer über den Rücken.
«Fuck, biatch!»
«Was ist?», fragte Fares.
«Wie? Was ist? Haben Sie das nicht gehört?»
«Das ist ein Rainmaker. Überrascht, dass er noch funktioniert?»
«Funktioniert? Das soll so sein?»
«Funktioniert natürlich nicht mehr so gut, wir haben ja die meisten Kiesel entfernt. Damit niemand Verdacht schöpft. Ein stiller Rainmaker wäre seltsam.»
«Was ist denn ein Rainmaker?»
«Ach so», jetzt lachte er. «Ein Musikinstrument. Wenn man es umdreht, hört es sich an wie Regen. Kommt aus Chile. Echtes Copado-Kaktusrohr.»
«Und warum rasselt es dadrin?»
«Die Dornen des Kaktus werden nach innen getrieben und der Hohlraum mit kleinen Kieseln gefüllt. Das ergibt das Geräusch. Bei dem hier würde aber jeder mit Ahnung von Musik sofort merken, dass etwas mit diesem Ding nicht stimmt. Ist nur zu einem Drittel mit Kieseln gefüllt, der Rest ist …» Er machte eine Geste, ich wüsste schon, was.
«Noch nie davon gehört, Rainmaker. Hab ich mich erschrocken. Was passiert als Nächstes, wenn ich ihn herausnehme? Sagt das Teil ‹Hallo›?»
«Nein, es rasselt, nur eben viel zu kurz.»
Ich griff mit etwas weniger Respekt nach dem Ding.
Meine Mutter schüttelte den Kopf. «Typisch, alles ein großer Witz für ihn. Das Leben, der Tod.»
Und Fares meinte: «Stell dir jetzt das Rasseln zehnmal so lang vor, dann hast du Regen.»
Wir schauten einander an, und ich hatte das Gefühl, wir würden alle ein Lachen unterdrücken.
Ich drehte den Rainmaker abermals, es rasselte wieder, dann ein trockenes Plock.
«Was war das denn?», fragte ich.
«Sein Herz», schoss es aus meiner Mutter hervor.
Fares korrigierte das Bild und tippte sich mit dem Zeigefinger auf den rechten oberen Mundwinkel. «Er hatte eine Goldkrone.»
Betretenes Schweigen, Fares sagte nichts weiter, und sie verkniff sich eine Entschuldigung für ihre Pietätlosigkeit.
«Rocco wollte auch keine stählerne Aschekapsel. Die zerfällt nicht so schnell im Erdreich. Es war seine Idee, etwas aus Holz zu nehmen, etwas Unauffälliges», sagte Fares.
«Wie den Rainmaker», flüsterte ich und legte ihn auf den Tisch.
«Ja.»
Wir hingen eine Weile unseren Gedanken nach, während Fred Feuerstein im Fernsehen ein Rennen mit Barnie Geröllheimer fuhr.
Dann deutete Fares auf den Umschlag. «Da drinnen sind die Briefe. Soweit ich weiß, ist jeder Brief separat in einem Umschlag, und du sollst jeden Tag einen aufmachen. Er hat sie datiert. Steht aber auch auf dem großen Umschlag. Da ist auch das Geld drin.»
«Aha.»
Er schaute von mir zu meiner Mutter. «Ich glaube, das wäre alles, von meiner Seite.»
«Danke», sie klang nicht besonders freundlich.
Schon mal das Gefühl gehabt, du kennst deine eigene Mutter nicht? Dass sie Geheimnisse vor dir hat, diese andere Person? So fühlte ich mich.
«Hast du noch was?», fragte er.
«Nein.»
Stehend schüttelten wir die Hände über dem Rainmaker auf dem Tisch, als würden wir einen Pakt besiegeln.
«Und wenn etwas ist, dann kannst du mich morgen noch telefonisch erreichen. Die Nummer steht auf der Rückseite des Tickets.»
«Okay. Danach nicht mehr?»
«Dann bin ich wieder auf See, ohne Empfang.»