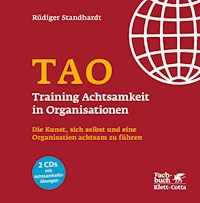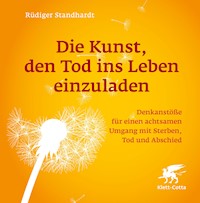
27,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
24 Impulse zu einem offenen Umgang mit dem Sterben Ein achtsamer Wegbegleiter für alle, die sich mit ihrem Tod befassen wollen Holt die Themen Sterben, Tod und Abschied heraus aus der Tabuzone Für mehr Gelassenheit, Lebensfreude und Leichtigkeit des Seins Mit diesem außergewöhnlichen Buch finden Sie heraus, was im Leben wirklich zählt und wie es möglich ist, sich auf das Wesentliche auszurichten. Obwohl es nur zwei Gewissheiten im Leben gibt – wir werden alle sterben und wir wissen nicht wann – vermeiden viele Menschen zeitlebens das immer noch tabuisierte Thema Sterben und Tod und empfinden eine Scheu, sich mit der eigenen Endlichkeit zu beschäftigen. In diesem Buch erhalten Sie viele erfrischende Denkanstöße zu den Themen Leben, Sterben, Tod und Trauer, inspirierende Fragen, die Sie zur Selbstreflexion ermutigen sowie spannende Impulse von Sabine Mehne, Sabine M. Kistner und Stephanie Gotthardt. Sie sind eingeladen, den Forschergeist zu entwickeln, um das Leben in seiner ganzen Fülle zu erfahren. »Wenn wir in Gedanken mit dem Tode vertraut sind, nehmen wir jede Woche, jeden Tag als ein Geschenk an, und erst wenn man sich das Leben so stückweise schenken lässt, wird es kostbar.« Albert Schweitzer
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 284
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Rüdiger Standhardt
Die Kunst, den Tod ins Leben einzuladen
Denkanstöße für einen achtsamen Umgang mit Sterben, Tod und Abschied
Mit einem Vorwort von David Roth und Beiträgen von Sabine Mehne, Sabine M. Kistner und Stephanie Gotthardt
Klett-Cotta
Impressum
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Klett-Cotta
www.klett-cotta.de
© 2023 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte vorbehalten
Cover: Bettina Herrmann, Stuttgart
unter Verwendung einer Abbildung von chrupka/iStock by Getty Images
Gesetzt von Eberl & Koesel Studio GmbH, Kempten
Gedruckt und gebunden von Friedrich Pustet GmbH & Co. KG, Regensburg
ISBN 978-3-608-98707-2
E-Book ISBN 978-3-608-11992-3
PDF-E-Book ISBN 978-3-608-20605-0
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Inhalt
Vorwort
Einleitung
Einladung zur Praxis der Achtsamkeit
1 | Leben
Denkanstoß 1:
Liebe Dich selbst
Denkanstoß 2:
Liebe in der Partnerschaft
Denkanstoß 3:
Die Arbeit lieben
Denkanstoß 4:
Den blauen Planeten lieben
Denkanstoß 5:
Vorsorge – ein Akt der Liebe
Denkanstoß 6:
Glücklich sein im Leben
Einladung zur Praxis der Achtsamkeit
2 | Sterben
Denkanstoß 7:
Von Wünschen und Löffeln
Denkanstoß 8:
Den Abschied zu Lebzeiten planen
Denkanstoß 9:
Hospizarbeit und Palliativversorgung
Denkanstoß 10:
Sterbefasten und Sterbehilfe
Denkanstoß 11:
Kommunikation am Lebensende
Denkanstoß 12:
Körperliche, seelische und spirituelle Prozesse in den letzten Tagen und Wochen
Einladung zur Praxis der Achtsamkeit
3 | Tod
Denkanstoß 13:
Die Urne selber gestalten
Denkanstoß 14:
Gestaltungsspielräume im Todesfall
Denkanstoß 15:
Was nach dem Tod kommt
Denkanstoß 16:
An der Schwelle des Todes
Denkanstoß 17:
Interview mit dem Tod
Denkanstoß 18:
Aktives Abschiednehmen zwischen Tod und Bestattung
Einladung zur Praxis der Achtsamkeit
4 | Trauer
Denkanstoß 19:
Die Unfähigkeit zu trauern
Denkanstoß 20:
Trauerphasen
Denkanstoß 21:
Trauergruppen
Denkanstoß 22:
Trauer am Arbeitsplatz
Denkanstoß 23:
Die Trauer als achtsamer Lebensbegleiter
Denkanstoß 24:
Das Leben neu entdecken
Einladung zur Praxis der Achtsamkeit
Schlusswort
Einladung zur Praxis der Achtsamkeit
Anhang
Anmerkungen
Literatur
Achtsamkeitsübungen
Internetadressen
Online-Achtsamkeitstraining
Meinen beiden Söhnen Thilo und Henning in Liebe, Freude und Verbundenheit
Bereite Dich jetzt auf den Tod vor, damit Dein Leben intensiver und erfüllender wird.
Stephen Levine
Vorwort
Herzlichen Glückwunsch!
Diese beiden Worte am Anfang eines Buches zu finden, in dem es um Sterben, Abschied, Trauer und Tod geht, wird Sie vielleicht überraschen. Aber mit der Entscheidung, sich diesen unausweichlichen Themen zu stellen, könnte sich ihr Leben verändern. Zum Besseren!
Es ist noch gar nicht so lange her, da gehörte der Tod zum Alltagsleben. Die Menschen sind da gestorben, wo sie zu Hause waren. Aufgebahrt wurden Tote in den eigenen vier Wänden. Das Leben im Haus ging weiter! Trauer war eine Sache der Gemeinschaft. Und heute? Die Dienstleistungs- bzw. Entsorgungsmentalität, die an der Schnittstelle zwischen Leben und Tod herrscht, aber auch der Kult, den wir um Höchstleistung und ewige Jugend zelebrieren, haben dazu geführt, dass viele den Tod häufig nur noch vom Hörensagen kennen. Ein weiterer Grund liegt in unserem Konsumverhalten, unserem Glauben alles ersetzen, neu kaufen zu können. Wir leben, als gebe es keine Grenzen. Der Tod ist eine natürliche Grenze. Weil man ihn nicht abzuschaffen kann, wird er tabuisiert und totgeschwiegen.
In diesem Buch von Rüdiger Standhardt teilen er und seine Gastautoren Erfahrungen und Ideen mit Ihnen, die helfen werden, Trauer und Tod anzunehmen. Es geht nicht darum, etwas zu überwinden, zu verdrängen oder zu bewältigen. Es geht darum, den Tod als Teil des Lebens zu begreifen und über die Annahme der Tatsache, dass jeder von uns sterben muss, ein Gefühl für die eigene Endlichkeit zu bekommen. Der Tod begrenzt das Leben. Durch den Tod wird unsere Lebenszeit zu etwas Kostbarem. Den Tod zurück ins Alltagsleben zu holen, dazu will dieses Buch ermuntern.
In unserem Bestattungshaus in Bergisch Gladbach betten wir die Toten in ihrer Lieblings- bzw. Alltagskleidung zur letzten Ruhe. Eltern und Kindern bieten wir an, bei der Totenwäsche und dem Einkleiden dabei zu sein. Der Verstorbene wird in einem hellen, freundlichen Raum aufgebahrt. Familie und Freunde können Stunden, wenn sie es wollen auch Tage, mit dem Toten verbringen. Sie können den Toten anfassen, ihm Geschenke und Gegenstände, die ihm wichtig waren und ausgemacht haben, als Grabbeigaben in den Sarg legen. Die Trauernden können Musik hören, Lesen, Schweigen, Reden, Schreien, Lachen. Erlaubt ist alles, was nicht gegen die guten Sitten verstößt. Bei uns trauern die Menschen ohne Vorschriften. Wenn man jemanden liebt, lässt man sich ja auch nicht diktieren, wie man dieses Gefühl ausleben soll. Trauer ist für mich eine besondere Form der Liebe. Trauerliebe, wie ich sie nenne, verlangt deshalb eine besondere Form des Ausdrucks. Jeder Trauernde sollte die Chance haben, sein ganz individuelles Abschiedsritual zu entdecken.
Es ist an der Zeit, die starren Wege, die uns die konventionelle Bestattungskultur vorschreibt, zu verlassen und endlich wieder die Trauernden in den Mittelpunkt zu stellen. Je früher wir anfangen hinzuschauen, desto besser sind wir darauf vorbereitet, im Trauerfall die richtigen Entscheidungen zu treffen und mit unserer Trauer vernünftig umzugehen. Wer seinen Ehepartner, seinen Vater, seine Mutter, sein Kind oder einen guten Freund verliert, muss sein Leben neu ordnen. Der Verlust eines geliebten Menschen hinterlässt eine Lücke. Was hätte man noch alles zusammen erleben können, was wollte man dem Verstorbenen nicht alles noch sagen. Es sind die verpassten Chancen, vielleicht sogar die Trauer über das eigene, manchmal ungelebte Leben, die wehtun. Der Tod zeigt uns, wie schnell die Zeit vergeht, wie unwiederbringlich vieles im Leben ist.
In Rüdiger Standhardt und den Autoren dieses Buches habe ich Verbündete im Kampf gegen Ignoranz, Unachtsamkeit und Herzlosigkeit gefunden. Als Bestatter versuche ich, Menschen Mut zu machen, sich die Toten und die damit verbundenen Gefühle nicht stehlen zu lassen. Experten aus den Bereichen Vorsorge, Sterbebegleitung, Bestattung, Trauerbegleitung teilen in diesem Buch ihr Wissen. Die Autorin Sabine Mehne hatte während ihrer Krebstherapie eine Nahtoderfahrung und klärt heute auf über körperliche, seelische und spirituelle Prozesse in den letzten Tagen und Stunden.
Der Tod kann ein guter Lehrmeister sein, weiß Sabine Kistner, eine innovative Bestatterin aus Hessen. Sie schreibt über aktives Abschiednehmen in der Zeit zwischen Tod und Beerdigung und beschreibt Rituale für diese Übergangszeit. Stephanie Gotthardt, eine der führenden Trauerexpertinnen des Landes, erklärt, warum Trauer zum achtsamen Lebensbegleiter werden kann. Diese Menschen aus unterschiedlichen Professionen zusammengebracht hat Rüdiger Standhardt, bekannter Achtsamkeitstrainer und Trainer für Persönlichkeits- und Führungskräfteentwicklung. Inmitten der Auseinandersetzung mit dem Tod fragt er: Was ist Lebenskunst?
Trauern ist ein langer, manchmal lebenslanger Prozess. Ein solcher Prozess endet nicht nach sechs Wochen. An der Seele bleibt immer eine Narbe zurück. Diese Narbe tut auch nach langer Zeit weh, mal weniger, mal mehr. Es ist wichtig, dass über diese Narben geredet wird. Trauern bedeutet Gefühle zeigen. Wenn ich in einer solchen Situation des Verlustes nicht Gefühle zeigen, ja, weinen kann und darf, in welcher Situation sollte ich es denn sonst tun können? Gleichzeitig bedeutet trauern aber auch, danke zu sagen. Wenn dieser Mensch nicht gelebt hätte, wäre die Welt anders – unabhängig davon, ob er nur einen Wimpernschlag im Mutterleib gelebt hat oder ob er hundert Jahre alt geworden ist. Wenn in einer solchen Stunde dann das, was diesen Menschen beseelt hat und was von ihm ausgegangen ist, als Erinnerung in den Herzen der Anwesenden verankert wird, dann besteht die Chance, aus einer Trauerfeier eine Geburtstagsfeier werden zu lassen.
Jedes Jahr sterben in Deutschland über 900 000 Menschen. Sicher haben die Angehörigen und Freunde ganz ähnliche Wünsche für die Trauerfeier. Und ganz sicher wird der Weg zur ewigen Ruhe ihrer Lieben steinig, denn sie werden über Vorschriften und Dogmen stolpern. Grabsteine aus grauem, braunem oder schwarzem Marmor, poliert und mit geschwungener Oberkante verziert. Dann Stein für Stein aufgestellt in Reih und Glied. Der Volksmund spricht: »Ordnung ist das halbe Leben« und Friedhofsgärtner und Verwaltungsbeamte finden, dass das auch im Tode so sein sollte. Wie starr und unbeweglich das System mittlerweile ist, fällt immer dann auf, wenn tatsächlich mal etwas anderes als ein genormtes Grab verlangt wird.
Wir sollten uns von diesen Steinwüsten verabschieden. Konformismus erstickt jede Kreativität. Jeder Mensch ist einzigartig. Leider ist davon bei einem Spaziergang über die meisten Friedhöfe nicht mehr viel zu spüren. Im krassen Gegensatz zu einer lebendigen Trauerkultur steht die anonyme Bestattung. In meinen Augen eine Bankrotterklärung unserer Kultur des Erinnerns. Bedauerlicherweise erleben wir Anonymität und Konformismus heute überall. Im Alltag werden wir reduziert auf Kundennummern, Personalnummern und PIN-Codes. Namen sind nicht mehr gefragt. Für mich ist einer der schönsten Gedanken aus der Bibel: »Ich habe dir einen Namen gegeben und bei diesem Namen werde ich dich rufen.« Beim Namen – nicht bei der PIN.
Ich schaue im Rahmen einer Trauerfeier zurück und frage: Was ist von diesem Menschen ausgegangen? Was hat er bewegt? Wo hat er Spuren und Gedanken in dieser Welt zurückgelassen? Wodurch kann ich glauben, dass Tod niemals Tod ist? Solche Betrachtungen treffen für den Obdachlosen wie für den Vorstandvorsitzenden zu, für den Erwachsenen oder Greis wie auch für das Baby, das im Mutterleib verstorben ist.
Begreifen ist etwas sehr Sinnliches und nichts Mentales. Wir haben es verlernt, zu b e g r e i f e n. Mental verarbeiten wir auch mittlerweile den Tod. All das, was einen bewegt, was man ausdrücken möchte, lässt man sich im Trauerfall häufig aus der Hand nehmen und von anderen ausdrücken. Denken Sie nur an die ewig gleichen Traueranzeigen oder die oft mit wenig Gefühl runter geleierten Trauerreden. Trauer ist Liebe und wenn sie verliebt sind, dann schreiben Sie ihre Liebesbriefe ja auch selbst oder schicken Sie etwa einen Stellvertreter, wenn sie eine Liebeserklärung machen wollen? Wer den Unterschied zwischen tot und lebendig begreifen will, muss hinschauen. Das, was uns Menschen ausmacht, was uns beseelt, lebendig sein lässt, liegt nicht im Sarg und steckt in keiner Urne.
Ich würde mir wünschen, dass unsere Toten in Zukunft wieder durch liebevolle Hände beerdigt werden, Hände von Familienangehörigen, Freunden und Nachbarn und nicht durch Fremde oder seelenlose Versenkungsapparate. Ich träume davon, dass auch die Beerdigungen in aller Stille der Vergangenheit angehören und das nachfolgende Zusammensitzen und gemeinsame Essen, die sogenannte Trauerfeier, wieder zu einer Feier des Lebens wird.
Ich träume davon, dass Trauernde wieder in die Gemeinde integriert werden und dass Sterben, Tod und Trauer nicht mehr totgeschwiegen werden. Ich träume davon, dass der Tod wieder zu einem Begleiter wird, der uns spüren lässt, welch’ kostbares Geschenk das Leben ist. Für die Generation unserer Großväter waren Tod und Trauer noch ein selbstverständlicher Teil des Lebens, die Erfahrungen aus der fast alltäglichen Trauerarbeit in Familien, Nachbarschaft und Gesellschaft waren für jeden nutzbar. Das ist heute anders.
Auch Trauer ist ein Gefühl, das wir leben sollten. Tun wir es nicht, wiegen die Folgen schwer. Unterdrückte, nicht gelebte Trauer kann Menschen krank machen. Die Folgen können Depression und eine Reihe psychosomatischer Erkrankungen sein. Trauer im Verwandten- und Freundeskreis, aber auch am Arbeitsplatz zulassen, offen mit dem Verlust umgehen, auch wenn man vermeintlich Schwäche zeigt, wäre eine Alternative zur stummen Ignoranz, mit der Trauerfällen häufig begegnet wird.
Dieses Buch wird eine lebendige Lektüre sein, es schenkt Ihnen gute Gedanken, Inspiration und die Sicherheit, im Fall der Fälle vorbereitet und handlungsfähig zu sein. Ich bin überzeugt davon, dass dieses Buch ihr Leben verändern wird. Zum Besseren.
Herzlichst
David Roth
Einleitung
Das klare Todesbewusstsein von früh an trägt zur Lebensfreude, zur Lebensintensität bei. Nur durch das Todesbewusstsein erfahren wir das Leben als Wunder.
Max Frisch
Mutig, lebendig und humorvoll leben und zugleich stets »abflugbereit« sein! – so lautet mein Leitspruch. Meine Leidenschaft besteht darin, Menschen im Rahmen des von mir entwickelten Online-Achtsamkeitstraining Den Tod ins Leben einladen, um wirklich zu leben bei der Einübung in die Praxis der Achtsamkeit zu begleiten, die unterschiedlichen Aspekte rund um die Themen Leben, Sterben, Tod und Trauer zu besprechen und die Teilnehmenden zu ermutigen, ein Vorsorgehandbuch zu erstellen. Eine solche umfassende Entdeckungsreise ist in unserer Kultur alles andere als selbstverständlich! Während viele Menschen eine Hochzeit bereits ein Jahr im Voraus planen, sind Überlegungen zum eigenen Sterben sowie eine Planung der eigenen Abschlussfeier meistens nicht üblich. Obwohl es nur zwei Gewissheiten im Leben gibt – wir werden alle sterben, und wir wissen nicht wann – vermeiden viele Menschen zeitlebens das immer noch tabuisierte Thema Sterben und Tod und empfinden eine Scheu, sich mit der eigenen Endlichkeit zu beschäftigen. Und so ist es nicht verwunderlich, dass nur wenige Menschen in umfassender Weise geklärt haben, was nach ihrem Tod geschehen soll. Nur 30 Prozent der Deutschen haben eine Verfügung für den Todesfall getroffen, und noch weniger Menschen haben ihre letzten Wünsche verschriftlicht. Diejenigen jedoch, die sich mit Mut und Entschlossenheit dieser Aufgabe zugewandt haben, berichten davon, dass sie intensiver, freudiger und entspannter leben, weil die letzten Dinge geregelt sind. Albert Schweitzer hat das so formuliert: Wenn wir in Gedanken mit dem Tode vertraut sind, nehmen wir jede Woche, jeden Tag als ein Geschenk an, und erst wenn man sich das Leben so stückweise schenken lässt, wird es kostbar.
Auf meinen Spuren
Wer Interesse hat, sich auf eine innere Forschungsreise zu begeben, der ist eingeladen, sich zu erinnern und aufzuschreiben, wo sie oder er bisher im eigenen Leben mit dem Sterben und Tod in Berührung gekommen ist, welche emotionale Qualität diese Erlebnisse hatten und wie die Erfahrungen bis heute nachwirken. Meine erste Erinnerung ist meine Uroma Amalie, die mit über 80 Jahren im Lehnstuhl saß und sagte: »Der Herrgott kann mich holen kommen, ich bin bereit.« Diese klaren Worte beeindruckten mich als Jugendlicher, denn meine Uroma war eine vitale und lebensfrohe Frau, und in ihren Worten lag kein Bedauern. Als ich 15 Jahre alt war, brachte sich meine Oma Elisabeth um, und ich erfuhr, dass sie dies zuvor auch schon zweimal versucht hatte. Ich erlebte meine erste Beerdigung und konnte lange nicht nachempfinden, welche innere Not sie erlebt haben muss, um am Ende diesen Weg zu wählen. Mehr als ein Jahrzehnt später starb mein Opa Johannes. Er hinterließ einen genauen Ablaufplan, was nach seinem Tod alles zu geschehen hätte – geschrieben auf seiner Reiseschreibmaschine, ohne die Informationen eines Internets und all die Möglichkeiten, die uns heute zur Verfügung stehen. Die Hinterbliebenen waren froh, so eine gute Planung vorzufinden, und so konnten die letzten Dinge entspannt abgewickelt werden. Meine Oma Margarete war 93 Jahre alt, als sie nach einem Sturz ins Krankenhaus kam. Weil es ihr zunehmend schlechter ging, wurde sie auf die Intensivstation verlegt. Ihre Tochter machte dies rückgängig, und wir erlebten, wie sie immer weniger wurde und rechneten in Kürze mit ihrem Tod. Zu sechst saßen wir um ihr Bett, ihr Atem war für uns nicht mehr vernehmbar, und uns allen war klar: Der Tod tritt in Kürze ein. Doch wir irrten uns, und nach einer langen Zeit des Abwartens war uns klar, dass heute nicht der Zeitpunkt ihres Sterbens sein würde. Nach einigen Tagen kam meine Oma zurück in das Altenheim und verbrachte dort zwei Jahre ausschließlich in ihrem Bett, bis sie mit 95 Jahren starb. Es hat sich mir bis heute nicht ganz erschlossen, warum meine geliebte Oma im Krankenhaus nicht gestorben ist, obwohl sie innerlich bereit war, zu sterben.
Zweimal durfte ich dabei sein, als ein Mensch starb. Ich erinnere mich an meine Freundin Annette, eine Frau Mitte vierzig, verheiratet und Mutter zweier minderjähriger Kinder. Sie hatte Krebs und wusste irgendwann, dass sie sterben wird, und diese von ihr ausgesprochene innere Klarheit erschreckte mich. Gut eine Woche später, als es dann auf ihr Ende zu ging, wünschte sie sich meinen Besuch im Krankenhaus. Als ich die Türe öffnete, spürte ich, wie sie innerlich alle Kraft aufbrachte, um noch zu leben, und als ich zusammen mit ihrem Mann und meiner damaligen Partnerin an ihrem Bett saß, ließ sie immer mehr los und starb nach fünfzehn Minuten ganz ruhig und friedlich. Mich beeindruckte einerseits die Klarheit von Annette über den nahenden Tod einige Tage vor ihrem Ende und anderseits der Umstand, dass sie ihren Tod zum Schluss noch um wenige Stunden hinauszögern konnte, bis die gewünschten Menschen an ihrem Sterbebett waren. Am eindrücklichsten waren für mich die Geschehnisse rund um den Tod von Tante Helga und Onkel Otto aus dem Bergischen Land. Über fünfzig Jahre waren sie verheiratet. Sie hatten keine Kinder und wünschten sich, zusammen zu sterben. Tante Helga starb an Lungenkrebs und wurde wenige Tage später beerdigt. Als der ganze Trauerzug in Richtung Grab ging, wollte Onkel Otto eine kleine Pause machen und wünschte, sich ins Auto zu setzen. Während er im Auto Platz nahm – es war genau die Zeit, als der Sarg seiner Frau abgesenkt wurde –, starb er. Sein Wunsch war erfüllt, und die Rettungssanitäterin verzichtete glücklicherweise auf eine Reanimation. Als die Trauergäste den Friedhof verlassen wollte, erfuhren sie, dass die nächste Beerdigung in einer Woche stattfinden würde.
Tagebuch der Selbsterforschung
An was erinnerst Du Dich spontan, wenn Du an das Sterben und den Tod denkst?
Welche Erfahrungen haben Dich besonders berührt?
Bei welchen Menschen warst Du beim Sterbeprozess dabei?
Meine Forschungsreise
In den Tagen rund um den Jahreswechsel 2020/2021 spürte ich, dass die Zeit gekommen war, mich intensiver als je zuvor mit dem Thema Sterben und Tod zu beschäftigen. Zwar hatte ich mich schon viele Jahre zuvor, insbesondere in der Begleitung von Zivildienstleistenden und im Zusammenhang mit meinen Seminaren Die 50 überschritten, immer wieder neu mit dem Tabuthema Tod beschäftigt, doch jetzt wollte ich tiefer einsteigen. Zunächst entstand die Idee, ein neunmonatiges Online-Achtsamkeitstraining zu konzipieren, um Menschen die Möglichkeit zu eröffnen, in Gemeinschaft mit anderen Menschen und mit achtsamer Wegbegleitung diese Themen anzugehen. Meine Intention war, dass jede und jeder ein persönliches Vorsorgehandbuch entwickelt und zugleich viele berührende Impulse zu den sechs Themen Stille, Leben, Sterben, Tod, Trauer und Transzendenz erhält.
Das Jahr 2021 stand dann ganz unter diesem Thema. Ich habe die unterschiedlichsten Bücher gelesen (siehe Anhang), ein vierwöchiges Praktikum bei einem Bestatter absolviert[1], mir verschiedene Krematorien angeschaut, meine eigene Urne getöpfert[2], mit vielen Bestatter:innen, Trauerrednern, Trauerbegleitern und Autor:innen[3] gesprochen, verschiedene Seminare besucht, inspirierende Filme angeschaut, Ausstellungen und Messen besucht, mir Stadt- und Waldfriedhöfe angeschaut, mein eigenes Vorsorgehandbuch aktualisiert und erweitert, an einer Weiterbildung zum Hospizbegleiter teilgenommen[4] und meine ehrenamtliche Tätigkeit aufgenommen. Und weil die Menschen in meiner Umgebung mitbekamen, was ich tat, gab es viele, zum Teil sehr berührende Gespräche über Endlichkeit, Sterben und Tod, und nicht selten nahm ich für mein neues Projekt wichtige Impulse mit. Für mich waren zwei Erfahrungen besonders herausfordernd: Zum einen die Situationen in meinem Praktikum, wo ich beim Waschen und Ankleiden der Leichen mitwirkte, zum anderen meine erste Erfahrung in der Sterbebegleitung mit einem 65-jährigen Mann, der ALS hatte, sich fast nicht mehr bewegen konnte und bald starb.
Tagebuch der Selbsterforschung
Auf welche Weise hast Du Dich mit der Thematik von Leben und Tod beschäftigt?
Welche Orte würdest Du gerne aufsuchen, um Deinen Horizont zu erweitern?
Hast Du schon eine oder mehrere Leichen gesehen und vielleicht auch berührt?
Gesellschaftliche Wirklichkeit
Die Aufgabe der Bestattung lag jahrhundertelang in den Händen der Familie und Nachbarn, und meist übernahmen die Frauen die Aufgabe, den Toten zu waschen und anzukleiden. Anschließend kam der Schreiner mit dem Sarg, und der Verstorbene wurde in den eigenen vier Wänden auf dem Totenbett oder im offenen Sarg aufgebahrt. So hatten die Verwandten, Freunde, Bekannten und Nachbarn die Gelegenheit, sich persönlich vom Verstorbenen zu verabschieden. Diese Totenwachen, die meist rund um die Uhr stattfanden, hatten den Charakter eines gelassenen Zusammenseins, bei dem nicht nur gebetet wurde, sondern es wurde auch gemeinsam gegessen und getrunken und Geschichten aus dem Leben des Toten wurden erzählt. Es war ein Abschiednehmen über mehrere Tage, am Ende wurde der Sarg gemeinsam zum Friedhof gebracht, und der Höhepunkt des Abschiednehmens war die Beerdigung.
Vor über 150 Jahren veränderte sich langsam diese Tradition. Der Beruf der Bestatter entstand, und die bisher von verschiedenen Menschen wahrgenommen Aufgaben wurden zu einem Beruf gebündelt. Auf diese Weise fand einerseits Entlastung statt, anderseits wurden den Angehörigen immer mehr Aufgaben und Möglichkeiten des aktiven Abschiednehmens aus der Hand genommen. Nach der Tragödie des Zweiten Weltkrieges »wollte die Nachkriegsbevölkerung nicht mehr zurückschauen«, schreibt die Journalistin und Buchautorin Sabine Bode. »Aufräumen und aufbauen hieß die Devise im geteilten Land auf beiden Seiten. Trauer, Reflexion, Bilanz ziehen, die Auseinandersetzung mit persönlicher Schuld wurden sorgfältig gemieden. So kam es zu den großen Veränderungen: zum einsamen Sterben in Krankenhäusern, zur kühlen Verabschiedung von den Toten und zur verborgenen Trauer. Dieser unsichtbar gemachte Tod ist womöglich die einschneidendste kulturelle Veränderung der Neuzeit.«[5]
In den letzten dreißig Jahren hat sich die Bestattungskultur erkennbar verändert. Bis zu diesem Zeitpunkt war eine Erdbestattung selbstverständlich, und es gab eine große Akzeptanz der christlichen Abschiedsrituale. Die Gründe für den Wandel der Bestattungskultur liegen in der Liberalisierung der Bestattungsgesetze, in der Abwendung von der christlichen Bestattungskultur und der daraus entstehenden immer individueller werdenden Bestattungs- und Erinnerungskultur. Ganz konkret: Das Sterbegeld und die Sargpflicht wurden abgeschafft, und die Verbrennung des Leichnams im Krematorium ermöglichte alternative Bestattungsformen. Es gibt heute neben der Erdbestattung auch Baum- und Seebestattungen, die nachhaltige Bestattungsmethode »Reerdigung«[6] sowie die Möglichkeit, sich einen Erinnerungsdiamanten anfertigen zu lassen.
Fakten zur Bestattung[7]
Sterbefälle in Deutschland pro Jahr: rund 930 000
Feuerbestattungen: 68 Prozent
Erdbestattungen: 32 Prozent
Zahl der Bestattungsunternehmen: 4300
Zahl der Beschäftigten insgesamt: 27 000
Und auch unter den Bestatter:innen ist einiges in Bewegung geraten: Während sich viele Familienunternehmen mit den Veränderungen immer noch schwertun, gibt es eine wachsende Zahl von Quereinsteigern[8], die mit viel Lebenserfahrung und ohne den Ballast einer Familientradition unkonventionelle Wege gehen. Der Bestatter, Trauerbegleiter und Autor Fritz Roth (1949–2012) ist der bedeutendste Pionier in Deutschland für einen lebendigen Umgang mit dem Sterben und dem Tod, und seine innovative Arbeit wird jetzt von seinen beiden Kindern David und Hannah Roth fortgeführt. Sein »Haus der menschlichen Begleitung«[9], auch »Landhotel der Seele«[10] genannt, sowie sein erster privater Friedhof in Bergisch Gladbach bei Köln lassen spürbar werden, wie ein natürlicher, entspannter und wertschätzender Umgang mit Tod und Trauer heute aussehen kann. An diesem Ort werden nicht nur die normalen Bestattungsaufgaben wahrgenommen, sondern es gibt auch Bildungsveranstaltungen, Gesprächsgruppen für trauernde Menschen sowie kulturelle Veranstaltungen und Projekte wie »Im letzten Hemd« oder »Ein Koffer für die letzte Reise«.
Weiterbildungsmöglichkeiten
Während das Thema »Sterben, Tod und Trauer« noch vor einigen Jahren stark tabuisiert war, hat sich in den letzten Jahren einiges verändert, und immer mehr Menschen werden neugierig und sind bereit, sich auf dieses spannende Themenfeld tiefer einzulassen. Nachfolgend ein paar Ideen, wie der eigene Horizont erweitert werden kann. Eine gute Möglichkeit, das kleine Einmaleins der Sterbebegleitung zu erfahren, sind Letzte-Hilfe-Kurse[11]. Die Teilnehmer:innen lernen an einem Nachmittag oder Abend, was es für eine Begleitung Schwerkranker und Sterbender am Lebensende braucht. Die Themen der vier Module lauten: Sterben ist ein Teil des Lebens, Vorsorgen und Entscheiden, Leiden lindern und Abschied nehmen.
Stephanie Gotthardt bietet zusammen mit David Roth eine dreitägige Weiterbildung zum/zur Ersthelfer/in in menschlicher Trauerbegleitung[12] an. Genau wie bei körperlichen Notfällen kann auch Trauer eine »Notsituation« sein, die sich wie eine »offene Wunde« anfühlt und eine gezielte Ersthilfe braucht. In diesem Seminar werden Basiswissen, innere Haltungen und Methoden vermittelt, die in einer Trauersituation zeitnah anwendbar sind und nachhaltig helfen. Wer eine tiefere Auseinandersetzung mit Leben, Sterben und Tod wünscht, dem empfehle ich eine Weiterbildung zur ehrenamtlichen Hospizbegleitung zu absolvieren. Ehrenamtliche Hospizhelfer:innen begleiten Schwerstkranke, Sterbende und deren Angehörige. Sie hören zu, führen Gespräche, nehmen am Leben der Betroffenen teil und unterstützen sie auch bei praktischen Tätigkeiten. Die Weiterbildungen umfassen in der Regel verschiedene Wochenenden und Abendveranstaltungen und bei einigen Anbietern zusätzlich auch noch ein Praktikum.
Das Bohana-Netzwerk[13] ist ein Online-Portal, das über selbstbestimmte Trauer, alternative Bestattungen und individuelle Vorsorgemöglichkeiten informiert. Das Netzwerk engagiert sich für eine lebendige Abschiedskultur und besteht aus innovativen Bestatter:innen, Trauerbegleiter:innen und Menschen, die dazu beitragen, den Umgang mit dem tabuisierten Thema Tod leichter zu machen. Auch Vereine, Verbände und Bildungsinstitute mit ihren Unterstützungsangeboten werden im Bohana-Netzwerk sichtbar gemacht. Die Gründerin Anne Kriesel hat einen Online-Kurs[14] zum Thema Vorbereitet sein – was soll bleiben, wenn du gehst konzipiert. Der Kurs umfasst drei Module (Papierkram ordnen, Bestattung und Abschied gestalten, Erinnerungen schaffen) und folgt dem Leitsatz »einfachmachen«.
Die Messe Leben und Tod[15] findet in Bremen statt und steht für Themen aus den Bereichen Hospiz, Palliative Care, Trauer und Trauerbegleitung, Seelsorge sowie Bestattungskultur. Diese Messe findet seit 2010 jährlich statt und ist eine Mischung aus Fachkongress, offenen Vorträgen und Ausstellung rund um die Themen Sterben, Tod und Trauer. Das Angebot richtet sich an Betroffene, Angehörige und interessierte Bürger:innen ebenso wie an haupt- und ehrenamtlich tätige Menschen.
Das Museum für Sepulkralkultur[16] in Kassel widmet sich den Themen Sterben, Tod und Gedenken. Ziel des Museums ist es, Kontinuität und Wandel im Umgang mit den letzten Dingen zu veranschaulichen. Das Museum unterhält eine Dauerausstellung sowie wechselnde Ausstellungen zu ausgewählten Themen der Sepulkralkultur.
Tage der offenen Tür bieten mittlerweile viele Krematorien an, und auch die Teilnahme an Führungen über einen Friedhof oder in einem Bestattungswald sind eine gute Gelegenheit genauer herauszufinden, was am Ende gewünscht wird. Und zuletzt gibt es mittlerweile eine Vielzahl von informativen Büchern und Filmen über das Leben, das Sterben, den Tod und die Trauer, die für das eigene Nachdenken wichtige Impulse geben können.[17]
Vielmehr sollten wir das, was uns im Zusammenhang mit Sterben und Trauer beunruhigen könnte, endlich einmal zu Ende denken. Es ist hilfreich, sich auch emotional mit dem Tod vertraut zu machen, und zwar rechtzeitig, bevor der Ernstfall eintritt – ein Ernstfall, von dem wir mit absoluter Sicherheit wissen, dass er eines Tages eintreten wird. Eine solche innere Vorbereitung ist Fürsorge und Vorsorge im besten Sinne. Sie sagt uns, mit welchen Entscheidungen uns der Ernstfall konfrontieren wird. Eine Vorbereitung nimmt nicht schon vorweg, wie wir uns entscheiden werden, aber sie verhindert kopfloses Zustimmen und erlaubt stattdessen ein Innehalten.
Fritz Roth
Ein umfassender Ansatz
In dem vorliegenden Buch beschäftigen wir uns mit sechs grundlegenden Themen. Wir beginnen mit der Stille. Bevor wir uns mit dem Sterben, dem Tod und der Trauer beschäftigen, geht es um das Leben, um das, was wirklich wesentlich im Leben ist. Und am Ende des Buches geht es um die Transzendenz, um das, was für viele Menschen wahrnehmbar und doch so schwer mit Worten auszudrücken ist. Das nachfolgende Schaubild macht die sechs Themen sichtbar – der äußere Kreis ist bewusst nicht »benannt«, denn er steht für die Transzendenz, die unsichtbare, alles umfassende Dimension unseres menschlichen Daseins.
Stille
Man muss aus der Stille kommen, um etwas Gedeihliches zu schaffen. Nur in der Stille wächst dergleichen, sagte schon vor über hundert Jahren der Schriftsteller Kurt Tucholsky. Das Bedürfnis nach Stille ist heute größer denn je, denn der alltägliche Geräuschpegel, die permanente Reizüberflutung, die vielfältigen Ablenkungen sowie die ständige Erreichbarkeit durch unsere modernen Medien bewirken eine innere Alarmbereitschaft und Stress. Es braucht einen Gegenpol zum unbewussten Machen und Tun, und das sind Stille und Schweigen, damit uns das Wesentliche des Lebens nicht zwischen den Fingern zerrinnt. Und so ist Stille der neue Luxus! Während viele die Stille nicht ertragen, spüren immer mehr Menschen eine tiefe Sehnsucht nach Stille, und so boomen Achtsamkeitskurse und Schweige-Retreats in Klöstern und Meditationszentren.
Tagebuch der Selbsterforschung
Wann hast Du das letzte Mal einige Stunden in vollkommener Stille verbracht?
Was brauchst Du, um zur Ruhe und zur Besinnung zu kommen?
Welche Erfahrungen hast Du mit der Stille und dem Schweigen gemacht?
Was sind die Ursachen, warum die Stille so gerne vermieden wird? Die Stille ist gefährlich, weil wir zur Besinnung kommen und wahrscheinlich feststellen, dass die Probleme unseres Lebens nicht im Außen liegen, sondern in uns selbst. Ich habe über viele Jahre immer wieder Menschen erlebt, die zu Beginn eines Schweigekurses ihre Freude über diese besondere Auszeit zum Ausdruck brachten und mir bereits nach zwei Tagen mitteilten, dass die Stille sie »fertig macht« und sie am liebsten abreisen würden. Sie spürten ihre innere Unruhe und all das Ungeklärte in ihrem Herzen und wollten fliehen. Doch dieser Moment des Unwohlseins ist ein magischer Moment. Wir können flüchten oder standhalten, und daher braucht es in diesen Momenten eine Ermutigung, um im inneren Feuer zu verweilen. Und nicht selten sagten die gleichen Menschen am Ende der Schweigezeit, dass sie sich so gut erholt fühlten wie zuletzt nach einem dreiwöchigen Urlaub. Andere Teilnehmende bemerkten in der Zeit des Schweigens, dass ihr Leben doch nicht so glücklich ist, wie sie immer dachten, und dass ihre Wünsche und Träume schon seit längerer Zeit auf der Strecke geblieben waren. Und wir alle, die wir uns auf die Stille einlassen, erleben immer wieder auch unangenehme Emotionen, beispielsweise Schmerz, Wut und Trauer. In der Stille sind wir eingeladen, unser ganzes Leben willkommen zu heißen und offen zu sein für das, was sich aus dem Nicht-Tun heraus entwickelt.
Die Wirkungen von Stille, Schweigen, Meditation und Achtsamkeit sind vielfach beschrieben.[18] Stille reduziert die Stresshormone, fördert die Selbstreflexion, Auffassungsgabe und Konzentration und macht ruhiger und kreativer. Und die Stille führt uns in eine tiefe Selbsterkenntnis, lässt uns verstehen, was Absichtslosigkeit und Nicht-Wissen für unser Leben bedeuten, warum Selbstliebe, Mitgefühl, Humor und Ungehorsam so wichtig sind und dass die wirklich wesentlichen Dinge des Lebens nicht »erarbeitet«, sondern uns geschenkt werden. Auf dem Weg, die Stille zu einem festen Bestandteil des Lebens werden zu lassen, ist für viele Menschen der Besuch eines Achtsamkeitstrainings (z. B. eines achtwöchigen MBSR-Kurses) eine gute Unterstützung, denn Voraussetzung für ein solches Training ist die Bereitschaft, sich einmal am Tag Zeit für die Stille zu nehmen.
Bewährte Achtsamkeitsübungen
Die Stille kultivieren
Gehe regelmäßig in die Stille, mindestens einmal am Tag. Beginne mit 15 Minuten. Für viele Menschen ist zu Anfang eine geführte Meditation als mp3-Audiodatei oder CD[19] eine gute Unterstützung.
Unterbreche Deine Routine durch achtsames Innehalten
Gewöhne Dir an, mitten im geschäftigen Alltag immer wieder einmal bewusst innezuhalten und Deinen Atem zu spüren.
Bringe Präsenz in Dein Tun
Schenke allem, was Du tust, Deine Aufmerksamkeit. Wenn Du telefonierst, dann telefoniere und schaue nicht gleichzeitig Deine E-Mails durch. Wenn Du isst, dann esse und vermeide den Blick in die Zeitung oder auf das Smartphone. Lebe jeden Augenblick Deines Lebens so bewusst wie möglich.
Gönne Dir regelmäßig Auszeiten
Reserviere Dir regelmäßig medienfreie Zeit im Jahr, in der Du ein paar Tage bewusst aus Deinem Alltag aussteigst und auf Smartphone, Laptop, Internet und Musikhören verzichtest. Am einfachsten gelingt dies unter Gleichgesinnten in einem Schweigeseminar.
Wer sich ein glückliches und erfülltes Leben wünscht, der wählt nicht den Weg der Verdrängung, Vermeidung und Arbeitssucht, sondern der kultiviert Stille und Achtsamkeit. Aus diesem Grunde erfahren alle Menschen, die an meinem Online-Achtsamkeitstraining Den Tod ins Leben einladen, um wirklich zu leben teilnehmen, eine erste Einführung in die Stille und Praxis der Achtsamkeit. In dem vorliegenden Buch empfehle ich, nach jedem Kapitel das Buch zur Seite zu legen und sich Zeit zu nehmen für eine Achtsamkeitsübung.
Zum Abschluss die Worte des Journalisten Tiziano Terzani über die Stille:
»Wundervoll diese Stille! Und doch versuchen wir modernen Menschen sie, wo es geht, zu vermeiden, haben fast Angst vor ihr, vielleicht weil wir sie mit dem Tod gleichsetzen. Wir haben es uns abgewöhnt, still, allein zu sein. Drückt uns ein Problem oder spüren wir, dass uns Verzweiflung überkommt, betäuben wir uns lieber rasch mit irgendeinem Lärm oder mischen uns unter Leute, anstatt uns einen stillen, abgeschiedenen Ort zu suchen, innezuhalten und über die Sache nachzudenken. Ein Fehler, denn die Stille ist eine Urerfahrung des Menschen. Nur in der Stille ist es möglich, wieder in Einklang zu kommen mit sich selbst.«[20]
Leben
Als ich im Sommer 2021 einige Tage in dem schon erwähnten »Haus der menschlichen Begegnung« war, las ich in einer Dauerausstellung die Worte von Nelly Sachs: Alles beginnt mit der Sehnsucht. Wir Menschen sehnen uns nach Liebe und Lebendigkeit. Wir wünschen uns menschliche Begegnungen, die uns nahe gehen. Wir suchen eine Arbeit, die wir lieben, wollen vielleicht einen Neuanfang wagen sowie Zeiten der Ruhe und Stille erleben. Kurz und gut: Es geht uns um ein erfülltes, glückliches Leben. Wir leben in einem der reichsten Länder dieser Erde, und eigentlich müssten die Menschen im deutschsprachigen Raum mit einem Lächeln auf ihrem Gesicht unterwegs sein. Doch leider ist das nicht so. Viele Menschen jammern und klagen, sind chronisch unzufrieden und erkennen die sie umgebende Fülle nicht. Der Wohlstand hat uns eine äußerliche Fülle geschenkt, doch letztlich geht es im Leben um viel mehr. Aber nicht um mehr Konsum, sondern um die Entdeckung und Pflege der nicht-materiellen Fülle – oder anders ausgedrückt: weniger um das Haben, sondern mehr um das Sein[21]. Und wenn wir in eine tiefe Verbindung mit uns gekommen sind und zugleich auch mehr die Verbundenheit mit allen und allem erleben, dann wird uns unser Wohlstand immer fragwürdiger, und wir erkennen den unverhältnismäßig hohen Preis für unsere Lebensweise. Der blaue Planet wird von uns Menschen hemmungslos zerstört, so dass unsere Kinder und Enkel keine Zukunftsperspektive haben, und die sogenannten Entwicklungsländer leiden schon heute massiv unter unserer ungesunden Lebensweise.
Tagebuch der Selbsterforschung
Wonach sehnt sich Dein Herz wirklich?
Was sind die Ursachen Deiner Zufriedenheit oder Unzufriedenheit?
Was ist für Dich echter Wohlstand?
In dem ersten Kapitel Leben gehen wir den verschiedenen Dimensionen von echtem Wohlstand nach und beleuchten weitere Aspekte, die für ein erfülltes Leben wesentlich sind. Sie bekommen fünf Denkanstöße sowie einen Beitrag von mir mit dem Titel Glücklichsein im Leben. Geheimnisse, die unser Leben grundlegend verändern können.
Sterben
Über 80 Prozent der Menschen wollen zu Hause sterben, doch nur 20 bis 25 Prozent tun es auch. Die große Diskrepanz zwischen Wunsch und Wirklichkeit liegt zum großen Teil daran, dass sich die meisten Menschen keine Gedanken machen, wie sie nicht sterben wollen. Während ich mich länger mit der Frage beschäftigte, wie ich sterben will, machte mich Sabine Mehne in einem Gespräch darauf aufmerksam, dass es viel wichtiger ist, mir darüber klar zu werden, was ich nicht