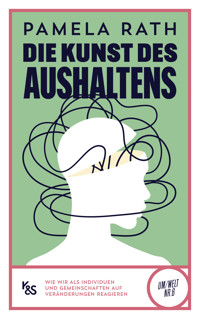
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Kremayr & Scheriau
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
War das nicht immer schon so? Haben Krisen und Herausforderungen nicht immer schon unser Leben bestimmt? Oder wird von uns ständig mehr Toleranz und Resilienz gefordert? Kriege, Klimakatastrophe, Pandemie oder KI – wohin man sich wendet, steht man Endzeitstimmung gegenüber. Doch aufgeben war noch nie eine Option. In einer Welt voller Unsicherheit und offener Fragen ist nicht unbedingt Entschiedenheit die Schlüsselkompetenz: Pamela Rath argumentiert für das Aushalten als wertvolles Vermögen unserer Zeit – die Fähigkeit, Unruhe, Veränderung und Komplexität auszuhalten. Wie können wir als Individuen und Gemeinschaften lernen, mit den Widrigkeiten umzugehen? Statt Antworten zählt die Einladung zum Dialog. Die Autorin verbindet persönliche Erfahrungen mehrerer Interviewpartner:innen mit theoretischen Ansätzen und zeigt Wege auf, wie das Aushalten produktive Kraft statt Ertragen von Belastung wird. Die Zukunft wird immer neu und unvorhersehbar sein, begegnen wir ihr mit mehr Hingabe als Widerstand.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 189
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
PAMELA RATH
DIE KUNST DESAUSHALTENS
WIE WIR ALS INDIVIDUEN UND GEMEINSCHAFTEN AUF VERÄNDERUNGEN REAGIEREN
INHALT
VORWORT VON REZA RAZAVI
1. DIE KOMPETENZ DES AUSHALTENS WÜRDIGEN
ANPASSUNG ALS LERNLEISTUNG
DIALOG STATT SPALTUNG
HILFREICHE VORSTELLUNGSKRAFT
2. WARUM JETZT?
LEBEN IN DER VUCA-WELT
DIE DEMOKRATIE AUF DER KIPPE
GLOBALE KRISEN ALS DAMOKLESSCHWERT
UND DU?
3. WARUM ICH?
ICH BIN EINE SUCHENDE
AMBIGUITÄT ZULASSEN
SCHMERZ TRANSFORMIEREN
PATRIARCHAT AUSHALTEN
ARBEITSWELT, NEW WORK UND DIVERSITÄT
4. VERÄNDERUNGEN ALS TEIL UNSERES LEBENS (UND WIE WIR DAMIT UMGEHEN)
HISTORY DOESN’T REPEAT ITSELF, BUT IT RHYMES
WANDEL UND TRANSFORMATION
OPTIMISMUS UND SELBSTWIRKSAMKEIT
5. VON ANDEREN LERNEN
KULTURELLE UNTERSCHIEDE
17 PERSPEKTIVEN
GESPRÄCH MIT REZA RAZAVI
SCHLUSSBEMERKUNG
KURZBIOGRAFIEN DER INTERVIEWPARTNER:INNEN
EPILOG
DANKSAGUNG
LITERATUR UND LINKS
Für meine Söhne
VORWORTVON REZA RAZAVI
Der Mensch strebt danach, glücklich zu sein. Wir halten das Leben vor allem dann für lebenswert, wenn wir gesund sind, Dinge tun, die uns Freude machen, finanziell abgesichert sind und eine liebevolle Partnerschaft und verständnisvolle Freund:innen haben. Viele Bücher über die Kunst, ein glückliches Leben zu führen, werden zu Bestsellern. Dieses Streben nach Glück wird in der Regel durch die Anhäufung positiver Gefühle definiert. Je häufiger unser Körper positive Botenstoffe – wie Dopamin, Oxytocin, Serotonin – freisetzt und damit unser Wohlbefinden steigert, desto glücklicher fühlen wir uns. Nicht selten entsteht der Wunsch, uns in diese positive Gefühlswelt zu betten und das kuschelige Nest möglichst gar nicht mehr zu verlassen. Noch mehr Reichtum, Besitz, Anerkennung, Spaß, Erfolg und letztlich auch ein noch längeres und gesünderes Leben stehen auf unserer persönlichen Lebensagenda. Nur: So funktioniert das Leben nicht. Wo Licht ist, ist auch Schatten, ohne Krankheit wüssten wir nicht, was Gesundheit ist, wo Glück ist, ist auch Leid. Was wir gewöhnlich Glück nennen, hängt an der richtigen Proportion und daran, wie wir mit den Polaritäten des Lebens umzugehen verstehen.
In der Erkenntnis, dass ein glückliches Leben ohne Leid kaum möglich ist, sollten wir lernen zu akzeptieren, dass sich uns immer wieder Herausforderungen in den Weg stellen, mit denen wir klarkommen müssen. Ohne diese Impulse, denen auch immer eine mobilisierende Kraft innewohnt, gäbe es keine Weiterentwicklung – weder im Großen noch im Kleinen. Weder hätte die Menschheit sich über die Jahrtausende entwickelt, noch würden wir uns als Individuen entfalten können, wenn wir das, was sich uns in unserem Streben nach Glück entgegenstellt, nicht aushalten und überwinden könnten. Deshalb ist es wichtig zu lernen, mit Ängsten, Widerständen und Krisen umzugehen. Toleranz zu entwickeln und unangenehme Gefühle wie Schmerz und Ohnmacht auszuhalten, gehört zur Kunst des Lebens dazu.
Unsere Zeit ist geprägt von vielen Krisen und Herausforderungen, die uns früher eher nacheinander begegnet sind, aktuell jedoch gleichzeitig und in immer kürzeren Abständen auftreten. Was heute funktioniert, kann morgen schon ins Wanken geraten. Die globalisierte, zunehmend digitale Welt wird immer dynamischer und unberechenbarer, die Intervalle zwischen dem Alten und dem Neuen werden immer kürzer. In diesen Übergangsphasen entsteht Neues nicht auf Knopfdruck und Altes löst sich nicht sofort auf. Statt eines linearen Fortschritts erleben wir wie bei der Entstehung eines Schmetterlings eine Art „Puppenstadium“, in dem sich alte Strukturen allmählich auflösen, während sich etwas Neues entwickelt. Diese Zeiten des Übergangs sind oft von Verwirrung, Überforderung und einem Verlust von Verlässlichkeit geprägt – aber sie bergen auch ungeahnte Kräfte und Potenziale für die Zukunft.
Die Philosophin Natalie Knapp beschreibt solche Übergänge als „poetische Zonen des Lebens“1 – kreative Freiräume, in denen das Leben besondere Kraft entfaltet und Chancen zur Weiterentwicklung bietet. Wenn wir lernen wollen, positiv mit einer Übergangsphase umzugehen, brauchen wir vor allem die Bereitschaft, Spannungen zu ertragen und uns vor übereilten Reaktionen zu hüten. Krisen erfordern Geduld und ein Aushalten von Ungewissheiten – keine Kurzschlusshandlungen und keine vorzeitigen Entscheidungen, die wir später bereuen könnten. Wahre Stärke zeigt sich darin, sich den Herausforderungen zu stellen und das Übel, das sich darin verbirgt, in den Blick zu nehmen, statt die Augen zu verschließen, beruhigende Worte zu finden und die tatsächliche Herausforderung zu vernebeln.
Gerade in Zeiten der Transformation ist Klarsicht gefordert. Wir müssen uns von der Idee lösen, dass ein reibungsloses Funktionieren oder immerwährendes Glück der Zweck und das Ziel unseres Lebens ist. Pamela Rath beleuchtet in diesem Buch vielstimmig, dass die Fähigkeit, Unsicherheiten und Zweifel auszuhalten, zur wichtigen Schlüsselkompetenz unserer Zeit wird – auch wenn wir nicht wissen, welche Rolle wir Menschen dabei spielen werden oder welches Ergebnis uns am Ende erwartet. Und diese zentrale Kompetenz, die gerade für die jüngeren Generationen angesichts von Kriegen und Klimakrisen hilfreich erscheint, erfordert eine Balance in allen vier Dimensionen des Seins:
Mental: Fokus und Konzentration bewahren
Emotional: innere Balance finden und halten
Physisch: körperlich stabil bleiben, selbst in stressigen Zeiten
Spirituell: das große Ganze im Blick behalten und an die übergeordneten Werte und Ziele glauben
Wenn wir in allen vier Dimensionen in unserer Kraft sind, schaffen wir es, mit den derzeitigen und noch bevorstehenden Dynamiken bestmöglich umzugehen. Dann sind wir stabil genug, um die guten alten Zeiten loslassen und die bevorstehende Zeit trotz teilweise düsterer Aussichten positiv gestalten zu können.
Ich freue mich darauf, gemeinsam mit vielen Leserinnen und Lesern in das spannende Thema des Aushaltens einzutauchen, und glaube, dass dieses Buch mit seinen Impulsen und Fragen zu einem guten Zeitpunkt auf die Bühne von Gesellschaft und Organisationen kommt. Die Kunst des Aushaltens ist eine Fähigkeit, die zu lange vernachlässigt wurde. Lassen Sie uns dies ändern.
1.DIE KOMPETENZ DES AUSHALTENS WÜRDIGEN
Im November 2021 sprang ich spontan ein, um die Eröffnungs-Keynote am Divörsity-Kongress2 zu halten. „Es ist nicht die stärkste Spezies, die überlebt, auch nicht die intelligenteste, sondern diejenige, die am besten auf Veränderungen reagiert“3, mit diesem Zitat begann ich meine Rede. Während ich im Vorfeld über meinen Notizen dafür saß, kam mir mit großer Dringlichkeit in den Sinn, dass das Tolerieren von Unterschieden, das Aushalten von Vielfalt und Veränderungen eine Kompetenz ist, die wir nicht genug kultivieren.
Ja, eine Vielfalt an Zuständen! Inmitten der Krisen und Katastrophen, die es in einer Gleichzeitigkeit zu behandeln gilt, sind wir konfrontiert mit Fragen, wenn nicht sogar einer Sehnsucht nach Handlungsanleitung, Verantwortung, Beurteilung, Kapitulation, Erfolg. Nur, wohin führen uns diese Ansprüche?
„Ich halte das alles nicht mehr aus! Ich sag dir eines, die Welt steht nimmer lang!“ Wie oft hören wir in letzter Zeit diese Sätze oder lesen sie auf Social Media? Sie sind schnell dahingesagt und klingen in meinen Ohren auch eher harmlos, weil ich sie schon als Kind von meiner Großmutter oft zu hören bekam. Aber gerade weil ich mit der Aussage nicht erst kürzlich konfrontiert wurde, hat sie für mich den Anschein, alt zu sein, vielleicht sogar so alt wie das zivilisierte Zusammenleben der Menschen selbst.
Wann benutzen wir diese Sätze? Dann, wenn wir uns ohnmächtig fühlen, den Umständen gegenüber, der Veränderung. Wenn die Welt, wie wir sie kennen, sich in einer enormen Geschwindigkeit in eine neue Richtung dreht und wir nicht mehr hinterherkommen. Wenn wir mit Dingen konfrontiert sind, die uns das Leben schwermachen, die uns stören und belasten. Die Erde dreht sich weiter, die Welt verändert sich, ob wir wollen oder nicht. Jetzt geht es um Anpassung, an neue klimatische, wirtschaftliche und soziale Verhältnisse. Und diese werden sich nicht zwingend zum Besseren wenden.
Können wir uns auf diese Schwierigkeiten besser vorbereiten? Ich versuche mit diesem Buch die These: ja, durch Aushalten. Können wir das Aushalten als Kompetenz trainieren oder kultivieren? Davon bin ich prinzipiell überzeugt. Die Frage, ob das schon in der Kindheit passieren muss oder ob diese Kompetenz zu jedem Lebenszeitpunkt erlernbar ist, macht mich neugierig.
Ich halte mich für einen grundsätzlich offenen Menschen, was bedeutet, dass ich vieles toleriere, das anders ist. Ich bin weltoffen und auch ein Stück weit naiv, ich glaube grundsätzlich an das Gute in den Menschen. Für mich ist das Aushalten im Grunde sehr positiv. Der Zustand, den mensch nicht dulden, ertragen oder überwinden kann, wird zwar eher negativ empfunden (weg von), aber das Aushalten stellt sich als Wunsch, als Ziel, als Lösung dar. Nämlich als Wunsch, etwas auszuhalten, bis es sich ins Positive geändert hat. Als Ziel, ebendiese positive Situation zu erreichen. Oder die aktuelle Situation auszuhalten, bis es eine Lösung gibt. Und das ist ein Hin-zu, weil es dem Aushalten auch einen Sinn gibt. So gebrauche ich Aushalten auch persönlich – als Wunsch nach einer Lösungsfindung.
Ich selbst drücke die zuvor genannte Ohnmacht oder Hilflosigkeit eher durch die (meist rhetorische) Frage „Wie soll ich das bitte aushalten?“ aus, wenn ich einen Ausweg brauche. Diese Frage interpretiere ich als Wunsch nach einer Idee, wie ich mit etwas umgehen soll oder kann, also als eine sehr konstruktive und daher positive Haltung. Natürlich muss ich zugeben, dass vor allem im Raum Wien, wo der Grant immer im Subtext steht, sich dieser Wunsch nach Lösungsfindung eher wie ein Vorwurf anhört und daher hier negativ konnotiert ist. Aber die Philologin in mir neigt zur Überzeugung, dass Aushalten beides sein darf, sowohl positiv als auch negativ, und ich entscheide mich immer für die positive Bedeutung.
Ich bin über die sprachwissenschaftliche These gestolpert, dass die Wurzel des Wortes „halten“ mit der von „hüten“ zu tun hat. Vieh halten, Vieh hüten. Behalten, behüten. „Halten“ eröffnet bei genauerer Überlegung mich völlig faszinierende Möglichkeiten, was alles gehalten werden kann, bzw. mit welcher Konnotation. Stehen bleiben, parieren: eine körperliche Entscheidung, sich nicht mehr zu bewegen, zu bremsen, oder aber die Bewegung eines anderen (Objekts) abzubremsen, zum Beispiel den Ball, bevor er ins Tor gelangt. Halten als aufhalten oder tragen, mit den Händen, ist eine aktive Handlung, bei der ich entscheide, etwas physisch anzugreifen. Die Hand von jemandem, eine Taschenlampe oder eine Einkaufstasche halten. Im Vergleich dazu: eine Rede halten – dynamisch meinen Mund und meine Sprache gebrauchen, während eine Tasche halten eine statische Aktivität ist. Ich lege diese unterschiedlichen Dynamiken auf das Aushalten um und verstehe Aushalten sowohl als Prozess als auch als Zustand. Das sind nur meine Assoziationen, aber sie zeigen, was für ein weites Feld das Wort aushalten aufmacht.
Der Duden (Duden.de) bietet 584 Synonyme für das Wort aushalten an. Die beliebtesten sind unter anderem: tragen, abhalten, bewältigen, sich fügen, hinnehmen, übernehmen, ertragen, vertragen, sich ergeben, durchhalten, verkraften, abkönnen, einstecken, stützen, bestehen, überstehen, durchmachen, dulden, ausstehen, standhalten, erleiden, leiden, mitmachen, sich schicken, sich behaupten, durchstehen, verschmerzen, verwinden, verdauen, aufkommen für, auffangen, überleben, erdulden, tapfer bleiben, versorgen, anhalten, fertig werden mit, tolerieren, auf sich nehmen, über sich ergehen lassen, schlucken, nicht nachgeben, nicht aufgeben, schmachten, unterhalten, sponsern, widerstehen, bleiben, ausharren, sich widersetzen.
Dulden klingt nicht nach Erfolgskompetenz. Haltung hingegen schon eher. Aushalten und Haltung haben den gleichen Wortkern, auch in vielen anderen Sprachen als Deutsch. Sie haben etwas mit Stand, Standfestigkeit zu tun, also eine geistige Fähigkeit, die als körperliche Metapher funktioniert. Die Beine stehen fest, durch Muskelkraft – vielleicht sogar durch Wurzeln gefestigt –, und erlangen durch Training, durch mehr Belastung oder Nutzung noch mehr Kraft.
Nach diesem Ausflug in die Semantik halten wir fest: Aushalten ist offenbar ambigue, also zwei- oder mehrdeutig. Besonders spannend ist es in Verbindung mit Aussicht auf Wandel, auf Veränderung – und diesem Spannungsfeld widme ich dieses Buch. Denn ich bin der Meinung, dass wir Menschen uns gerade mitten in einer Zeitenwende befinden, mit noch nicht absehbaren positiven sowie selbstverständlich auch negativen Auswirkungen für uns Menschen. Und wenn ich eines aus der Geschichte der Menschheit und aus meinem eigenen kurzen Leben gelernt habe, dann ist es Selbstverantwortung als höchste Prämisse. Ich möchte mich vorbereiten auf das, was kommt, ich möchte die Gegenwart besser aushalten können, damit ich die Zukunft, sofern sie mir streng entgegenschlägt, noch besser aushalten kann.
Mich beschäftigt das Thema Aushalten daher sehr und ich möchte mit diesem Buch zum Dialog einladen. Denn ich weiß nicht mehr als du, lieber Leser und liebe Leserin. Was ich mir aber wünsche: einen breiten Diskurs über das Aushalten.
Dieses Buch ist also kein Handbuch, auch keine Anleitung. Dieses Buch ist eine Lernreise. Zum gemeinsamen Lernen voneinander. Darüber, was gut funktioniert und nachahmbar ist, und darüber, was keine:r weiß oder kann und wie Expert:innen glauben, uns darauf vorbereiten zu können.
Ich denke grundsätzlich optimistisch und zuversichtlich, während ich am Boden der Realität stehe. Ich weiß, dass viele Menschen (noch) nicht aus diesem Holz geschnitzt sind. Speziell für jene Menschen ist diese Lernreise gedacht, damit wir uns gegenseitig Mut machen und zum Kulturwandel motivieren. Meine Sicht auf das Thema Aushalten fließt in diesem Buch zusammen mit dem Blickwinkel und den Erfahrungen von 17 Personen, die ich interviewt habe. All diese Gedanken sollen Perspektiven anbieten sowie zur Debatte und Diskussion anregen – darüber, wie und was eine Gruppe, eine Organisation, eine Gesellschaft gemeinsam aushalten kann und soll.
Auch will ich dir durch die unterschiedlichen Interpretationen die Basis dafür bieten, dass du dich mit deinen eigenen Mustern des Aushaltens und deinem persönlichen Umgang mit der Gegenwart und der nahen Zukunft auseinandersetzen kannst. Dieses Buch ist somit eine Einladung zum Dialog an dich, liebe:r Leser:in.
ANPASSUNG ALS LERNLEISTUNG
Alle reden vom Wandel, von der Transformation. Die Veränderung ist allgegenwärtig. Ein oft bemühtes Zitat ist: „Die einzige Konstante im Leben ist die Veränderung.“ Es wird entweder Heraklit oder Buddha zugeordnet.
Wenn ich auf das menschliche Leben schaue, auf mein eigenes, auf das meiner Kinder, kann ich das nur bestätigen. Nichts ist heute so, wie es gestern war. Jede Person, die Kinder hat oder kennt, weiß das; bei der Entwicklung von Kindern nehmen wir Veränderung als gegeben wahr und an. Die Kindheit, die Pubertät, das Erwachsenwerden, das Altern wird als Veränderungsprozess wahrgenommen, das können wir bei uns selbst gut beobachten. Tatsächlich ist das biologische Leben der beste Beweis dafür, dass die Veränderung der einzig mögliche Weg ist, sich dem irdischen Leben zu stellen und auf diesem Planeten zu überleben. Aber Veränderung ist immer Arbeit, sie verlangt immer eine Anpassungsleistung. Sie ist anstrengend, teilweise überfordernd, bestimmt auch manchmal lustvoll, aber in jedem Fall meistens eine Herausforderung, wenn nicht sogar eine Überwindung. Sie braucht Mut und Offenheit, Zuversicht und Optimismus. Keine Angst vor dem Neuen.
Konservativismus ist aktuell im Trend, denn wer die Anpassung nicht will (nicht aushalten will?), aus welchen Gründen auch immer, will, dass die Dinge so bleiben wie bisher. Konservative wollen einen Zustand konservieren oder einen alten Zustand wiederherstellen, sie halten die Veränderung zum Neuen nicht aus. Andere, denen Innovation und Fortschritt wichtig sind und die meinen, der einzige Weg ist der nach vorne, die halten Stillstand nicht aus.
Heutzutage, so scheint es, sind beide Lager fast gleich groß. Und obwohl ich der Meinung bin, dass es für humanistisch geprägte, moderne und gebildete Menschen nur eine Tendenz geben sollte – die nach vorne und nicht die rückwärtsgewandte –, musste ich schmerzhaft erlernen, meine Wahrnehmung und Haltung zu verändern, auszuhalten, dass dieses andere Lager existiert und auch eine gewisse Berechtigung hat.
Apropos Lernen. Anpassung ist eine aktive Lernleistung. Sie setzt voraus, dass mensch bereit ist, eine neue Situation zu erfahren. Diese muss noch gar nicht für gut empfunden oder bewertet werden. Es reicht, dem Neuen offen gegenüberzustehen. Und dann erst kommt das Aushalten. Die Wahrnehmung der eigenen Bewertung. Und Lernen setzt die Bereitschaft voraus, dass nach der neuen Erfahrung unter Umständen alte Erfahrungen oder altes Wissen widerlegt werden. Ohne eine konstruktiv kritische Selbstreflexion führt der Umgang mit Neuem ohnehin zu keiner Veränderung. Nur wenn ich der Meinung bin, dass das neu Erfahrene, Gelernte, relevant und sinnvoll ist, entscheide ich, dieses Wissen zu behalten, und strenge gegebenenfalls auch eine daraus resultierende Verhaltensänderung an. Dafür braucht es die Intelligenz, jene Relevanz zu begreifen. Dieser Vorgang ist aber eben auch nur möglich durch die Auseinandersetzung mit dem Neuen. Es ist quasi ein Teufelskreis, dass durch Verschlossenheit kein Lernen stattfinden kann und sich somit – in „Selffulfilling Prophecy“ – die eigene Meinung laufend bestätigt.
Veränderung, vor allem auf individueller Ebene, braucht bestimmte Voraussetzungen, die alle der gleichen Logik folgen:
GAIN größer als PAIN. Ich muss mehr davon haben, als es mich kostet, sonst mache ich es nicht.
PUSH- oder PULL-Faktoren, sprich ein Ziel oder eine Ursache, zu etwas hin oder von etwas weg zu gehen. Die Veränderung erzeugt Lustgewinn oder Frustvermeidung. Entweder es wird etwas verbessert, oder etwas Schlechtes kann reduziert oder verhindert werden.
Ohne eine dieser oder ähnliche Logiken wird Veränderung nicht ausgelöst. Vor allem nicht selbstbestimmt oder freiwillig. In den hier beschriebenen Varianten ist das Aushalten der Veränderung bzw. des Veränderungsprozesses zwar auch nicht zwingend leicht, aber gewiss leichter als fremdbestimmte, erzwungene Veränderung. Diese auszuhalten ist hart.
Das bringt uns zu unserer aktuellen Welt. Hier finden wir zig Faktoren vor, die von außen – von oben, von da drüben oder von denen – Forderungen nach Veränderung mit sich ziehen oder schlicht und einfach unsere Umwelt und unsere Realität verändern. Und zwar auf rasante Weise.
Erinnerst du dich an Teenager-Liebeskummer? Wenn nicht, höre kurz rein in Sarah Connors „Vincent“. Also ich kann mich sehr wohl an solche Gedanken mit 13 oder 14 Jahren erinnern, die diese Stimmung widerspiegeln:
Mama, ich kann nicht mehr denken
Ich glaub’, ich hab’ Fieber
Ich glaube, ich will das nicht
Mama, was soll ich jetzt machen?
Ich glaub’, ich muss sterben
Was, wenn mein Herz zerbricht?
Auch wenn alle Mamas der Welt dich vom Gegenteil überzeugen wollen, glaubst du in dieser Stimmung, dein Ende naht. Und doch, Spoiler-Alert, wirst du es aushalten. Du wirst alles aushalten, solange dein Herz weiter schlägt. Der menschliche Körper ist sehr zäh und widerstandsfähig. Allein deine Nerven informieren dich über Gefahren und Schäden, und deine Hormone verursachen ein Gefühlschaos, das dich so sehr belastet, dass du glaubst, es nicht auszuhalten.
Als Erwachsene wissen wir, dass wir all das überlebt haben, dass der Körper zäher ist als die Psyche, dass uns nicht alle Schicksalsschläge umbringen. Wir werden zwar manchmal verwundet und können die Narben noch lange nach der Verwundung sehen, wir wissen aber auch, dass manche Narben sogar verschwinden. Es ist manchmal nur eine Frage der Zeit, oder des entsprechenden Zellenregenerations-Rhythmus.
So wie der Körper wächst auch die Psyche des jugendlichen Menschen, die Persönlichkeit verändert und entwickelt sich weiter. Martin Seligman behauptete daher: „Wir brauchen eine Psychologie des Mit-der-Situation-Wachsens“5, er benannte sie „Positive Psychologie“ und prägte damit seither das Wissenschaftsverständnis.
DIALOG STATT SPALTUNG
Wie einer meiner Interviewpartner:innen, Ali Mahlodji, im Gespräch mit mir betonte: Es gibt nun mal Dinge, die wir aushalten müssen, eben beispielsweise die Weltlage, Kriege, Hunger in der Welt. Da könnten wir als Einzelpersonen nicht sofort etwas verändern. Das Aushalten ist in diesem Fall sinnvoll, da wir andernfalls unseren eigenen Alltag nicht meistern könnten.
Das Wort Aushalten übt eine gewisse Faszination auf mich aus, denn es gibt so viele unterschiedliche Ansichten und Definitionen dazu. Meist ist Aushalten jedoch negativ konnotiert, nicht nur in der deutschen Sprache, auch in anderen. Wir verbinden Aushalten mit negativen Situationen, in denen wir uns schwertun, etwas auszuhalten, das uns nicht passt. Menschen folgen auch eher dem menschlichen Trieb des Lustgewinns und der Frustvermeidung und entziehen sich unangenehmen Situationen, anstatt sie auszuhalten. Sie sehen häufig weg oder lenken sich ab, wenn sie die Wahl haben. Diese Personen sind somit privilegiert, sich zu entscheiden. Wer keine Wahl hat, ist eher zum Aushalten gezwungen. Ich frage mich jedoch: Wann wählen Menschen freiwillig das Aushalten? Und wofür? Sind diese Menschen eher die Ausnahmen?
Und was wäre die Alternative zum Aushalten? Aus meiner Sicht ist das Gegenteil von Aushalten ein Aufhören oder Ausweichen. Zumindest körperlich. Mental könnte es sein, dass wir in den Widerstand gehen. Wenn ich zum Beispiel an das Aushalten einer Ungerechtigkeit denke, dann wäre das Gegenteil davon die Empörung, bis zur Abwehr, bis zum Kampf.
Wir wollen stattdessen immer verändern, weg vom Negativen und hin zum Positiven, und suchen verbissen nach Lösungen, die uns dorthin bringen. Auch tun wir uns schwer, andere Meinungen auszuhalten, wir wollen stattdessen diskutieren, meistens mit dem Ziel, das Gegenüber von der eigenen Meinung zu überzeugen. Wir wollen uns durchsetzen und gewinnen – und das isoliert. Wenn nur die Überzeugung und das Rechthaben im Fokus stehen und nicht der kleinste gemeinsame Nenner, führt der Meinungsaustausch nicht zu Lösungen, sondern zur Spaltung: die, die recht haben und die Sache richtig verstehen, versus die anderen. Debatten werden eher zu verbalen Ringkämpfen als zur Darlegung von Sichtweisen geführt. An echtem Meinungsaustausch, die eigene Meinung mit einer anderen zu tauschen, ist niemand interessiert. Denn bevor ich lerne, dass das, woran ich fest glaube, falsch ist, lerne ich es lieber nicht. Aushalten bedeutet eben auch, Neues zu lernen und das alte Wissen neu zu reflektieren und anzupassen. Viele Menschen identifizieren sich allerdings mit ihren Meinungen und „verteidigen sich“. Diese bewusst pointierte Kampfrhetorik dient der verbalen Sichtbarkeit dieser „Spaltung“. Gegensetzliche Meinungsinhaber:innen wenden sich voneinander ab und halten sich nur mehr in Kreisen Gleichgesinnter auf.
Da nehme ich mich selbst ebenfalls an der Nase, denn auch ich halte Meinungen, die beispielsweise gegen mein Verständnis von Gleichberechtigung und Toleranz gehen, schwer aus. Auch ich verspüre den Drang, sofort darauf zu reagieren. Und wenn mensch sich die aktuellen Debatten in den sozialen Medien ansieht, bin ich damit nicht allein. Dennoch ist es für mich eine wichtige Kompetenz, den Dialog auszuhalten, das Zuhören zu praktizieren – ohne sofort zu replizieren oder den eigenen Standpunkt ins Zentrum zu stellen –, zu fragen, statt zu antworten. Diese Kompetenz scheint jedoch aufgrund des erhöhten Tempos unseres üblichen Informationsaustausches nicht mehr vorhanden zu sein; vielleicht war sie auch noch nie vorhanden und es fällt mir jetzt mehr auf. Darauf gehe ich näher in Kapitel 2 (Die Demokratie auf der Kippe) ein.
Wenn wir nicht kämpfen, wollen wir zumindest sudern, wie mensch in Wien sagt. Denn: „Das ist ja nicht auszuhalten!“ Was aber, wenn das Aushalten doch eine wichtige Kompetenz ist, die uns am Ende weiterbringt, weil wir so lange ausgehalten haben, bis die positive Veränderung, die Verbesserung eingetreten ist?
HILFREICHE VORSTELLUNGSKRAFT
Über Veränderung freuen können sich die Menschen am besten mit Vorstellungskraft. Oder: Veränderung aushalten lässt sich nur mit Vorstellungskraft. 2025 werde ich 50. Alles, was jetzt noch kommt, ist eine Zugabe. Aber Veränderung wird es dennoch immer wieder bringen. Mit 45 Jahren habe ich mir einen Masterabschluss in meiner berufenen Disziplin, Arbeits-, Organisationspsychologie und HR Management, geschenkt und eine Entscheidung getroffen: nämlich die, dass sich das Leben auch ändern darf. Vielleicht hat mich die Corona-Pandemie – im Wissen, dass wir diese Krise überleben konnten – zu der Idee ermutigt, dass vielleicht auch andere Veränderungen umsetzbar sind. Zu erleben, was alles möglich wird, wenn es sein muss, ließ die Zuversicht wachsen, dass Dinge auch möglich sind, wenn sie sein sollen oder dürfen.
„What if “ ist nicht nur der Titel eines meiner Lieblingslieder von Creed, aus dem Album „Human Clay“, sondern auch der Claim des Ministeriums für Neugier und Zukunftslust6. Diese Non-Profit-Initiative der Pro Active GmbH möchte Neugier als Treiber von Innovation und positive Vorstellungen von der Zukunft fördern. „Was wäre wenn“-Sätze zu formulieren, wurde in meinem Leben nicht goutiert. Solche Fragen wurden als unnötig beurteilt, weil sie Gedankenspiele abseits der Realität befeuern. Ich kann mich noch genau erinnern, als wir in meiner





























