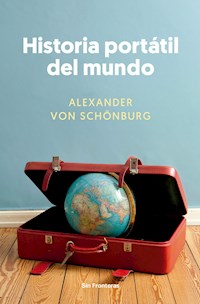11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wir leben in einem Zeitalter der Beliebigkeit und Selbstsucht. Überall gilt »ich zuerst«, alles ist erlaubt, jeder will sich selbst optimieren, so wird übertrumpft, gedrängelt, auf Facebook gepöbelt. Doch auf diese Weise wird unser Zusammenleben höchst unangenehm, und wir steuern geradewegs in den Untergang. Alexander von Schönburg plädiert für mehr Anstand, für Werte und Tugenden, die lange altmodisch erschienen und heute wieder aktuell sind. Dem »anything goes« der hedonistischen Gesellschaft stellt er die neue Ritterlichkeit gegenüber. Denn nobles Verhalten macht das Leben erst schön.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:www.piper.de
ISBN 978-3-492-99217-6© Piper Verlag GmbH, München 2018Covergestaltung: zeromedia.net, MünchenCovermotiv: ohn William Waterhouse/Tristan und Isolde (Ritter);imagenavi/getty images (Rolltreppe);FinePic® (Verlauf)Datenkonvertierung: psb, BerlinSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
INHALT
Worum es geht
Die Tugenden
1
Klugheit
2
Humor
3
Weltoffenheit
4
Bescheidenheit
5
Höflichkeit
6
Demut
7
Treue
8
Keuschheit
9
Mitgefühl
10
Geduld
11
Gerechtigkeit
12
Sportlichkeit
13
Gehorsam
14
Dekorum
15
Freundlichkeit
16
Milde
17
Aufrichtigkeit
18
Großzügigkeit
19
Maß
20
Diskretion
21
Coolness
22
Fleiß
23
Zucht
24
Mut
25
Toleranz
26
Selbstbewusstsein
27
Dankbarkeit
Letzte Fragen
Quellen und Literaturhinweise
La bellezza vincerà.
Florentinische Weisheit
Be kind but be fierce, you are needed now more than ever.
Winston Churchill
Rejuvenecer las ideas marchitas es la tarea des humanista.
Nicolás Gómez Dávila
WORUM ES GEHT
Vor lauter Fortschrittsseligkeit haben wir den Sinn für das Märchenhafte und Geheimnisvolle verloren. Daher möchte ich dieses Buch mit einem Märchen beginnen. Alte Geschichten sind immer gut. In ihnen werden über die Generationen hinweg Wahrheiten weitergegeben, in alten Geschichten hören wir Dinge, die wir im Tiefsten unseres Herzens eigentlich schon längst wissen. Märchen bewegen sich noch dazu in der Welt des Unbewussten. Wenn wir etwas über uns und unsere Sehnsüchte herausfinden wollen, sind sie eine gute Quelle. Dieses hier stammt aus dem Schatz der Geschichten um König Arthus und geht so:
König Arthus ist mit seinen Kameraden auf der Jagd im Inglewood. Plötzlich merkt er, dass er von seinen Jagdkumpanen getrennt worden ist. Der Inglewood, muss man wissen, ist der Wald, in dem die Anderswelt zu Hause ist, der Wohnort verschiedener mystischer Wesen, von denen einem nicht alle wohlgesinnt sind. In diesem Wald trifft Arthus zu seinem Unglück auf einen Typen, der aus einem Film der Coen-Brüder stammen könnte, einen, der das Urböse repräsentiert: den Hexenmeister Sir Gromer. Arthus hat keine Chance gegen Gromer. Seltsamerweise aber – wir befinden uns in einem Märchen – gewährt Gromer seinem Opfer eine Fluchtmöglichkeit. Unter einer Bedingung: Er muss in genau einem Jahr wiederkommen und ihm die Antwort auf eine Frage geben. Kennt er die Antwort, darf er leben, kennt er sie nicht, muss er sterben. König Arthus kehrt bedrückt nach Carlisle Castle zurück, und es dauert nicht lange, bis sein engster Vertrauter, sein Neffe Sir Gawain, wissen will, was los ist. Deprimiert sein war in der Glanzzeit des Rittertums tabu, Melancholie galt als schlechtes Benehmen, das durfte sich nur erlauben, wer unglücklich verliebt war, und das dann auch nur für kurze Zeit. Arthus vertraut sich also seinem Freund an, den vor allem, wie uns alle, interessiert, welche Rätselfrage der böse Sir Gromer gestellt hat. Die Frage ist eine der Urfragen überhaupt und lautete: »Was ist der größte Wunsch einer Frau?« Damit nahm der böse Gromer eine Frage vorweg, die Sigmund Freud ganz ähnlich stellte (»Was will das Weib?«), aber das war etwa anderthalb Jahrtausende später, und Arthus hatte nur ein Jahr Zeit, die richtige Antwort herauszufinden.
Gawains Reaktion? Die einzig richtige: »Lass uns hinausziehen und die Antwort herausfinden!« Was die beiden auf ihrer Erkundungstour erleben, können wir uns ausmalen, sie gehen getrennte Wege und treffen sich, da es noch kein WhatsApp gab, immer wieder, um ihre Erfahrungen zu vergleichen. Keine der gewonnenen Antworten stellt die beiden aber zufrieden. Wie es sich für gute Märchen gehört, bekommt Arthus aber eine kleine Hilfestellung. Bei einem seiner Ausritte gerät er nämlich wieder in den Inglewood, und diesmal begegnet er einer Hexe. Lady Ragnelle. Diese Person wird in sämtlichen Versionen der Geschichte als besonders hässlich beschrieben, damit dem Zuhörer (einst wurden solche Geschichten vorgetragen) übel würde. Ekzeme im Gesicht, faule Zähne, Buckel, eitrige Füße, fettige Haare und so weiter. Die Alte will Arthus die Antwort auf die Frage verraten – aber wiederum nur unter einer Bedingung: Sie will einen der Ritter von Arthus’ Tafelrunde zum Gatten, und zwar Sir Gawain. Der ist damals ein aufstrebender Star am Hof (etwa wie Tom Cruise nach »Top Gun«) und genießt einen gewissen Ruf für »luf talkying« (Süßholzraspeln), wie es in der berühmtesten, auf Mittelenglisch gedichteten und Thomas Malory zugeschriebenen Version des Märchens heißt, er ist also ein bekannter Schwerenöter.
Als Arthus nach Carlisle zurückkommt, erzählt er Gawain natürlich nichts. Arthus wirkt zwar traumatisiert, doch er will seinem Vertrauten ums Verrecken nicht verraten, was im Wald vorgefallen ist. Man muss vielleicht darauf hinweisen, dass sowohl der Hexenmeister als auch die Hexe nicht einfach »das Böse« darstellen in diesem Drama. Figuren im Wald haben in solchen alten Geschichten eine ganz andere Funktion. Sie stehen archetypisch für das Ungezähmte im Menschen, das Wilde, das Natürliche, das absolute Gegenbild zu dem domestizierten Menschen, deren überzüchtetste Version die Menschen am Hofe darstellen. Die Menschen in der Welt des Arthus sind gespreizt, affektkontrolliert, gesittet. Im Wald ist er mit der ungezähmten Welt konfrontiert, die auch in ihm schlummert. Auch deshalb will Arthus mit Gawain nicht über das reden, was im Wald vorgefallen ist. Irgendwann tut er es dann doch, beim Wein, im Suff. Und da Versprechen, die im Suff gegeben werden, nichts gelten, eröffnet Gawain Arthus erst am nächsten Tag, dass es ihm selbstverständlich eine Ehre sein werde, sich zur Rettung seines Lebens zur Verfügung zu stellen und die unansehnliche Alte zu heiraten. »Um euer Leben zu retten, würde ich sogar den Teufel zum Altar führen.«
Gawain lässt sich das nicht ausreden, und so reitet Arthus in den Wald zurück, um dem Weibsstück die erfreuliche Nachricht zu überbringen. Die Hexe kann sich vor Freude darüber, den begehrtesten Junggesellen im Land abzubekommen, kaum einkriegen und verrät Arthus, ohne länger zu zögern, die Antwort auf die große Frage. Interessant ist hier: Sie muss nicht erst den Vollzug der Ehe abwarten, das Wort eines Ritters gilt, das weiß man auch im tiefsten Wald. Sie verrät ihm also umgehend des Rätsels Lösung: »Manche Leute sagen, wir wollen schön sein oder geliebt und geachtet werden, andere sagen, wir wollen reich sein und keine Lasten tragen, aber all das trifft nicht zu«, erklärt ihm die Frau. Aber was ist es nun, was »wemen desyren moste specialle?«, was sie wirklich wollen, wie es in der berühmtesten Fassung der Geschichte im charmanten Mittelenglisch heißt, das im 14. Jahrhundert das noch viel französischer klingende Anglonormannisch als Hof- und Literatursprache abgelöst hatte. »Was wir vor allen Dingen am meisten wünschen, ist … (hier bitte Trommelwirbel hinzudenken) … Eigenständigkeit.« Im Original ist das Wort »sovereynté«. Die Souveränität, das Recht, das Leben selbst zu bestimmen. »Nun gehe hin, Sire, denn nun ist dein Leben gerettet.«
Arthus begibt sich also auf den Weg zu Sir Gromer und kann dem Drecksack die Antwort hinschleudern. Wütend muss Sir Gromer Arthus gehen lassen, auf dem Rückweg holt der die Lady ab und bringt sie an den Hof. Dort herrscht gedämpfter Enthusiasmus, die Vorbereitungen zum Hochzeitsfest laufen schon, dank Klatschmäulern, den Vorläufern von Twitterern und Klatschportalen, sind Details der Verlobung Gawains an die Öffentlichkeit gelangt. Es wird gelästert, nicht zuletzt über das unhöfische Milieu, aus dem die Braut stammt. Als die Hochzeit dann gefeiert wird, geschieht das allerdings in aller gebotenen Festlichkeit, es wird fröhlich, das Volk darf zechen, Feuerspucker und Hofnarren treten auf, der Höhepunkt ist ein großes Hoffest. Interessanterweise schildert das berühmte Gedicht aus dem 15. Jahrhundert mit großer Detailversessenheit, wie übel sich Lady Ragnelle bei den Hochzeitsfeierlichkeiten benommen hat. Angeblich soll sie unmäßig gefressen, gepöbelt und sogar andere Hochzeitsgäste bespuckt haben. Es kann sein, dass der Autor dies aber auch nur eingeflochten hat, um – indirekt – das zum Teil raue Betragen mancher Adeliger seiner Zeit aufs Korn zu nehmen. Vielleicht sollte durch diesen Exkurs aber auch hervorgehoben werden, dass Lady Ragnelle eben nicht aus dem gesellschaftlichen Umfeld des Hofes stammt.
Irgendwann ist unweigerlich der Moment der Hochzeitsnacht gekommen. Die beiden Frischvermählten ziehen sich ins Schlafgemach zurück, das der König ihnen zur Verfügung gestellt hat. Die Diener zünden den Kamin an, tragen Wein auf, etwas Obst und schließen die Türen hinter dem Paar. »Sir Gawain, jetzt, da wir alleine sind«, sagt Lady Ragnelle, »bitte ich höflich um den Hochzeitskuss.« Wir wissen alle, was mit »Kuss« gemeint ist. Sir Gawain zögert nicht. Das Wort eines Ritters! Kaum steigt er zu ihr ins Bett und küsst sie, Sie haben es sicher schon geahnt, verwandelt sich seine abstoßende Braut in das schönste Geschöpf, das er je zu Gesicht bekommen hat. Gawain stürzt sich in ihre Arme und »gab ihr viele Küsse«, was eine wirklich elegante Umschreibung dessen ist, was damals in der Honeymoon-Suite von Carlisle Castle vonstattengegangen sein muss.
Hier kommt noch nicht der Abspann. Das ist noch nicht das Happy End. Die Geschichte hat noch einen Haken. Lady Ragnelle erzählt Gawain, dass ein Teil des Bannes immer noch auf ihr laste. Durch seine Liebe habe Gawain sie zwar befreit – nur eben leider nicht ganz. »Meine Schönheit, wie du sie jetzt siehst, ist nicht von Dauer. Du musst dich entscheiden, ob ich am Tag oder in der Nacht schön bin. Der Bann erlaubt nicht beides.« Gawain: »Dann sollst du in der Nacht für mich schön sein.« Sie: »Dann aber werden sich die Leute am Tage das Maul über mich zerreißen.« Er: »Nein! Das soll nicht sein! Dann sollst du nur am Tag schön sein!« Sie: »Aber mein Liebster, das würde mir das Herz brechen, dass in der Zeit, in der wir einander haben und allein sind, ich mich nicht in meiner wahren Erscheinung zeigen kann.«
»Ich kann und will es nicht entscheiden«, sagt schließlich Gawain, »ich muss die Entscheidung, ob du am Tag oder in der Nacht schön sein willst, in deine Hände geben. Wie du dich auch immer entscheidest, mir soll es gefallen.« – »Danke, edelster Ritter«, jubelt Lady Ragnelle, ich vereinfache hier das Mittelenglische, »gesegnet bist du, denn nun bin ich endgültig von dem Bann befreit und vollständig von dem bösen Zauber erlöst. Nun wird meine Schönheit bei Tag und bei Nacht sichtbar sein. Nur diese Antwort konnte mich ganz vom Bann erlösen.« In der frühesten bekannten irischen Fassung der Geschichte gewinnt Gawain durch sein Opfer nicht nur die schönste Frau weit und breit, sondern auch Land, Reichtum und Macht, in der berühmtesten, Sir Thomas Malory zugeschriebenen Version, bringt Lady Ragnelle den ersehnten Sohn, Gingalain, zur Welt, und sie und Gawain führen so etwas wie eine Musterehe, denn er hat das mit der Souveränität seiner Frau anscheinend auch im täglichen Leben durchgezogen (»Gawen gave her the sovereynté every delle«). Eine moderne Ehe.
Was lernen wir nun daraus?
Zunächst einmal, dass es im Mittelalter auch schon Mädchen wie Meghan Markle gab, die ein paar Klassenschranken übersprungen haben, und dass sich darüber schon damals das Maul zerrissen wurde. Wir lernen auch viel über Treue und darüber, dass ein gegebenes Wort Vertragskraft hat. Wir lernen, dass Zivilisation immer dann einen Sprung nach vorne macht, wenn Frauen als vollwertige Gegenüber und Handelnde auftreten. In der märchenhaften Erzählung bringt Lady Ragnelle den ersehnten Erben zur Welt, zieht ihn groß und ist die bestimmende Figur bei Hofe, im realen Mittelalter tauchen Figuren wie Eleonore von Aquitanien auf, die halb Europa beherrschen. Die ältesten Rittergeschichten, wie das Rolandslied, spielen an der Front, in der höfischen Dichtung des Hochmittelalters stehen plötzlich die Frauen im Mittelpunkt, ihre Überhöhung zum reineren und vollkommeneren Geschöpf in der höfischen Minnedichtung ist ein erstes Aufblitzen der Moderne.
Was uns alle mittelalterlichen Rittergeschichten aber vermitteln, ist vor allem die Botschaft: Es gibt Wege, der niederen und kleinherzigen und rohen Instinkte in uns Herr zu werden. Durch Zivilisation. Durch Ritterlichkeit.
Dieses Buch geht der Frage auf den Grund, ob und wie es auch heute möglich ist, dem allgemeinen Credo der Selbstbezogenheit und Beliebigkeit etwas entgegenzusetzen. Wir bestimmen durch unser eigenes Verhalten ja mit, wie die Welt beschaffen ist. Wenn alle um uns herum kulturell abgleiten und nur noch mit Bildschirm vor der Nase und wahlweise Jogginghose oder Rollkoffer durch die Welt rauschen, ist das kein Grund, mit abzugleiten. Im Gegenteil: Bewahrer tradierter und altmodischer Vorstellungen zu sein ist in Zeiten, in denen die Mehrheit dabei ist, alles Bewährte und Gelehrte aus dem Fenster zu schmeißen, die rebellischere Haltung.
Die gesamte Ratgeberliteratur, die ganze Kultur der How-to-Bücher, beruht auf dem Versprechen, das »Ich« zu optimieren. Der wichtigste Anspruch unserer Zeit ist es, die eigene Identität frei konstruieren zu können. So fühlt sich die moderne Elite nur noch sich selbst gegenüber verantwortlich, diesem Ideal gehorchend, versucht sie, alle Konventionen und Dogmen, die den Menschen belasten, loszuwerden und Selbstbestimmtheit als einzigen Sinn und Zweck des Daseins zu betrachten. Wir leben im Zeitalter des Poststrukturalismus und damit geht der Verlust jeglicher Schranken und Gewissheiten einher.
Aber zu jeder Entwicklung gibt es eine Gegenentwicklung. Was, wenn man der Geisteshaltung der modernen Elite Widerstand leistet und ihr eine neue Form von Nobilität entgegenhält? Der Begriff »Manieren« wurde auch beim Festungsbau verwendet und bezeichnete das jeweils notwendige Befestigungssystem. Je nach Bedrohungspotential variierten die Manieren, nach denen gebaut wurde. Vielleicht ist es heute an der Zeit, wieder ein paar Gedanken auf unsere Baugesetze zu verschwenden, damit alle Menschen – nicht zuletzt die am Rande der Gesellschaft – darin ihren Platz finden können. Die Zeit, in der Eleganz per se verdächtig ist, ist vorbei. Jede Zeit hat die Helden, die sie benötigt. Nach dem mit perfekt geschnittenem Anzug auftretenden James Bond der 50-er bis 90-er Jahre, für den das Wort »suave« passte, folgte der unrasierte, deutlich vulgärere, von Daniel Craig verkörperte Bond, nach dem soignierten Derrick folgte der Kult der unrasierten und äußerlich verwahrlosten Schimanskis und Tschillers. Aber das ist jetzt vorbei. Craig hat versprochen, aufzuhören, Götz George lebt nicht mehr und Till Schweiger nervt, der Proletenkult, die »populäre Feier des Vulgären« (Jens Jessen) liegt in den letzten Zügen, es gibt ein weitverbreitetes Unbehagen an der Formlosigkeit und in der entscheidenden Runde in diesem Duell gilt es, auf der richtigen Seite zu stehen.
Begriffe ändern ihre Bedeutung. So wie Höflichkeit nicht mehr unmittelbar mit höfischem Benehmen zu tun hat, so haben Nobilität und Ritterlichkeit heute, anders als früher, nichts mehr mit Pferden zu tun. An der Stelle, apropos Pferd, ein Dialog aus Friedrich Torbergs »Tante Jolesch«: Zwei Freunde sitzen im Kaffeehaus, da kommt ein Mann mit Reitstiefeln herein. Sagt der eine zum anderen: »Ich hab ja auch kein Pferd, aber dermaßen kein Pferd wie der habe ich nicht.« Pardon! Ich musste das einfach zitieren, auch wenn es hier nichts zur Sache tut. Was ich eigentlich sagen will: Nobilität ist auch ohne Pferd möglich. Ursprünglich wollte ich dieses Buch mal »Wie man ohne Titel adelig wird« nennen, worauf es mir ankommt, ist jedenfalls, dass Adel nichts mit Geburt, aber sehr viel mit Kultur zu tun hat, die man sich aneignen kann. Oder eben nicht.
Nicht alles, was der Adel bewirkt hat, war segensreich, aber niemand wird leugnen, dass es ein paar Werte, Traditionen, Denkweisen und tugendhafte Eigenarten gibt, die in Adelskreisen besonders hochgehalten worden sind und ein bewahrenswertes kulturelles Reservoir darstellen. Auf der Suche nach Eigenarten, die man mal als »edel« bezeichnete, werde ich immer wieder auf Beispiele aus der ritterlichen Literatur zurückgreifen, weil gerade in den Archetypen der ritterlichen Epik etwas sehr Schönes, etwas spezifisch Abendländisches, aufscheint: Ritterlichkeit vereint auf ziemlich unwiderstehliche Art das Ethische und das Ästhetische mit dem Starken. Ein ritterlicher Held ist immer auf der Seite des Guten und verbindet das immer mit Stärke. Ein Ritter ist eben nicht per se ein Mr. Nice Guy aber er verteidigt das Gute und kämpft für die Schwachen. Bei aller Anmut ist da eine starke Dosis Wehrhaftigkeit im Spiel. Das Faszinierende an der Ritterlichkeit ist, dass sie es im Idealfall schafft, das Unversöhnliche zu versöhnen: Anmut und Stärke, Kraft und Milde.
Die eigentliche Herausforderung liegt letztlich darin, Coolness und Kindness miteinander unter einen Hut zu bringen und damit gedanklich den Widerspruch zwischen zwei eigentlich unvereinbaren Polen zu versöhnen, die um den Kern der Ritterlichkeit kreisen. Ich meine den ewigen Widerspruch zwischen weltmännischer Lässigkeit und mitfühlender Güte. Das aus der Antike geerbte Heldenideal ist eher kalt, also »cool«, es favorisiert Tatkraft, Überlegenheit, Macht, Ruhm und Ehre. Das postantike, christliche Ideal besingt eher die Milde, den Kult des Schwachen, der Selbstverleugnung. Es geht, um es mit vertrauten Bildern zu illustrieren, darum, wie man die Menschenfreundlichkeit eines Ned Flanders von den »Simpsons« mit der Härte eines Kriegers à la Django unter einen Hut kriegt.
Und als wäre das nicht Anspruch genug, verlangt Ritterlichkeit auch eine Mischung aus Keckheit, Selbstsicherheit und Eleganz, für die Kenner den schönen Begriff désinvolture reserviert haben. Bei diesem Begriff müssen wir uns kurz aufhalten. Désinvolture ist ein Wort, das kaum übersetzbar ist. Wörtlich heißt es so viel wie »Unverdrehtheit«, es beschreibt die Fähigkeit, mühelos Rückgrat zu zeigen, auf der Seite des Wahren, Guten und Schönen zu stehen und dies mit größtmöglicher Anmut und Lässigkeit zu verbinden. Und es bezeichnet die absolute Verfügungsgewalt über eine Situation, besonders wenn sie kritisch ist. Der Begriff umfasst mehr, als man womöglich überhaupt in Worte fassen kann. Ernst Jünger schreibt zu désinvolture in der zweiten Fassung von »Das abenteuerliche Herz«: »Man findet das Wort meist durch ›Ungeniertheit‹ übersetzt; und das trifft insofern zu, als es ein Gebaren bezeichnet, das keine Umschweife kennt. Zugleich aber verbirgt sich in ihm noch ein anderer Sinn, und zwar der göttergleichen Überlegenheit. In diesem Sinne verstehe ich unter Désinvolture die Unschuld der Macht.« Vielleicht ist James Bond deshalb so eine populäre Heldenfigur? Er ist jedenfalls eine dieser archetypischen Figuren, die Lässigkeit und Anstand, Ritterlichkeit und désinvolture ausstrahlen. Er ist immer Herr der Lage und sieht dabei auch noch gut aus. Wer hat noch désinvolture? Ein Jedi-Ritter, wenn er die Bar auf dem Planeten Tatooine betritt. Cecil, ein Bekannter von mir, der sich auch mit Sakko und Einstecktuch in Antifa-Kneipen in Hamburger Hinterhöfen herumtreibt, wenn es dort ein gutes Konzert gibt, und nie doof angemacht wird. Oder auch Schwedens berühmt cooler König Karl XII.: Voltaire beschreibt ihn als jemanden mit geradezu übermäßiger Lässigkeit und désinvolture: Mitten im Krieg gegen Sachsens August sagte er sich zum Überraschungsbesuch in Dresden an. Er kam mit seiner Kutsche angerauscht, ohne Begleitschutz: »Déjeuner surprise!« Die Sachsen waren so verblüfft, dass sie ihn staunend durchließen, die beiden Herrscher speisten, danach ließ Karl sich wieder in seinen Stützpunkt in Stralsund bringen, und der Krieg konnte weitergehen. Voltaire erzählt in seiner 1732 verfassten Biografie Karls XII. auch, wie dieser schwedische Oberchiller in Stralsund einen Brief diktiert und eine Bombe im Zimmer einschlägt. Der Sekretär hört auf zu schreiben. »Was gibt es?«, fragt Karl. »Die Bombe, Sire!« Darauf Karl: »Was hat die Bombe mit dem Brief zu tun?«
Kann man das lernen? Wie wird man nobel?
Ritterlichkeit war nie eine Frage der Geburt und kann es heute erst recht nicht mehr sein, weil die alte Aristokratie längst ihre historische und soziologische Bedeutung verloren hat, ein neuer Adel aber noch nicht sichtbar ist. Wir befinden uns also in einer Übergangszeit, in der sich Nobilität erst wieder neu konstituieren muss. Eigentlich ein idealer Zeitpunkt für so ein Buch, und wer sonst als ein Angehöriger der untergegangenen Oberklasse sollte es schreiben, der auf dem Boden einer modernen Angestelltenexistenz steht, also den Vorteil hat, als Brücke zwischen Altem und Neuem zu fungieren.
Neuen Adel gab es schon immer. Im Grunde besteht der ganze Adel aus neuem Adel. Ein König hat immer einen Ahnen, der sich irgendwann nach oben geputscht hat. Und es gab historisch immer verschiedenste Möglichkeiten, adelig zu werden. Bei den Germanen wurden aus manchen Freien Edelfreie, die mehr Ansehen und Führungsanspruch hatten, weil sie im Kampf besonders erfolgreich waren und eine große Gefolgschaft hatten. Andere wurden adelig, weil sie das Vertrauen des Häuptlings genossen, und gehörten, streng genommen, zum Dienstpersonal. Familien wie meine waren Knechte am Hof von Kaiser Barbarossa, der vertraute seinen Dienstboten mehr als irgendwelchen großkopferten Edelfreien, hob deshalb Leute wie meine Vorfahren in den Adelsstand und schickte sie in abgelegene Kolonialgebiete, in unserem Fall das heutige Südwestsachsen, um dort für Ordnung zu sorgen. Dass ein Großteil des karolingischen und kapetingischen Hochadels ursprünglich aus dem Dienstpersonal stammt, ist übrigens auch an manchen Titeln und Ehrenbezeichnungen abzulesen. In dem Titel Marschall steckt sogar noch das Wort marescalsus, das ursprünglich »Pferdeknecht« hieß. Der Kämmerer, eine Position, aus der später der Finanzminister wurde, war ursprünglich dafür zuständig, dass Betten bei Hofe hergerichtet waren, erst mit der Zeit wurden aus Dienerrollen die mächtigsten Posten des Landes.
Erlauben Sie mir an der Stelle bitte einen kleinen Exkurs zum Adel: Die Entstehung des Adels in Europa fällt in eine Epoche, die sehr schlecht beleuchtet ist. Die Völker und Stämme, die zu Beginn unserer Zeitrechnung jenseits des Limes, also außerhalb des Römischen Reiches, lebten, kannten keine Schriftkultur. Was wir über sie wissen, ist rudimentär, die einzigen Quellen, die es gibt, sind unzuverlässig, da sie von römischen Autoren stammen, deren Ehrgeiz nicht so sehr darin bestand, im heutigen Sinne Anthropologie zu betreiben, die fremden Menschen und ihre Sitten also wirklich zu verstehen, sondern dem heimischen Publikum, den zunehmend wohlstandsverwahrlosten besseren Kreisen Roms, mit der Schilderung stolzer, unverdorbener Naturburschen einen Spiegel seiner eigenen Dekadenz vorzuhalten. Was Tacitus zum Beispiel über die Germanen schrieb, stützte sich hauptsächlich auf Hörensagen und zeichnete ein bewusst idealisiertes Bild der Germanen. Überhaupt war der Begriff »Germanen« ziemlich willkürlich, eigentlich diente er den Römern nur als Sammelbegriff für eine unübersehbare Anzahl von Stämmen, über die man herzlich wenig wusste. In den Regionen entlang des Limes allerdings, in denen die unstrittig eher rohe Welt der sogenannten Germanen die verfeinerte Welt der Römer berührte, kam es zu einem ziemlich interessanten und Früchte tragenden Austausch auf kulturellem, kommerziellem, technischem und sogar personellem Gebiet. Immer dort, wo es zum Clash kommt, wie entlang des Limes zwischen nordisch-germanischer und romanisch-mediterraner Welt, entstehen interessante Dinge. Die beiden Welten mischten sich. So war der berühmte germanische Anführer Arminius, der Held vom Teutoburger Wald, eigentlich römischer Legionär, und viele germanische Häuptlinge ahmten den Lifestyle der Römer jenseits der Grenzen nach. Anführer auf der germanischen Seite fanden es schick, womöglich nach sanftem Druck ihrer Frauen, sich nach römischer Sitte regelmäßig zu baden, in Togas zu hüllen, römisches Geschirr zu benutzen und römischen Schmuck zu besitzen. Nach den Erschütterungen zwischen dem 2. und 5. Jahrhundert, nach der Völkerwanderung, die die europäischen Völker und Stämme wie in einer Moulinex-Maschine vermischte, und dann schließlich nach dem Untergang Roms hausten in ehemals römischen Kerngebieten plötzlich Germanen, deren Väter noch lange Bärte hatten und beim Essen die Knochen hinter sich schmissen, und machten in den inzwischen etwas heruntergekommenen Thermen einen auf feine Römer. Im ehemals römischen Gallien hatten sich die Besatzer ziemlich gründlich mit der ansässigen Bevölkerung vermischt, so sah sich dort nach dem Untergang des Römischen Reiches eine landbesitzende gallorömische Elite mit Neuankömmlingen aus dem germanischen Westen konfrontiert, mit denen sie sich abwechselnd schlugen und arrangierten. Besonders in dem Raum, der von den heutigen Beneluxländern bis ins heutige südöstliche Frankreich reicht, muss zwischen 5. und 8. Jahrhundert ein ziemliches Hauen und Stechen geherrscht haben. Aus wahrscheinlich zunächst eher pragmatischen Gründen entwickelten sich in dieser Zeit und in dieser Region allmählich gemeinsame Spielregeln für den Krieg untereinander. Statt den Gegner nach dem Sieg immer gleich zu töten, begann man, einen Kodex zu entwickeln, der ehrenhafte Niederlagen möglich machte. Das war schon allein deshalb sehr praktisch, weil man sich so mehrmals im Kampfe gegenüberstehen konnte. Paradoxerweise sorgte das dafür, dass kriegerische Auseinandersetzungen unter unseren Vorfahren eine ständige Plage blieben, der ständige Kampf war gebändigter und dadurch risikoloser geworden. Der Verlierer von heute konnte der Gewinner von morgen sein. Ein bisschen wie in der englischen Premier League, nur brutaler. Im nördlichen Rheinland, genau dort, wo alte und neue Welt sich berührten, setzte sich Ende des 5., Anfang des 6. Jahrhunderts als Dauergewinner der Stamm der Franken durch, die unter der Führung wechselnder Dynastien schließlich ein Reich gründeten, das später den Anspruch erhob, in Kontinuität zum alten Römischen Reich zu stehen.
Drei wesentliche Faktoren begünstigten die Entstehung von noblen Idealen und Ritterlichkeit: Erstens der Trend, im Kampf Zurückhaltung zu üben. Zweitens der wachsende Einfluss des Christentums (der Gegner, der einem gegenüberstand, war nun eben plötzlich ein Mitchrist statt irgendeines fremden Wilden). Drittens: die Frau. Womit wir wieder bei Lady Ragnelle sind. Oder Eleonore von Aquitanien. Oder Isolde. Viel ist über den Einfluss der Kirche bei der Zügelung jener germanischen Raubeine geschrieben worden, Bischöfe sorgten dafür, dass Krieger sich an Grundregeln zu halten begannen, kein Waffengebrauch am Sonntag, Hände weg von Frauen, Kindern, Waisen, Klerikern und Kaufleuten, aber die größte zivilisatorische Wirkung hatten, bei Lichte besehen, die Frauen. »Überall dort, wo die Männer zum Verzicht auf körperliche Gewalt gezwungen sind, stieg das soziale Gewicht der Frauen«, schreibt Norbert Elias, einer der Väter der Soziologie des 20. Jahrhhunderts. Wer in der Kriegergesellschaft des Mittelalters etwas auf sich hielt, zerrte Frauen nun nicht mehr an den Haaren in sein stinkendes Gemach, sondern zog sich, wenn er eine Frau begehrte, was Anständiges an, vielleicht wusch er sich vorher sogar und unterhielt sich mit ihr, machte ihr, wie man später sagte, den Hof. Das war vermutlich nicht so sehr eine Frage des Bedürfnisses, sondern des Prestiges. Wer feinere Sitten hatte, signalisierte damit gesellschaftlich seine Position und innerhalb des Stammes oder der Großfamilie seinen Führungsanspruch. In den Ritterdichtungen des 9. und 10. Jahrhunderts, dem Minnegesang, begegnet uns bereits ein völlig neuer Kriegertypus. Der moderne Krieger hatte nun plötzlich galant gegenüber Frauen zu sein. Zwar waren die befestigten Höfe und die in dieser Zeit entstehenden Burgen weiterhin typischerweise Männerherrschaften, aber Frauen waren definitiv die treibende Kraft hinter der Verfeinerung des Burglebens, sie waren es, die Dichter, Sänger und Kleriker, die Intellektuellen jener Tage, anlockten, Kriegerschanzen zu Orten geistiger Regsamkeit machten und Luxusbedürfnisse auf Burgen wachküssten, an denen all das bis dahin fremd gewesen war.
Für so manchen altmodischen germanischen Kriegertypen war dieses neumodische Zeug, all das, was Freud als »Affektzügelung« und Elias als »Zivilisation« bezeichnete, sicher überflüssiger Schnickschnack, aber das änderte nichts daran, dass sich – aus Prestigedruck – ein neuer Verhaltenskodex entwickelte. Die Bändigung des Kriegers auf dem Schlachtfeld durch die Praxis der milte, die Bändigung des Ritters durch von den Troubadours herbeigesungene Ideale der höfischen Liebe begannen mehr und mehr eine soziale Kaste zu demarkieren, die sich »edel«, also adelig, benahm. Um sich von nachrückenden Parvenüs abzugrenzen, entwickelte diese Kriegerschicht immer ausgefeiltere Tugend- und Verhaltenskodexe, in deren Zentrum christliche Motive, allen voran die Verteidigung von Schwachen, Alten und Armen, standen.
Die neuralgischen Punkte zur Verfeinerung der Sitten waren die sich bildenden kleineren und größeren Fürstenhöfe des Mittelalters. Je wirtschaftlich potenter diese Burgen waren, desto mehr zogen sie Nachkommen weniger bemittelter freier Familien, arme Ritter, die sprichwörtlichen Glücksritter, an.
Einen Geburtsadel im strengen Sinne hat es also nie gegeben. Was es aber sehr wohl gab und gibt, sind gemeinsame Werte, Ideale, Verhaltensnormen und Rituale. Und die haben sich von den kulturellen Zentren aus, in Europa waren das ab dem Mittelalter die Höfe, in überlappenden Kreisen verbreitet. Wer sich zur gesellschaftlichen Elite zählte, hatte gemeinsame Vorstellungen davon, was richtig und was falsch war und wie man sich in Gesellschaft zu verhalten hatte. Das, was als notwendig, comme il faut, betrachtet wurde, war nie ein esoterisches Wissen, sondern zu jeder Zeit erlernbar und verbreitete sich schon dadurch, dass sich nachrückende soziale Schichten daran orientierten. Das war immer so und ist es auch weiterhin.
Wenn Sie mich nun fragen, ob mich als Angehöriger des historischen Adels irgendetwas von, sagen wir, Carsten M. oder Mario B. unterscheidet, muss ich leider antworten: Nein. In unseren Adern fließt das gleiche Blut, Stoffwechsel und Verdauung funktionieren ähnlich. Wenn es etwas gibt, das uns unterscheidet, dann ist es nur der Umstand, dass wir früher damit angefangen haben, uns zusammenzureißen. Alle waren wir mal langbärtige Wilde. Es bedarf eines gewissen Trainings, um nicht zu fressen und zu vögeln, wenn einem gerade der Sinn danach steht, um manchmal auch Verzicht zu üben, um seine egoistischen Instinkte zu überwinden, um aus der Notwendigkeit, sich zu ernähren, so etwas wie Esskultur zu machen – um all diese Dinge irgendwann auf die Reihe zu kriegen, braucht es Generationen, und bei Familien wie meiner hat dieses Training einfach einen Tick früher angefangen.
Wenn der von den Futtertrögen der Macht längst verdrängte historische Adel heute überhaupt noch irgendeine Rolle zu spielen hat, dann also höchstens als Konservator gewisser zivilisatorischer Errungenschaften, die in unserem Zeitalter der Beliebigkeit der Verteidigung bedürfen. Wenn Zivilisation etwas wert ist, dann können sich die letzten Angehörigen des untergehenden historischen Adels vielleicht dabei nützlich machen, sich an der Verteidigung derselben zu beteiligen.
Ende Exkurs.
Wie, das ist die Frage, der ich in diesem Buch auf den Grund gehen will, kann man heute Ritterlichkeit leben? Was ist Nobilität, was ist Anstand heute? Ich erörtere diese Frage immer wieder aus adeliger und christlicher Perspektive, denn das ist die einzige Perspektive, die mir zur Verfügung steht. Ich orientiere mich dafür an den klassischen Tugenden und habe dort, wo es mir notwendig schien, ein kleines Update vorgenommen. Man kann, zumindest in Europa, nur über Tugenden sprechen, wenn man das auf der Basis der im Abendland vermittelten klassischen Tugendlehre tut.
In Abwesenheit eines gemeinsamen sittlichen Koordinatensystems ist ein Buch über Tugenden, speziell ritterliche Tugenden, eigentlich völlig abwegig und dadurch paradoxerweise absolut notwendig. Die Wertedebatten der vergangenen Jahre waren ein Anfang, auch wenn ihr biederer Grundton zutiefst abstoßend war, aber sie zeigten immerhin, dass uns langsam unwohl bei dem Anblick des sich immer rascher leerenden Reservoirs tradierter Vorstellungen wird. Wir tun übrigens auch den Menschen, die aus fremden Kulturen zu uns kommen, keinen Gefallen, wenn wir ihnen vermitteln, sie seien in ein Land gekommen, das keine spezifischen kulturellen Vorstellungen, also auch keine allgemeinen Regeln und Gebräuche kenne. Die Menschen, die Europa so attraktiv finden, tun dies ja nicht nur, weil sie unser Sozialsystem, sondern auch unsere Kultur anzieht. Wenn wir unsere eigene Kultur verleugnen, begehen wir also Verrat an denen, die bei uns Zuflucht suchen.
Diese Alles-ist-okay-Welt, diese Kultur der völligen Beliebigkeit, der wir ausgeliefert sind, geht eigentlich inzwischen jedem halbwegs vernünftigen Menschen auf den Wecker. Wir können uns glücklich schätzen, in einer Gesellschaft zu leben, die liberaler, weltoffener und toleranter ist als alle Gesellschaften vor uns, aber wenn wir an den Punkt kämen, dass alles gleichermaßen zulässig wäre und nur das Überlieferte als per se überholt und falsch angesehen würde, dann wäre das Projekt der Moderne an sein natürliches Ende gelangt.
Noch eine Vorwarnung: Von Ritterlichkeit und Anstand zu reden, anderen darüber etwas beibringen zu wollen ist natürlich gewagt. Dieses Buch enthält zum Beispiel ein Kapitel über die Tugend des Maßhaltens, eine besonders wichtige Tugend, eine der vier sogenannten Kardinaltugenden. Dieses Kapitel steht hier, obwohl ich gestern Abend drei Nogger gegessen habe, nicht nach, sondern zum Abendessen. Wenn die Autorschaft eines solchen Buches voraussetzen würde, dass der Erzähler von einem Podest moralischer Überlegenheit herabspricht, würde das, fürchte ich, sowohl den Verfasser als auch die Leser überfordern. Es hat immer wieder Bücher wie dieses gegeben, auch gute, und sie sind in den seltensten Fällen von besonders tugendhaften Autoren verfasst worden. Sir Thomas Malory, von dem die eingangs erzählte Geschichte von Gawain und Ragnelle stammt, der wichtigste englische Autor von Arthusgeschichten, verfasste die meisten seiner Werke (darunter auch »Le Morte d’Arthur«) im Gefängnis, sein Strafregister reichte von Wilderei über Diebstahl bis zu Vergewaltigung und Mord. Eines der berühmtesten Werke instruktiver Ritterliteratur ist das »Libre del ordre de cavayleria«. Es ist im Jahr 1274 entstanden, eine raue Zeit, und der Verfasser, Ramón Llull, war alles andere als ein Saubermann. Sein Vater, der mitgeholfen hatte, die Sarazenen von der Insel Mallorca zu vertreiben, hatte ihn mit ein paar Gütern um Palma belohnt, wo er als ziemlicher Wüstling herrschte. Ramón Llull war ein untreuer Ehegatte, er war herrisch, unwirsch und streitsüchtig, aber sein Buch über Ritterlichkeit war ein wichtiger Leitfaden für aufstrebende Ritter, die ihr raues Dasein hinter sich lassen wollten.
Der Punkt ist: Es ist gar nicht vermeidbar, immer wieder zum Heuchler zu werden. Die einfachste Art, nicht zu heucheln, ist, gar keine moralischen Prinzipien zu haben. Moralische Prinzipien, Standards, Koordinatensysteme sind aber wichtig, auch wenn man ihnen nicht immer gerecht werden kann. Verschwinden diese Koordinaten ganz, ist sogar die theoretische Möglichkeit futsch. Um es mit Max Scheler, dem Verfasser des Werks »Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik«, zu sagen, der auf dem Weg aus dem Bordell gesehen und daraufhin gefragt wurde, wie er das mit seinen Theorien zur Ethik vereinbaren könne: »Der Wegweiser geht auch nicht den Weg, den er weist.«
Jedes Buch ist ja auch eine Form der Eigentherapie. Vielleicht beschreibe ich in diesem Buch einfach nur die Person, die ich gerne irgendwann sein würde. Folgenden Satz finde ich da in diesem Zusammenhang tröstlich: »La civilisation … n’est pas encore terminée.« Norbert Elias hat diesen Satz seinem Monumentalwerk »Über den Prozess der Zivilisation« vorangestellt. Er wird sich etwas dabei gedacht haben. Wenn Zivilisation kein abgeschlossener Prozess ist, dann ist es meine eigene – und unser aller – Zivilisiertheit auch nicht.
DIE TUGENDEN
Eine Gebrauchsanweisung
Malen Sie sich bitte eine Person aus, die in allen Lebenslagen lässig wirkt, die jegliche Mühen mit Leichtigkeit auf sich nimmt, die meist gut gelaunt ist, immer einen ermunternden Witz auf den Lippen hat, der es gelingt, zu allen Anlässen immer genau das Richtige anzuhaben, die selbstsicher, aber nie arrogant, hilfsbereit, aber nie gönnerhaft ist, die unverrückbare Prinzipien hat, ihre Meinung unmissverständlich sagt, die aber auch weiß, wann man schweigen und wann man ein Auge zudrücken muss, eine Person, die in heiklen Situationen zu schlichten versteht, die Menschen gut führen kann, ihnen sogar Unangenehmes annehmbar zu vermitteln vermag, weil sie Zuversicht ausstrahlt. Jeder möchte so sein. Und jeder möchte in Gesellschaft eines solchen Menschen sein.
Aristoteles (384–322 v. Chr.) war der Überzeugung, dass es solche Menschen gibt und dass wir alle danach streben sollten, so zu sein. In der »Nikomachischen Ethik«, verfasst für seinen Sohn Nikomachos, stehen Dinge, an denen niemand, der sich danach wieder mit diesem Thema befasste, fortan vorbeikam.
Das griechische Fundament
Aristoteles’ Überlegungen fußten auf der Annahme, dass Menschen – wie alles auf der Welt – einen Wesenskern haben. Um zu erkennen, wo der Wesenskern einer Sache liegt, muss man sie nur beobachten. Ein Messer schneidet, auf einem Stuhl sitzt man. Es wäre Unsinn, mit einem Stuhl ein Brot zu schneiden und sich auf ein Messer zu setzen. Menschen haben vieles mit Tieren gemein, wir wachsen, wir ernähren uns, wir pflanzen uns fort, aber darüber hinaus sind wir, beobachtete Aristoteles, denkende und soziale Tiere, also hängt die Frage, ob wir unserem Wesenskern gerecht werden, auch damit zusammen, ob wir diese beiden Kapazitäten recht nutzen. Es genügt für einen Menschen also zum Beispiel nicht, den ganzen Tag in Jogginghosen herumzuliegen, zu fressen und zu scheißen, wohingegen das für eine Lebensform, die ausschließlich dem Stoffwechsel gewidmet ist, wie eine Holothurie, eine Wassergurke, zum Beispiel, völlig okay wäre.
Tugendhaftigkeit ist für Aristoteles nicht etwas, das einem in die Wiege gelegt ist, sondern das einem durch hartnäckige Übung beigebracht werden muss. Wie bei einem Musikinstrument, so die These, kann man durch Übung – instruiert durch die richtigen Lehrer – zum Meister werden. Tatsächlich sagen wir, wenn jemand mit großer Leichtigkeit schwierige Musikstücke spielt, er oder sie spiele »virtuos« (das lateinische virtus heißt »Tugend«), da steckt die Ahnung drin, dass man durch Übung irgendwann dahin kommt, dass alles leicht aussieht.
Tugenden sind für Aristoteles nie absolut, sondern befinden sich immer genau in der Mitte zwischen zwei Extremen. Von jeder Tugend, sagt er, gebe es überdrehte Versionen, die das Gute ins Lasterhafte steigerten. Hingegen gebe es von allen Tugenden unterentwickelte Abarten, die die Tugend in eine Untugend verwandeln. Am Beispiel der Tapferkeit hieße das: Ein Mangel an Tapferkeit ist ein Laster – die Feigheit. Auf der anderen Seite des Spektrums ist die Tugend der Tapferkeit einfach bescheuert, »tollkühn«, wie man früher sagte. Tugendhaft ist Tapferkeit, nur genau in der Mitte. Da ist nicht viel Platz. Es ist ein süßer kleiner Punkt, aurea mediocritas, die goldene Mitte, sagt der Lateiner, schöner ist eigentlich der englische Begriff »der süße Punkt«, der sweet spot. Wo der sich befindet, das ist bei Aristoteles genau wie in Frauenmagazinen, was diesen und andere Punkte anbetrifft, immer nur eine Frage der richtigen Instruktion, dann findet man den schon. Zuschauen und Nachahmen sind die probatesten Methoden. Wichtig ist allerdings eines: Man muss sich gute Gesellschaft aussuchen. Und dass man danach handelt, ist eher die Ausnahme. Die Grundregel im Leben ist, leider: Runter ist immer leichter als rauf. Feige statt mutig zu sein ist leicht. Das, was man heute erledigen muss, auf morgen zu verschieben ist leicht. Seinen Partner zu betrügen ist (abgesehen von logistischen Fragen) leicht. Das Laster oder das Scheitern muss man nicht groß erklären. Das Heroische, das, was Überwindung kostet, ist erklärungsbedürftig, weil außergewöhnlich. Thomas von Aquin nennt das Phänomen acedia, eine Mischung aus Trägheit und Traurigkeit. Der Mensch meidet das Gute, weil das Überwindung und Mühe kostet. Runter ist wie gesagt immer leichter als rauf.
Der Geheimtrick ist, wie gesagt, sich in gute Gesellschaft zu begeben und Leute zu finden, zu denen man aufschauen kann, die einen überragen, die klüger sind als wir und uns herausfordern. Die Fähigkeit, tugendhafte Menschen zu erkennen, sagt Aristoteles, ist übrigens bei uns eingebaut, wir müssen nur genauer hinsehen und nicht halb blind durchs Leben taumeln. Die Herausforderung ist jedoch, dass man sich dafür geistig und körperlich aus seiner Komfortzone herausbewegen muss.
Läuft man nicht Gefahr, ein wenig bemüht zu wirken, wenn man ständig dabei ist, zu anderen aufzuschauen und sie in ihrer ach so tollen Tugendhaftigkeit nachzuahmen? Ja, stimmt, anfangs schon, sagt Aristoteles, aber nach einer Weile legt sich das, denn nach und nach wird das gute Verhalten irgendwann Gewohnheit, zum Teil unserer Natur, und irgendwann müssen wir uns dafür dann gar keine Mühe mehr geben. Fake it ’til you make it, frei nach Alfred Adler, dem Vater der Individualpsychologie, oder, »Zum zehnten Mal wiederholt, wird es gefallen«, wie Horaz sagt. Wenn man nur lange genug so tut, als wäre man zum Beispiel ehrlich, und sich kleine Unehrlichkeiten wie Flunkereien oder Schwarzfahren verkneift, wird man durch diese Praxis auf die Dauer tatsächlich immer ein bisschen ehrlicher. Alles, was wir tun, jede kleine Entscheidung, formt unweigerlich unsere Persönlichkeit. Das Werk des Tuns sind wir selbst, oder so ähnlich, hat ein sehr kluger Mann einmal gesagt.
Was aber, wenn man gar nicht unbedingt das Verlangen hat, Everybody’s Darling zu sein? Ich war mit meiner Frau in Padua und habe mir angesehen, wie Giotto die Tugenden und wie er die Laster gemalt hat. Ehrlich: Die Laster sehen interessanter aus, mehr Drama, mehr Action, mehr Leidenschaft. Auch ein Joschka Fischer hat ja mal zugegeben, dass er die Hölle immer viel interessanter findet und ihn die Aussicht, in einem langen, weißen Nachthemd Halleluja zu singen, langweilt. Heißt es nicht auch nice guys finish last und good girls go to heaven, bad girls go everywhere? Diese Sprüche haben es immerhin auf Millionen Kissen und T-Shirts gebracht. Die kurze Antwort auf diese Frage ist eine Gegenfrage: Do you really want to go everywhere? Das kann ziemlich anstrengend und unerquicklich werden. Ich kenne Leute, die dort waren. In einem Gedicht von Bertolt Brecht heißt es: »An meiner Wand hängt ein japanisches Holzwerk/Maske eines bösen Dämons, bemalt mit Goldlack./Mitfühlend sehe ich/Die geschwollenen Stirnadern, andeutend/Wie anstrengend es ist, böse zu sein.«
Kein Aristoteles, kein Thomas von Aquin, kein Brecht trauen uns zu, dass wir immer hübsch artig bleiben. Aber sie sagen uns auch: Die Abkehr von der Tugend, ob aus Gründen der Bequemlichkeit oder aus mangelnder Einsicht, endet ziemlich weit unten, wo es nicht besonders hübsch ist, in der Hölle, und die sieht nicht notwendigerweise so aus wie bei Hieronymus Bosch, in der kann man auch stecken, wenn man äußerlich erfolgreich im Leben steht. Das komplett egogesteuerte, nur dem eigenen Selbst und uneingeschränkten Vergnügen gewidmete Leben, da muss man auf Giottos Fresken in der Scrovegni-Kapelle[1] nur genau hinsehen, sieht ziemlich bitter aus. Die Figur des Zorns, zum Beispiel, mag dramatisch mehr Unterhaltungswert bieten, es ist eine Figur, die sich mit dramatischer Geste regelrecht in der Mitte entzweireißt, aber es ist eben auch ein Bild der Selbstzerstörung.
Der Grund, warum wir nach Tugendhaftigkeit streben sollten, hat für Aristoteles, in dessen Konzept Gott und Jenseits keine Rolle spielen, nichts mit Note Eins, mit Sternchen und Herzchen in einem großen goldenen Tugendbuch zu tun, sondern mit Erfüllung, mit einem gelungenen, fruchtbaren, menschengemäßen Leben – der sogenannten eudaimonía, manchmal mit »gedeihliche Lebensführung«, manchmal schlicht mit »Glück« übersetzt. Je besser der Mensch sein Potenzial ausschöpft, so das aristotelische und damit gesamte klassische Denken, desto geglückter, desto »eudaimonistischer« das Leben. Es geht um nichts Geringeres als das gelungene, geglückte Leben. Man sollte übrigens das Wort »eudaimonistisch« öfter ins Gespräch einstreuen.
Eine eudaimonistische Existenz bedeutet aber (Achtung, das ist jetzt wichtig!) nicht ein Leben am Pool bei angenehmen 25 Grad im Schatten und Drinks mit bunten Schirmchen, es heißt vielmehr, dass man immer wieder an seine Grenzen geht. Es geht darum, über sich hinauszuwachsen und die bestmögliche Version seiner selbst aus sich herauszukitzeln. Eudaimonía riecht ein wenig wie der Schweiß bei einer anstrengenden Bergtour und fühlt sich an wie die Müdigkeit nach einem Tag, an dem man viel geschafft hat. Eudaimonía ist ein lebenslanger Prozess, der nie abgeschlossen ist, weil man sich fortwährend neue Ziele setzen muss.
Das habe ich jetzt bewusst verkürzt dargestellt, um dem ehrwürdigen Aristoteles nicht näher auf die Pelle rücken zu müssen. Würde man das nämlich tun, müsste man feststellen, dass er ein ziemlicher Snob war und fest daran glaubte, dass das alles nur für eine hauchdünne Schicht überhaupt eine Rolle spielt. Wenn Widrigkeiten wie niedere Geburt oder Hässlichkeit ins Spiel kommen, da war Aristoteles leider gnadenlos, hat man sowieso keine Chance, da kann man das ganze Bemühen auch sein lassen. Sklaven und Ausländer geht das mit der eudaimonía aus seiner Sicht schon gar nichts an, die zählen gar nicht. Man muss da natürlich Aristoteles’ Zeit und seine Kultur im Hinterkopf haben. Athen war eine aristokratische Kultur, in der nur die reichen Städter was zu sagen hatten und all die anderen, die arbeitende Bevölkerung, die Ausländer und Sklaven, etwa 80 Prozent der Gesamtbevölkerung, gar nicht zählten. Ich musste das jetzt unfairerweise doch erzählen, denn nur dann versteht man auch, was das Neue an der Tugendlehre war, die – auf Aristoteles aufbauend – folgte. Spätestens ab dem 4. Jahrhundert mit christlichen Denkern wie Ambrosius von Mailand, und dann Hunderte Jahre später mit Thomas von Aquin (13. Jahrhundert) sah man manches anders.
Der christliche Twist
Auch die christliche Ethik lehrt, dass Tugendhaftigkeit etwas ist, das man durch gute Lehrer lernen und durch Übung erwerben kann, auch hier wird betont, dass das keine Frage von lästiger Verpflichtung ist, sondern es um die Verwirklichung von Glück, um das geglückte, gelungene, gute Leben geht, also um etwas, das äußerst lohnend ist; Tugendhaftigkeit bedeutet »die treffliche und gelungene Erfüllung von Zwecken unserer Natur«. Das ist noch Aristoteles pur. Aber – und diese Behauptung ist das Neue im christlichen Menschenbild und für nicht Gläubige schwer nachvollziehbar – alleine kriegt der Mensch das nicht hin.
Die Ursünde besteht nach christlichem Verständnis darin, dass der Mensch aus Stolz darauf besteht, besser zu wissen, was für ihn gut ist, der Griff nach dem Apfel repräsentiert bildhaft den Willen, selbst das Ruder zu übernehmen, wie Gott sein zu wollen, nicht mehr nur Geschöpf, sondern lieber selbst Schöpfer sein zu wollen. Wir wollen nicht von einer höheren Macht abhängig sein, wir wollen selbst bestimmen, wer wir sind. Die ganze Bibel kann als Liebesgeschichte zwischen Gott und dem Menschen gelesen werden, in der der Mensch sich von Gott losreißt, der ihn aber nie aufgibt, und der Mensch die Chance erhält, zurückzukehren, aber diesmal freiwillig, aus einer Position der Stärke heraus, voll angezogen, nicht nackt, als selbstbewusster Macher, nicht als dummer Paradiesbewohner, der alles frei Haus geliefert bekommt. Dem Menschen ging es ja im Paradies hervorragend, an einer Stelle der Genesis heißt es sogar, dass Gott in dem Garten, den er für die Menschen geschaffen hatte, gelegentlich spazieren ging, und zwar vormittags, wenn es noch nicht so heiß war. Ein ziemlich anrührendes Bild, das von inniger Gemeinschaft von Gott und Mensch erzählt, eigentlich eine unfassbare Vorstellung. Der Mensch, der sich gegen diese Gemeinschaft entschließt, kann noch so guten Willens sein, wenn er sich alleine auf sich verlässt, sagt die christliche Lehre, geht das schief.
Und noch etwas Neues, noch Wesentlicheres kam hinzu: War das Gute, das Richtige, das Tugendhafte, das Heroische, das gute Leben für Aristoteles & Co. etwas, das nur die Oberklasse anging, sind nach biblischer Auffassung alle dazu berufen. Das ist schon im Judentum angelegt, findet aber dann mit Jesus seinen Höhepunkt. Der Völkerapostel Paulus, ohne den das Christentum eine kleine Sekte geblieben wäre und den Spötter auch gerne als den faktischen Gründer des Christentums als Weltreligion bezeichnen, erklärt das so: Durch den Tod von Jesus stirbt der Mensch mit ihm, durch seine Auferstehung, die in der Taufe mitvollzogen wird, wird er wiedergeboren und ist ab dem Moment Gottessohn und Königskind, egal, in welche Klasse man hineingeboren wurde. Das Wasser der Taufe (früher musste man dabei untertauchen) ist gleichbedeutend mit einem kleinen Tod, die Salbung, die nach der Taufe erfolgt, ist ein uraltes jüdisches Ritual, mit dem Könige ausgezeichnet wurden. Ab jetzt ist jeder, der getauft ist, Königssohn und Königstochter und hat sich auch gefälligst so zu benehmen. Für Griechen war das gute Leben eine Sache der oberen Zehntausend, die Bergpredigt – die zentrale Botschaft, quasi das Grundgesetz des Christentums – hingegen richtet sich an alle, und zwar angefangen mit den Armen, Hässlichen und Benachteiligten. Die heutige Obsession, jedem moralische und intellektuelle Hoheit zuzugestehen, der für sich geltend machen kann, einer Minderheit anzugehören oder irgendwie verfolgt zu sein, geht eigentlich auf etwas ursprünglich sehr Schönes zurück, auf diese christliche Denkart nämlich, die Idee von Nobilität auf den Kopf und den Schwachen in den Vordergrund zu stellen. Die Ironie ist, dass vieles, was das Christentum erst in die Welt gebracht hat, Individualität, das über die Grenzen des eigenen Stammes bis hin zum Feind Reichende, die Vielfalt, die Inklusion, die Gleichberechtigung, sich heute letztlich gegen seine Geburtshelfer gewendet hat und unsere Kultur sich damit verrät.
Das Christentum hat so manches vom Gedankengut der Antike verworfen, was heute wieder modern ist: das Interesse an Vollkommenheit, an makelloser Schönheit, die Faszination mit optimiertem Gengut, selbst entworfenen Menschen. In der Bibel wird ständig darauf verwiesen, dass das Krumme eine Chance hat, gerade zu werden. Nach biblischer Vorstellung arbeitet Gott mit den Schwachen und den Unperfekten, er hat nämlich gar keine andere Wahl, wenn er die Freiheit zulässt. Die Bibel ist jedenfalls voll von krummen Lebenslinien. Das Alte Testament verdankt so manche seiner schönsten Passagen den Klageliedern des zum Mörder und Ehebrecher gewordenen Königs David und ist voller Versager, die doch noch irgendwie die Kurve gekriegt haben. Noah hat getrunken, Jakob war ein Betrüger, Moses war ein Totschläger, und Jesus hat seine Kirche zwar mit ein paar ziemlich fähigen Jungs gegründet, aber wenn es darauf ankam, waren sie auch ziemliche Penner. Seine Lieblingsjünger, das ist mehrfach und für sie wenig schmeichelhaft festgehalten, schliefen immer genau dann, wenn es darauf ankam.
Aristoteles hätte wahrscheinlich über die Geschichte des geläuterten Räubers, der neben Jesus am Kreuz hängt und für den angeblich in der letzten Sekunde seines verpfuschten Lebens alles wieder gut sein soll, den Kopf geschüttelt. Für Aristoteles war das Erreichen von eudaimonía zwar ein fortwährender, nie endender Prozess, aber es kam schon auf das Gesamtbild an, für ein völlig verpfuschtes, kriminelles Leben in allerletzter Minute die Absolution zu bekommen ist nach aristotelischen Maßstäben absurd, so viel Großzügigkeit wäre in seinem Tugendspektrum weit im roten Bereich der Unangemessenheit, um nicht zu sagen der Idiotie, gewesen. Das Eigenartige an den ritterlichen Tugenden ist, wie eingangs erwähnt, dass sie auf gewisse Weise eine Synthese hinbekommen haben, zwischen dem Perfektion, Schönheit und Kraft huldigenden Ideal der Antike und dem Sinn für das Schiefe und Krumme des Christentums sowie seiner auf Barmherzigkeit, also Altruismus, hinauslaufenden Ethik. Deswegen werde ich immer wieder, wenn es nun um die einzelnen Tugenden geht, auf die ritterliche Idealvorstellung zurückgreifen. Sie scheint mir ein ideales Rezept für eine Zeit zu sein, die damit hadert, auf welchen sogenannten Werten sie fußt.
Aristoteles’ Lehre, dass der Mensch sein Leben lang unterwegs zu Höherem ist, fiel im Mittelalter auf fruchtbaren Boden, bekam aber durch christliche Denker, allen voran Thomas von Aquin, eine völlig neue Wendung. Die Vorstellung, dass sich der Mensch in via befindet, auf lebenslanger Wanderschaft, ist durch und durch auch eine christliche geworden, neu war aber der Twist, dass Stolperer, Rückfälle und Ausrutscher plötzlich geradezu notwendige Bestandteile des Weges sein sollten, dass ein Mensch aus Gebrochenheit auch gestärkt hervorgehen und zu seiner eigentlichen Bestimmung kommen kann, dass Unzulänglichkeiten zum Weg gehören, weil sie den Menschen an seine Hilfsbedürftigkeit erinnern. Vielleicht ist überhaupt das, was die Gemeinsamkeit der antiken griechischen mit der heutigen Kultur ausmacht, was sie gleichzeitig vom christlich-jüdischen Denken trennt: Die Griechen glaubten mit Aristoteles und Platon – und wie es die heutigen Prediger der Selbstbestimmung auch wieder tun – an die Möglichkeit zur menschlichen (Selbst-)Perfektion. Juden und Christen sind hinsichtlich Bemühungen, Perfektion zu erreichen, ob als Gesellschaft oder persönlich, traditionell skeptisch. Die Geschichte der Menschheit hat den Skeptikern bisher recht gegeben. Deshalb werden Sie in diesem Buch keinen Leitfaden finden, der Ihnen zur Perfektion verhilft, allein den Versuch, diese exakt zu bestimmen, halte ich für anmaßend. Ich hoffe aber, Sie stimmen mir darin zu, dass es sich sehr wohl lohnt, sich darüber Gedanken zu machen, in welche Richtung man denn schauen müsste, um Perfektion zu finden. Heute tun viele so, als wäre alles gleichgültig. Es gibt keine Standards mehr, alles ist beliebig. Das gefällt natürlich, da kann sich jeder alles nach Belieben schönreden, dann ist alles »irgendwie okay«. Aber das kann es ja nicht sein. Man muss sich schon die Mühe machen, sich ernsthaft auf die Suche nach dem Richtigen zu begeben. Wie könnte das Leben aussehen, wenn man es besser, schöner, anspruchsvoller führte? Wenn man sich ein wenig streckte? Wenn man seiner Bequemlichkeit nicht nachgäbe und sich stattdessen manchmal ein bisschen in den Arsch treten würde? Und zwar bei den kleinen Dingen des täglichen Lebens begänne, bei sich selbst, im eigenen unmittelbaren Umfeld! Was geschieht, wenn man erst einmal seine kleinen, täglichen destruktiven Gewohnheiten in den Griff bekommt, bevor man sich gleich etwas Riesengroßes vornimmt, an dem man garantiert scheitert? Um dahin zu kommen, muss man erst einmal einsehen, dass wir a) noch nicht perfekt sind, dass unser Charakter, unser Verhalten, unser Sein noch deutlich Luft nach oben aufweisen, und dass wir b) die glatte, makellose Perfektion wohl nie erreichen werden, was auch irgendwie beruhigend ist, denn wer kann oder will schon perfekt sein. Nur weil heutzutage vermeintlich der völlig idiotische Anspruch der Makellosigkeit erfüllt werden muss, kann auch der robespierrehafte Rigorismus immer dann sein hässliches Haupt erheben, wenn irgendwer wieder mit irgendeiner Verfehlung erwischt worden ist. Gesünder und lebensnaher wäre es, wir würden endlich einsehen, dass keiner von uns Grund zur moralischen Erhabenheit hat, dass jeder von uns über einen gewissen A-Loch-Faktor verfügt. Sigmund Freud kannte keine Schuld, sondern nur Schuldgefühle und lag damit grundlegend falsch. Es gehört zum Leben, sowohl Täter als auch Opfer zu sein. Obwohl das so ist, sagt der Wiener Psychiater und Neurowissenschaftler Raphael Bonelli, ist das Bewusstsein eigener Schuld eher die Ausnahme: »Die wenigsten Patienten kommen mit Schuldgefühlen, aber viele mit Beschuldigungen.« Dabei habe jeder, so Bonelli, ein Gefühl dafür, dass wir zu Ungerechtigkeit fähig sind, »spätestens, wenn einem selbst Unrecht angetan wird«. Wir werden schuldig allein schon dadurch, dass wir leben, wir können nicht anders. Leben heißt verzehren. »Schon vor aller willentlichen Schuld«, sagt die Philosophin Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz, »steht der Mensch auf schrägem Boden, weil Leben anderes Leben verbraucht, meist danklos. Oder, um es mit dem Vokabular der Umweltschützer zu sagen: Jeder von uns hinterlässt einen ökologischen Footprint auf der Erde, ob er will oder nicht. Das »Ihr seid schon gut so, wie ihr seid«, welches uns von der Unterhaltungsindustrie eingebläut wird, weil sie von der Angleichung der Standards nach unten lebt, ist eine Lüge. Nehmen Sie zum Beispiel ruhig einmal an, dass Sie einen genervten und lieblosen Ton an den Tag gelegt haben, als Sie sich zuletzt ein Wortgefecht mit Ihrer Partnerin oder Ihrem Partner geliefert haben. Man muss zu seiner eigenen Doofheit stehen, man muss dazu stehen, dass man immer wieder die Benchmark verfehlt, um überhaupt das Bewusstsein dafür wachzuhalten, dass es eine Benchmark gibt, um somit auch die Bereitschaft aufzubringen, sich zu bessern. Vor allem aber, um Doppelmoral zu vermeiden und nicht hämisch zu reagieren, wenn andere fallen, wie das heute zum allgemeinen Verhalten gehört. Wenn sich endlich mal herumsprechen würde, dass keiner von uns blitzblank-picobellissimo ist, wären wir per se schon bessere Menschen. Das ist auch der Grund dafür, dass es 27 und nicht 28 Tugenden geworden sind, die hier behandelt werden. 28 ist eine sogenannte perfekte Zahl (sie besteht aus der Summe ihrer Divisoren 1 + 2 + 4 + 7 + 14), und Perfektion ist unrealistisch. Und kalt. In der Grammatik ist das Perfekte das Abgeschlossene, das Vergangene. Perficere bedeutet »etwas durchmachen, zu Ende bringen«. Perfektion hat etwas Totes und Starres. Für unsere Zwecke ist 27 perfekt, weil die Zahl eben nicht perfekt ist, aber knapp darunter liegt und wir damit einräumen, dass wir die Richtung vor Augen haben, aber nicht den Anspruch erheben, das Ziel bereits erreicht zu haben.
[1] Scrovegni-Kapelle, Piazza Eremitani 8; um die Ecke gibt es ein köstliches kleines indisches Lokal, Buddha, nur falls Sie schon immer in Norditalien indisch essen wollten.
1
KLUGHEIT
Was Wissen schafft
Die gute Nachricht: Klugheit hat nichts mit Intelligenz zu tun.
Évariste Galois, zum Beispiel, war ein bedeutender Mathematiker im Paris des 19. Jahrhunderts. Wegen einer Frau, sie war Tochter eines Arztes, willigte er in ein Duell ein. Die Nacht vor dem Duell, von dem er ahnte, dass er es nicht überleben würde, verbrachte er damit, dass er ein mehr als sechzig Seiten langes, eng mit mathematischen Theorien bekritzeltes Papier verfasste. Am Morgen des 30. Mai 1832 wurde er in einem Straßengraben mit Bauchdurchschuss von einem Bauern gefunden, einen Tag später war er tot. In den nach seinem Tod gefundenen eiligen Aufzeichnungen entdeckte man die Grundlagen für die Beweise der Unlösbarkeit von gleich zwei der drei klassischen Problemen der Mathematik – der Dreiteilung des Winkels und der Verdoppelung des Würfels.
Niemand wird bestreiten, dass Galois intelligent war, wahrscheinlich gehörte er sogar zu den genialsten jungen Köpfen seiner Zeit, aber klug war er nicht. Die Arzttochter wollte damals, so viel man weiß, überhaupt nichts von ihm wissen, er wollte mit seiner Teilnahme am Duell ein Ausrufezeichen setzen, im 19. Jahrhundert waren solche Idiotien in besseren Kreisen keine Seltenheit. Vielleicht glaubte er auch, die Behörden beeindrucken zu können, mit denen er als leidenschaftlicher Republikaner immer wieder in Konflikt geraten war. Ein verschwendetes Leben. Als Galois starb, war er gerade mal zwanzig Jahre alt, wäre er klug und nicht bloß intelligent gewesen, er wäre wahrscheinlich als der größte Mathematiker des 19. Jahrhunderts in die Geschichte eingegangen. Vielleicht wäre er größer gewesen als Einstein, würden wir heute Zeitreisen unternehmen.
Klugheit ist so vorteilhaft und gewinnbringend, dass Kant in ihr gar keine Tugend erkennen konnte. Es ist klug, nicht zu rauchen, aber ist es deshalb schon ein Verdienst? Kant tappt damit in die bekannte Falle: die Annahme, dass alles, was einem Vorteil oder Lustgewinn beschert, unmöglich tugendhaft sein kann. Was moralisch ist, hat gefälligst auch ein wenig bitter zu schmecken. Dieses Missverständnis, dem nicht nur Kant, sondern viele vor und nach ihm aufgesessen sind, hat katastrophale Folgen. Statt Tugendlehren als Richtlinien für ein gelungenes und vergnügliches Leben anzusehen, verfestigt sich so das Bild eines humorlosen Maßnahmenkatalogs, der auf Verzichten, Unterlassen und ein Leben voller Neinsagen und Unfreiheit hinausläuft. Das eigentliche Paradox, dass gerade die Selbstüberwindung der Steigerung des Lebensgenusses, der Intensivierung der Lust dient, dass der Mensch eben nicht glücklich werden kann, wenn er immer nur den leichten Weg nimmt, ist darin gar nicht erfasst. Für den großen Thomas-von-Aquin-Gelehrten Josef Pieper hat Moral zunächst einmal etwas mit ethischer Mündigkeit zu tun. Klugheit als »vollendetes Können wirklichkeitsgerechter Entscheidungen« benötigt Freiheit, um irgendeinen Wert zu haben, nur wer das Richtige aus freien Stücken tut, handelt ehrenvoll. In der thomistischen Tugendlehre gilt die Klugheit im Sinne des griechischen Wortes phronesis als Erste unter den Tugenden, sie ist überhaupt die Bedingung für die anderen Tugenden.
Ende der Leseprobe