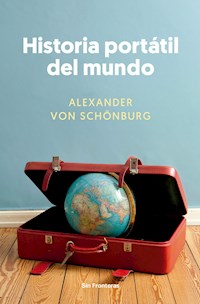19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Der Tod der Queen markiert das Ende einer Ära und zugleich eine Zeitenwende. Alexander von Schönburg, der Elizabeth II. oft begegnet ist, beleuchtet in seinem Buch ihr Vermächtnis. Er geht der Frage nach, was die Werte und Tugenden, für die Elizabeth II. stand, uns heute noch zu sagen haben. Anhand der Ereignisse und der zum Teil dramatischen Wendepunkte ihrer Regentschaft beschreibt er ihre charakterlichen Eigenschaften und zeigt, woran wir uns für kommende Herausforderungen ein Beispiel nehmen sollten und wo es für ihre Erben wichtig sein wird, ganz neu zu denken.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.piper.de
© Piper Verlag GmbH, München 2023
Covergestaltung: BÜRO JORGE SCHMIDT , München
Coverabbildung: ullstein bild - TopFoto / John Hedgecoe
Litho: Lorenz & Zeller, Inning am Ammersee
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence, München mit abavo vlow, Buchloe
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem E-Book hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen und übernimmt dafür keine Haftung.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Motto
So war die Queen wirklich
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
Die Chancen der Scheinkönige
Dank
Bildteil
Anmerkungen
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
I would earnestly warn you against trying to find out the reason for and explanation of everything. […] To try and find out the reason for everything is very dangerous and leads to nothing but disappointment and dissatisfaction, unsettling your mind and in the end making you miserable.
Queen Victoria in einem Brief an ihre Tochter Victoria (»Vickie«), die Ehefrau des deutschen 99-Tage-Kaisers Friedrich III.
Geht eure Wege! Und lasst Volk und Völker die ihren gehn!
Dunkle Wege wahrlich,
auf denen auch nicht eine Hoffnung mehr wetterleuchtet!
Mag da der Krämer herrschen,
wo alles, was noch glänzt, Krämer-Gold ist!
Es ist die Zeit der Könige nicht mehr: was sich heute Volk heißt, verdient keine Könige.
Friedrich Nietzsche (»Also sprach Zarathustra«)
L’homme est toujours mécontent de ce qu’il a,
Et il aime seulement ce qu’il n’a pas.
Joseph de Maistre (»Étude sur la souveraineté«)
So war die Queen wirklich
Als ich der Queen zum ersten Mal begegnete, war ich so aufgeregt, dass ein nervöses Huhn neben mir wie ein Zen-Meister gewirkt hätte. Sie gab ein Abendessen in Windsor Castle, bei dem ich neben ihr platziert wurde. Ich hatte bis dahin nur einmal zuvor in meinem Leben eine Mahlzeit neben einer Königin eingenommen, und das war nicht so gut gelaufen.
Damals saß Königin Sofía von Spanien neben mir, in Schloss Wolfsgarten bei Frankfurt, Gastgeber war der dort lebende Moritz von Hessen. Gerade erst war die Vorspeise serviert worden, eine Vichyssoise, da beging Sofía von Spanien den fatalen Fehler, mich zu fragen, was ich beruflich tue.
Die WTSB-Frage (»Was tun Sie beruflich?«) ist bekanntlich an Spießigkeit nicht zu überbieten. Aber auch königliche Hoheiten sind gegen Spießertum nicht vollends immun, jedenfalls sah ich mich gezwungen, Königin Sofía zu offenbaren, dass ich Reporter einer Boulevardzeitung bin.
Ich arbeitete damals für die B. Z., Deutschlands traditionsreichstes Revolverblatt. Auch der große Billy Wilder hat einst für die B. Z. geschrieben, ebenso wie Wolfgang Rademann, dem die deutsche Hochkultur Werke wie »Traumschiff« und »Schwarzwaldklinik« verdankt, und, was weniger bekannt ist, auch Christian Kracht, immerhin einer der bedeutendsten Schriftsteller unserer Zeit. Aber all dies ins Felde zu führen, hätte in dem Moment wenig gebracht, weil Königin Sofía sicher noch nie die »Schwarzwaldklinik« gesehen hat, daneben womöglich weder »Some Like It Hot« noch »Faserland« kennt, und auch deshalb, weil ihre gesamte Aura nach meiner Offenbarung derart schockgefroren wirkte, dass sich auf der vor ihr stehenden Vichyssoise eine leichte Eisschicht abzuzeichnen schien.
Hätte ich ihr gesagt, dass ich Waffenhändler bin oder mit kongolesischen Blutdiamanten handele, sie hätte konsterniert geblickt und dann seelenruhig die Tischkonversation fortgesetzt. Nachdem ich ihr aber verraten hatte, womit ich meinen Lebensunterhalt verdiene, fühlte sie sich außerstande, jene »petit conversation du table« aufrechtzuerhalten (so nennt man in diesen Kreisen die Kunst des angenehm-oberflächlichen Tischgesprächs), bei der es jede allzu große Offenheit und jeden Anflug von Tiefschürfen zu meiden gilt. Stattdessen erklärte sie mir geradeheraus, dass ihr jegliches Verständnis dafür fehle, dass jemand mit meinem Familienhintergrund Journalist geworden sei, da dies so etwas wie Seitenwechsel und somit Verrat bedeute, und wandte sich den Rest des Mittagessens von mir ab.
Die Königin von England war da anders.
Als diese bei einem späteren Zusammentreffen – auf das allererste, von dem ich eingangs zu erzählen begann, werde ich gleich noch zurückkommen – erfuhr, dass ich als Angestellter in einem Zeitungsverlag versuche, meine Familie über Wasser zu halten, reagierte sie verständnisvoll. Ich glaube, dass die Queen sich bewusst war, dass ihr Status, ihr mit Prunk und Pomp gepampertes Dasein als Staatsoberhaupt, ein Anachronismus ist. Dass die Zeit der adeligen Vorrechte, der Schlösser und Kutschen, des Hofstaats und des Brimboriums eigentlich vorbei ist. Die Queen hat immer in Palästen gelebt, sie hat nie ihr Haupt gebettet, wo nicht ein Butler in Rufnähe war, aber ich bin sicher, dass sie ahnte, dass sie das letzte und somit untypische Exemplar einer verschwindenden Spezies war. Die Adeligen unserer Tage, das wusste sie genau, leben nicht in Palästen. Vielmehr sind sie Überbleibsel einer vergangenen Welt, die sich nur noch durch gewisse Rituale, Redeweisen und kulturelle Eigentümlichkeiten so etwas wie ein Zusammengehörigkeitsgefühl zu bewahren versuchen, die mit mehrfach geflickten Schuhen durch die Welt gehen und auf jede Form des Bling-Bling verächtlich herabblicken. Die Queen wusste genau, dass für die allermeisten Angehörigen ihrer Schicht eine herausragende gesellschaftliche Stellung nur noch eine blasse Erinnerung ist, die keine materielle Grundlage mehr hat, und dass die Hauptleistung der meisten ihrer Artverwandten darin besteht, sich mit einer ihnen feindlich gesinnten Moderne zu arrangieren. Deshalb wurde mir als Angehörigem besagter Schicht, die man »verarmter Adel« nennt, bei Besuchen auf Schloss Windsor spürbar Sympathie entgegengebracht. Außer von Prinz Andrew, der immer schon bewundernd auf die Jachten-und-Privatinsel-Klasse schielte, was ihm ja auch zum Verhängnis wurde. Für Leute wie mich, die in alten, mehrfach geflickten Smokings herumlaufen und nicht über Learjets verfügen, die er sich ausleihen kann, hat er nichts übrig. Die Queen hingegen entschied sich schon bei der Wahl ihres Gatten für den Typ Abenteurer ohne Kohle, sie hegte seit jeher, was man an ihren engsten Freundinnen ablesen kann, ein Misstrauen gegen wohlhabende Angehörige der Oberklasse und Neureiche und hatte eine Schwäche für Menschen mit Stammbaum, denen das Lametta verloren gegangen war; jedenfalls reagierte sie, als sie von meinem Beruf erfuhr, mit einem zärtlichen, mitfühlsamen »This must be rather difficult«.
Deswegen wird sie auch, sollte sie im Himmel von diesem Buch erfahren, sicher Verständnis haben, zumal ich jene Leser zu enttäuschen beabsichtige, die ein plumpes Ausschlachten privater Begegnungen oder ein indiskretes Wühlen in ihrer Intimsphäre erwarten.
Die Queen war der bekannteste Mensch der Welt. Und zugleich ein höchst privater. Man glaubt, alles über sie zu wissen. Und weiß doch gar nichts.
Verbreitet ist zum Beispiel das Bild eines konservativen, überaus beherrschten, ja steifen Menschen. Helen Mirren stellt sie in Stephen Frears Film »Die Queen« so dar. Dieses Bild könnte kaum weiter entfernt von der Wahrheit sein. Sie hatte eine warme Seite, ich habe sie als überaupt nicht gefühlskalt erlebt. Die Hinsicht, in der sie wirklich dem Klischee entsprach, war ihre herrlich altmodische Aussprache. Wie noch wenige verbliebene Aristo-Dinosaurier sprach sie »girl« wirklich »gärl« aus und sagte »orf« statt »of«. In politischen Dingen war sie überhaupt nicht konservativ, handelte – zum Entsetzen des Establishments – oftmals eher wie eine Revoluzzerin. Unter ihrer Regentschaft wurde die Thronregelung zugunsten von weiblichen Königskindern geändert, unter ihrer Ägide wurde das British Empire aufgelöst und der Commonwealth-Bund reformiert; sie war es, die misstrauisch beäugt von den Konservativen bereits in den 1950-er Jahren die Aussöhnung mit dem ehemaligen Kriegsgegner Deutschland forcierte und am Ende ihrer Regentschaft, zum Entsetzen des Establishments, in Irland einen Bußgang für die kolonialistischen Exzesse ihrer Vorfahren unternahm. Sie war es auch, die den Buckingham-Palast öffentlich zugänglich machte und das Königshaus zum Steuerzahlen zwang. Und die Premierminister, mit denen sie sich am besten verstand, waren Politiker der Arbeiterpartei und keine Torys. Im Vergleich zu ihrer reaktionären Mutter (die ich auch noch das Vergnügen und die Ehre hatte, kennenlernen zu dürfen) war sie geradezu ein Punk.
Zunächst aber endlich zu dem erwähnten allerersten Zusammentreffen: Der Anlass des Abendessens in Windsor Castle, bei dem ich zu meinem Schrecken neben der Queen platziert wurde, war ein Familienereignis, zu dem ich als Neuankömmling an der äußersten Peripherie der Königsfamilie eingeladen war. Da saß ich also neben ihr und litt Höllenqualen. Worüber redet man mit der Queen? Ein ganzes Abendessen lang? Über Pferde? Davon verstehe ich nicht genug. Übers Essen? Das wäre spießig. Über Politik? Sicher nicht. Die Nervensäge Tony Blair war damals Premierminister, es wäre falsch gewesen, sie dazu zu verleiten, schlecht über ihr eigenes Personal zu reden. Allzu Offensichtliches à la »Nett ham Sie’s hier« wäre ebenso unpassend. Ich versuchte, cool und weltmännisch zu tun, und scheiterte kläglich. Zwar hatte ich mit den vor dem Dinner gereichten Dry Martinis probiert, mir Mut anzutrinken, aber es war hoffnungslos. Ich brachte kein Wort heraus. Unsicherheit vermittelt sich ja leider vor allem nonverbal. Man kann Nervosität förmlich mit Händen greifen. Sie strahlt aus. Sie hat fast etwas Toxisches. Wahrscheinlich hat das mit Quantenphysik zu tun. So wie Selbstsicherheit anziehend wirkt, so abstoßend ist Unsicherheit bei Menschen.
Außer bei der Queen. Sie war unempfänglich für diese Form von sozialer Aussätzigkeit. Sie kannte es nicht anders. Sie begegnete in ihrem Alltag – bis auf Prinz Philip, der Einzige weltweit, der sich das Recht herausnahm, sie herumzukommandieren und sogar anzuschnauzen – fast ausschließlich Menschen, die in ihrer Gegenwart nervös waren. Selbst mächtige Staatsmänner stotterten plötzlich, wenn sie vor ihr standen. Die Queen hatte sich die Fertigkeit angewöhnt, ihren jeweiligen Gegenübern die Verlegenheit zu nehmen.
Sie bemerkte meine missliche Situation und beschloss, mich aufzulockern. Dazu führte sie mir einen Trick vor. Sie öffnete eine kleine, silberne Keksdose. Das Geräusch genügte, und aus allen Ecken des Esszimmers wackelten ihre Lieblingsgeschöpfe heran – die legendären Corgis. Das Geräusch verhieß ihnen, dass die Königin ihnen gleich Leckerlis füttern würde. Dann schloss sie die Keksdose wieder. Auch dieses Geräusch kannten die Hunde und wackelten enttäuscht zurück in ihre Ecken. Das wiederholte die Königin mehrfach. Stets rafften sich die armen, kurzbeinigen Tiere auf, um dann jedes Mal aufs Neue enttäuscht abzudrehen. Das tat die Königin so oft, bis meine Nervosität einem Lachen gewichen war. Später gelang es mir dann auch, sie zum Lachen zu bringen. Wie, erzähle ich an anderer Stelle.
Eines muss ich klarstellen: Wenn ich schon so indiskret bin, im privaten Kontext erlebte Geschichten preiszugeben, was mir im weiteren Familienkreis nicht nur Applaus bescheren wird, möchte ich noch etwas eher Grundsätzliches ansprechen. Über die private Queen zu schreiben ist eines der letzten noch verbliebenen Tabus. Sie war mit Abstand die öffentlichste Person der Welt. Und doch war sie stets von einem undurchdringlichen Schleier des Geheimnisses umhüllt.
»Die ganze Institution der Monarchie«, heißt es bei Walter Bagehot, dem legendären englischen Verfassungstheoretiker, »basiert auf dem Mysterium.«[1] Wenn jeder in das Innerste des Häuptlingszelts blicken könnte, wäre das Mysterium dahin.
Soll ich an diesem Zauber rühren?
Ich werde es versuchen. Ich glaube nämlich, dass Bagehot nicht recht hat. Wenn es stimmt, dass man das Königtum – und hier im Speziellen Elizabeth II. – nicht näher untersuchen darf, weil es sonst entzaubert wird, ruht das auf der Prämisse, dass das Untersuchte sich sonst als Schwindel, als fauler Zauber herausstellen würde. Ich denke im Gegenteil, dass es wertvoll und gewinnbringend ist, die Monarchie und speziell Elizabeths Regentschaft und Persönlichkeit zu inspizieren. Sie kann uns viel lehren. Und das gilt nicht etwa für solche Leser, die ein Faible für Kronen und Zepter und Hermelin haben. Elizabeth II. war eine historische Figur von herausragender Bedeutung. Nach Ludwig XIV., der mehr als 72 Jahre den französischen Thron innehatte, hat niemand in der dokumentierten Geschichte der Menschheit länger regiert als sie. Sie hat nie eine Universität besucht, war aber die Vertraute und die Beraterin von 15 britischen Regierungschefs, sie war die Herrin über mehr als 1000 Angestellte und hatte nie formell jemandem, dem sie Rechenschaft schuldig war, ging aber noch im Alter von 96 Jahren gewissenhaft – mehr als 40 Stunden wöchentlich – ihrer Arbeit nach, nahm offizielle Termine wahr und las täglich die aus der Regierungszentrale in der Downing Street in einer roten Box übermittelten Staatspapiere. Noch am Tag vor ihrem Ableben bestand sie, obwohl sie sich überhaupt nicht wohlfühlte, darauf, an einer Zoom-Konferenz teilzunehmen, die in ihrem Terminkalender eingetragen war, und konnte nur nach dringlichem Rat ihres Leibarztes davon abgehalten werden. Einen Tag zuvor hatte sie den scheidenden Premierminister Boris Johnson zu einem fast einstündigen Gespräch gesehen und gleich anschließend die neue Premierministerin empfangen, um sie mit der Bildung einer neuen Regierung zu beauftragen.
Sogar leidenschaftliche Republikaner und eingefleischte Gegner der Royals werden einräumen müssen, dass die Queen eine Lücke hinterlässt. Das Ableben dieser großen Monarchin stellt eine Zeitenwende dar, deren volles Ausmaß wir womöglich erst mit einigem Abstand begreifen werden.
Königin Elizabeth II. steht für eine Epoche der Menschheitsgeschichte. Die Welt, wie wir sie seit der Thronbesteigung Elizabeths kannten, ist kaum noch wiederzuerkennen. Als sie gekrönt wurde, fuhren noch Dampflokomotiven, und der Liter Benzin kostete 56 Pfennig. Die Menschen sprachen vor dem Essen noch Tischgebete, es sprach noch niemand vom Klimawandel, und wenn jemand 1952 behauptet hätte, man könne sich sein Geschlecht selbst bestimmen, hätte er/sie/xyz dafür verständnisloses Kopfschütteln geerntet.
Mit dieser elisabethanischen Epoche, das lässt sich mit Sicherheit sagen, geht eine Welt zu Ende.
Bei dem erhabenen Schauspiel, das sich in London bei ihrem Begräbnis entfaltete – mehr als vier Milliarden Menschen weltweit verfolgten es live –, schwang etwas Endgültiges mit. An diesem Tag, das war mit Händen zu greifen, wurde mehr zu Grabe getragen als eine Person. In gewisser Weise wurde an diesem Tag das Ableben des gesamten 20. Jahrhunderts mitsamt seinen Gewissheiten betrauert. Es war spürbar, dass ein ganzer Kosmos von Werten und Idealen an sein natürliches Ende gekommen ist. Vorstellungen, die gestern noch bindend und allgemein verständlich waren, feierten ein letztes, großes Abschiedsfest. Die Ergriffenheit, die viele an diesem Tag spürten, hatte auch viel damit zu tun, dass zugleich das Neue, das nun kommen wird, noch unsichtbar und damit unheimlich ist. Das gab diesem Abschied in London etwas Beklemmendes.
Der Beginn der Regentschaft von Elizabeth II. fiel zwar in eine Zeit, die alles andere als sorglos war, auch Anfang der 1950er-Jahre war die Zukunft in vielerlei Hinsicht unsicher. Aber dennoch gab es wenigstens noch so etwas wie allgemein verbindliche Gewissheiten. Und es gab den Glauben daran, dass es einem morgen besser gehen würde.
Vielleicht ist das Stadium der Ahnungs- und Orientierungslosigkeit, in der wir uns als Gesellschaft derzeit kollektiv befinden, ein notwendiges Übel. Vielleicht gehört so etwas zu Epochen des Übergangs, und Desorientierung ist die Bedingung dafür, dass sich etwas völlig Neues formieren kann. René Guénon, der französische Intellektuelle, auf dessen Kritik an der westlichen Zivilisation wegen ihres Materialismus und ihres Mangels an spiritueller Orientierung sich Charles in seinem Buch »Harmony« stützt, schrieb: »Der Übergang von einem Zyklus zum anderen kann nur in der Dunkelheit stattfinden.«
Die Königin ist tot!
Es lebe der König?
Der umgekehrte Ruf, wie er am 6. Februar 1952 erklang, nachdem Elizabeths Vater, König George VI., gestorben war, muss jedenfalls deutlich feierlicher geklungen haben.
Mit dem Ruf »Der König ist tot! Es lebe die Königin!« schwang damals, so ist aus sämtlichen Berichten der Zeit herauszulesen, Aufbruchstimmung mit. Die damals 25 Jahre alte Elizabeth und der fesche blonde Marineoffizier an ihrer Seite verhießen Frische, Neuanfang, Glamour. Allein ihre Jugend diente als glaubwürdiges Versprechen dafür, dass der Staub, der sich seit Generationen zentimeterdick auf dem Königshof gesammelt hatte, nun endlich verschwinden würde. Die Times, traditionsgemäß eher zurückhaltend, überschüttete die neue Königin mit Vorschusslorbeeren und gebrauchte das Wort »Enthusiasmus«, dabei nahm sie in Kauf, dass das zu diesem Zeitpunkt – der Leichnam von Elizabeths Vater lag noch aufgebahrt, sie selbst war gerade auf dem Weg von Nairobi nach London – pietätlos wirken könnte.
Im Leitartikel des 8. Februar 1952 hieß es: »Bereits in diesen ersten Stunden ihrer Regentschaft kann sie nicht nur auf bedingungslosen Zuspruch zählen, sondern auf die enthusiastische Loyalität des gesamten Empire.«[2]
»Die Wahrheit ist, dass George VI. kein besonders populärer Monarch war«, so der Historiker Ed Owens, Autor des Buches »The Family Firm – Monarchy, Mass Media and the British Public 1932 – 1952«. Nie war es George VI. gelungen, sich vom Schatten seines flamboyanten, aber – wenn auch nicht in der Aristokratie und dem Establishment, so doch in der Arbeiterschaft und dem einfachen Volk – beliebten Bruders Edward zu befreien, des 325-Tage-Königs, der 1936 zur Abdankung gezwungen worden war. »Die Menschen waren schockiert, als der Tod von George VI. verkündet wurde, zum Teil waren sie sogar traurig, aber vor allem war dies auch ein Moment des Aufbruchs«, so Owens, »in vielerlei Hinsicht war der verfrühte Tod des Königs eine große Chance für die Monarchie. Es brachte eine junge Frau auf den Thron, die dessen Popularität zu diesem Zeitpunkt bereits weit überragte.«[3]
Ähnliches lässt sich über den Thronwechsel von Elizabeth auf Charles nicht behaupten: Von einem Geist der Zuversicht ist weder in England noch sonst wo in der westlichen Welt irgendetwas zu spüren. Unsere gesamte westliche Zivilisation ist von Selbstzweifeln gezeichnet, Charles selbst ist ein Grübler, und niemand wird ernsthaft behaupten, dass er in seinem fortgeschrittenen Alter und in der gegenwärtigen Lage für Neuanfang und Aufbruch steht.
Die Berichterstattung der Times ist ein guter Seismograf für die britischen Befindlichkeiten. Im Vorfeld seiner Krönung fehlte in fast keinem größeren Porträt des neuen Königs der Hinweis darauf, wie unvorteilhaft die Regentschaft seiner beiden Namensvorgänger verlaufen war: Die von Charles I. (1600 – 1649) endete mit dessen Enthauptung, und Charles II. (1630 – 1685) wurde aus dem Land gejagt. Und die Sonntagsausgabe der Zeitung, die den Thronwechsel 1952 noch fast schon unziemlich bejubelt hatte, beschäftigte sich beim gleichen Anlass 70 Jahre später ausführlich mit der Frage, ob es denkbar sei, als König bei Gericht vorgeladen zu werden. Es geht um die unschöne »Cash for Honours«-Affäre.[4] Charles hatte als Prince of Wales dubiosen Geschäftsleuten zu hohen britischen Ordensauszeichnungen verholfen – gegen die Zahlung von Millionenspenden an ihm nahestehende Wohltätigkeitsorganisationen. Auf Korruption im Zusammenhang mit Ordensverleihungen stehen nach einem Gesetz aus dem Jahre 1925 bis zu zwei Jahre Haft. Aber kann der Crown Prosecution Service, wie die Staatsanwaltschaft in Großbritannien heißt, also die Krone, gegen die Krone ermitteln?
Die Queen war unangreifbar, unantastbar, Charles ist das nicht. Als die Queen auf den Thron kam, war das Mysterium Königshaus noch intakt. Man begegnete den Royals mit ehrfürchtiger Scheu. Heute wirken sie wie Darsteller einer riesigen, globalen Seifenoper, als Teil der Unterhaltungsindustrie. Die Angriffe seines Sohnes Harry, das weiß keiner besser als Charles, sind viel mehr als eine banale Fehde zwischen Brüdern. Der Konflikt ist eine gefährliche Herausforderung für eine Institution wie die Krone, deren Existenz eine Provokation für die Postmoderne ist. Letztlich ist das Königtum etwas Sakrales. Im Krönungsakt kommt das sehr deutlich zum Ausdruck. Die ersten Könige waren, wie man bei James Frazer nachlesen kann, Magier – sie verzauberten die Menschen. All das und all das, wofür es steht, ist in der Postmoderne anstößig. In Meghans Freundeskreis spricht man bereits offen vom »Endgame«, das auf Englands spätfeudale Gesellschaft nun zukomme. Und ich halte das für alles andere als übertrieben.
Die Geschichte der royalen Exilanten ist mehr als nur ein Drama um zwei verwöhnte Social Justice Warriors. Die Sache ist komplexer. Und es ist eine Geschichte, die viele kennen. Die Eltern versuchen, ihren Kindern Werte weiterzugeben, und die pfeifen drauf, finden alles, wofür die ältere Generation steht, verwerflich. Im Grunde ist der Konflikt der Windsors einer, der uns spätestens seit der Französischen Revolution als Gesellschaft ingesamt beschäftigt. Die Partei aus Charles, Camilla, William und Kate steht für die Aufrechterhaltung des Status quo, für die Verteidigung des kulturellen Erbes, der Institutionen und für ein Weltbild, wonach der Mensch in Pflichten hineingeboren wird und bei seiner Geburt nicht einfach bei null beginnt. Die Partei Harry und Meghan hingegen – und mit ihnen die nachwachsenden Generationen – will mit den Institutionen der Vergangenheit aufräumen und nimmt das Erbe als Ballast wahr, den der Mensch loswerden müsse, um frei zu werden. In ihren Augen braucht der Mensch keine Institutionen, an denen er sich orientieren kann, erst recht keine, die älter sind als er.
Wie tief Harrys Aversion gegen alles Überlieferte ist, erzählt er freimütig in seinen Memoiren. Er schildert, wie ihn ein Lehrer in Eton einmal wegen seiner Unwissenheit über die Geschichte seiner Vorfahren bloßstellen wollte: »Ich kann es nicht fassen, Wales«, sagte der wütende Lehrer. »Wir reden über deine Blutsverwandten – bedeutet dir das nichts?« – »Weniger als nichts«, antwortete Harry und gab damit mehr preis, als ihm wahrscheinlich lieb war.
Die Generation Harry und Meghan steht für den Wunsch nach Tabula rasa, der nicht nur eine politische und soziale, sondern auch eine metaphysische Dimension hat, sie steht für die Abschaffung althergebrachter Ordnungen und lehnt die Prämisse ab, dass der Mensch ein Mängelwesen ist, das feste Strukturen, Tradition und Regeln braucht. Insbesondere Meghan steht für den Glauben daran, dass der Mensch sein Heil – ja das der ganzen Menschheit – aus eigener Kraft herbeiführen kann, wenn es ihm gelingt, die Fesseln der Tradition und der sozialen Grenzen zu sprengen.
So viel steht fest: Das, was mit der Queen zu Ende gegangen ist, wird sich von ihren Nachfolgern nicht ohne Weiteres fortsetzen lassen. »We’ll try to keep everything going«, sagte Charles beim ersten Treffen seiner Regentschaft mit der neuen, kurzzeitigen Regierungschefin. »Wir werden versuchen, den Laden am Laufen zu halten.« Darin klingt die Hoffnungslosigkeit seiner Aufgabe an.
Sein Buch »Harmony«, in dem Charles seine Weltanschauung und sein Programm zur Schaffung einer besseren Welt präsentiert, beginnt mit den Worten: »Dies ist ein Aufruf zur Revolution.« Er weiß also, dass wir in einer Epoche des Übergangs leben. In Zeiten revolutionärer Umwälzungen gilt der Satz des großen Aristokraten Giuseppe Tomasi di Lampedusa (1896 – 1957), der sagte: »Alles muss sich ändern, damit es bleiben kann, wie es ist.«
Alles? Der Fortgang von Königin Elizabeth II. ist jedenfalls Anlass auszusortieren. So einiges, für das die Queen stand, zerrinnt gerade. Die Queen war ein Monument für altmodische Tugenden wie Duldsamkeit, Demut, Hingabe, Loyalität, Selbstbeherrschung. Alles Dinge, mit denen sich die ihr nachfolgenden Generationen schwertun. In gewisser Weise war sie unsere letzte lebende Verbindung in das, was man »die alte Zeit« nennen könnte.
Nicht alles, was die Queen uns in ihrem langen Leben vorexerzierte, ist heute noch zeitgemäß. Aber: Wenn wir alles über den Haufen werfen, wofür sie stand, wird unsere Gesellschaft zivilisatorisch verarmen. Heute verändern sich die Dinge in so rasanter Geschwindigkeit, dass viele die Orientierung verlieren, ja, man muss hoffen, dass es noch Dinge gibt, die Bestand haben. Doch welche Dinge sind das? Und was muss aussortiert werden? Von Gottfried Benn stammt der schöne Ausdruck: »Jeder sieht hier etwas enden. Keiner sieht, was hier beginnt.«
Es ist an der Zeit, Inventur zu machen.
I.
Sich frei fühlen
Was ist Freiheit?
Man kann sich über diese Frage jahrelang den Kopf zerbrechen. Man kann kluge Bücher lesen und die wichtigsten Theorien dazu studieren. Man wird dort dann über den Unterschied zwischen »Freiheit wozu« und »Freiheit wovon« von John Stuart Mill stolpern und über die Behauptung Voltaires, dem Menschen bleibe gar nichts anderes übrig, als nach immer größerer Freiheit zu streben, bis er sämtliche Fesseln aller nur erdenklichen Moral- und Sittenvorstellungen abgeworfen habe. Irgendwann landet man vielleicht bei Fjodor Dostojewski, dem großen Psychologen unter den Romanschriftstellern des 19. Jahrhunderts, der wiederum behauptet, dass dem Menschen seine Freiheit, wenn er sie sich erobert hat, nach einiger Zeit unheimlich wird, sodass er sich von Neuem unterwerfen und Anführern hinterherlaufen wird, die ihm versprechen, für ein Leben voll »stillem, friedlichem Glück« zu sorgen.[5] Man kann das so lange machen, bis einem der Kopf raucht.
Oder man geht vor wie Prinz William.
Der macht sich keinen Kopf um die Freiheit, Grübeln ist nicht sein Ding (er kommt da nicht nach seinem Vater). Stattdessen versucht er, sich regelmäßig kleine Inseln zu schaffen, in denen er das, was er unter Freiheit versteht, lebt.
Einmal im Jahr entzieht er sich für ein paar Tage seinen Pflichten als Thronfolger und entflieht nach Ostafrika. Er fliegt in die kenianische Hauptstadt Nairobi, dann geht’s weiter mit einem Kleinflugzeug in Richtung Norden, nach kurzer Zeit landet er im Wild- und Naturschutzgebiet Lewa. Dort steigt er in einer legendären Lodge, sie heißt Sirikoi, ab. Sie gehört dem Vater seines Freundes Michael Walker und dem Naturschützer Ian Craig (mit deren Tochter Jecca er einmal kurzzeitig liiert war). Er nächtigt dort in einem Zelt, das mit edlen Teppichen ausgelegt ist. Es gibt eine kleine Bar, auf der Whiskey und Tequila, eine Flasche Wasser und ein Kübel mit Eis bereitstehen. Auf dem Schreibtisch, der von einer antiken Leselampe mit grünem Schirm bewacht wird, liegt eine ledergebundene Mappe, daneben ein Mont-Blanc-Füller und eine Ausgabe von »Birds of East Africa«. Das Schönste: Das Badezimmer ist unter freiem Himmel, und man hat direkten Blick auf den Sirikoi-Fluss. Dort treffen sich jeden Abend, ein atemberaubendes Naturschauspiel, die tagsüber in der Wildnis verstreuten Tiere, darunter Elefantenherden, zur nächtlichen Abkühlung.
Die Familie Walker steht den Royals schon lange nahe. Der Großvater von Williams Freund Michael, Eric Walker, war ein Pionier des Luxustourismus. Er war einer der Ersten, der darauf gekommen ist, dass sich ultimativer Komfort und das Erlebnis von Wildnis verbinden lassen, und baute luxuriöse Baumhäuser in die Wälder des kenianischen Aberdare-Gebirges. Sein Werk nannte Walker dann passend »Treetops Hotel«. Der Legende nach befand sich die 25 Jahre alte Elizabeth auf einer der Aussichtsplattformen des »Treetops« und filmte mit ihrer Handkamera voller Begeisterung die sich am Wasserloch streitenden Paviane und Warzenschweine, als sie am 6. Februar 1952 die Nachricht vom Tod ihres Vaters erhielt. Der Satz »Als Prinzessin kletterte sie in den Baum, als Königin kam sie wieder herunter« wurde zum festen Bestandteil royaler Folklore. Genauso wie die in der Netflix-Serie »The Crown« kolportierte Behauptung, Prinz Philip habe sie damals vor dem Angriff eines aggressiven Elefantenbullen beschützt und diesen eigenhändig in die Flucht geschlagen. In Wahrheit hatte das royale Pärchen, als die Kunde vom Ableben des Königs eintraf, ein paar Stunden zuvor aus dem »Treetops« ausgecheckt. Elizabeth und Philip befanden sich bereits in der »Sagana Lodge«, einem kleinen, aber feinen Anwesen in der Nähe von Nanyuki. Das im Colonial-Revival-Stil gebaute Holzhaus hatten sie erst wenige Jahre zuvor als Hochzeitsgabe des Koloniallands Kenia geschenkt bekommen. Als Elizabeths Privatsekretär, Martin Charteris, das Telegramm aus London erhielt, eilte dieser zu Philip, der seiner Gemahlin die Nachricht mit folgenden Worten überbrachte: »You’re now Queen, I’m afraid.« So leid es mir tut, du bist jetzt Königin.
Zurück zu William und seiner Idee von Freiheit.
Die Lodge am Sirikoi-Fluss ist nicht sein eigentliches Ziel in Kenia. Hat er vier bis fünf Tage zur Verfügung oder kann sich sogar eine ganze Woche Auszeit leisten, ruft er Fuzz an. Fuzz, eigentlich Francis Dyer, ist eine Institution in Kenia. Seine Urgroßeltern gehörten zur ersten Generation weißer Kenianer. Seine Urgroßmutter Elizabeth Cross war eine Legende, selbst eine beeindruckende Figur wie Karen Blixen steht im Vergleich zu ihr als verweichlichtes Püppchen da. Englischen Auswanderern aus gutem Hause wurden zur Kolonialzeit ganze Landesteile in Kenias Rift Valley verkauft. Elizabeth Cross, die Tochter eines dieser englischen Ex-Pats, bestritt, nachdem sie ihren Mann verloren hatte, ihren Lebensunterhalt bis ins hohe Alter damit, auf einem Ochsenkarren, begleitet nur von ein, zwei einheimischen Getreuen, zwischen Kenia und Äthiopien hin- und herzufahren und Waren wie Mais, Tee und Zucker in entlegene Gebiete zu bringen. Fuzz wuchs auf der Familienfarm in Kisima mit Blick auf den Mount Kenya auf, wurde Farmer und machte Karriere im professionellen Artenschutz. Im Wildschutzgebiet Borana betreibt er eine kleine exklusive Lodge (»Fuzz’ Camp«). Man kann sie nicht über Reiseveranstalter oder im Internet buchen. Hierher kommt man nur, wenn »man jemanden kennt, der jemanden kennt«.
Fuzz ist außerdem Pilot. Sein Ruhm auf diesem Gebiet fußt auf der einzigartigen Fähigkeit, an Orten zu landen, die zur Landung im klassischen Sinne nicht geeignet sind. An solche Orte, fernab jeder Zivilisation, entführt Fuzz seine Kundschaft. Hier ins Wild- und Naturschutzgebiet Borana, ins Herz von Kenia, brachte William im November 2010 auch Kate, um ihr den Heiratsantrag zu machen. Er mietete sich dafür eine allein stehende, auf dem Gipfel eines Berges thronende Holzhütte ohne Wasser und Strom, dafür aber mit Blick auf die unendliche Weite der Ebene von Borana – und auf den Pride Rock genannten Felsvorsprung, den jeder aus »König der Löwen« kennt: Der markante Punkt diente den Disney-Animateuren als Vorbild für den Ort, an dem der neu geborene Simba dem Löwenvolk präsentiert wurde.
Seit sie Kinder haben, begleitet Kate William nur noch selten nach Afrika. Aber sie weiß, dass er dieses Gefühl der Freiheit, das er hier auskostet, verlieren wird, wenn er eines Tages das Unglück haben sollte, Englands König zu werden. Deshalb ermuntert sie ihn, einmal im Jahr hierherzukommen – solange es noch möglich ist.
Der Thronfolger muss inzwischen immer in Begleitung von drei Sicherheitsleuten anreisen. Wenn Fuzz ihn in seiner Piper mitnimmt, bleiben zwei der drei Bodyguards zurück. Für 24 Stunden, manchmal sind es sogar 48 Stunden, weiß dann kein Mensch, wo sich der britische Thronfolger aufhält. Weder der Hof noch die Downing Street noch das Foreign Office noch die Botschaft in Kenia, nicht einmal Bimbi, Fuzz’ Ehefrau, die sonst über so ziemlich alles im Bilde ist, was in Borana geschieht. Nur »Badger« ist bei diesen Ausflügen dabei. »Badger«, sein echter Name darf aus Sicherheitsgründen nicht verraten werden, ist einer der ältesten Freunde Prinz Williams aus der Schulzeit in Eton. Er ging zum Militär, wurde Offizier und ließ sich zum Leibwächter ausbilden, um immer an Williams Seite bleiben zu können.
Wie laufen diese Blitzfluchten in die Freiheit ab?
Fuzz, Prinz William und Badger fliegen frühmorgens los, landen an einem zuvor von Fuzz ausgekundschafteten Ort – an einem Fluss oder auf einer Lichtung mitten im Busch. Dort steht dann bereits ein von Fuzz’ Angestellten errichtetes Zelt, ein paar Meter entfernt ein provisorisch unter freiem Himmel aufgebautes Waschbecken, in der Nähe ein eilig ausgehobenes Plumpsklo hinter einem Blickschutz aus Stroh. Tagsüber sind die Jungs mit der Suche nach Wilderern beschäftigt, sie folgen Spuren, erfassen die Wildtierbestände. Der Kampf für die Artenvielfalt ist Williams große Leidenschaft. Er kann stundenlang darüber dozieren, wie wir Menschen in nur wenigen Jahren all die wunderbaren Geschöpfe ausgerottet haben, die Millionen Jahre vor uns da waren. Am liebsten macht William beim »Collaring« mit – dabei werden GPS-Sender an Elefanten befestigt, und die Bewegungsdaten werden dann live an Wildschützer übermittelt. Die können dadurch bei ungewöhnlichen oder verdächtigen Bewegungen sofort reagieren.
Bis spätestens sechs Uhr abends fliegt man wieder zurück ins provisorische Lager, wo Drinks und Dinner warten. Am Äquator geht die Sonne das ganze Jahr lang, mit minimalen Abweichungen, bereits gegen halb sieben unter. Und sie geht genau zwölf Stunden später wieder auf. Gegen 22 Uhr liegt die Nummer 1 der britischen Thronfolge, die hier nur einer aus dem Team ist, auf dem Feldbett und schläft beim Knistern des Lagerfeuers ein. Geweckt wird William mit einer heißen Tasse Tee. Um zu wissen, wie spät es ist, braucht er nicht auf die Uhr zu schauen. Wenn die Berge rot leuchten, ist es 6:30 Uhr. Der Tee wird ihm von einem von Fuzz’ Helfern ans Zelt gebracht. Die haben übrigens nicht den blassesten Schimmer, wer dieser William ist. Für sie sind alle Weißen, die Fuzz hier anschleppt und für die sie gegen gute Bezahlung diese aus ihrer Sicht absurd komfortabel ausgestatteten Zelte in der Wildnis herrichten, Menschen von einem anderen Planeten mit sonderbaren Bedürfnissen. Und auch der Blick, den »Mister William«, wie sie ihn hier nennen, genießt, wenn er um halb sieben aus dem Zelt tritt, ist für sie nicht spektakulär, sondern alltäglich: die rot leuchtenden Akazien und Zypressen inmitten der unendlichen Ebene, die Gnuherden, die Giraffen, die Vogelvielfalt. Für »Mister William« ist das der Ort, an dem er am weitesten von seinem normalen Leben weg ist. Wenn er hier abends verschwitzt und glücklich mit Fuzz und Badger am Lagerfeuer sitzt, an einem von Fuzz’ Clase-Azul-Tequilas nippt, ist das für ihn: Freiheit. Dann vergisst er für kurze Momente manchmal sogar, dass sich diese Freiheitstür bald wieder schließen und eines Tages ganz verschlossen sein wird.
* * *
William hatte bisher ein freies Leben – im Vergleich zu seiner Großmutter.
Mit dem Begriff »behütet« sind die Umstände, unter denen Elizabeth aufwuchs, nur ungenügend beschrieben. Als sie am 21. April 1926 per Kaiserschnitt zur Welt kam, war sogar der Innenminister zugegen. Das war (sie war als Tochter des Herzogs von York bei ihrer Geburt die Nummer 3 der Thronfolge) damals so üblich – um sicherzugehen, dass hier alles seine Richtigkeit hatte und Neugeborene nicht ausgetauscht wurden. In den offiziellen Biografien heißt es oft, sie habe eine »gewöhnliche« und alles andere als hoheitsvoll-höfische Kindheit gehabt. Aber das trifft nicht zu. Ihr Vater, der Herzog, war zwar nur der jüngere Bruder des damaligen Thronfolgers, aber das Haus, in dem sie wohnten, war alles andere als gewöhnlich. Die Adresse lautete 145 Piccadilly, ein Stadtpalast mit 25 Schlafzimmern, einem Ballsaal und eigenem Park. Ihre Eltern sahen Elizabeth und ihre vier Jahre jüngere Schwester Margaret so gut wie nie, aufgezogen wurden sie von einer Armada von Hausangestellten, allen voran von der für ihre Strenge gefürchteten Gouvernante Clara Knight und ihrer Nanny Margaret MacDonald (genannt »Bobo«).
Unterrichtet wurde Elizabeth ausschließlich von Hauslehrern. Ab ihrem zwölften Lebensjahr wurde der Historiker Sir Henry Martin, der Direktor des Internats Eton, der elitärsten Schule des Landes, mit dieser Aufgabe betraut. Das erste Mal, dass Elizabeth Menschen außerhalb des Buckingham-Palastes begegnete, war mit 18, als sie kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs zum Freiwilligendienst beim Auxiliary Territorial Service (ATS) einrückte, wo sie (Dienstnummer SGV 230873) lernte, Militärfahrzeuge zu warten. Die anderen Teilnehmerinnen ihres Kurses, allesamt gleichaltrige junge Damen, wurden zu Stillschweigen über ihre erlauchte Mitschülerin vergattert. Viel Kontakt zu ihnen hatte sie nicht. Sie saß in der ersten Reihe, rechts und links von eigens für sie abkommandierten jungen Offizieren flankiert. Die Mahlzeiten nahm sie im Offizierscasino ein. Während die anderen Frauen in Baracken übernachteten, wurde sie nach getanem Dienst abends zurück nach Schloss Windsor chauffiert.
Wahrscheinlich war Elizabeth nur zwei Mal in ihrem Leben wirklich frei: in den intimen Stunden unmittelbar vor ihrem Tod und in den Abendstunden des 8. Mai 1945, dem Tag der deutschen Kapitulation am Ende des Zweiten Weltkriegs. Die Londoner feierten damals auf den Straßen. Die ganze Stadt war auf den Beinen. Spät abends bekamen Elizabeth und Margaret die Erlaubnis, sich zwischen Piccadilly und Marble Arch und im Hyde Park anonym unter die Menschenmassen zu mischen. Wie im Rausch müssen die beiden durch die lachenden, weinenden, küssenden und feiernden Massen gelaufen sein, sie sangen mit ihnen Lieder wie »Roll out the Barrel« und erlaubten sich angeblich sogar den Spaß, mit Tausenden Bürgern vor den Buckingham-Palast zu strömen, um dort »We want to see the King!« zu grölen.
Dieser, Elizabeths Vater, König George VI., gerade mal 50 Jahre alt, war zu diesem Zeitpunkt bereits schwer lungenkrank. Sein Kettenrauchen war in den neun Jahren seit der Abdankung seines älteren Bruders immer heftiger geworden und wurde posthum vielfach als unbewusster, schleichender Selbstmord gedeutet. Seit seiner widerwilligen Thronbesteigung 1936 hatte er unter der Last des Amtes gelitten, und auch wenn der Film »The King’s Speech« mit Colin Firth eine andere Geschichte erzählt, öffentliches Sprechen war für ihn bis zum Ende seines Lebens eine Qual.
Hätte sein älterer Bruder, der beim Volk beliebte kurzzeitige König Edward VIII. wie erwartet eine junge Dame aus der britischen Oberklasse als Braut ausgewählt, statt sich in die geschiedene Amerikanerin Wallis Simpson zu verlieben, die junge Elizabeth hätte als Tochter des nachgeborenen Herzogs von York ein unbeschwertes Leben als »minor royal« führen können, an der Peripherie des Hofes, finanziell sorglos, aber ohne mühsame Repräsentationspflichten.