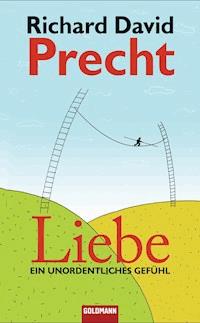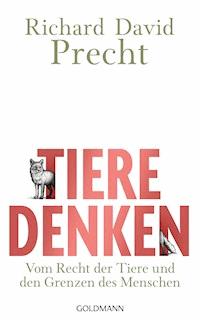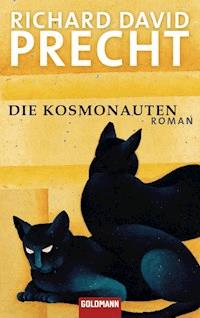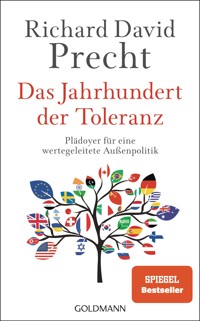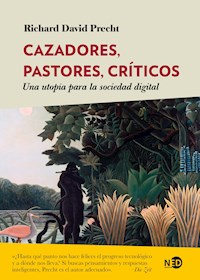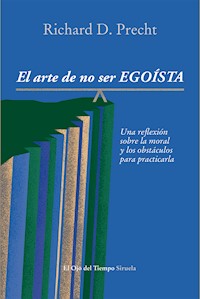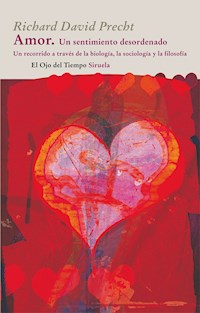Inhaltsverzeichnis
Titel
Widmung
Einleitung
Gut und Böse
Platons Talkshow - Was ist das Gute?
Rivalen der Tugend - Das Gute gegen das Gute
Copyright
Für Matthieu auf dem Weg in ein selbstbestimmtes Leben
Der Mensch ist guat, nur die Leut san a Gsindl.
Johann Nepomuk Nestroy
Einleitung
Als der österreichische Journalist und Fernsehautor Josef Kirschner im Jahr 1976 seinen sehr erfolgreichen Ratgeber mit dem Titel schrieb: »Die Kunst, ein Egoist zu sein«, ahnte er nicht, wie sehr ihn die gesellschaftliche Wirklichkeit fünfundreißig Jahre später überholt haben würde. Kirschner meinte damals, dass unsere Gesellschaft krank sei, weil sich die meisten Menschen zu sehr anpassten und dabei versäumten, ihren eigenen Weg zu gehen.1 »Schonungslos werden uns jene Schwächen vor Augen geführt, die uns an der Selbstverwirklichung hindern«, verkündete der Klappentext. Statt nach Liebe, Lob und Anerkennung zu gieren, sollten wir es lieber wagen, uns ohne allzu viel Rücksicht durchzusetzen, befreit von den Meinungen anderer Menschen. Lieber ein erfolgreicher Egoist als ein duckmäuserischer Anpasser, lautete die frohe Botschaft.
Im Deutschland des Jahres 2010 beschäftigen uns andere Sorgen. Die Idee der Selbstverwirklichung ist heute kein ferner Traum mehr, sondern eine tägliche Sorge. In dem Anspruch, anders zu sein als die anderen, sind sich alle gleich. Das Wort Egoismus aber hat seinen verbotenen Zauber verloren. Die »Schwächen«, die Kirschner ausmerzen wollte, werden heute allenthalben schmerzlich vermisst: die Rücksicht und die Scham, die Hilfsbereitschaft und die Bescheidenheit. Als »egoistisch« gebrandmarkte Banker gelten heute als die Urheber der jüngsten Finanzkrise. Wirtschaftswissenschaftler und Politiker zweifeln öffentlich an den Segnungen eines Wirtschaftssystems, das auf den Prinzipien des Egoismus und des Eigennutzes beruht. Unternehmensberater und Consultants unterrichten Manager in kooperativem Verhalten. Ungezählte Festredner beklagen hoch bezahlt den Verlust der Werte. Und kaum eine Talkshow vergeht ohne den diffusen Ruf nach einer »neuen Moral«. Die Kunst, kein Egoist zu sein, so scheint es, steht heute höher im Kurs.
An die Moral zu appellieren fällt dabei niemandem schwer. Und es hat viele Vorteile. Es kostet nichts, und es lässt einen selbst in gutem Licht erscheinen. Doch so nötig ein neuer Blick auf die Moral im Zeitalter der Weltgesellschaft tatsächlich ist - eine Moral nach dem Ende der Systemkonkurrenz von Sozialismus und Kapitalismus, eine Moral in den Zeiten des Klimawandels, des Gefahrenindustrialismus und der Ökokatastrophe, eine Moral der Informationsgesellschaft und der Multikulturalität, eine Moral der globalen Umverteilung und des gerechten Krieges -, so wenig scheinen wir bis heute zu wissen, wie Menschen tatsächlich moralisch funktionieren.
In diesem Buch soll versucht werden, dieser Frage näherzukommen. Was wissen wir heute über die moralische Natur des Menschen? Was hat Moral mit unserem Selbstverständnis zu tun? Wann handeln wir moralisch und wann nicht? Warum sind wir nicht alle gut, wo wir es doch eigentlich ganz gerne wären? Und was könnte man in unserer Gesellschaft ändern, um sie langfristig »besser« zu machen?
Was ist das überhaupt - die Moral? Es ist die Art, wie wir miteinander umgehen. Wer moralisch urteilt, teilt die Welt in zwei Bereiche: in das, was er achtet, und in das, was er ächtet. Tag für Tag, manchmal Stunde um Stunde beurteilen wir etwas nach gut und schlecht, akzeptabel und nicht akzeptabel. Und was der Inhalt des moralisch Guten sein soll, darin sind sich die allermeisten Menschen erstaunlich einig. Es sind die Werte der Ehrlichkeit und der Wahrheitsliebe, der Freundschaft, der Treue und der Loyalität, der Fürsorge und Hilfsbereitschaft, des Mitgefühls und der Barmherzigkeit, der Freundlichkeit, der Höflichkeit und des Respekts, des Muts und der Zivilcourage. All das ist irgendwie gut. Aber gleichwohl gibt es keine absolut sichere Definition des Guten. Mutig zu sein ist eine gute Eigenschaft - aber nicht in jedem Fall. Loyalität ehrt den Loyalen, aber nicht immer. Und konsequente Ehrlichkeit führt nicht ins Paradies, sondern stiftet vermutlich vielfachen Unfrieden.
Um das Gute zu verstehen, reicht es nicht aus zu wissen, was es sein soll. Vielmehr müssen wir unsere komplizierte und oft verquere Natur verstehen. Aber was ist das, »unsere Natur«? Für den schottischen Philosophen David Hume gab es zwei mögliche Betrachtungsweisen.2 Einmal kann man sie studieren wie ein Anatom. Man fragt nach ihren »geheimsten Ursprüngen und Prinzipien«. Diese Arbeit erledigen heute die Hirnforscher, die Evolutionsbiologen, die Verhaltensökonomen und Sozialpsychologen. Die zweite Perspektive ist die eines Malers, der die »Anmut und Schönheit« des menschlichen Handelns vor Augen führt. Diese Aufgabe fällt heute ins Ressort der Theologen und Moralphilosophen. Doch wie ein guter Maler die Anatomie des Menschen studiert, so muss sich der Philosoph heute auch in die Skizzen der Hirnforscher, Evolutionsbiologen, Verhaltensökonomen und Sozialpsychologen vertiefen. Denn das Studium unserer Natur sollte uns nicht nur etwas über unsere guten Absichten sagen. Sondern auch dazu, warum wir uns so selten nach ihnen richten. Und vielleicht einen Hinweis darauf geben, was man dagegen tun kann.
Was der Mensch »von Natur aus« ist, ist nicht einfach zu sagen. Jede Erklärung kleidet sich in die Gewänder der Zeit, in der der Schneider ihrer Ideen lebt. Für einen Denker des Mittelalters, wie Thomas von Aquin, war die natura humana der eingehauchte Geist Gottes. Was Gut und Böse ist, wissen wir deshalb, weil Gott uns einen inneren Gerichtshof geschenkt hat - das Gewissen. Im 18. Jahrhundert änderte der Gerichtshof seinen Urheber. Was vorher das Werk Gottes sein sollte, war für die Philosophen der Aufklärung die Leistung unserer Rationalität. Unsere klare Vernunft gäbe uns verbindlich Auskunft darüber, welche Grundsätze und Verhaltensweisen gut sind und welche schlecht. Nach Ansicht vieler Naturwissenschaftler der Gegenwart ist das »Gewissen« dagegen weder eine Sache Gottes noch eine Sache der Vernunft, sondern eine Versammlung biologisch uralter sozialer Instinkte.
Für Moral, so scheint es, sind heute zunehmend Biologen zuständig. Und es scheint erfolgreich, vielleicht allzu erfolgreich zu sein, was der Evolutionsbiologe Edward O. Wilson bereits im Jahr 1975 einforderte: dass man die Ethik vorübergehend den Philosophen aus den Händen nehmen und »biologisieren« sollte. 3 Die Deutungshoheit in der Öffentlichkeit, im Fernsehen, in Zeitungen und in Zeitschriften aller Couleur haben heute tatsächlich die Naturwissenschaftler. Selbstgewiss weisen sie darauf hin, »dass es schon vor der Kirche eine Moral gab, Handel vor dem Staat, Tausch vor Geld, Gesellschaftsverträge vor Hobbes, Wohlfahrt vor den Menschenrechten, Kultur vor Babylon, Gesellschaft vor Griechenland, Selbstinteresse vor Adam Smith und Gier vor dem Kapitalismus. All diese Aspekte sind Ausdruck der menschlichen Natur, und das seit dem tiefsten Pleistozän der Jäger und Sammler.«4
Am Ursprung unserer Moralfähigkeit aus dem Tierreich besteht kein Zweifel. Die offene Frage ist allerdings, wie zielstrebig und sinnvoll sich unsere Moral biologisch und kulturell entwickelt hat. Ganz offensichtlich hatten unsere Gehirne im Lauf der Evolution eine unglaubliche Fülle an neuen Herausforderungen zu bewältigen. Und je klüger sie wurden, umso komplizierter, so scheint es, wurde die schwierige und unübersichtliche Frage der Moral. So wie wir zur Kooperation neigen, so neigen wir zu Misstrauen und Vorurteilen. Und so wie wir uns nach Frieden und Harmonie sehnen, so überkommen uns Aggressionen und Hass.
Die gleitende Logik der Moral, nach der die Philosophen zweitausend Jahre suchten, wurde auch den Biologen bislang nicht offenbart. Allzu schnell hatten sie sich von Anfang an auf das Prinzip »Eigennutz« versteift. Nichts anderes als das Vorteilsstreben sei der vermeintliche Motor unseres Soziallebens. Und so wie der Eigennutz im Kapitalismus am Ende zum Wohl aller führen soll, so sollte auch der Eigennutz in der Natur den kooperativen Affen »Mensch« hervorbringen. Das ist leicht zu verstehen. Und bis vor einigen Jahren passte es auch gut in den Geist der Zeit. Doch das Bild, das viele Wissenschaftler noch in den 1980er und 1990er Jahren vom Menschen entwarfen, ist heute verblasst. Wo wir vor wenigen Jahren kühl kalkulierende Egoisten sein sollten, sind wir nach Ansicht zahlreicher Biologen, Psychologen und Verhaltensökonomen heute ein ziemlich nettes und kooperatives Wesen. Und unser Gehirn belohnt uns mit Freude, wenn wir Gutes tun.
Auch die Ansichten über den Einfluss der Gene auf unser Verhalten haben sich innerhalb des letzten Jahrzehnts dramatisch verändert. Doch die wichtigsten Annahmen über die Evolution der menschlichen Kultur sind nach wie vor spekulativ: ob bei der Entwicklung unseres Gehirns, dem Entstehen der Lautsprache, dem Zusammenhang zwischen unserer Sexualität und unserem Bindungsverhalten, dem Beginn der menschlichen Kooperation und Hilfsbereitschaft - nirgendwo stehen wir tatsächlich auf sicherem Boden.
Die Erforschung unserer Biologie ist eine wichtige Quelle für die Erkenntnis unserer Fähigkeit, »gut« zu sein. Aber sie ist nur eine unter anderen. Warum auch sollten Tiere wie wir, die widersprüchliche Absichten haben, weinen können und Schadenfreude empfinden, sich in ihrer Entwicklung streng an mathematische Theorien und präzise kalkulierte Modelle ihrer Natur und Moral halten? Gerade der irrationale Gebrauch, den wir von unserer Fähigkeit zur Vernunft machen, ist der Grund dafür, dass wir etwas sehr Besonderes sind: Jeder von uns fühlt, denkt und handelt verschieden.
Was in diesem Buch zum Thema Moral versammelt ist, verteilt sich in der Welt der Universitäten auf zahlreiche Fächer und Fakultäten. Von der Soziobiologie zur transzendentalphilosophischen Moralbegründung, vom englischen Empirismus zur Kognitionsforschung, von Aristoteles zur Verhaltensökonomik, von der Primatenforschung zur Ethnologie, von der Anthropologie zur Soziolinguistik und von der Hirnforschung zur Sozialpsychologie.
Die meisten Wissenschaftler dieser Fächer nehmen die Forschungen aus anderen Bereichen eher selten wahr. In dieser Praxis zerfällt die Moral des Menschen in Theorieschulen und Denkrichtungen, fachliche Domänen, Teilaspekte und Perspektiven. Einen Reiseführer für die Moral zu schreiben wird dadurch nicht leicht. Der Pfad durch das Dickicht der Fakultäten ist oft nur mühselig zu schlagen. Auch bleibt manche Sehenswürdigkeit der Wissenschaft zwangsläufig unberücksichtigt und die eine oder andere klare Quelle ungenutzt.
Der erste Teil des Buches widmet sich dem Wesen und den Grundregeln unseres moralischen Verhaltens. Ist der Mensch von Natur aus gut, böse oder gar nichts? Die Arbeit an einem realistischen Menschenbild ist noch lange nicht beendet. Ich möchte versuchen, einige wichtige alte Gedanken der Philosophie mit vielen neuen und ganz neuen Forschungsergebnissen zu verknüpfen. Wird der Mensch in der Tiefe seines Herzens getrieben von Egoismus, Gier, Machtinstinkt und Eigeninteresse, wie in Zeiten der Finanzkrise (und nicht nur in diesen) allerorten zu hören und zu lesen ist? Und sind seine Instinkte, die viel zitierten animal spirits, nur etwas Schlechtes und Verderbliches? Oder ist doch irgendetwas am Menschen edel, hilfreich und gut, wie Goethe einforderte? Und wenn ja, was? Und unter welchen Bedingungen tritt es zutage?
Von Platons Idee des Guten geht es zunächst zu den klaren Weltanschauungen. Zu den Ideen, der Mensch könnte von Natur aus gut sein oder schlecht. Aus Studien an Affen und Menschenaffen lernen wir, wie stark der Sinn für Kooperation in uns verankert ist. Aber auch, warum wir uns oft so unberechenbar benehmen. Unser Mitgefühl hat ebenso biologische Wurzeln wie unser Gefühl, unfair behandelt zu werden. Moralisch zu sein ist ein ganz normales menschliches Bedürfnis - schon deshalb, weil es sich zumeist ziemlich gut anfühlt, Gutes zu tun. Ein unmoralisches Leben hingegen, das uns selbst als solches bewusst ist, wird uns kaum dauerhaft glücklich machen. Denn der Mensch ist das einzige Lebewesen, das seine Taten vor sich selbst rechtfertigt. Und die Mittel der Rechtfertigung nennt man Gründe. Das Universum unserer Moral besteht nicht aus Genen oder Interessen, sondern aus Gründen.
So weit, so schön. Doch warum läuft so vieles schief in der Welt, wenn wir fast alle immer das Gute wollen? Unsere Suche nach Gründen, unsere Abwägungen und Rechtfertigungen machen uns nicht unbedingt zu besseren Tieren oder Menschen. Als gefährliche Mitgift rüstet sie uns zugleich mit kaum kontrollierbaren Waffen aus, die wir gegen uns selbst einsetzen wie gegen andere. Warum sonst sind wir fast immer im Recht? Warum haben wir so selten Schuld? Wie schaffen wir es, unsere guten Vorsätze zu vertagen und zu verdrängen?
Der zweite Teil des Buches beschäftigt sich mit diesen Tücken: mit dem Unterschied zwischen der Psychologie unseres Selbstanspruchs und der Psychologie unseres alltäglichen Verhaltens. Mit dem Widerspruch zwischen dem Programm und der Ausführung der Moral.
Unser Dilemma ist nicht schwer zu benennen: Auf der einen Seite tragen wir in uns das uralte Erbe unserer moralischen Instinkte. Häufig weisen sie uns beim Handeln in unserer modernen Welt den richtigen Weg; häufig aber auch nicht. Auf der anderen Seite rettet uns die Vernunft nicht unbedingt aus dieser Misere. Je länger der Weg wird zwischen unseren sozialen Instinkten und unserem Denken, unserem Denken und unserem Handeln, umso tiefer wird auch die Kluft zwischen Wollen und Tun. Erst dieser Graben ermöglicht die vielen moralischen Skrupel im Nachhinein: dass wir hadern, verzweifeln und bereuen.
Vermutlich ist dies die Antwort darauf, warum sich fast alle Menschen, die ich kenne, irgendwie für die Guten halten und es trotzdem so viel Ungerechtigkeit und Niedertracht in der Welt gibt. Weil wir es als einzige Tierart schaffen, gute Vorsätze zu hegen und sie zugleich unberücksichtigt zu lassen. Weil wir es fertigbringen, bei uns und anderen mit zweierlei Maß zu messen. Weil wir selten um eine Ausrede verlegen sind. Weil wir gerne geneigt sind, unser Selbstbild schönzufärben. Und weil wir uns frühzeitig darin üben, Verantwortung abzuwälzen.
Der dritte Teil stellt die Frage, was wir aus all dem lernen können für unser zukünftiges Zusammenleben. Wenn Bertolt Brecht - der große Soziobiologe unter den Dichtern - Recht haben sollte, dann kommt »erst das Fressen und dann die Moral«. Folgerichtig müsste es in einem Land wie Deutschland, in dem es so viel Fressen im Überfluss gibt, auch sehr viel Moral geben. Tatsächlich leben wir in einem sehr liberalen Land, der wohl freiheitlichsten und tolerantesten Kultur der Geschichte. Doch dagegen steht die nicht ganz unberechtigte Klage über den Werteverlust. Tugenden und öffentliche Moral schmelzen derzeit dramatisch dahin. Kirche, Vaterland, Heimatmilieu, Weltanschauung - die Altbauten aus der bürgerlichen Gründerzeit, in denen unsere Moral früher recht oder schlecht hauste, bröckeln und verfallen. Wer will sich darüber wundern? Ein außerirdischer Beobachter, der auch nur einen einzigen Tag lang die Werbung in Fernsehen, Radio, Zeitung und Internet studierte, würde wohl kaum ein Indiz dafür finden, dass wir in einer Demokratie leben; einer Gesellschaftsordnung, die auf Kooperation, Solidarität und Zusammenhalt beruht. Was er wahrnähme, wäre eine Propaganda, die mit finanziellem Milliardenaufwand nichts anderes betreibt als die unausgesetzte Förderung des Egoismus.
Ich möchte in diesem Buch einige Anregungen geben, was wir in Wirtschaft, Gesellschaft und Politik möglicherweise besser machen können. Es geht dabei nicht nur um gute oder schlechte Gesinnung. Es geht darum, wie sich unser Engagement für andere fördern lässt - in Zeiten, in denen unsere Gesellschaft auf dem Spiel steht wie seit vielen Jahrzehnten nicht mehr. Und um Vorschläge, wie wir die sozialen Institutionen so umbauen könnten, dass sie das Gute leichter und das Schlechte schwerer machen.
Mein besonderer Dank gilt dabei all den Menschen, die dieses Buch als Erste gelesen und mit ihrem klugen Rat kommentiert und verbessert haben. Den scharfen Blick des Biologen warf Prof. Dr. Jens Krause von der Humboldt-Universität Berlin auf das Buch. Prof. Dr. Thomas Mussweiler von der Universität Köln studierte es als Sozialpsychologe. Prof. Dr. Christoph Menke von der Universität Frankfurt am Main las es als Philosoph. Prof. Dr. Hans Werner Ingensiep von der Universität Duisburg-Essen begutachtete es als Biologe und Philosoph. Prof. Dr. Achim Peters von der Universität Lübeck beurteilte es aus der Sicht eines Neurobiologen. Prof. Dr. Jürg Helbling von der Universität Luzern inspizierte es aus der Warte eines Sozialanthropologen und Ethnologen. Ihre Anregungen und ihre Kritik waren mir sehr wertvoll. Ich danke Dr. Torsten Albig für seine Ausführungen über Kommunalpolitik, Martin Möller und Hans-Jürgen Precht für ihre kritischen und hilfreichen Anmerkungen. Mein besonderer Dank gilt Matthieu, David und Juliette für ihre wertvollen Lektüren. Und ganz besonders meiner Frau Caroline, ohne die dieses Buch niemals geworden wäre, was es ist.
Und nicht zuletzt danke ich der Deutschen Bahn. Ein Großteil der Arbeit an diesem Buch wurde in vollen Zügen genossen, in Speisewagen und an turbulenten 4er-Tischen. Viel häufiger aber noch in der melancholischen Morgenstille der Mosellandschaft auf einer völlig unrentablen Nebenstrecke unter Einkaufsnomaden, Arbeitsmigranten und Kegelklubs zwischen Köln, Cochem, Wittlich, Wasserbillig und Luxemburg. Ich danke den ungezählten Gesprächen, deren unfreiwilliger Zeuge ich war. Sie bestärkten mich immer neu in der Ansicht, dass das Wesen des Menschen von Philosophen oft nur unzulänglich erfasst wird. Und ich danke dem unbekannten Bistrokellner, der mit mir so oft den Morgen geteilt hat und dessen Maximen und Reflexionen meine Arbeit so oft begleiteten. Möge der deutsche Wähler und Steuerzahler nicht nur in meinem Interesse den Börsengang der Deutschen Bahn auch weiterhin erfolgreich verhindern.
Ville de Luxembourg, im August 2010Richard David Precht
Gut und Böse
Platons Talkshow
Was ist das Gute?
Was eine Talkshow ist, darauf kann man sich leicht verständigen. Eine Talkshow ist eine Unterhaltungssendung in Form eines Gesprächs in Hörfunk und Fernsehen. Ein Gastgeber versammelt seine Gäste an einem ausgewählten Ort, meistens einem Studio, interviewt sie und eröffnet ein von den Moderatoren gelenktes Gespräch unter den Teilnehmern.
So weit, so klar. Aber wer hat’s erfunden? Glaubt man Wikipedia, so kommt die Talkshow aus den USA, erfunden in den 1950er Jahren. Und in Deutschland geht es 1973 los mit - erinnern Sie sich? - Dietmar Schönherrs Je später der Abend. Aber der eigentliche Urheber der Talkshow ist - Platon.
Etwa 400 Jahre vor Christus beginnt der griechische Philosoph mit der Konzeption eines gelehrten Talks über die großen Fragen dieser Welt: Wie soll ich leben? Was ist das Glück? Was ist das Gute? Wozu brauchen wir die Kunst? Und warum passen Frauen und Männer nicht zusammen?
Der Produzent der Show heißt Platon - und sein Gastgeber ist Sokrates. Und er ist wirklich ein abgekochter Profi. Nonchalant hält er das Gespräch zusammen, leitet die Runde, gibt wichtige Impulse und stellt mehr oder weniger vergiftete Fragen. Fast immer legt er die anderen dabei rhetorisch aufs Kreuz. So sicher sich die anderen Gäste zu Beginn des Gesprächs mit ihren Ansichten sind, am Ende müssen sie einsehen, dass Sokrates selbst mal wieder der Klügste von ihnen ist. Mehr oder weniger überzeugt stimmen sie seiner Meinung zu. Dabei sind die zwei, drei oder vier Gesprächsteilnehmer stets hochkarätige Gäste, Politprofis, Poeten, Propheten und Pädagogen - ausgewiesene Experten der Staatskunst, der Kriegsführung, der Rhetorik oder der Künste. Als Kulisse dienen unterschiedliche Settings. Mal versammeln sich die Gäste in der Villa eines Prominenten, mal machen sie einen Spaziergang in der Umgebung Athens, mal diskutieren sie beim Abendessen. Und ein anderes Mal treffen sie sich sogar im Knast. Die Schauplätze wirken so echt und authentisch wie die Gäste. Der einzige Haken ist - alles ist abgesprochen und inszeniert. Und aus Mangel an elektronischen Ausstrahlungsmöglichkeiten begnügt sich der Produzent mit Papier.
Aber immerhin: Als erster Denker des Abendlandes entscheidet sich Platon dazu, den Widerstreit der Vorstellungen, Ansichten und Ideen nicht wegzureden, sondern ihn auszudiskutieren. Fast alles, was wir von Platons Schriften haben, sind solche Diskussionen und Streitgespräche. Doch was ist der Sinn des Ganzen? Wer war dieser Platon?
Der Junge hatte ein beneidenswertes Leben, aufgewachsen mit einem goldenen Löffel im Mund.1 Seine Familie war so reich wie einflussreich. Doch die Chancen für ein ruhiges Leben standen schlecht. Zu bewegt waren die Zeiten. Als Platon geboren wird, im Jahr 428 vor Christus, ist Perikles, Athens politischer Superstar, gerade gestorben. Eine Zeitenwende. Der lange blutige Krieg mit den Rivalen aus Sparta hat begonnen; am Ende wird er Athen vernichten.
Platon selbst aber geht es gut. Während die Soldaten Athens in Sizilien scheitern und umkommen, das spartanische Heer marodierend durchs Umland zieht, während die Demokratie in der Stadt durch eine Wirtschaftselite ausgehebelt wird, die Flotte untergeht und die attische Demokratie schließlich vollends zusammenbricht, erhält er eine vorzügliche Ausbildung. Man darf vermuten, dass er Karriere machen will, ein mustergültiges Beispiel geben für seine Familie.
In der Stadt dagegen herrscht Anarchie. Die Ordnung verfällt im Eiltempo. Ein Menschenleben ist nicht mehr viel wert. Eines Tages in dieser Zeit trifft Platon in den Straßen einen merkwürdigen Menschen, einen Herumtreiber ohne Geld und Gut, einen, wenn man so will, blitzgescheiten Obdachlosen. Die jungen Nachwuchsintellektuellen der Stadt sind fasziniert. Konsequent verzichtet der Aussteiger auf alles Hab und Gut. Ein Revoluzzer, bewaffnet allein mit seiner gefährlichen Rhetorik, der die Herrschenden auslacht. Ein Spötter, der ihre Werte veralbert, ihre Weltweisheiten entzaubert. Der Name dieses Mannes ist: Sokrates.
Hunderte von Geschichten ranken sich um Sokrates. Doch wer dieser Mensch in Wirklichkeit war, darüber wissen wir fast nichts. Wie Jesus Christus ist er vor allem eine Sagenfigur. So wie es keine Schriftzeugnisse aus der Feder von Jesus gibt, so gibt es auch keine von Sokrates. Was immer wir wissen, wissen wir aus den wenigen Schriftstücken seiner Gegner und aus den umfangreichen Elogen seiner Anhänger und Bewunderer. Wie bei Jesus, so lässt sich auch bei Sokrates vermuten, dass er tatsächlich gelebt hat. Und auf einige wenige Fans hatte er eine ausgesprochen nachhaltige Wirkung.
Der begeistertste dieser Enthusiasten aber war Platon. Hätte sich der 20-Jährige dem alten Herrn nicht angeschlossen, wer weiß, was von ihm geblieben wäre. Platon ist Sokrates’ Evangelist. Er macht ihn zum Superstar der antiken Welt, zu einem Universalgenie der Logik und der Vernunft. Sokrates weiß, was den Menschen im Innersten zusammenhält. Er ist der einzige Kenner der Weltformel.
Die Begegnung mit Sokrates hinterlässt Spuren. Binnen kurzer Zeit gibt Platon seine politischen Ambitionen auf. Er will nichts mehr werden, jedenfalls nichts, was in den Augen der Gesellschaft viel zählt. Sokrates öffnet dem jungen Mann die Augen für die Verlogenheit und Korruption in der Gesellschaft, für Lug und Trug und die Selbstsüchtigkeit der Herrschenden. Die beste Demokratie wird wertlos, wenn das gesamte politische System verrottet ist und nur noch aus egoistischen Cliquen besteht, aus Seilschaften, Privilegien und Willkür.
Im Jahr 399 vor Christus, so scheint es, haben die Regierenden in Athen die Faxen dicke. Sie zerren Sokrates vor Gericht und machen ihm den Prozess. Das Todesurteil ist schnell gefällt, der Tatbestand offensichtlich. Sokrates, so heißt es, »verderbe die Jugend« - aus Sicht der herrschenden Oligarchen ein durchaus berechtigter Vorwurf. 430 Jahre später wird die römischjüdische Obrigkeit in Jerusalem den Wanderprediger Jesus aus ähnlichen Gründen zum Tode verurteilen: wegen Nestbeschmutzung. In beiden Fällen belegt vor allem der letzte Prozess, dass diese Menschen tatsächlich existierten. Und gemeinsam sind sie, Sokrates und Jesus, die Großväter der abendländischen Kultur.
Der Tod des Sokrates hält die Entwicklung nicht auf. Er schafft nur einen Märtyrer. Und nun schlägt Platons Stunde. Er setzt das Projekt seines Lehrmeisters fort, allerdings mit ganz anderen finanziellen Mitteln. Zwölf Jahre nach Sokrates’ Tod kauft er ein Grundstück und eröffnet dort eine Schule - die Akademie. Die Einrichtung ist ohne Beispiel. Unentgeltlich haben junge Männer die Chance, für mehrere Jahre in einer Art philosophischer Kommune zu leben. Der Lehrplan umfasst die Fächer Mathematik, Astronomie, Zoologie, Botanik, Logik, Rhetorik, Politik und Ethik. Am Ende, so wünscht es sich Platon, werden hochgebildete Männer die Schule verlassen. Sie sollen die Welt besser machen. Feingeistige Intellektuelle und politische Kader sollen sie sein, von allen falschen persönlichen Antrieben befreit. Eine philosophische Heilsarmee für eine kranke Gesellschaft. Tatsächlich werden viele Absolventen in unterschiedliche Teile der Welt aufbrechen als Missionare der Akademie und Ratgeber der Mächtigen.
Die wichtigste Voraussetzung für diesen Job ist die Kenntnis des guten Lebens. Es ist die Hauptfrage, die Platon mehr interessiert als alles andere. Das ganze Denken in der Akademie ist diesem Ziel untergeordnet: das Gute zu erkennen und zu leben. Nur dafür hinterfragen die Akademiker die überkommenen Mythen und Konventionen und kritisieren falsche Wahrheiten und Lebensentwürfe. Für Platon sind Philosophen Krisenhelfer und Scouts für Sinndefizite. Der Bedarf an solchen Männern - Frauen spielen in Platons Welt keine Rolle - ist groß. Der Niedergang der öffentlichen und der privaten Moral, die kriegerischen Wirren und die allgemeine Verwahrlosung schreien geradezu nach einer Neuordnung der Verhältnisse, einer Revolution der Seelen.
Was also ist ein gutes, ein besseres Leben? An welchem moralischen Wesen soll Athen genesen? Platons frühe Schriften verraten, wie angeregt und erbittert über die Frage diskutiert und gestritten wurde.2 Die Suche ist allgegenwärtig. Die Gesellschaft steht auf der Kippe. Und auf den öffentlichen Plätzen der Stadt, den Foren und in den Privathäusern kreuzen vor allem jüngere Menschen rhetorisch ihre Klingen.
Man wird sich aus heutiger Sicht darüber vielleicht wundern. Denn die Frage ist nicht mehr sehr modern. Und »das Gute« scheint uns sehr viel abstrakter zu sein als den alten Griechen. Aber auch in Deutschland ist es noch gar nicht lange her, dass sich junge Menschen die Köpfe über diese Frage heiß redeten. Von Mitte der 1960er bis Mitte der 1970er Jahre galt das Private vielen jungen Intellektuellen als das Politische. Und auch die Ökobewegung der frühen 1980er Jahre forderte von sich und der Gesellschaft: »Du musst dein Leben ändern!« Erst der erneut starke Anstieg des Wohlstandes in den 1980er und 1990er Jahren ließ die Diskussionen um ein alternatives Leben, alternative Werte und ein alternatives Wirtschaften für längere Zeit wieder weitgehend verstummen.
Die Frage nach dem guten Leben entzündet sich in Krisenzeiten. In Platons Zeit ging es um nichts weniger als das Ganze. Wenn man sich die Situation vorstellt, in der er philosophiert, so erscheint unsere heutige Zeit auch eingedenk der Weltwirtschaftskrise dagegen ruhig und harmlos. Nie zuvor erlebte das Abendland eine solche Blüte der Kunst und einen solchen Sturm bahnbrechender Ideen wie im antiken Athen. Doch die Supermacht steht kurz vor dem totalen Kollaps.
Platons Rezept gegen den Verfall ist die Idee einer Reinigung. Die Menschen, so meint er, müssten wieder ganz neu lernen, mit sich selbst richtig umzugehen. Statt Forderungen an den Staat und die Gemeinschaft zu stellen, sollten sie bei sich selbst anfangen. Denn nur ein sehr tugendhafter Mensch sei auch ein guter Bürger.
So weit die Idee. Die Probleme eines solchen Programms aber sind groß. Auch Platon weiß, dass reale Menschen nicht in einer Idealwelt leben, und zwar weder in einer äußeren noch in einer inneren. Äußerlich bestimmen die Wechselfälle des Lebens, die Einflüsse, der Zufall und das Schicksal sehr weitgehend über mein Verhalten. Und auch innerlich segeln die allermeisten Menschen nicht in ruhigem Gewässer. Ihre Ängste und Sorgen, ihre Neigungen und Wünsche, ihre Bedürfnisse und Begehren lassen sie hin und her schaukeln.
Wie lässt sich in einer solchen Situation ein positives Selbstbewusstsein gewinnen? Wie wird man zum Regisseur eines guten, moralisch sauberen Lebens? Wie gewinne ich die nötige Selbstbeherrschung und Selbstkontrolle? Um diese Fragen zu klären, inszeniert Platon seine handgeschriebenen Talkshows. Mit seinem Talkmaster Sokrates, einem Alter Ego des Autors, lotst er den Leser durch den Parcours der Ansichten und Argumente. Für Platon ist dies ein wunderbares Spiel. Er ist Regisseur und Moderator zugleich. Und am Ende gewinnt in diesem Gedankenkasino immer das Haus, also Sokrates/Platon. Nur in dem einen oder anderen seltenen Fall wird die Entscheidung vertagt. Auf diese Weise gelingt es Platon, den Leser dort abzuholen, wo er normalerweise steht. Nach und nach thematisiert er alle denkbaren Haltungen zum Leben und spielt die Vorzüge gegen die Einwände aus. Begriffliche Unschärfen werden geklärt und Widersprüche freigelegt. Am Schluss ist die Spreu vom Weizen getrennt und Ordnung in die Vielfalt gebracht. Die Gesprächspartner des Sokrates lernen ihre falschen Vorstellungen aufzugeben. Und es wird ihnen klar, wie ein Leben aussehen könnte, das für jedermann gut und richtig ist.
Platons Talkshow ist ein Erfolgsformat, ohne jeden Zweifel. Die Forschung allerdings hat oft darüber gerätselt, für welches Publikum sie gedacht war. Denn der gebildete Leser wusste natürlich ganz genau, dass dieser Sokrates nicht der echte Sokrates war. Der war ja bekanntlich bereits tot. Was aber ist dann der Sinn dabei, dass Platon sich hinter Sokrates versteckt? Möglicherweise sind Platons frühe Dialoge tatsächlich von authentischen Gedankengängen des historischen Sokrates inspiriert. Aber eben nur die frühen. Was das Publikum anbelangt, so sollten die Talkshows ganz offensichtlich der Volksbildung dienen - aber welchen Volkes? Für den Breitengeschmack waren die Dialoge zu schwer verständlich. Wahrscheinlich las letztlich mal wieder nur ein ziemlich kleiner Kreis die Schriften. Oder er hörte ihnen, gemäß einer richtigen Talkshow, zu, wenn sie von anderen vorgelesen wurden, möglicherweise sogar mit verteilten Rollen.
Und was war die Moral der Texte? So nett und mitunter sogar humorvoll sie auch verpackt sind, so autoritär sind Platons Vorstellungen zugleich. Eisern fordert Sokrates seine Gesprächspartner auf, ihr Leben hart zu prüfen und nahezu alles umzukrempeln. Ein jeder soll so leben, als ob einem der Philosoph ständig streng über die Schulter blickte. Noch besser wäre es, sie würden selbst weise Philosophen werden. Denn genau darin sieht Platon des Menschen höchstes Ziel. Ein ziemlich merkwürdiges Ansinnen allerdings. Welcher Mensch hat dazu schon Lust und vor allem Zeit? Würde ein jeder Platons Rat befolgen, so würde vermutlich das Wirtschaftssystem dabei zusammenbrechen. Und machen wir uns nichts vor: Die Idee, dass alle Männer Philosophen werden sollen, konnte nur in einer Zeit entstehen, in der Frauen und Sklaven die meiste Arbeit erledigten.
Man mag auch daran denken, dass jede Suche nach Wahrheit immer etwas langweilig ist, wenn es einen - nämlich Platon - gibt, der diese Wahrheit schon kennt und alles besser weiß. Es ist die immer gleiche Crux mit den Erleuchteten, von Platon und Buddha bis zu Bhagwan oder dem Dalai Lama. Aber ganz offensichtlich scheint es viele Wahrheitssucher bis in die heutige Zeit nicht zu stören, dass jemand auf dem heiligen Weg mit ihnen das Spiel von Hase und Igel spielt und auf wundersame Weise immer schon vorher angekommen ist.
Von dieser Warte betrachtet hat Platons Philosophie von vornherein einen etwas »esoterischen« Einschlag. Und dieser Eindruck verstärkt sich noch dadurch, dass Sokrates’ Schüler von seinen Anhängern und Lesern tatsächlich eine klare Entscheidung verlangt: Sie sollen sich dazu verpflichten, gut zu sein, und allen anderen Verlockungen abschwören. Ein radikaler Lebensweg steht ihnen bevor, trainiert durch den eisernen Zuchtmeister Platon.
Wie aber sieht dieser Weg aus? Die alte, im Griechentum weit verbreitete Streitfrage lautet: Wie halte ich es im Leben mit den sinnlichen Genüssen? Machen sie das Leben gut? Oder stören sie das gute Leben? Auch für Platon ist diese Frage eine Kernfrage: Vernunft oder Lust - was macht auf lange Sicht glücklicher? Die Antwort darauf ist ziemlich eindeutig: Federleicht wiegen die flüchtigen Annehmlichkeiten der Lust gegen die dauerhafte Zufriedenheit durch ein gutes und rechtschaffenes Leben. Geht es nach Platon, so hält uns der Leib mit seinen starken Trieben und Bedürfnissen bei der Glückssuche eigentlich nur auf. Immer wieder führt er uns in Versuchungen und auf Irrwege. Und nur wer sich davon frei macht, ist tatsächlich frei. Ein wahrhaft glückliches Leben - Platons Wort dafür ist eudaimonia - befreit davon, das Leben auf billige Weise stets nach Lust und Unlust zu beurteilen. Denn wer das tut, der bleibt in Bezug auf seine geistige Reife ein Leben lang in der Pubertät. Der wahre Philosoph aber steht über seinen sinnlichen Bedürfnissen.
Da alle Sinnengenüsse zeitlich begrenzt sind und da jedes sinnliche Glück schnell in sein Gegenteil umschlagen kann, wählt Platon eine Lebensform mit eingebauter Risikoversicherung: Leidvermeidung statt Lustgewinnung. Die enormen Folgen für die europäische Kulturgeschichte können gar nicht hoch genug bewertet werden. Als Platons Philosophie im Mittelalter wieder belebt wird, inspiriert sein asketisches und leibfeindliches Ideal auf verheerende Weise das Christentum und wandert von hier aus schließlich auch wieder in die Philosophie. Selbst die bewusst antireligiöse Aufklärung wird sich an diesem alkoholfreien Bier betrinken: dass das Ziel des Lebens darin liegt, die primitive Sinnlichkeit so weit wie möglich zu überwinden.
Der Fairness halber muss man sagen, dass Platon an einigen Stellen seiner Dialoge ganz offensichtlich stark mit sich selbst ringt, ob er bei dieser radikalen Aussage wirklich bleiben soll.3 Doch die Quintessenz lässt sich in keinem Fall abstreiten: Das Lustprinzip ist nicht nachhaltig. Und so fällt die Lust bei Platon der Abrechnung mit ihren Risiken und Nebenwirkungen zum Opfer.
Platons Antwort auf die Kernfrage ist also: so wenig Genüsse wie unbedingt nötig! Wer die Wahrheit und das Gute liebt, lässt sich von seinen niederen Instinkten nicht verwirren. Nicht Sexualität, Geld, Essen oder sonstige Vergnügen machen dauerhaft glücklich, sondern nur die enthaltsam-philosophische Lebensführung. Alles andere ist alles andere. Und wer sein Leben nach dem Kriterium der Lust und Unlust bemisst, wählt einen falschen Maßstab.
Doch welcher ist richtig? Die Kunst, sein Leben schlau zu bemessen, ist eine ziemlich schwierige Sache. So klar Platons Kritik am falschen Bemessen ausfällt, so schwer tut er sich zugleich damit, einen besseren Maßstab zu liefern. Macht man es sich leicht, so könnte man sagen, der Maßstab wäre Wissen und Erkenntnis. Aber macht das Messen des Lebens am Maßstab der Wahrheit wirklich glücklich? Selbst wenn die Freuden der Erkenntnis manchmal groß sein mögen, dauerhaft anhaltend sind sie nicht. Wie viele miese Erkenntnisse können mir den Tag verhageln? Und ist ein raffiniert aufgelöstes Integral tatsächlich langfristig erfüllender als eine tolle Liebesnacht?
Besonders kritisch aber ist der folgende Einwand: Selbst wenn es stimmen sollte, dass nichts so sehr erfüllt wie Wissen und Erkenntnis - muss man dann nicht sagen, dass Lernen und Erkennen »lustvoll« sind? Dass also Lust und Erkenntnis schon deshalb zusammengehören, weil anders gar nicht erklärt werden könnte, wieso ein lernendes und nach Wahrheit strebendes Leben überhaupt glücklich machen soll? Ganz ohne Lust geht es also wohl doch nicht. Platon ist ein so schlauer Fuchs, dass er auch über diesen Einwand selbst nachgrübelt. Natürlich, so folgert er, braucht der Mensch zum Glück einen Lustgewinn - es fragt sich nur: von welcher Qualität?
Nach Platon ist die Lust nicht das Kriterium, sondern eher so etwas wie eine spätere Belohnung. Doch damit beginnt sogleich wieder die Frage nach dem nun wirklich gültigen Kriterium. Und um diese Frage zu beantworten, kommt Platon zu seinem Hauptthema. Das Maß aller Dinge nämlich ist - das Gute! Was Platon von seinen Schülern fordert, ist das Bekenntnis zu einer klaren Hierarchie: Alles Tun und Wollen soll so geordnet sein, dass es dem Streben nach dem Guten unterworfen ist. Nur ein guter Mensch sei ein wahrhaft glücklicher Mensch. Und so bleibt eigentlich nur noch die schwierigste aller Fragen übrig: Was ist denn eigentlich »das Gute«?
Man kann es sich natürlich einfach machen und den umgekehrten Weg einschlagen und herausfinden, was das Schlechte ist - frei nach Wilhelm Busch: »Das Gute, dieser Satz steht fest, ist stets das Böse, das man lässt.« Aber hat Wilhelm Busch Recht?
Während ich dies schreibe, erschüttert der Fall eines couragierten Mannes die Republik, der an einer Münchner S-Bahn-Station zwei Schulkindern zu Hilfe kam und dafür von Schlägern zu Tode geprügelt wurde. Wer würde diesen beherzten Einsatz, diese mutige Zivilcourage, nicht »gut« nennen? Die Hände in den Hosentaschen zu lassen und sich wegzustehlen wäre weniger gut gewesen. Unterlassene Hilfeleistung ist zwar »das Gute, das man lässt«, aber nach Buschs Kriterium wäre es nichts Schlechtes. Das Böse zu lassen reicht also nicht immer ganz aus.
Die berühmteste Passage über das Gute findet sich in Platons Hauptwerk Politeia, zu Deutsch: »Der Staat«.4 Das Gute, so heißt es hier, ist etwas ganz Besonderes, die größte und tollste Sache der Welt. Etwas schwammig formuliert lässt sie sich leicht beschreiben: Das Gute ist viel mehr als die Lust und auch mehr als das Wissen. Aber wie drückt man das präzise aus?
Die Antwort ist: gar nicht! Statt eine positive Definition des Guten zu geben, lässt Platon seinen Sokrates ein Gleichnis erzählen, das wahrscheinlich berühmteste Bild der Philosophiegeschichte: 5 Schaut euch die herrliche Sonne an! Sie spendet Licht und Wärme zugleich. Allein die Sonne ermöglicht es uns, zu sehen und zu erkennen. Und zugleich lässt sie auf der Erde alles wachsen und gedeihen. Und ist es mit dem Guten nicht genauso? Es inspiriert und erhellt unser Denken und bringt uns näher an die Wahrheit. Und je mehr wir erkennen, umso mehr nehmen wir wahr. Unser scharfer Geist verleiht den Dingen um uns herum ihre Kontur und damit ihre Existenz. So wie die Sonne, über allen Dingen stehend, alles durchwirkt, so durchwirkt das Gute - ebenfalls über den Dingen stehend - unsere menschliche Existenz. Mit anderen Worten: So wie die Sonne das Leben schenkt, so verleiht das Gute unserem Dasein Wert und Sinn.
So weit Platons »Sonnengleichnis«, ein hübsches und sehr berühmtes Bild. Aber wieso eigentlich ein Bild? Warum greift ein messerscharfer und kühler Analytiker des Geistes wie Platon an einer solchen Schlüsselstelle seines Werkes auf ein Gleichnis zurück? Nüchtern betrachtet ist der Vergleich doch im Grunde nur eine Behauptung! Dass die Sonne dem Leben auf der Erde seine Existenz ermöglicht, daran besteht heute kein Zweifel. Aber was spricht dafür, dass es tatsächlich ein Gutes gibt mit sonnengleichen Eigenschaften? Wo ist der Beweis?
Und in der Tat: Auch die Gesprächspartner des Sokrates sind not amused. Das Bild befriedigt nicht wirklich. Und der große unfehlbare Guru sieht sich gezwungen, die genauere Beleuchtung des Guten freundlich zu vertagen: »Allein, ihr Herrlichen, was das Gute selbst ist, wollen wir für jetzt doch lassen …«6 Was ist vorgefallen? War sich Platon bei der Frage nach dem Guten tatsächlich so unsicher? Oder hatte er strategische Gründe, das Gute trotz Sonnengleichnis so unbeleuchtet zu lassen? Die Platonkenner sind sich nicht einig. Auch eine Schrift über Platons späte Lehrveranstaltungen scheint das Problem nicht zu lösen. In dieser Schrift nämlich setzt Platon das Gute mit »dem Einen« gleich - also mit Gott. So betrachtet würde das Bild funktionieren: Die gleiche Kraft, die mit der Sonne die Natur durchwirkt, durchwirkt mit dem Guten unser Dasein. Genau auf diesen Zug springen die frühen christlichen Denker später auf und definieren Gott als das Wahre und das Gute zugleich: »Ich bin das Licht, die Wahrheit und das Leben!« Der Wahrheit halber aber sollte man hinzufügen, dass die »ungeschriebene Lehre« von Platons Vorlesungen in der Akademie nicht vom Meister selbst stammt. Ob Platon das Gute tatsächlich mit dem Einen gleichgesetzt hat, bleibt spekulativ.7
Ein Fazit bleibt auf jeden Fall das gleiche: Das Gute bleibt unaussprechlich. Das »größte Lehrstück«, wie Platon das Gute nennt, ist zugleich das größte Leerstück. Und so kreisen die Dialoge unentwegt um eine große Unbekannte. An einer Stelle beschreibt Platon das Gute als unverzichtbaren Nährstoff für das »Gefieder der Seele« - was für ein wunderschönes Bild!8 Aber wie alle wunderschönen Bilder auch arg schillernd. Ohne das Gute, so könnte man immerhin folgern, ist der Mensch ein gerupftes Huhn. Aber erst Platons hochbegabter Schüler Aristoteles, der bedeutendste Naturwissenschaftler seiner Zeit, wird sich die Mühe machen, das Seelen-Gefieder zoologisch näher zu bestimmen. Doch davon später.
Platons große Leistung ist es, dass er die verlogene und arrogante Moral vieler seiner Zeitgenossen entlarvte. Die »Herrenmoral« und ihr unhinterfragtes »Recht des Stärkeren« hielten seiner Prüfung nicht stand. Stattdessen zwang er die Gesprächsteilnehmer des Sokrates, sich für ihre Einstellung und ihre Taten zu rechtfertigen. Doch was hatte er selbst anzubieten? Für Platon ist das Gute eine letztlich unerklärbare Essenz, die unser Leben »von oben herab« durchwirkt; eine übergeordnete Größe, erhabener als die menschliche Existenz. Das Gute gäbe es auch dann, wenn es keine Menschen gäbe. Es ist unsichtbar, im Großen und Ganzen unbegreifich, aber ohne Zweifel objektiv vorhanden. Mit meiner persönlichen Meinung hat das Gute so wenig zu tun wie mit meiner Meinung über die Sonne oder ein ungesalzenes Radieschen. Die Aufgabe lautet: Wie kann ich mich in der Erkenntnis des Guten so schulen, dass ich ein durchweg gutes Leben führe? Denn wenn mir dies gelingt, wenn ich das Gute bei mir trage wie einen gut geeichten moralischen Kompass, dann habe ich das Zeug zum Vorbild für alle anderen, mithin zum »Philosophenherrscher«.
Nach Platon ist es das höchste Ziel, ein Mensch zu werden, der immer weiß, was er tun soll, der jede Situation moralisch richtig gewichtet und sich mit traumwandlerischer Sicherheit zwischen Alternativen entscheidet.
Tja, wenn man das nur immer könnte … Klingt das nicht viel zu schön, um wahr zu sein? Oder sollte man nicht lieber seufzen: wie langweilig! In jedem Fall heißt die Frage: Ist solch ein Leben überhaupt möglich?
• Rivalen der Tugend. Das Gute gegen das Gute
Rivalen der Tugend
Das Gute gegen das Gute
Gutmensch m., Besessener, der sein Leben verpasst, indem er immer nur das Gute denkt und tut. Weil das Gute zugleich auch das Richtige sein soll, geraten die Gutmenschen frühzeitig in eine bedrohliche Schlinger- bewegung: Das Richtige verfällt fortwährend, aber das Gute muss jedem Verfall standhalten. Beim immer bedenklicheren Spagat zwischen dem Richtigen und dem Guten erleiden viele Gutmenschen einen Beckenbruch.
Guy Rewenig
Lassen Sie uns ein kleines Spiel machen: Stellen Sie sich einmal vor, Sie besäßen ein unermessliches Vermögen. Sagen wir zum Beispiel zehn Milliarden Euro. Eine unvorstellbar große Summe (wenn man sie nicht gerade zur Rettung einer Bank ausgibt). Dieses viele Geld braucht kein Mensch, und auch Ihre materiellen Bedürfnisse sind vollends befriedigt. Sie können das Geld also ausgeben, und zwar für einen guten Zweck. Und jetzt sind Sie an der Reihe.
Was kommt Ihnen als Erstes in den Sinn? Vielleicht denken Sie an die Millionen hungernden Kinder in der Sahelzone, in Äthiopien oder in Indien. Oder der Regenwald in Brasilien und in Indonesien fällt Ihnen ein, von dem jeden Tag mehrere Quadratkilometer in Flammen aufgehen. Sie denken an die vielen zum Teil noch unbekannten Tierarten, die ausgerottet werden, oder an die enorme Bedeutung des Regenwaldes für das Klima. Auch die Meere bedürfen dringend unseres Schutzes. Und wegen des Klimas kann man das Geld natürlich auch den Chinesen schenken, damit sie ihre Kraftwerke mit moderner Filtertechnik ausstatten. Eine andere Idee wäre, Ihr Geld für Wirtschaftshilfe auszugeben, um aktuelle oder drohende Bürgerkriege zu vermeiden, etwa in Ruanda oder in Somalia.
Alle diese Ideen sind ohne Zweifel richtig. Es gibt so viel Gutes zu tun. Und zehn Milliarden Euro können dabei ohne Frage helfen. Also, wofür entscheiden Sie sich? Je länger Sie darüber nachdenken, umso klarer dürfte Ihnen werden, dass eine solche Entscheidung nicht leicht ist. Der Bereich des Guten ist schwer abzuschätzen und zu vermessen. Und ein moralischer Zollstock ist niemandem zur Hand.
Man könnte dem Spiel zudem auch noch eine ganz pessimistische Note geben, nämlich indem man die möglichen Folgen Ihrer Investition durchdenkt. Stellen Sie sich zum Beispiel vor, Sie geben Ihr Geld einigen brasilianischen Indianern, damit diese nicht länger brandroden und keine seltenen Tiere jagen oder verkaufen. Was passiert? Vielleicht ziehen sich die Indianer untereinander in kürzester Zeit über den Tisch. Am Ende gibt es ein paar Superreiche. Und der Rest fackelt wieder den Regenwald ab. Die Superreichen bauen sich Haziendas und vernichten ebenfalls den Wald. Vielleicht haben Sie aber auch Glück, und das mit den Indianern klappt ganz vorbildlich. Aber wie lange? Immerhin gibt es ja auch Nachbarn, die Sie nicht begünstigen konnten. Eifersucht und Neid breiten sich aus. Unruhen kommen auf, am Ende vielleicht sogar ein Bürgerkrieg. In Ruanda oder in Somalia wird es Ihnen mit den Folgen Ihres Geldes mit Sicherheit noch schlechter gehen. Also alles nach China? Nun, die Chinesen montieren mit Ihrem Geld die modernste Filtertechnik ein. Und dann? Als aufstrebende Industrienation bauen sie noch mehr Kraftwerke, die Sie nicht alle ausrüsten können. Und in Deutschland meckern die Stromkonzerne, wenn über die neuen, überall geplanten kontinentübergreifenden Stromnetze billiger Strom aus China auf unseren Markt fließt …
Man muss dieses Szenario nicht in allen Einzelheiten durchdenken. Und man muss auch nicht zwingend zu dem bösen Schluss kommen, dass jede gute Großtat am Ende doch nur ins Chaos führt. Aber zumindest eine Frage bleibt: Wenn es so viele unterschiedliche gute Ziele gibt und damit so verschiedene Wege, Gutes zu tun, wo liegt dann die Instanz, die mir sagt, was gut und was besser ist? Auch Platon wusste, dass dies ein empfindlicher Punkt in seiner Theorie des Guten ist. Und er hat es sich mit dieser Frage auch nicht ganz einfach gemacht. Im Hippias Maior, einer seiner späten Schriften, diskutiert auch er, dass das Gute gemeinhin eine ziemlich relative Sache ist.1 Was für mich gut und erstrebenswert ist, muss nicht für jeden anderen gut und erstrebenswert sein. Der Held Achilles zum Beispiel, ein geborener Abenteurer und Kämpfer, wäre ohne Zweifel ein denkbar ungeeigneter Familienvater. Für ihn ist gut, ein Krieger zu sein, und ein Familienvater zu sein, schlecht. Obwohl ein guter Familienvater zu sein grundsätzlich nichts Schlechteres ist als ein Krieger.
Platon sieht also einen Widerspruch. Nämlich den zwischen einer persönlichen Neigung und dem, was allgemein gut ist. Wer etwas Gutes will, der tut dies, weil er ein erfülltes Leben führen will. Erfüllung aber kann ich sowohl in dem finden, was meinen Neigungen vorteilhaft (agathon) zu sein scheint, als auch in dem, was allgemein und grundsätzlich sittlich gut ist (kalon).
Dieser Spagat bleibt Platons ungelöste Aufgabe. Wie passen das Gute und mein Gutes zusammen? Aber gibt es tatsächlich nur diesen einen Konflikt? Am Beispiel unserer Zehn-Milliarden-Euro-Spende haben wir gesehen, dass die Sache selbst dann völlig unübersichtlich werden kann, wenn ich ausschließlich das Gute und gar nicht mein Gutes im Auge habe. Wer hilft mir, das Gute vom etwas weniger Guten und vom Besseren zu unterscheiden? Und brauche ich diese Unterscheidungsmöglichkeit nicht ganz zwingend, wenn ich ein optimales Leben führen will?
Diese Frage hat auch mich in meinem Leben stark beschäftigt. Als Abiturient schloss ich mich im Jahr 1984 der Solinger Arbeitsgruppe von amnesty international an, um Gutes zu tun. Das
Originalausgabe
1. Auflage
Copyright © 2010 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
eISBN 978-3-641-04935-5
www.goldmann-verlag.de
Leseprobe
www.randomhouse.de