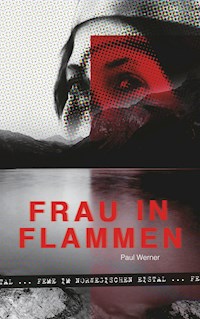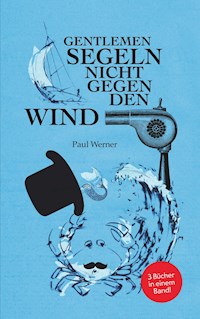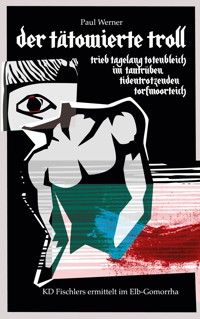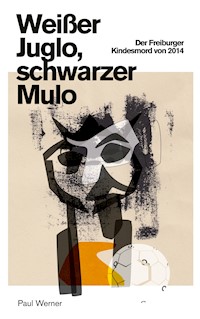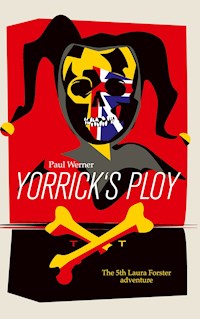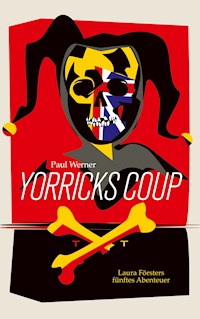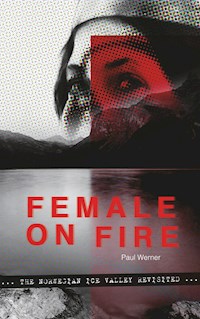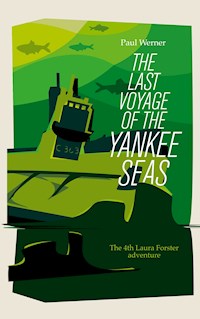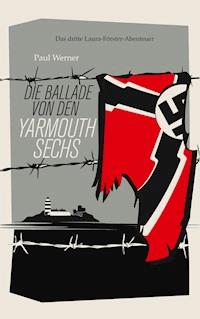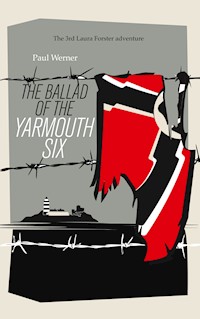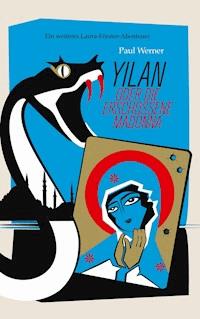Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Tatort Ostsee. Ein banaler Unfall stößt Laura Förster mit der Nase auf einen Mord, dessen Spuren in jene achtziger Jahre reichen, da der Kalte Krieg mit einem Male siedend heiß zu werden drohte: vom NATO-Doppelbeschluss, SS 20, Pershing Marschflugkörper, Strategic Defence Initiative bzw. "Star Wars" bis zum Mauerfall und Implosion der UdSSR. Im neutralen, politisch jedoch sehr bewegten Schweden jenseits von ABBA und Pippi L. hieß dies vor allem "Whiskey on the Rocks" alias S 363, in dessen düsterem Schatten Laura und Solitaire wie Raubvögel ins Nest der Grauen Albatrosse einfallen, einer Liga des internationalen Verbrechens, an deren Spitze der mysteriöse U-Boot-Kommandant Schramm steht. Wie immer garantiert der Name Laura so spannende wie humorvolle Unterhaltung, diesmal gepaart mit einer Hommage an das einzigartige Biotop der ostschwedischen Schären, schrullige U-Bootfahrer und verblichene Kap Hoorn-Bezwinger ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 425
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Obwohl auf tatsächlichen Begebenheiten beruhend, ist die Handlung des Romans frei erfunden. Etwaige Ähnlichkeiten namentlicher oder anderer Art mit nicht zur Zeitgeschichte gehörenden lebenden oder bereits verstorbenen Personen wären insofern rein zufälliger Natur.
Inhaltsverzeichnis
Erstes Kapitel
Der Kormoran
Der Schleicher
Dai Paparazzi
Zweites Kapitel
Die Frau im Regen
Thelma und Louise
Hellemania
Drittes Kapitel
Das Boot
Timo, der Troglodyt
Die Falle
Viertes Kapitel
In der Anakonda
Der Schwarze Taucher
Die Königin der Tiefe
Fünftes Kapitel
Bei den Morlocks
Das Narbengesicht
Die Kniende Jungfrau
Sechstes Kapitel
Schräge Vögel
Die Orgelpfeifen
Die Odyssee
Siebtes Kapitel
Torpedo los!
Der Familienrat
High Rollers
Achtes Kapitel
Die versetzte Braut
Villa Kunterbunt
Der Hinterhalt
Neuntes Kapitel
Neues aus Hadleyville
Jennifer Juniper
Das Wrack
Zehntes Kapitel
Unter den Linden
Die acht Schwestern
Nord nach Nordwest
Elftes Kapitel
Das Kuckucksei
Morgenrot, Drachentod
Die lange Seite
Zwölftes Kapitel
Mayday! Mayday! Mayday!
Anruf genügt, die Erste
Eons neun Leben
ERSTES KAPITEL
1. Der Kormoran
Der Mann im offenen hölzernen Fischerboot lässt für einen Moment vom Flicken der zerrissenen Maschen seines mit grünbraunem Seetang gespickten blauen Netzes ab und hebt den Kopf wie ein Vorsteherhund, dessen gespitzte Ohren das ferne Flügelschlagen von Gänsen vernimmt und nun, gestützt auf die Erfahrung vieler Jahre der Jagd an der Seite seines Herrchens, Richtung und Abstand der Beute bestimmt. Die seit wenigen Stunden wie undurchdringliche grauweiße Wattebäusche über die grauen, feucht glänzenden Schären wabernden Nebelschwaden werden zusehends dünner und scheinen gewillt, den Hiesigen ihre einzigartige Szenerie im Niemandsland zwischen Land und Meer alsbald zurückzugeben.
Der graubärtige Fischer legt Nadel und Garn in dam dafür vorgesehenen Kästchen ab und wirft das Netzende, mit dessen Ausbesserung er sich bis jetzt die Wartezeit verkürzt hat, in den Bug des ruhig an einem Warpanker dümpelnden Klinkerbootes. Dann nimmt er einen Schluck dampfend heißen Tee aus der mitgeführten Thermosflasche, schlägt den Kragen seiner abgewetzten Ölzeugjacke hoch und zieht die bislang in den Nacken geschobene speckige Mütze tiefer in die Stirn. So wird deren Schirm den größten Teil seines Gesichtes beschatten, sobald die zaghaften Strahlen der matt silbern scheinenden herbstlichen Morgensonne es endlich geschafft haben, Wolken und Nebel zu durchdringen.
Der Graubart hat eine unruhige Nacht hinter sich. Bei weitem nicht die erste, ganz und gar nicht. In den Schären um Karlskrona führt die schwedische Marine häufig Schießübungen durch und veranstaltet tags wie nachts obskure Manöver. Die beliebten Neuentwicklungen der hier angesiedelten Bofors-Kanonenschmiede wollen schließlich unter allen nur erdenklichen Bedingungen ausgiebig getestet werden, bevor sie in den Verkauf gehen. So rollen immer mal wieder ballistische Druckwellen rasend schnell wie virtuelle Tsunamis über die Inseln und durch die Buchten und blasen dem Fischer in seinem Holzhaus am südöstlichen Zipfel von Sturkö die Kerzen aus, die er vor allem im Herbst und Winter elektrischem Licht vorzieht. Weniger aus romantischen Anwandlungen, als vielmehr, um seine Stromrechnungen möglichst niedrig zu halten.
Letzte Nacht aber war es besonders schlimm. Gegen zehn Uhr abends, kurz vor den Spätnachrichten des schwedischen Rundfunks, rumste und knirschte es plötzlich gewaltig ein Stückchen weiter östlich. Dann trat zunächst wieder Stille ein, bis die Dieselmotoren eines Schiffes wie eine ganze Herde panisch aufheulender Elche zu röhren begannen. Immer wieder, in stets neuen sinnlosen Schüben, bis in den frühen Morgen hinein. Bei aller an Schweden sonst gerühmten Langmut - das würde einen geharnischten Beschwerdebrief an die Marineleitung nach sich ziehen.
Was der Graubart den ringsum von Klippen und Schären geschützten Fanggründen mit viel Ausdauer, ausgezeichneter Ortskenntnis und langer Erfahrung im Umgang mit Reusen und Netze an Beute abringt, dürfte ihn finanziell gerade so über Wasser halten. Flundern, Sprotten, Krabben und Garnelen, der eine oder andere Dorsch, das war's dann schon.
Bisweilen gesellt sich unfreiwillig auch einer jener Ostseeheringe hinzu, die sie hier strömmingar nennen. Der hat längst nicht die Qualität seines atlantischen Vetters, ist von weniger festem Muskelfleisch als dieser und wird nach Norden hin, am Ende des Bottnischen Meerbusens, durch die zunehmende Verkümmerung des Rückgrats dem gemeinen Aal immer ähnlicher. Ohne über die die kulinarischen Gewohnheiten der Schweden die Nase zu rümpfen, merkt man vielen ihrer Gerichte doch an, dass sich die einst bettelarmen Nachlassverwalter der rastlosen Wikinger über die Jahrhunderte daran gewöhnt haben, aus der nagenden Not eine zweifelhafte Tugend zu machen. So und wohl nur so ist zu verstehen, wie es dazu kommen konnte, dass besagter strömming nach den unfassbar landestypisch faden, köttbullar genannten Hackfleischklopsen zum zweitbeliebtesten und für Nicht-Schweden noch viel gewöhnungsbedürftigeren Nationalgericht namens sur strömming werden konnte.
Diese Transformation wird nicht etwa durch wochenlanges Einweichen in einer mit vielen geheimen, nur in Vollmondnächten gesammelten Kräutern angereicherten Weinessig-Marinade gewonnen. Weshalb der sur strömming auch nicht mit seinem deutschen Namensvetter, geschweige denn dem Rollmops oder Bismarckhering verwechselt werden sollte. Nein, im Grunde ist der naturbelassene sur strömming das Ergebnis eines schlichten Gärungs- und Verwesungsprozesses. In Dosen gepresst und im Erdreich verscharrt, bleibt der tote Fisch Wochen und Monate sich selbst überlassen, was dem nationalen Phlegma sehr entgegenkommt. Statt ihn dort auch seine ewige Ruhe finden zu lassen, exhumiert man den inzwischen gottserbärmlich stinkenden Fisch, der inzwischen so weit vergoren ist, dass man ihn eigentlich auch trinken könnte, was aber whol am staatlichen Alkoholmonopol rütteln würde.
Zu festlichen Anlässen wird er stattdessen gern auf dem unvermeidlichen Knäckebrot mit einem solchen Haufen Zwiebeln serviert, dass sowohl Geruch als auch Geschmack der Fischleiche weitgehend übertönt werden. Der bloße Umstand, dass die sich wie Mehltau ausbreitenden Ikea-Filialen, die es sich ja zur Aufgabe gemacht haben, Menschen in aller Welt nicht nur an schwedisches Modul-Mobiliar, sondern auch an die schwedische Küche heranzuführen, trotz ihres missionarischen Eifers bislang auf das Feilhalten dieser besonderen Fischspezialität bislang verzichtet haben, sollte zu denken geben.
Es gab Zeiten, da der Graubart sich vom Fieber seiner fischenden Landsleute anstecken ließ und dem elektrisierenden Ruf „er bläst" an die Westküste um Göteborg folgte wie einst Ishmael den von Kopf bis Fuß tätowierten Harpuniers von Nantucket. Nur, dass es hier nicht um Wale, sondern um eine sehr viel bescheidenere, wiewohl vergleichbar unberechenbare Beute ging. Die Schwärme des ungleich attraktiveren, von den Schweden sill genannten Atlantikherings pflegten sich in erratischen Zyklen langer Abwesenheit und kurzer Besuchszeit an der Westküste die Ehre zu geben und dann jedes Mal aufs Neue einen veritablen Goldrausch auszulösen, der umso heftiger ausfiel, als man nie wusste, wie lange der sill diesmal bleiben würde. Bevor man sich's versah, war er nämlich wie auf ein geheimes Kommando wieder von der Bildfläche verschwunden. Ein seltsames Verhalten, wie von der Natur so eingerichtet, als wolle sie sicherstellen, dass alle atlantischen Küstenbewohner umschichtig an diesem Teil ihrer Schätze teilhaben konnten.
Welche Ausmaße dieser Run auf die karge, bettelarme schwedische Westküste mit ihren von Wind und Wellen blank geputzten und von jeglicher Vegetation gemiedenen Schären annahm, lässt sich noch heute an der Vielzahl von bunt bemalten, in solchen „Klondyke"-Jahren wie Pilze aus dem Boden geschossenen Holzhäuschen ermessen, die sich dicht an dicht auf den winzigen Granitfelsen fröstelnd aneinander drängen. Aus den eilends wie Ikea-Regale zusammengehauenen Unterkünften für die aus allen Landesteilen herbeigeeilten Heringsfischer sind natürlich längst allesamt mehr oder minder trendige Sommerresidenzen des Göteborger Gutbürgertums geworden.
Mit Geschick und Glück konnte ein Mann damals im Laufe einer Saison genug verdienen, um sich und die Seinen für längere Zeit zu versorgen. Jedenfalls, solange er in der Folge nicht gewieften Anlageberatern in die Hände fiel, die ihm unter Vorspiegelung exorbitanter Renditen das sauer verdiente Geld wieder aus der Tasche zogen.
Bei der bloßen Erinnerung daran spuckt der Fischer von der Storcheninsel ins Wasser. Wie gewonnen, so zerronnen, heißt es. Da war wohl was dran, wenngleich – so leicht, wie er zerrann, war der flüchtige Reichtum ja auch wieder nicht gewonnen worden.
Statt irgendwo in der Karibik am feinkörnigen, fast weißen Strand zu liegen und einen Caipirinha mit Schirmchen zu schlürfen, während eine skandalös junge Einheimische ihm den Rücken massiert, muss der Graubart im regnerischen, nebligen schwedischen Herbst weiterhin Tag für Tag seine spröden, löchrigen Reusen auslegen und seine von Tang und Seegras verfilzten Netze auswerfen.
Dafür hat er hier so gut wie keine Konkurrenz zu fürchten. Der Schärengarten um die zweitgrößte ostschwedische Hafenstadt Karlskrona ist angeblich streng bewachtes militärisches Sperrgebiet. Dass der als eigenbrötlerisch geltende Graubart von Sturkö sich darin ziemlich frei bewegen und nach Lust und Laune fischen darf, verdankt er seinen guten Beziehungen zur obersten Marineleitung in Stockholm, der ein Cousin bis zu dessen Unfalltod vor wenigen Jahren in gehobener Funktion angehörte. Für Außenstehende ohne Vitamin B bestand immer schon wenig Hoffnung, hier als Fischer zum Zuge zu kommen. Außerdem ist der Schärengarten so unübersichtlich und tückisch, dass es langer Jahre eines erfüllten Arbeitslebens und vieler kleinerer und größerer Havarien bedarf, sich mit allen topographischen Besonderheiten vertrau zu machen.
Schließlich gibt es hier wie fast überall in den ostschwedischen Schären neben natürlichen Hindernissen auch allerlei von Menschenhand geschaffene Fallstricke und unsichtbare, dicht unter der Oberfläche lauernde Hindernisse zu gewärtigen, die irgendwann eingebaut wurden, um Invasionsflotten die Durchfahrt zu erschweren. Wenn die unmittelbare Gefahr gebannt war oder sich als von vornherein unbegründet erwiesen hatte, wurden solche Hindernisse keineswegs immer eilends beseitigt, denn irgendwann in näherer Zukunft konnten sie ja wieder nützlich sein. So blieben sie oftmals einfach bestehen und gerieten allmählich in Vergessenheit, bis sie in jüngerer Zeit irgendwann wieder unangenehm auf sich aufmerksam machten.
Warum dieser Teil des Schärengartens eigentlich zum Sperrgebiet erklärt wurde, hat der Graubart sowieso nie ganz nachvollziehen können. Auf den ersten Blick gibt es hier nichts, was auch das Auge des Laien sofort als topographische Nische von strategischem Wert erkennen würde. Immer mal wieder wird gemunkelt, dass die Bucht, zu der sich dieses Gåsefjærd genannte und dementsprechend vielfach gewundene Fahrwasser letztlich erweitert, von schwedischen Kriegsschiffen im Ernstfall als geheimer Ankerplatz benutzt werden soll. Der Graubart lächelt. Kriegsschiffe nicht auf dem Kriegs-, sondern auf dem Gänsepfad, wie klingt das denn.
Zivile Seekarten, so heißt es, verzeichnen die Schleichwege, ohne deren Kenntnis ein Seemann dieses geheime schwedische Scapa Flow allenfalls mit sehr viel Glück finden würde, nicht, militärische angeblich schon. Dem Fischer kann's egal sein. Er braucht hier keine Seekarten und Kriegsschiffe im Gänsemarsch hat er auch noch nie angetroffen.
Der Graubart geht nach achtern und wirft seinen Außenborder an. Dessen Qualmen, Stottern und Husten scheucht zwei mit ihren Köpfen im Gefieder dösende Schwäne auf, die schwerfällig wie Pelikane hektisch flügelschlagend über die Wasseroberfläche laufen, als fürchteten sie, sonst den morgendlichen Bus nach Karlskrona zu verpassen. Erst nach zehn, zwanzig Metern haben sie schließlich genug Fahrt aufgenommen, um mit weit ausgebreiteten, in der Luft wie sausende Sensen singenden Schwingen aufzusteigen und mit rhythmischem Pumpen aufgeregt schnatternd davonzufliegen. Der Nebel hat sich in Wohlgefallen aufgelöst und einem Wechselspiel von Sprühregen, grauer, niedriger Bewölkung und kurzen Perioden bleiernen Sonnenscheins Platz gemacht.
Geschickt von seinem Skipper gesteuert, gleitet das Boot zwischen den meerumspülten Klippen hindurch, die sich, vor Millionen Jahren vom unvorstellbaren Druck des Gletschereises befreit, seit dem Ende der letzten Eiszeit unaufhaltsam Millimeter um Millimeter aus dem Wasser heben. Da und dort ziert tiefgrünes Moos die Felsen. Schüchterner Strauch- und Baumbewuchs gibt die Vorhut für die verstohlene Rückeroberung der Klippen durch die heimische terrestrische Flora. Die hat nicht nur mit der See, sondern auch mit Saboteuren zu ringen. Gerade passiert das Boot eine Schäre, deren Vegetation von grau-weißlichen Kormoranexkrementen verätzt und auf ihr jämmerliches Skelett reduziert wurde. Nun steht nur noch ein einzelner verdorrter Stamm mit nackter, knorriger Krone wie eine aufgelassene botanische Burgruine aus der graugrünen Pracht. Ein einzelnes Exemplar der aus Asien importierten und rapide vermehrenden, aber aus unerfindlichen Gründen dennoch unter Naturschutz stehenden gefiederten Todfeinde sowohl der Fischer, als auch jedweder Form von Vegetation hat den Startschuss der allgemeinen Umzugsbewegung des Schwarms offenbar nicht gehört. Noch im Halbschlaf oder von einem Anflug von Nostalgie gelähmt ist der Vogel auf einem der abgestorbenen Zweige sitzengeblieben. Als er sich nun plötzlich doch noch in die Luft erhebt, folgt der aufrecht im Boot stehende Fischer ihm mit seinem ausgetreckten rechten Arm wie mit einem Gewehr. Peng! Just in dem Moment, da er, noch in der Drehung, den imaginären Abzug betätigt, lässt sich der Kormoran erneut nieder. Diesmal jedoch nicht auf einem Zweig, sondern auf einem Objekt, das hier mindestens ebenso fehl am Platz ist, wie der Vogel selbst.
Der Graubart erschrickt und drosselt reflexhaft die Geschwindigkeit seines Boots bis fast auf null, gibt automatisch nur so viel Gas wie erforderlich, um den Außenborder am Leben und das Boot leidlich auf Kurs zu halten. Dann zieht er langsam eine weite Linkskurve, die ihn zur Kormoran-Burgruine zurückführt. Nein, er ist keinem jener Trugbilder erlegen, die sich in diesen Breiten bei bestimmten Wetterlagen einstellen können wie eine Fata Morgana in der Wüste. Das Objekt ist offenbar von dieser Welt und befindet sich immer noch an dem Ort, wo es nichts zu suchen hat, noch in seiner scheinbaren Ohnmacht irgendwie bedrohlich. In seiner massiven Unbeweglichkeit gleicht es einem schwärzlich-olivgrünen Orca, der auf der Jagd nach jungen Seelöwen von der Brandung zu weit auf den Strand hat treiben lassen und nun nicht mehr ins tiefere Wasser zurückfindet. Stundenlang muss sich die Bestie bereits zuckend und bockend vergeblich abgemüht haben, aus eigener Kraft wieder freizukommen, bis sie resignierend einsehen musste, dass dies ohne fremde Hilfe nicht mehr zu schaffen ist.
Einem Tier hätte man einen solch fatalen Fauxpas natürlich nachgesehen. Dies aber ist kein Orca, sondern ein U-Boot, offenbar wie zur Strafe auf die Klippen des Gåsefjærd gelaufen, in dem es nichts zu suchen hat. Die geringe Tiefe dieses Gewässers macht die Passage größerer Fahrzeuge jedenfalls ohne militärische Spezialkarten großen Maßstabs und ohne Lotsen zum Vabanquespiel. Mal ganz davon abgesehen, dass seit seiner militärischen Widmung Unbefugten der Zugang streng untersagt ist.
Der Bug des Bootes blickt seewärts und ragt unnatürlich weit aus dem Wasser. Vielleicht wäre es mit etwas Glück über die glatten Klippen gedonnert, wenn da nicht am Ende des langen glatten noch Rumpfes Ruder und Schrauben säßen. Der Umstand, dass das Achterschiff zurzeit von einem bereits breiten und sich weiterhin langsam vergrößernden Ölfleck umspült wird, ist eine schlechte Kunde sowohl für die Umwelt als auch für das Boot. In allen Farben des Regenbogens schillernd, deutet der Fleck unübersehbar auf eine ernsthafte Beschädigung der Antriebsmaschinerie, die das Boot vermutlich auch dann lähmen würde, wenn es auf wundersame Weise von den Felsen freikäme. Wie es aussieht, ist das U-Boot aus Richtung „Scapa Flow" kommend hier, kurz vor dem Erreichen tieferen Wassers, unvermittelt havariert.
Der Fischer setzt seine Mütze ab und kratzt sich nachdenklich am Schädel. Dass das Boot mit einer Verdrängung von gut und gern tausend Tonnen und einem entsprechenden Tiefgang von etwa vier Metern hier und noch dazu wahrscheinlich in der Nacht überhaupt unversehrt eindringen konnte, kommt an sich schon einem Wunder gleich, bedeutet zugleich aber auch das Verderben des Bootes. Denn wäre es noch bei der Einfahrt mit dem Bug aufgelaufen, hätte es bei AK achteraus höchstwahrscheinlich wieder von den Klippen gleiten können. So aber musste es irgendwann wenden. Bei seiner Länge von geschätzt siebzig Metern und einem ausholenden Wende-Radius im engen Fahrwasser ein höchst riskantes Unterfangen. Das aber erstaunlicherweise auch irgendwie gelungen schien. Da das Glück, nach allem, was man so hört, eine ziemlich launische Dame ist, kam es dann letztlich doch, wie es eigentlich kommen musste. Während das Vorschiff gerade so eben noch über die Granitfelsen schrammte, blieb das tiefer im Wasser liegende, empfindlichere Heck unweigerlich an dem Klippen von Torumskär hängen.
Wäre dies in einem tidenabgängigen Meeresarm bei Niedrigwasser passiert, könnten die kühnen U-Bootfahrer ihre Hoffnung wenigstens noch auf die zu erwartende Flut setzen. Doch die atlantische Tide läuft sich schon in Skagerrak und Kattegat zu Tode und ist an der schwedischen Südostküste nur noch ein blasser Abklatsch ihrer selbst.
Das Auflaufen des Bootes muss den Riesenkrach von gestern Abend verursacht haben. Anschließend versuchte die Crew wohl verzweifelt alles, die wie zum Hohn verlockend nahe freie See zu erreichen. Daher das Jaulen und Heulen des gepeinigten Diesels. Mit einer angeschlagenen, unrund drehenden Schraube und ausgekugelter, vielleicht sogar angeknackster Welle hätte das Boot trotz seiner beiden je zweitausend PS starken Dieselmotoren zwar keine nennenswerte Strecke machen können, säße aber zumindest schon mal nicht mehr im Sperrgebiet fest.
Der Graubart stoppt den unschlüssig vor sich hin blubbernden Außenborder, duckt sich instinktiv ein wenig, als fürchte er, unter Beschuss zu geraten. Dann manövriert er sein Boot mit dem letzten Rest Eigenschwung in Lee der Kormoran-Burg, deren verätzte, verkohlte Zweigen wie die knochigen Arme und von behaarten Warzen übersäten Finger einer örtlichen Hexe anklagend auf den seltsamen Eindringling weisen.
Die Flagge am Turm des U-Bootes ist dem Fischer nicht vertraut. Weiß, mit einem schmalen blauen Streifen am unteren Rand und rotem Stern sowie rotem Hamme-und-Sichel Emblem. Schwedisch ist das Boot sicher nicht, so viel steht fest. Ein osteuropäischer Anrainer dieses von den Sozialisten so gern als Meer des Friedens titulierten Ostsee? Ein Russe vielleicht. Ganz sicher sogar. Wer sonst führt in einer mit Riesenschritten dem schönen neuen digitalen Zeitalter entgegenstrebenden Welt noch die nostalgischen Insignien der ersten industriellen Revolution im Wappen? Verbohrte Sozialisten eben.
Die Russen, das ist dem Fischer sehr wohl gewärtig, sind keine unbeschriebenen Blätter im ostschwedischen Schärengarten. Zu Beginn des durch rasch wechselnde skandinavische Allianzen gekennzeichneten 18. Jahrhunderts sandte Peter der Große eine ansehnliche Flotte mit etwa 60.000 Marineinfanteristen nach Westen. Den Soldaten, vielfach Söldner der übelsten Sorte, gab er feie Hand, im schwedischen Schärengürtel zwischen Arholma im Norden und Landsort im Süden unter den Zivilisten nach Herzenslust zu rauben, zu morden und zu brandschatzen. Gut, das war jetzt bereits eine Weile her, belastete aber zumindest unterschwellig die schwedisch-russischen Beziehungen dauerhaft und stieß den Schweden daher sofort wieder unangenehm auf, als in den sechziger und siebziger Jahren immer mal fremde U-Boote in ihren Küstengewässern gesichtet wurden. Trotz großen Personal- und erheblichen Materialaufwandes wie zum Beispiel lückenloser Radar- und Sonarketten gelang es dem schwedischen Militär nie, auch nur eines solchen Bootes habhaft zu werden.
Nun braucht, wer den Schaden hat, für den Spott gar nicht erst zu sorgen. Als ruchbar wurde, dass heimische Seehunde ebenso wie aus den USA importeiorte und irgendwann in die Natur entlassene Nerze beim Schwimmen ähnliche Schnapp- und Gurgellaute von sich geben wie schnorchelnde U-Boote, wurde Schweden unverdient zum Gelächter Europas und der Welt.
Sollte es sich bei diesem Boot jedoch tatsächlich um einen Russen handeln, würde der Welt das Lachen im Halse steckenbleiben.
So sehr er den Lärm verfluchte, der ihm die Nachtruhe geraubt hat, so unheimlich ist dem Graubart nun die gespenstische Stille, die das Boot umgibt. Kein Mensch an Deck oder auf der Brücke. Kein Laut dringt aus dem Innern des Bootes nach draußen. Sind die vierzig oder fünfzig Mann Besatzung, die es wahrscheinlich braucht, um ein Boot dieser Größe zu betreiben und notfalls in Gefechtsbereitschaft zu versetzen, vielleicht erstickt, weil bei geschlossenem Turmluk der CO2-Gehalt im Boot sprunghaft anstieg, während die ganze Besatzung schlief? Man hat dergleichen von Crews gelesen, deren immer noch relativ intaktes, aber von feindlichen Wasserbomben auf den Grund des Meeres geschickten Boot nicht mehr an die Oberfläche kam.
Seltsam, man würde doch erwarten dürfen, dass ein Teil der Mannschaft irgendwie um das Boot wuselt, den erlittenen Schaden bei Tageslicht begutachtet und mit Bordmitteln zu beheben versucht. Nichts von alledem.
Rüber rudern und einfach mal anklopfen? In seiner Jugend hat der Graubart den Krieg der Welten verschlungen und später atemlos Orson Welles' legendärer Hörspielversion an einem primitiven Radioempfänger verfolgt, der immer ausgerechnet an den spannendsten Stellen zu krächzen begann und jederzeit endgültig den Geist aufzugeben drohte. Ein Mann, Ogleby oder so ähnlich hieß er wohl, war zu der wie ein Meteorit in seinem Garten eingeschlagenen, glühend heißen Raumkapsel geeilt, um den ungestalten, wie verstopfte Staubsauger röhrende und an unsere irdische Schwerkraft nicht gewöhnten Marswesen aus ihren interplanetarischen Flugmaschinen zu helfen. Die Marsianer hatten es ihm bekanntlich nicht gedankt, sondern ihn mit einem Strahl ihrer Hitze-Kanonen in Staub und Asche verwandelt.
Vielleicht können die Russen die Außenhaut ihres Bootes zur Feindabwehr oder zwecks Vergrämung von Riesenkraken ja auch unter Starkstrom setzen, wie Kapitän Nemo diejenige seiner Nautilus?
Die Lösung des Rätsels ist vermutlich weit weniger dramatisch als jene Schreckensszenarien. Nun, da sie bereits alle Bemühungen, aus eigener Kraft freizukommen, aufgegeben haben, warten die Russen vermutlich mit dem ihnen nachgesagten Fatalismus auf eigene Bergeschiffe aus Leningrad oder Kaliningrad.
Eine große graue Wolke schiebt sich über diesen Teil der Schären und lässt die Szenerie um den olivfarben glänzenden Rumpf des U-Bootes noch eine Spur gespenstischer erscheinen. Der Fischer zögert. Eigentlich müsste er so schnell wie möglich die Behörden in Karlskrona in Kenntnis setzen. Sein bescheidenes Häuschen auf Sturkö hat jedoch noch immer keinen Telefonanschluss. Seit Jahren wartet er darauf, macht etwa sechs Eingaben im Jahr, wird jedoch ein ums andere Mal vertröstet und hingehalten.
Um Alarm schlagen zu können, muss er daher mindestens bis zur Ortschaft Utorp auf Sturkö zurück, wo er von Agnethas Tante-Emma-Laden aus telefonieren kann. Doch was, wenn das U-Boot in der Zwischenzeit doch wieder freikommt und sich von dannen macht? Wie stünde er da? Als ein weiterer Spinner in der langen Reihe angeblicher U-Boot-Spotter. Ein Fotoapparat wäre jetzt Gold wert. Oder zumindest eine zweite Person, ein glaubwürdiger Zeuge, der den Fund bestätigen könnte.
Plötzlich schreckt ein Laut den Kormoran auf und veranlasst ihn, davonzufliegen. Ein sanftes Quietschen wie das eines sich behutsam abschraubenden Deckels einer mit Marsmännlein gespickten, rotglühenden Raumfähre. Auf der Brücke oben im Turm erscheinen keine wasserköpfigen Horrorwesen mit Fangarmen, sondern die Gestalten zweier uniformierten Besatzungsmitglieder. Keine Offiziere, so viel versteht auch der Graubart von Uniformen, eher zwei gemeine untere Mannschaftsgrade, Matrosen oder bestenfalls Maate, seltsamerweise ohne Kopfbedeckung. Die Russen blicken in die Runde, als seien sie gerade dabei, eine Parklücke für das Boot zu finden. Vielleicht ist dies ihr erster Landgang und sie wollen sich zunächst mit der örtlichen Topographie vertraut machen, bevor sie den erstbesten Pub ansteuern.
Der Fischer grinst. Pub? Sagten Sie gerade Pub? Da werden die beiden Russen in Schweden lange suchen müssen. Dies ist ein seriöses Land mit aufrechten, gottesfürchtigen und Alkohol nur auf Rezept genießenden Menschen, wie diese beiden Jungs sehr bald feststellen werden.
Sehen können sie ihn jedenfalls nicht, jetzt, da er seinen Kahn in eine Bucht des südöstlichen Teils von Torumskär bugsiert hat. Das dem U-Boot nächstgelegene Ufer ist keine zehn Meter entfernt und lädt zu einem Ausflug geradezu ein. Der eine der beiden bückt sich und verschwindet für einen Moment von der Bildfläche wie die Handpuppe eines Kasperletheaters, die für den Augenblick Pause hat. Erneut quietscht der Deckel der Raumfähre. Offenbar schließt der Mann so behutsam das Turmluk, als wolle er seine Kameraden im Innern nicht wecken.
Das findet der Fischer merkwürdig. Warum sollten diese beiden die einzigen sein, die ihre Beine mal strecken und etwas anderes sehen möchten, als Schläuche, Röhren, Ventile oder Schotts?
Der Matrose am Deckel richtet sich wieder auf, nickt seinem Kollegen aufmunternd zu und klettert dann auf den Stufen am Turm steifbeinig nach unten an Deck wie jemand, der geraumer Zeit im Rollstuhl sitzen musste und kaum körperliche Bewegung hatte. Der andere folgt ihm auf etwas geschmeidigere Weise. Auf dem Bootsdeck angekommen, nehmen beide unvermittelt Anlauf und springen mit für „Rollstuhlfahrer" beachtlich weiten Sätzen auf die nächstgelegenen Klippe wie Orientierungsläufer, die einen rauschenden Bach vermittels einiger Trittsteine überwinden, die irgendwelche aufmerksamen Vorgänger dankenswerterweise hinterlassen haben.
Jetzt versteht der Fischer. Dies sind keine Matrosen auf Landgang, dies sind Deserteure, die das Missgeschick de U-Bootes zur Flucht nutzen wollen. Deshalb tragen sie auch keine Kopfbedeckung, denn die würde ihnen bei diesem Vorhaben nur lästig sein.
Doch die See ist kein Bach und obwohl die Klippen größer sind, als ein durchschnittlicher Trittstein, bieten sie aufgrund ihres feuchten Moos- und Algenbewuchses keinen sicheren Halt. Der eine der beiden rutscht schon beim ersten Aufprall aus und klatscht rückwärts ins hüfthohe Wasser. Wie ein begossener Pudel rappelt er sich wieder hoch und lässt sich vom Kameraden auf die Schäre helfen, die beide mit diesmal viel kürzeren Sprüngen auch erreichen.
Terra firma unter den Füßen, laufen sie los, stolpern und fallen, stehen fluchend wieder auf und rennen weiter. Der Fischer erschrickt erneut. Haben die beiden ihn doch bemerkt und steuern auf ihn zu, weil sie sich von ihm Hilfe erhoffen? Das könnte ihn in Teufels Küche bringen.
Jedenfalls laufen sie bewusst oder ahnungslos geradewegs auf ihn zu und sind jetzt nur noch zehn, elf Meter von der Bucht entfernt, die sie in der Eile vielleicht ebenfalls als geeignetes Versteck vor eventuellen Verfolgern ausgemacht haben.
Erneut springt der klatschnasse der beiden Matrosen, dessen triefende, schwere Baumwoll-Uniform ihm wie eine faltige Waschhaut am Leib klebt, über einen größeren Stein. Just, als der Mann abhebt, wird er sogleich wie von einer unsichtbaren Faust mit solcher Gewalt niedergestreckt, dass er mit dem Oberkörper zuerst auf den Stein prallt, ohne Zeit zu finden, sich mit beiden Armen schützend abzustützen, wie er das bei einem normalen Sturz wohl instinktiv getan hätte.
Jetzt erst wird dem Graubart klar, dass er eben unterbewusst einen trockenen Knall wie einen Peitschenschlag registriert hat. Dennoch kann er wie von einem makabren Zauber gebannt seinen Blick nicht von dem Matrosen wenden, der da mit den Händen zu beiden Seiten in Schulterhöhe nur wenige Meter vor ihm liegt, als habe er sich ergeben wollen und sei dennoch niedergestreckt worden. Unter seiner Brust quillt Blut hervor.
Der andere Matrose stoppt, läuft die paar Meter zurück und bückt sich nach etwas, das der Fischer nicht erkennt. Bevor der schwarzhaarige Matrose es greifen kann, rutscht das silbern glänzende Ding den feuchten, moosbewachsenen Felsen hinab und plumpst ins Wasser, wo es schnell untergeht. Der andere Mann flucht und kniet sich neben seinen Kameraden. Doch der scheint bereits jenseits von Gut und Böse. Während weitere Projektile über seinen Kopf hinwegpfeifen, wendet sich der Mann ab und läuft gebückt und im Zickzack nach rechts, weg von der Bucht und weg von dem erleichterten Graubart.
Noch scheint der Kollege am Boden sein Leben jedoch nicht ganz ausgehaucht zu haben. Er hebt kurz den Kopf und blickt geradeaus, direkt in die Bucht. So wird ein graubärtiger schwedischer Schärenfischer in seinem typischen Ambiente zum letzten diesseitigen Bild, das der Russe ins sozialistische Jenseits mitnehmen wird.
Geistesgegenwärtig greift der Fischer nach einem der beiden Ruder, die er ob der Launen seines Außenborders für alle Fälle stets mit sich führt und stochert damit im Wasser, dort, wo der silberne Gegenstand unterging. Und er hat Glück. Entweder das Objekt hat genügend Auftrieb, um noch eine Weile zwischen Hoffen und Bangen zu schweben oder es ist auf einer Felskante oder in Kelp hängengeblieben. Jedenfalls gelingt es dem Fischer, den Gegenstand mit dem Ruderblatt zu heben und zu sich heranzuziehen, bevor er tatsächlich für immer verloren ist.
Als er ihn aus dem Wasser hebt, erkennt er, dass es sich um einen banalen Flachmann handelt, wie ihn Jäger oder Fischer gern mit sich führen, um sich den einen oder anderen Schluck wärmenden Feuerwassers zu gönnen, während sie auf Beute oder Anbiss warten. Der Fischer wiegt den Flachmann in der Hand. Er fühlt sich eher leicht an, ist also sicher nicht aus Edelstahl, geschweige denn aus Silber, sondern vermutlich aus billigem Zinn, mit dem kruden Relief eines Doppeladlers nicht sehr fachmännisch auf die Vorderseite gelötet. Er schüttelt den Flachmann, erhält aber nicht das typisch glucksende Echo, das er erwartet hat, sondern ein seltsam papierenes Rascheln zur Antwort.
Als er den Deckel abschraubt, schiebt sich das Ende einer Art zusammengerollter schwarzer Folie vorwitzig wie ein aus seiner Gefangenschaft befreiter Krebs aus dem Stutzen nach oben. Bei näherem Hinsehen wird ihm klar, dass es sich nicht um eine Folie handelt, sondern um einen Film, genauer, die Negativrolle eines Mikrofilms, den der Matrose offenbar auf diese Weise wassergeschützt mit sich führte.
Der Fischer entnimmt die Rolle, spult den Anfang ab und hält den Film gegen das Licht. Er erkennt keine Porträts, sondern Schriftstücke, so als hätte jemand Buch- oder vielleicht Aktenseiten abfotografiert, um sie für die Nachwelt zu archivieren. Dann schiebt er den Flaschengeist wieder in den Flachmann und schraubt den Deckel fest auf den Stutzen. Sein letzter Blick zurück gilt dem unglückseligen Matrosen, so als hoffe oder fürchte er, dass der sich nur totgestellt habe und ihn nun seinen Mikrofilm hin zurückfordern werde.
Dann schielt hebt er zum U-Boot. Der Todesschütze, der den Matrosen auf dem Gewissen haben dürfte, ist nicht mehr allein auf der Brücke. In seiner Faszination für den wie eine Gämse hüpfenden Mann hat der Fischer nicht darauf geachtet, dass auf dem U-Boot inzwischen helle Aufregung ausgebrochen scheint und mehrere Männer in Offiziersuniform in seine Richtung gestikulieren.
Der Flucht- oder Desertionsversuch des Matrosen wurde also schnell bemerkt und dem Standrecht selbst im tiefen Frieden mir nichts, dir nichts Geltung verschafft. Egal, ob sie den Fischer gesehen haben oder nicht, die Russen werden sich jeden Augenblick aufmachen, die Leiche ihres Kameraden an Bord zu holen und sich auf die Suche nach dem anderen, überlebenden Crewmitglied begeben.
Spätestens dann sollte der Fischer nicht mehr hier sein. Wenn sie schon einen der Ihren derart gnadenlos exekutieren, werden sie sich vermutlich auch nicht zieren, einen unliebsamen Zeugen wie ihn aus dem Weg zu räumen. Der Fischer bückt sich und legt das Ruder wieder zurück an seinen Platz unter dem Dollbord, steckt den Flachmann in die Brusttasche seiner Jacke und wirft den Außenborder an. Dessen geräuschvolle Gangart kurz aber innig verfluchend, macht er sich vom Acker, bevor ihn noch eine verirrte Gewehrkugel oder gar ein Feuerstoß aus einer der Kalaschnikows erreichen kann, mit denen er die Russen auf dem Boot hat herumfuchteln sehen.
Ein etwas magerer Fang an diesem Morgen, sicher, aber Graubart kennt seine vaterländische Pflicht und ist entschlossen, ihr Genüge zu tun.
2. Der Schleicher
„Lass' es ruhig klingeln."
Stabschef Gustav Carlsson, Oberbefehlshaber der schwedischen Marine, schiebt die letzte trockene Scheibe Knäckebrot mit Wilder-Erdneer-Konfitüre fast in den Mund. Gerade ist er dabei, einen letzten Blick auf die Unterlagen für eine wichtige Besprechung am Nachmittag zu werfen, da klingelt natürlich wieder das vermaledeite Telefon.
„Lass' ruhig," ruft er seiner Frau noch einmal zu, die aus der Küche herbeigeeilt ist, um das Gespräch anzunehmen. Mögen sie warten, bis er mit dem Frühstück durch ist, gar so eilig kann es ja wohl nicht sein. Erst, als das enervierende Klingeln nicht aufhört, gibt er widerstrebend nach und hebt ab.
Was ihm ein aufgeregt klingender wachhabender Oberleutnant nun mitteilt, ist schwer zu glauben. Ein sowjetisches U-Boot in den Schären? Schon wieder? Also nicht bloß von Weitem gesichtet? Aufgelaufen, auf Torumskär havariert und nun wie auf dem Präsentierteller festliegend?
„Moment mal, sagten Sie Torumskär?"
Carlsson wendet sich um und blickt auf eine ältere Seekarte, die er vor Jahren antiquarisch erstanden hat und nun, fachmännisch gerahmt, unter Glas hinter ihm an der Wand hängt. Wenn Torumskär sich in den letzten beiden Jahrhunderten nicht wegbewegt hat, gehört es zweifelsfrei immer noch zum militärischen Sperrgebiet, das seine Vorgänger auf diesem Posten nach dem Kriege eingerichtet haben.
Und entdeckt von wem? Wahrscheinlich von einem nackt durch die Schären streifenden ayurvedischen Baum-Umarmer auf Kokain, Meskalin oder Acid. Nein? Von einem Fischer? Was für ein Fischer? Was hat ein Fischer im Sperrgebiet zu suchen? Wer hat das autorisiert? Warum öffnen wir das Sperrgebiet nicht gleich für die Allgemeinheit, veranstalten Sommer-Sonnenwendfeste und Lucia-Umzüge, wenn wir schon mal dabei sind.
„Wo genau? Hm."
Carlsson denkt nach. Der natürliche Reflex des Beamten drängt ihn, sich für unzuständig erklären.
„Was soll ich da? Wäre doch zweifelsohne besser, jemand zu schicken, der wenigstens ein paar Brocken Russisch kann, meine Güte. Wie, die Zeit ist knapp? Natürlich, das ist sie immer, gehört praktisch zu ihrer Definition. Ohne Dolmetscher wird das aber ein Dialog der Tauben. Wie? Nein, nicht der Vögel, der Gehörlosen. Hallo? Mit wem spreche ich jetzt?"
Nach einem verdächtigen Klicken in der Leitung, das Carlsson während seiner Tirade übergehört hat, ist er nun offenbar mit einem anderen Gesprächspartner verbunden.
„Natürlich, Herr Minister. Größtmögliche Diskretion, versteht sich. Aber die Verständigung, ich meine...Wie belieben? Deutsch? Sind Sie sicher? Ich? Ja, ganz gut, war ja mal NATO-Verbindungsoffizier auf der Hardthöhe, lange her. Wir hatten damals....Wie? Bericht an Sie, selbstverständlich. Unverzüglich, geheime Verschlusssache. Geht in Ordnung. Danke, Sie können sich auf mich verlassen."
Kaum hat Carlsson aufgelegt, als er draußen die quietschenden Bremsen des Dienstvolvos hört, der ihn abholen und zum Hafen bringen soll, wo ein Schnellboot auf ihn wartet. Er streift sich nachdenklich seinen Uniformmantel über, rückt die jahreszeitlich bedingt dunkelblaue Mütze mit „Spiegelei" am Schirm vor dem Spiegel zurecht auf und geht gemessenen Schrittes nach draußen, eine leicht verwirrte Ehefrau und Lissy, die wie immer vor sich hindösende Labradorhündin konsterniert zurücklassend.
Auf der Fahrt zum Hafen von Karlskrona geht er in Gedanken den Leitfaden für die Begegnung mit Außerirdischen durch, wie die Kollegen der Marine scherzhaft die Ständige Dienstanweisung des Verteidigungsministeriums nennen. Darin sind die empfohlenen Verhaltensweisen von Offizieren und Mannschaft im Falle eines wenig wahrscheinlichen, aber auch nicht ganz auszuschließenden Aufeinandertreffens mit ausländischen und vor allem osteuropäischen U-Booten in ungelenkem Verwaltungs-Schwedisch festgehalten. Eine richtiggehende Etikette für veritable Begegnungen Auge in Auge mit deren Besatzungen ist darin, soweit Carlsson erinnerlich, allerdings nicht enthalten. Dazu sind die soziokulturellen Idiosynkrasien der Nationen, auf die man dabei stoßen könnte, zu heterogen. Was soll's, dann gilt es eben zu improvisieren.
Doch das sagt sich so leicht. Das internationale Klima ist von tiefem gegenseitigem Misstrauen gekennzeichnet, der Kalte Krieg treibt auf einen neuen heißen zu. Da kann jeder falsche Zungenschlag zum Funken werden, der das Pulverfass in die Luft jagt. Sollte sich das Ganze trotz allem erneut als Luftnummer erweisen, würde er, Carlsson, Gefahr laufen, zur lächerlichen Figur zu werden. Sollte hingegen wirklich etwas dran sein am Gefasel dieses Fischers, der wahrscheinlich schon am frühen Morgen breit wie eine Flunder ist, so gilt es für Carlsson, Contenance zu wahren und sich durch diplomatisches Geschick für noch höhere Aufgaben zu empfehlen. Schließlich hat er sich nicht bald dreißig Jahre lang mühsam auf der Karriereleiter nach oben gestrampelt, um wie bei einem dämlichen Brettspiel durch eine unglückliche Würfelkonstellation wieder auf Anfang gesetzt, kaltgestellt oder gar in den vorzeitigen Ruhestand versetzt zu werden. Dann würde sich seine Versetzung vom kosmopolitischen Stockholm ins provinzielle Karlskrona vollends als das erweisen, was er schon lange argwöhnt, nämlich die Vorstufe zur Hölle eines häuslichen Rentnerlebens an der Seite von Frau, mit der er sich schon seit langem nichts rechtes mehr zu sage hat, sowie Hund, der zwar einen dankbareren Gesprächspartner abgibt, aber auf Dauer auch nervt.
Rasch vertreibt er dieses Schreckensszenario und lässt stattdessen die verschiedenen, sich ihm bietenden Optionen an seinem geistigen Auge vorüberziehen. Angenommen, es handelt sich wirklich um ein sowjetisches Boot: was hat es im Sperrgebiet gesucht? Sich das örtliche, scherzhaft „Scapa Flow" genannte Sammelbecken mal aus der Nähe ansehen? Lohnt es, dafür die hochnotpeinliche Havarie seines Bootes zu riskieren?
„Können Sie das Radio bitte etwas leider stellen," ruft er vom Rücksitz dem Fahrer zu. Der in diesen Tagen pausenlos auf allen Kanälen durchgenedudelte Ohrwurm vom Skandal im Sperrbezirk der deutschen Spider Murphy Gang ist wirklich das Letzte, was er jetzt zur Inspiration braucht.
Die globale Lage ist für derlei Frivolitäten viel zu angespannt. In Washington hat der gerade erst neu in sein Amt eingeführte und gleich schon mal angeschossene neue Sheriff und Held unzähliger B-Movies, Ronald Reagan, als erste Amtshandlung alle die Rüstung betreffenden Haushaltskürzungen seiner Vorgänger im Amt rückgängig gemacht und ein kombiniertes Flotten- und Luftwaffenmanöver am Nordkap anberaumt, das nur einen Steinwurf von Murmansk entfernt liegt. Dazu drängt er auf die Stationierung von Pershing Zwo-Mittelstreckenraketen in Europa und treibt die Strategische Verteidigungs-Initiative SDI voran, die ihm als Krieg der Sterne gegen das Reich des Bösen gilt, wie der die Sowjetunion gern nennt. Der Mann kann es eben nicht lassen, in Hollywood-Kategorien zu denken.
In Moskau regiert der kränklich aufgeschwemmte Ukrainer Leonid Breschnew. Wie lange noch, ist angesichts seines prekären Gesundheitszustandes abzusehen. Seinem wahrscheinlichen Nachfolger Jurij Andropow geht es dem Vernehmen nach auch nicht besonders gut. Das schleichende Siechtum seiner politischen Führungsriege steht symbolisch für den gegenwärtigen Zustand des Riesenreiches, das sich, obwohl wirtschaftlich auf der Felge fahrend, auf einen Rüstungswettlauf mit den Amerikanern einlassen zu können glaubt. Davon zeugt nicht zuletzt der fieberhaft vorangetriebene, Milliarden kostenden und irgendwie monomanisch anmutende Bau immer größerer U-Boote mit nuklearem Antrieb sowie Raketen mittlerer Reichweite und atomaren Sprengköpfen.
Die Europäer streiten unterdessen bis aufs Blut über den NATO-Doppelbeschluss, während die Sowjets ihre SS 20-Marschflugkörper an den Grenzen zum Westen platzieren wie ein Anatolij Karpow seine Schachfiguren auf dem Brett.
Und an der nationalen Front? Wie es der Teufel will, haben ausgerechnet in diesem kritischen Jahr die gefühlt seit der Vertreibung aus dem Paradies regierenden und von manchen für dieses einschneidende Ereignis verantwortlich gemachten Sozialdemokraten erstmals die Wahlen verloren. Der an der Spitze einer wackligen Minderheitsregierung stehende Thorbjörn Fälldin muss sich noch den morgendlichen Gang zur Toilette vom Parlament genehmigen lassen und wird von dem jungen wilden Erzkonservativen Carl Bildt rhetorisch gnadenlos vor sich hergetrieben.
Und ausgerechnet in diese explosive Gemengelage, labil wie eine LKW-Ladung Nitroglycerin, platzt jetzt dieses dämliche U-Boot! Ist es vielleicht sogar mit atomaren Sprengköpfen bestückt? Das würde gerade noch fehlen.
So oder so werden die Augen der Welt auf Schweden, die winzige Torumskär und nicht zuletzt auf Carlsson gerichtet sein. Das U-Boot wäre Wasser auf die Mühlen all jener im In- und Ausland, die den Schweden seit Jahren in den Ohren liegen, endlich ihre fadenscheinige Neutralität aufzugeben und freimütig Farbe zu bekennen, indem sie offiziell einem westlichen Verteidigungsbündnis beitreten, mit dem sie ja sowieso insgeheim vertrauensvoll zusammenarbeiten.
„Alles bestens, Madame la Marquise," murmelt Carlsson grimmig. Hätte er doch bloß auf seine Frau gehört und wäre mit ihr und Lissy für zwei Wochen auf die Kanaren geflogen, wo sie sich derzeit zu erschwinglichen Nachsaisonpreisen in der Sonne aalen könnten. Zu spät. Sich rechtzeitig krank melden wäre eine weitere Option gewesen, ging jetzt aber auch nicht mehr. Seine Dienstpistole hätte er vielleicht mitnehmen sollen, nur so der Form halber. Damit geschossen hatte er schon seit Jahren nicht mehr.
Wieso ging das Ministerium eigentlich davon aus, dass die Russen ausgerechnet des Deutschen mächtig sein würden? Verkehrssprache unter Comecon-Mitgliedern war doch wohl Russisch? In dieser Sprache konnte Carlsson nur „Guten Tag", „Danke", „zum Wohle" und „Auf Wiedersehen" sagen. Immerhin, ja, aber vielleicht etwas dürftig für die Zwecke einer gepflegten und wahrscheinlich heiklen Konversation. Alles in allem eine äußerst riskante Mission, bei der er nüchtern betrachtet nur verlieren konnte. Genau deshalb schickt der Minister ja wohl ihn, vermutlich sogar auf Empfehlung des Generalinspekteurs der Streitkräfte, mit dem Carlsson schon mehrmals aneinandergeraten ist.
Der Volvo bremst und rollt aus. Sie sind im Marinehafen angekommen. Carlsson steigt aus. Beim Näherkommen huscht ein zunächst ungläubiges, dann immer grimmiger werdendes Lächeln über seine Lippen. Am Kai liegt ein von oben bis unten in grauer Tarnfarbe gestrichenes Patrouillenboot mit laufender Maschine und qualmendem Auspuff. Sein Name: Smygaren. Machen die das mit Absicht oder sind die nur blöd? Smygaren bedeutet so viel wie Schleicher, ein Name, der weder zu einem Patrouillenboot noch zu dessen heutiger Mission so recht passen will. Ein ironischer Seitenhieb des Generalinspekteurs? Bleibt zu hoffen, dass die Russen nicht über ausreichende Schwedisch-Kenntnisse verfügen, um diese Posse auskosten zu können.
Der Bootsmann der Smygaren pfeift Seite, während Carlsson an Bord geht, die Dienstflagge am Heck grüßt und nach einem pflichtgemäßen „Guten Morgen, Männer" mit dem Kommandanten, einem blutjungen Leutnant, rasch im Inneren des Bootes verschwindet. Die Smygaren legt sofort ab und nimmt rasch Fahrt auf. In einer Ecke des winzigen Brückenaufbaus bemerkt Carlsson irritiert einen in aller Seelenruhe an seinem Pfeifchen suckelnden graubärtigen Zivilisten.
„Wer ist das denn?" fragt er und muss dabei schon laut rufen, um das satte Brummen der Maschine unter ihnen und das rauschende Kielwasser hinter ihnen zu übertönen. Seine letzte Fahrt auf einer vibrierenden Hämorrhoidenschaukel wie dieser ist schon mindestens zwei Jahrzehnte her. Da kann man schon mal vergessen, wie laut es an Bord dieser Flitzer wird, wenn der Bootsmann den Gashebel auf den Tisch legt.
„Birger Bengtsson, Herr Kap'tän," ruft der Kommandant zurück.
„Der Fischer, der das Boot gefunden hat," fügt er angesichts des verständnislosen Blicks seines Vorgesetzten hinzu.
„Verfügt über ausgezeichnete Ortskenntnis und kann uns zu dem U-Boot führen."
„Oh, prächtig. Ich stellte mir eigentlich vor, dass ein sowjetisches U-Boot in den Schären kaum zu übersehen sein würde. Ich meine, es verschmilzt ja nicht gerade harmonisch mit der Landschaft, oder?"
Carlsson lacht über seinen Scherz und rückt näher an Bengtsson heran, dessen Fischgeruch keinen Zweifel an seiner beruflichen Orientierung aufkommen lässt.
„Wie dicht können wir an den Russen heran, was schätzen Sie?" fragt er ihn, während der Leutnant die Karte des Sperrgebiets auf der Platte des zitternden Metalltisches ausbreitet.
„Dicht genug, um sich mit ihm ins Päckchen zu legen, wenn Sie wollen," entgegnet Bengtsson mit dem trockenen Humor eines Mannes, der aus seiner Abneigung gegen militärisches Gehabe keinen Hehl zu machen pflegt.
„Ich glaube, das machen wir eher nicht. Abstand halten scheint mir das Gebot der Stunde. Wie kommen wir am schnellsten dahin?"
Bengtsson beugt sich über die Karte. Man merkt, dass er selten mit Seekarten arbeitet und sich erst einmal orientieren muss.
„Es gibt hier eine enge Passage, die führt direkt zum Havaristen an der Westseite von Torumskär. Dürfte für Ihren Tiefgang reichen."
„Dürfte? Sie sind nicht sicher?"
Carlsson blickt fragend auf den Leutnant. Der zuckt mit den Schultern, als wolle er bedeuten, dass die Mitnahme des Fischers nicht seine Idee war.
„Checken Sie das bitte gegen," weist Carlsson ihn an.
„Wäre ganz schön dämlich, wenn wir auf dem Weg zu einem havarierten U-Boot selbst auf den gottverdammten Schären auflaufen würden, finden Sie nicht? Als lahme Ente im Sperrgebiet erwischt worden zu sein, ist für den Russen sicher peinlich bis dorthinaus. Das heißt, wir haben ihn quasi an seinen Schamhaaren. Warum sich dieses strategischen Vorteils begeben, indem wir zu viel riskieren und uns ebenfalls auf einer Schäre ausruhen müssen?"
„Schwieriges Gewässer," pflichtet der Leutnant bei.
„Aber Bengtsson kennt es angeblich wie seine Westentasche."
„Können die Russen uns kommen sehen? Ich will sie auf gar keinen Fall überrumpeln, das könnte sie zu Fehlreaktionen verleiten."
„Sie meinen, auf uns zu schießen?" fragt der Leutnant.
„Entweder das oder ihr Boot in die Luft jagen. Ich kenne deren Dienstanweisungen für solcherlei Eventualitäten nicht. Aber wenn sie zum Beispiel atomare Sprengköpfe an Bord haben, werden sie die nicht so ohne weiteres in Feindeshand fallen lassen wollen."
„Ratten und Russen darf man nicht in die Enge treiben, sonst greifen sie an," steuert Bengtsson halbherzig eine eigene Note bei.
„Richtig. Wenngleich ich es nicht unbedingt in dieses wenig schmeichelhaften Bild gekleidet hätte. Wir kommen ohne Waffen, wie Unterhändler eines Trecks weißer Siedler zum friedlichen Pow-Wow ins Lager der Rothäute. Gefällt mir gut – Rothäute, Sie versehen?. Decken Sie unser Buggeschütz mit der Plane ab. Niemand an Bord richtet eine Waffe auf das Boot, nicht einmal ein blankes Küchenmesser, haben wir uns verstanden? Sie sind für Ihre Männer verantwortlich. Ich gehe davon aus, dass die Russen Posten mit Kalaschnikows aufgestellt haben. Mit ihrer Flak blasen die uns weg, wenn sie sich angegriffen fühlen. Torpedieren wird allerdings schwieriger."
Der Leutnant lacht, nickt und geht an Deck, um den Befehl Carlssons an seine Leute weiterzugeben.
„Was für einen Eindruck macht der Russe auf Sie? Ich meine, abgesehen vom Auflaufen? Eher Nickel oder eher...Altmetall?"
Der Graubart zuckt mit den Schultern.
„Geht so, von außen betrachtet. Die haben mich ja nicht an Bord eingeladen."
„Ja, ich verstehe. Nun, wie kann es zu der Havarie gekommen sein, was denken Sie?".
„Er hat sich vermutlich nach einem Wendemanöver festgefahren ungefähr so..." Bengtsson zeichnet die Lage des U-Boots in die Karte.
„Bug und Vorschiff blicken seewärts, das Achterschiff hängt am Felsen. Muss mit ziemlicher Geschwindigkeit auf die Felsen gebrummt sein. Die Erschütterung muss man eigentlich bis Karlskrona gehört haben."
Carlsson nickt.
„In einer stillen, mondlosen Weihnachtsnacht hätte man das vermutlich schon gehört. Aber selbst, wenn – wer denkt denn an so was?"
Am allerwenigsten der allem Anschein nach gar nicht mal so wache Küstenschutz oder die Radarleitstelle der Marine, denkt Carlsson im Stillen bei sich. Da würden demnächst Köpfe rollen, sobald er seinen geharnischten Bericht vorlegte. Hauptsache, er würde den seinen auf den Schultern behalten.
Auch Bengtsson schweigt. Die Episode mit dem erschossenen Deserteur hat er mit keinem Wort erwähnt. Eigentlich wäre es wohl seine Pflicht, davon zu berichten und die Negative zu übergeben, aber eine innere Stimme souffliert ihm, das vorerst nicht zu tun. Wahrscheinlich sowieso alles auf Russisch. Helle, seine vorübergehend in Stockholm wohnende Tochter, kann Russisch, sehr gut sogar. Hat vier Semester in Moskau Geschichte studiert und danach längere Zeit die Bekanntschaft mit einem russischen Kommilitonen gepflegt. Vor kurzem ging die Beziehung dann leider den Weg alles Irdischen.
Die Smygaren betritt den Schärengarten gleichsam auf Zehenspitzen, verlangsamt ihre Fahrt wie ein sich anpirschender Jäger, der sich, vom Laufen noch heftig keuchend, seiner Beute nun geduckt nähert und jedes Geräusch vermeiden möchte. Carlsson und Bengtsson gehen ebenfalls an Deck.
„Da liegt er!"
Der Leutnant weist die Richtung und reicht Carlsson das Fernglas. Ganz behutsam, den Blick halb auf dem Russen, halb auf dem eigenen Echolot, manövriert der Leutnant die Smygaren, die ihrem Namen nun tatsächlich alle Ehre zu machen scheint, an den braun-schwarzen, je nach Lichteinfall ins dunkle Oliv changierenden Rumpf des fremden U-Boots heran. Carlsson erkennt auf den ersten Blick, dass es sich nicht um ein Exemplar der jüngsten russischen Projektserie handelt, deren Vertreter unter die Polkappe tauchen, sich dort frei schwebend wochenlang aufhalten und urplötzlich durch meterdickes Treibeis nach oben stoßen können, um einen Fächer Raketen mit atomaren Sprengköpfen auf ein halbes Dutzend amerikanischer Großstädte abzufeuern.
Dies hier ist ein Boot der Resterampe, wahrscheinlich in den fünfziger Jahren auf einer Leningrader Werft gebaut. Seine Besichtigung, falls es dazu kommt, dürfte für Carlsson zur nostalgischen Zeitreise werden. Auf der Brücke des Bootes, die mit ihrer angebrochenen Funkortungsantenne auch irgendwie den Eindruck erweckt, als sei sie bei einer Kollision mit Überwasserfahrzeugen in Mitleidenschaft gezogen worden, stehen drei Matrosen mit Maschinenpistolen im Anschlag.
„AK 47, Sie hatten Recht. Was jetzt?"
Carlsson wendet sich nach Bengtsson um.
„Gibt's da weiter vorn noch genug Wasser?"
Der Fischer nickt.
„Bis hinter die Kormoran-Schäre in jedem Fall. Danach wird's allerdings sehr schnell wirklich untief."
„Sie haben seine Expertise gehört," wendet Carlsson sich an den Leutnant.
„Am besten wird sein, Sie setzen mich dort vorn ab." Er zeigt auf eine noch oder schon wieder leidlich begrünte Klippe südlich des Havaristen.
„Dann ziehen Sie sich diskret zurück und warten auf Verstärkung. Bald wird hier sowieso die Hölle los sein. Alle Truppenteile sind in Alarmbereitschaft versetzt. Nehmen Sie Funkkontakt mit dem Büro des Oberbefehlshabers auf. Er wird sie wissen lassen, wie's weitergehen soll. Und wenn nicht, Gnade ihm Gott. Ich winke, wenn ich wieder abgeholt werden möchte. Noch Fragen?"
„Alles klar, Herr Kap'tän." Der Oberleutnant öffnet die Karabinerhaken an der Reling, so dass eine türartige Öffnung entsteht.
Sie haben Torumskär erreicht. Der Bug der Smygaren schmiegt sich regelrecht an den glatten Felsen, dessen Moosbewuchs Fenderfunktion übernimmt. Unter den misstrauischen Blicken der Russen mit ihren AK 40 lässig in der Armbeuge steigt Crlsson von Bord. Mit wackligen Beinen und ständiger Angst, auf dem von Algen und Öl bedeckten Granit auszurutschen und ins Wasser zu plumpsen, geht der Stabschef in kleinen Schritten auf das U-Boot zu. Auf dem jetzt bereits parallel verlaufenden Deck des U-Bootes würde er besseren Halt finden, aber die See-Etikette so gröblich zu verletzen, wäre ein ausgesprochen schlechter Einstand.
„Druschba!" ruft er den Matrosen zu, als er unten am Turm steht. Das russische Wort für „Freundschaft" ist ihm just in diesem passenden Moment wieder eingefallen. Die Matrosen erwidern den Gruß freudlos grinsend. An der Aussprache muss er offenbar noch arbeiten, aber die Russen wissen seine Bemühungen allem Anschein nach zu würdigen, darauf kommt's an.
„Bitt an Bord kommen zu dürfen," ruft Carlsson auf Deutsch als nächstes. Falls die Matrosen ihn verstanden haben, lassen sie es sich nicht anmerken. Seinen Epauletten und dem Mützenschirm werden Sie jedenfalls abgelesen haben, dass ihnen hier nicht irgendeine örtliche Flitzpiepe den lieben Gott zum Gruß entbietet, sondern ein hoher schwedischer Marineoffizier ihnen die Ehre gibt. Einer von ihnen bückt sich und ruft etwas nach unten, das Carlsson nicht versteht. Ganz beiläufig knüpft er seinen Uniformmantel auf und legt die Hände auf den Rücken. So können die Matrosen sehen, dass er keine Waffe mit sich führt, was entscheidend zu ihrer Entspannung beitragen dürfte.
Der Matrose, der nach unten gerufen hat, wartet offensichtlich auf eine Antwort, die jedoch auf sich warten lässt. Carlsson versteht das. Der Kommandant holt wahrscheinlich über Funk Weisungen aus Moskau, bevor er sich dem Schweden stellt. Das kann dauern. Breschnew, ein Freund des wissenschaftlichen Sozialismus, wie es heißt, ist nicht für schnelle Bauchentscheidungen oder Schüsse aus der Hüfte bekannt.
Carlsson geht langsam vor dem Turm auf und ab wie ein verliebter Teenager, der zu früh zum Rendezvous an der Litfaßsäule eingetroffen ist. Der Ohrwurm vom Skandal um Rosie geht ihm nicht aus dem Kopf. Er hofft auf eine Antwort vor dem Eintreffen weiterer Einheiten der Marine und vor allem dem der Elitetruppen des Heeres. Die sind heute entweder ungewohnt saumselig oder liegen längst bestens getarnt hier irgendwo vor Ort und haben die Russen womöglich schon im Fadenkreuz ihrer Zielfernrohre.
Endlich erschallt ein Ruf aus dem Inneren des Bootes wie aus dem Magen eines erlegten und bereits enthäuteten Wals. Der Maat, der vor einer knappen Viertelstunde nach unten gerufen hat, winkt Carlsson heran und bedeutet ihm, an Bord zu kommen.
Der Schwede erklimmt den Turm, grüßt die Flagge und gleitet dann durch den Schacht wie durch eine deckellose Müllrutsche nach unten, verliert dabei seine Mütze und stößt sich den Kopf. Dass U-Boote noch nie sein Ding waren, kann er insgesamt schwer verheimlichen.
Im Inneren leuchten zwar genügend Lampen, trotzdem müssen Carlssons Augen sich erst an das Zwielicht unter Tage gewöhnen. Der Geruch nach Öl, Schweiß und Diesel, der ihm entgegenschlägt, nimmt ihm fast den Atem. Als er wieder gefahrlos Luft holen zu können glaubt, dankt er dem Russen, der ihm seine Mütze aufgehoben hat, klopft sich instinktiv den imaginären Staub vom Mantel, als sei er hier auf Zeche Sofia Eins und wendet sich der Person zu, die an den „Kolbenringen" ihrer Uniformjacke als Kommandant zu erkennen glaubt.
„Kapitän dritter Klasse Anatolij Michajlowitsch Guschtschin," stellt sich der Russe tatsächlich auf Deutsch vor. Da ihm der eine oder andere Backenzahn zu fehlen scheint, klingen seine Zischlaute so feucht, als hätte man auf einen Frosch getreten.
„Darf ich Ihnen Josip Fjodorowitsch Awrukewitsch vorstellen, Kapitän ersten Ranges und Stabschef der U-Bootbrigade. Willkommen an Bord von S 137."
Carlsson dankt, schüttelt Hände, nennt seinen Namen und Dienstgrad, ebenfalls auf Deutsch und lässt sich dabei nicht anmerken, dass sein Gehirn gerade Überstunden macht.
S 137 wäre ein älteres, nicht-nuklearwaffenfähiges Boot der sogenannten Stalinec-Serie. Das würde zum ersten äußeren Eindruck passen, den Carlsson von dem Russen hat. Wieso aber so viel Lametta an Bord eines älteren Zossens wie diesem?
Ein russischer Kapitänsgrad dritter Klasse entspricht in etwa einem schwedischen Korvettenkapitän. Das wäre für hiesige Verhältnisse etwas ungewöhnlich, da hier das Kommando über U-Boote in der Regel von Kapitänleutnants wahrgenommen wird.