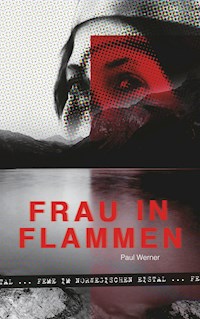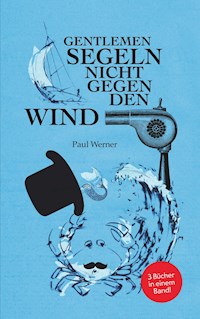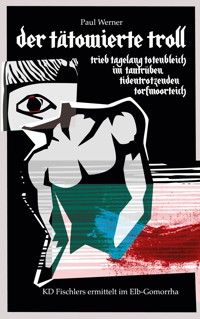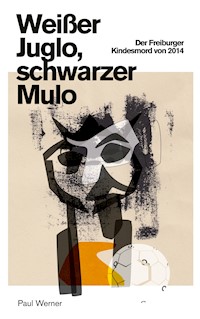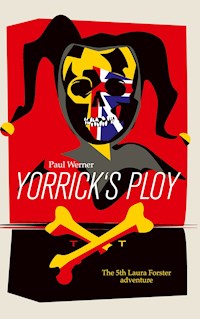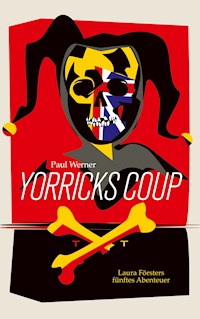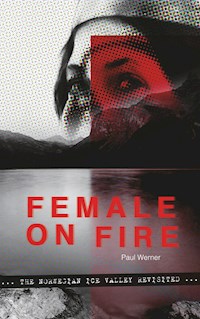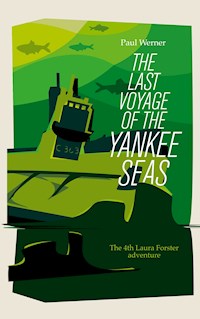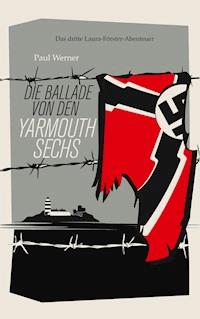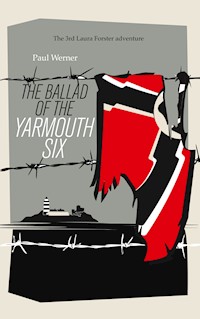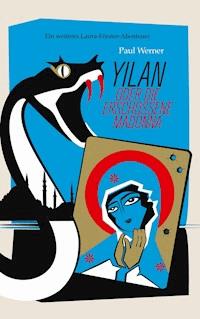Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
"Solang der alte Peter ..." lautet die erste Zeile einer Münchner "Hymne", deren Melodie dem BR seit Kriegsende als Jingle für seine Verkehrsdurchsagen dient. Derselbe mitgeschnittene Jingle wurde 1981 den Eltern der kleinen Ursula Herrmann bei einem knappen Dutzend "Schweigeanrufen" als gespenstische Erkennungszeichen übers Telefon vorgespielt und setzte damit die "Tonart" diesen aufsehenerregenden und in der deutschen Kriminalgeschichte einmaligen Entführungsfalles. Der Autor nimmt die demnächst zu erwartende Entlassung des rechtskräftig verurteilten Täters zum Anlass, alle faktischen und rechtlichen, aber auch die bislang unbeachtet gebliebenen symbolisch-"kreativen" Aspekte der Tat in gewohnter Weise schonungslos kritisch, aber auch immens unterhaltsam zu beleuchten und die überraschenden Ergebnisse seiner unorthodoxen Analyse zum Kaleidoskop eines Verbrechens "nicht wie jedes andere" zusammenzufügen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 273
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
INHALT
ÄSTHETIK DES BÖSEN
A. Kein Delikt wie jedes andere
B. Kein Jahr wie jedes andere
C. Kein Ort wie jeder andere
D. Chronologie der Ereignisse
FALLANALYSE
I. Die Entführung.
1. Der Hinterhalt
2. Die Kiste
3. Die Geisel
II. Die Erpressung
1. Der Ton macht die Musik
2. Wer schreibt, der bleibt
3. Bleicher als blass
III. Die Ermittlungen.
1. Gesetzt den Fall …
2. Susi und der Strolch
3. Wer andern eine Grube gräbt
4. Solon und Gomorrha
5. Im Uhlenhorst
IV. Der Prozess.
1. Alter Wein in neuen Schläuchen
2. Eine verschworene Gemeinschaft
3. Der rauchende Colt
4. Das Geständnis
V. Das Urteil
VI. Das Fazit
„Entweder war der Brunnen sehr tief,
oder Alice fiel sehr langsam, denn
sie hatte genügend Zeit, sich beim
Fallen umzusehen und sich zu fragen,
was wohl als nächstes passieren würde.“
(L. Carroll, Alice im Wunderland, m.Ü.)
ÄSTHETIK DES BÖSEN
Cyber-Crime, Dark Net, Wirecard, Cum-Ex, Clan-Kriege, sexualisierte Gewalt, Kinderpornographie – der heutige Alltag stellt die Ermittlungsbehörden nicht zuletzt dank der rasanten technischen Entwicklung im IT-Bereich vor Herausforderungen, die, so sollte man meinen, ohne ein gerüttelt´ Maß an spezialisiertem Knowhow nicht bewältigt werden können. Kein Feld für analoge alte Männer.
Zu den wenigen strafrechtlich relevanten Bereichen, in denen sich auf beiden Seiten der unsichtbaren Demarkationslinie seit der Sintflut wenig getan zu haben scheint und in denen sich daher weiterhin auch blutige Amateure tummeln, gehört ausgerechnet derjenige mit den weitreichendsten persönlichen Konsequenzen – Gewaltverbrechern.
So paradox das scheinen mag, liegt es doch nur in der Natur der Sache Mensch: seit den Tagen von Kain, Abel & Co ist die Anzahl potenzieller Täter und Opfer zwar exponentiell gestiegen, aber zu einem echten qualitativen Sprung konnte es schon deshalb nicht kommen, weil die Anzahl einschlägiger Motive und Vorgehensweisen bei Gewaltverbrechern kraft unserer physischen Beschaffenheit und psychischen Veranlagung alles in allem in etwa gleichblieb.
Von dieser Warte aus betrachtet, muss die Vielfalt äußerer Erscheinungsbilder solcher Verbrechen sogar noch erstaunen. Ausgeprägte Idiosynkrasien sorgen dafür, dass man sie nicht so einfach in einigen wenigen taxonomischen Schubläden unterbringen kann.
Mit viel Nachsicht und ein wenig Hilfestellung durch Prokrustes lassen sich solche Manifestationen hoher krimineller Energie und nicht zu unterschätzender Risikobereitschaft, dessen ungeachtet, in eine relativ übersichtliche „qualitative“ Rangordnung zwängen, die sich freilich weniger an rechtlichen denn an – im weitesten Sinne – ästhetischen Kategorien orientiert. Das bedarf der Erläuterung.
Ganz unten am Ende meiner zugegeben geschmäcklerischen Skala sind auf diese Weise Straftaten auszumachen, die ein kriminalistisches Tableau allein schon ob ihrer Häufigkeit vermutlich anführen würden.
Das sind Verbrechen, die sich an dumpfer und stumpfer Zerstörungswut kaum noch übertreffen lassen und oft genug aus reiner Langeweile oder im Namen irgendwelcher obskurer Ehrenkodizes sinnlos Leben vernichten, Familien zerstören und Zweifel an den vermeintlichen Errungenschaften der Evolution zu wecken geeignet erscheinen.
Auf der nächsthöheren Stufe begegnen uns Gewalttaten, die das Zeug klassischer antiker Tragödien besaßen, dann aber doch leider zu faden Trauerspielen verkamen. Das lange bekannte Grundproblem formulierte Shakespeare, wer sonst, folgendermaßen: unsere Lebensläufe werden nicht von Könnern wie Sophokles oder Euripides in Szene gesetzt, sondern von einem Idioten erzählt, der das Einmaleins des Gewerbes nicht beherrscht.
Sicher sind wir selbst da auch nicht schuldlos. Aber mal ehrlich: wer von uns hätte nicht dankend abgewinkt, wäre ihm oder ihr gleich bei der Geburt sein / ihr Leben einschließlich dessen Ende im Zeitraffer als „sneak preview“ vorgeführt worden?
Sei´s drum. Auf der obersten Stufe meiner persönlichen Taxonomie thront jene Kategorie von Gewalttaten, die uns noch bei der virtuellen Tatortbesichtigung sofort spüren lassen, dass hier jemand nicht nur blindwütig zerstören, sondern auch kreativ wirken und eine mehr oder minder subtile Botschaft loswerden will. Darauf deutet jeweils die bewusste Herrichtung einer „sprechenden“ Szenerie mit Hilfe von, nennen wir es Kulissen, die weder einem sachlichen Zwang noch der immanenten Logik der jeweiligen Deliktart gehorchen und insofern als „überschießend“ gelten müssen. Sie sind es, die uns das Vorhandensein eines, wenn auch reichlich abartigen Gestaltungswillens signalisieren.
Kriminologen sprechen angesichts solcher Phänomene gern von „Ritualen“, obwohl zu denen quasi konstitutiv die formelhafte Wiederholung gehört, während die von mir anvisierten Vorgehensweisen durch Einmaligkeit gekennzeichnet sind und ihre jeweilige „Botschaft“ weder an alle richten noch jedermann verständlich machen.
Angelegentlich früherer kriminalistischer Seitensprünge sprach ich in meinen „belletristischen Sachbüchern“ daher lieber von „Inszenierungen“, bis mir irgendwann auffiel, dass dieser Begriff in der Kriminalistik bereits auf eine für mich insofern unbrauchbare Weise besetzt ist, als er für gewöhnlich auf Täuschungsmanöver etwa zur Verdunkelung der tatsächlichen Motivlage der Täter angewendet wird.
So können bekanntlich ausgesprochene Beziehungstaten bisweilen durch eine entsprechende Inszenierung als Raub- oder Sexualmord getarnt sein. Eine à priori verlorene Liebesmüh, möchte man meinen, denn wie kann ein nervös-hektisch agierender Ersttäter in Sachen Mord hoffen, durch derlei Manipulationen das geübte Auge eines erfahrenen Kriminalbeamten zu täuschen, der tagein, tagaus mit Mordopfern konfrontiert wird.
Mir hingegen geht es gerade um solche Herrichtungen, kraft derer die Täter nicht täuschen oder tarnen wollen, sondern im Gegenteil beabsichtigen, etwas zu enthüllen, etwas ihnen Wichtiges mitzuteilen.
Dessen eingedenk, möchte ich hier fortan von „Installationen“ sprechen. Nicht im banalen sanitären Sinne des Klempnerladens um die Ecke, sondern im Sinne des breit gefassten Kunstverständnisses eines Pioniers wie Joseph Beuys. Dessen oft mitleidig belächelte Installationen wie „Stuhl mit Fett“ oder „Kombi mit Schlitten“ wurden von vielen Kritikern zumindest anfangs weniger als Kunst denn als Umwelt-frevelnde Straftaten aufgefasst, womit sich der Kreis meiner Beweisführung auf beinahe grazile Weise schließt.
Die leicht morbide Faszination, die für mich von solchen Installationen ausgeht, ist wohl in einer Art „Seelenverwandtschaft“ begründet. Will sagen, die jeweiligen Täter begeben sich mit ihren Narrativen auf meinen ureigenen Turf.
Das Schicksal oder der Allmächtige waren nämlich so gütig, mich in einige der ältesten Berufe der Menschheit hineinschnuppern zu lassen. Zu viel mehr als einer flüchtigen Bekanntschaft kam es meist schon deshalb nicht, weil ich, sobald ich den Dreh rauszuhaben glaubte, prompt das Interesse verlor. Die Routine des täglichen Einerleis überließ ich gern den Morlocks dieser Welt. Eine Haltung, die nur allzu oft mit Arroganz zu verwechseln war und mir daher nicht nur ziemlich beste Freunde bescherte.
Als verhinderter Journalist und professioneller Geschichtenerzähler brüste ich mich bisweilen schamlos damit, den Nukleus einer guten Story schon von weitem ausmachen zu können. Und habe ich den Plot erst mal am Wickel, ist es bis zum Urheber und dessen erzählerischen wie persönlichen Stärken und Schwächen nicht mehr weit.
Laufe ich auf diese Weise nicht Gefahr, in den Vortex der Täter-Narrative gesogen zu werden und nur unter Preisgabe meines mich beschwerenden Analysevorsatzes wieder an die Oberfläche zurückzukehren?
Gemach. Nur wenige Täter beherrschen die Kunst strukturierter Erzählung in solcher Perfektion.
Als professioneller Dolmetscher ebenso wie als Bühnendarsteller beherrsche ich das Mimikry des Lebens, kann in so gut wie jeden Schuh schlüpfen, jeder noch so irren These überzeugend das Wort reden und im Traum so fleißig morden, dass ich am Morgen mit blutigen Händen und fremder DNA aufwache.
Aliene Materien konnte es für mich schon aus beruflichen Gründen nicht geben. Solides Halbwissen, so pflegte mein etwas einfältiger fleischknetender Physio anzumerken, sei besonders gefährlich.
Nicht halb so gefährlich wie das Nachplappern von Platituden, pflegte ich zu entgegnen. Denn erstens durchläuft jeder Lernprozess diese notwendige intermediäre Phase. Zweitens wusste schon Faust, zu vermelden, dass jeder Traum von der Perfektion in Tränen endet und drittens gleicht der Einfaltspinsel, der erst dann Gebrauch von seinem Wissen machen will, wenn er sich dessen absolut sicher ist, der umsichtigen Landratte, die erst ins Wasser zu gehen bereit ist, wenn sie schwimmen kann.
Sogenannte Experten sind nach meiner Erfahrung oft Menschen, die ihr Halbwissen mit wohlklingenden Phrasen aufzublasen gelernt haben wie der Frosch, der gern fliegen wollte und uns Laien in der Gebrauchsanleitung meist nicht mehr als zwei läppische Seiten voraus sind.
Wem das bis hierher alles etwas zu schnell ging und ein wenig abgehoben und blutleer erscheint, dem kann vielleicht anhand des Beispiels zweier grundverschieden gelagerter „Installationen“ aus Doktor Werners Gruselkabinett geholfen werden.
In meiner Monographie Weißer Jiglo, schwarzer Mulo untersuche ich den bis heute jedenfalls amtlich als nicht aufgeklärt geltenden Mord an einem achtjährigen Freiburger Jungen, dessen Leiche im Sommer 2014 an Ufer eines Baches in der Peripherie der Stadt, sozusagen in Sichtweite des örtlichen Polizeipräsidiums gefunden wurde.
Es bedurfte keiner höheren Eingebung, um zu konstatieren, dass sich mit dieser fast schon provokativen Form der Leichenablage ebenso eine Botschaft verband wie mit der kindlichen Person des Opfers selbst und der zu seiner Ermordung nicht ganz zufällig gewählten Tötungsart des Erwürgens mit bloßen Händen. Hier handelte es sich augenscheinlich um eine „Installation“ mit nur zum Teil offenkundiger Botschaft.
Die Komplexität dieses Narrativs resultierte vor allem aus der Zugehörigkeit des Opfers zu einer lokalen Sinti-Sippe, deren Mitglieder sich Außenstehenden nicht ohne weiteres zu öffnen pflegen und auf allzu intensiv bekundetes Interesse gern auch mal körperlich aggressiv reagieren.
Da der „Erzähler“ bei der teilweisen Verschlüsselung seiner Botschaft sehr wahrscheinlich auf die schriftlich jedenfalls von den Betroffenen selbst nirgendwo fixierten Sitten und Gebräuche, die lückenhaft verbriefte Historie und die nur mündlich tradierte Mythologie derer rekurrierte, die man früher einmal „Zigeuner“ nennte, ohne sich viel dabei zu denken, führte kein Analyse-Weg an der intensiven Beschäftigung mit diesem so gewaltigen wie diffusen Korpus der spezifischen Folklore vorbei.
Es gelang mir zwar auch mit Hilfe meiner Methode nicht, Namen und Anschrift des Freiburger Kindesmörders zu eruieren. Immerhin aber glaube ich, die konstitutiven Bausteine seiner „Installation“ identifiziert zu haben.
Der Mann – Täterinnen kamen für dieses Verbrechen nie wirklich in Frage – bediente sich der sogenannten „Zinken“, einer uralten, aus einfachen, an Türen oder Hauswände gekritzelten oder geritzten Zeichen bestehenden Gauner-„Sprache“, mit Hilfe derer Hausierer, Bettler, aber auch Diebe und nicht zuletzt Sinti und Roma einander über den „Status“ eines Hauses oder Anwesens und seiner Bewohner zu informieren pflegten.
So unmittelbar, auf einen Blick verständlich solche Zinken für den engeren Kreis ihrer Adressaten sind, so unleserlich bleibt das oft nicht einmal wahrgenommene „kindliche Gekritzel“ für Außenstehende.
Der Freiburger Täter ritzte nun nicht an Tür und Tor, sondern bemühte sich insofern um ein Upgrade der alten Technik, als er nach Art der „Zinken 2.0“ die natürlichen und künstlichen Details des bewusst gewählten Ablageortes als Kulissen in seine Installation einbezog.
Um diese „Schrift an der Wand“ lesen zu lernen, musste ich den spezifischen Stellenwert dieser Details in der „Zigeuner-Folklore“ bestimmen. Das allein kostete mich Blut, Schweiß und Tränen.
Doch damit nicht genug, rekurrierte der kulturell alles andere als unbelastete Täter beziehungsweise Anstifter nach meinem Eindruck gleichzeitig auf eine personalisierte Zahlensymbolik und „zitierte“ aus Werken modernen filmischen wie musikalischen Schaffens. Eine Charade, die mich auf so manchen Holzweg und in die eine oder andere Sackgasse4 führte, mich aber auch ungemein bereicherte.
Völlig anderer, wenn auch vergleichbar komplexer Natur ist der Fall einer Frau weiterhin unbekannter Identität, deren halb verkohlte Leiche im Dezember 1970 am Rande der norwegischen Hafenstadt Bergen von Wanderern gefunden wurde.
Die Frau war nicht etwa zuerst ermordet und ihre Leiche anschließend zum Zwecke der Einäscherung angezündet worden. Vielmehr hatte man sie offenbar hier, am Rande einer Lichtung stadtnah und doch in beklemmender Ödnis relativ unwegsamen Geländes erst durch einen wohlgezielten Handkantenschlag ins Genick außer Gefecht gesetzt, ihre Schlaftabletten in Mund und Schlund gesteckt wie der Gans die fetten Maiskörner, um sie dann bei lebendigem Leibe zu verbrennen. Was eben nur zur Hälfte gelang.
Auch dies fraglos eine brutale Installation, verbunden mit einer grimmigen Botschaft, deren Entschlüsselung nur über das Narrativ des Opfers führte.
Das erwies sich seinerseits zwar sehr schnell als nachverfolgbar, ergab nur leider zunächst überhaupt keinen Sinn.
Wie ich in meiner diesbezüglichen Monographie Frau in Flammen darlege, war die mysteriöse Frau im Laufe der beiden, ihrer Ermordung vorangegangenen Jahre nach Art eine von ihrer Sippe verstoßene Sintezza mit zwei Köfferchen eines Inhalts, wie man ihn von einer ständig auf Achse befindlichen Dame erwarten konnte, kreuz und quer durch Westeuropa gereist und hatte auf allen damals im Hotelgewerbe gebräuchlichen polizeilichen Meldezetteln Namen und Anschrift sowie die Bezeichnung der Berufe, denen sie angeblich nachging, immer wieder gewechselt und sogar versucht, ihre Handschrift jedes Mal aufs Neue zu verstellen, so dass sie am Ende wahrscheinlich auf Befragung selbst nicht mehr gewusst hätte, wer sie eigentlich wirklich war und vor allem wie viele.
Da sie andererseits aber nie ihr äußeres Erscheinungsbild gewandelt hatte, wurde sie vom Hotelpersonal, das im Rahmen europaweiter Ermittlungen befragt wurde, ohne weiteres anhand des polizeilichen Phantombildes erkannt, nur eben jeweils anders benannt.
Da sie nicht in die Bergener Landschaft passte, kein Wort Norwegisch sprach und durch zahlreiche „Marotten“ auffiel, begann die örtliche Polizei schließlich, am Geisteszustand der Dame zu zweifeln.
Falls die Frau eine Botschaft zu übermitteln hatte, musste diese nach meinem Eindruck in einem ihrer zehn, zwölf Alias-Namen verborgen sein, dessen zuletzt von ihr benutzter sich auch tatsächlich als anagrammatischer Hilferuf entpuppte. Um das erkennen zu können, hätte die norwegische Polizei das Französische als mutmaßliche Muttersprache der Unbekannten schon ziemlich gut beherrschen müssen, was wohl nicht der Fall war.
Die Frau fühlte sich mit anderen Worten nicht nur verfolgt, sondern jemand war ihr tatsächlich in mörderischer Absicht auf den Fersen, so dass viele ihrer „Marotten“ sich als ängstliche Blicke über die Schulter einer Gehetzten erklärten.
Dass sie sich in ihrer Not nie an die Polizei wandte, konnte nur bedeuten, dass sie selbst Dreck am Stecken haben musste, der möglicherweise mit Brandstiftung größeren Ausmaßes zu tun hatte. Ihre Mörder waren vermutlich selbsternannte Racheengel, die sie für den Feuertod ihrer Nächsten und Liebsten verantwortlich machten und ihrem Opfer offensichtlich das gleiche Ende bereiten wollten, das dieses anderen, und sei es auch nur indirekt beschert hatte.
Das sind Cold Cases, die, einmal „ausermittelt“, aufgelassenen Weinbergen ähneln, in denen jeder ad libidum nach dem Gold der Erkenntnis schürfen darf.
Warum sich aber mit einem auch bald ein halbes Jahrhundert alten Fall wie dem der Entführung der damals zehnjährigen Ursula Herrmann widmen, der doch als von Polizei und Justiz erfolgreich aufgearbeitet gelten darf und mit der rechtskräftigen Verurteilung des mutmaßlichen Täters endete?
Letzteres lässt sich auch für den wahrscheinlich berühmtesten, sozusagen stilbildenden Entführungsfall schlechthin, den des Lindbergh-Babys aus dem Jahre 1932 sagen, der sogar mit der irreversiblen Hinrichtung des zum Täter gestempelten deutschstämmigen Kleinkriminellen Bruno Richard Hauptmann zunächst als abgeschlossen betrachtet wurde und dennoch jedenfalls die amerikanische Öffentlichkeit bis auf den heutigen Tag umtreibt.
Sicher, die Bundesrepublik des Jahres 1981 war natürlich nicht die USA der dreißiger Jahre und die Gründe, die meines Erachtens für eine fortwährende Auseinandersetzung mit dem Fall Ursula Herrmann sprechen, sind trotz einiger verblüffender und doch eher zufälliger Parallelen weitgehend anderer Natur.
Erstens beansprucht der Fall dank seiner zahlreichen Alleinstellungsmerkmale selbst in der „exklusiven“ Verbrechenskategorie Kidnapping eine Sonderstellung, die ihn zu einem kriminologischen Studienobjekt und kriminalhistorischem Showpiece erster Güte erhebt.
Zweitens hat der Fall so ziemlich alles zu bieten, was man von einer fesselnden Story mit skurrilen Einschüben erwarten darf. Eine Qualität, von der ich bei aller gebotenen Pietät als Autor nicht so einfach absehen kann.
Und drittens muss man kein leidenschaftlicher Anhänger von Verschwörungstheorien sein, um zu erkennen, dass sowohl die mängelbehaftete polizeiliche Ermittlungsarbeit als auch einige eher fragwürdige Aspekte der prozessualen Aufbereitung dieses Falles in jüngerer Zeit zum Entstehen der Hypothese vom skandalösen Justizirrtum selbst entscheidend beigetragen haben.
Im Kielwasser dieser, nicht zuletzt vom Bruder des Opfers, Martin Herrmann Junior, aus der Taufe gehobenen Hypothese gelang es dem 2010 als Täter rechtskräftig verurteilten Werner M., eine kleine Fangemeinde um sich zu scharen, die unter der Devise „Free Werner“ nicht zuletzt auf dem Netz ohne Boden gegen das Urteil, wenn schon nicht ernsthaft juristisch ankämpft, so doch reichlich dagegen Stimmung zu machen versucht.
Dabei mag bewusst oder unbewusst die jahrzehntlange und immer noch nicht beendete Kampagne gegen das Urteil im Lindbergh-Entführungsfall Pate gestanden haben, das nach Ansicht vieler auch schon zeitgenössischer Beobachter im Rahmen eines jeder Rechtsstaatlichkeit Hohn sprechenden Verfahrens zustande kam und einen „hässlichen“ Deutschen zum wohlfeilen Sündenbock machte. Allein mit dessen Hinrichtung ließen sich damals offenbar die Wogen der öffentlichen Erregung über die beschämend geringe Ausbeute zweijähriger Ermittlungen einigermaßen glätten.
Auch der Münchner Polizei und Augsburger Justiz lief im Fall Ursula Herrmann um die Mitte der Nuller-Jahre allmählich die Zeit davon. Auch hier konnte man durchaus den Eindruck gewinnen, der Verdächtige, Werner M., der, ähnlich dem „ewigen“ Hausmeister Jack Torrance in Stanley Kubricks The Shining immer schon der Hautverdächtige gewesen war, habe den Sündenbock für fast dreißigjährige behördliche Versäumnisse abgeben müssen.
Im Lindbergh-Fall kämpfte die Witwe Hauptmanns bis zu ihrem eigenen Tode in den neunziger Jahren für die Ehrenrettung ihres Mannes, wozu sie wohl auch allen Grund hatte.
Im Falle Ursula Herrmann ist es keine dem mutmaßlichen Täter nahestehende Person, die sich um dessen Rehabilitierung bemüht, sondern, wie gesagt, der ältere Bruder des Opfers. Was seine Kampagne nicht der kritischen Überprüfung entzieht.
So dringlich, wie die Anklageerhebung auf dem Hintergrund des drohenden Ablaufs der Verjährungsfrist damals, 2007 / 2008, ohne Zweifel war, so rechtzeitig erscheint die „Free Werner“-Kampagne deshalb, weil sich demnächst eine aus Juristen, Strafvollzugsbeamten, Soziologen und Psychologen gemischt besetzte Lübecker Strafvollzugskammer der Frage zu stellen haben wird, ob dem zu lebenslanger Haft verurteilten Werner M. nach Verbüßen jener berühmt-berüchtigten 15-Jahresfrist die „Reststrafe“ guten Gewissens zur fünfjährigen Bewährung ausgesetzt werden kann und der Mann, sein eigenes Einverständnis vorausgesetzt, auf freien Fuß zu setzen ist. Da kann es zumindest nicht schaden, früh genug „gut Wetter“ zu machen.
Aber das ist nicht mein Problem und schon gar nicht mein Anliegen. Ich habe hier nicht zu plädieren, sondern versuche, mit kühlem Blick, wiewohl nicht ohne Empathie für das Opfer, als dessen verspäteter Sachwalter ich mich verstehe, die Dinge zu analysieren.
Ob das aus den Details seiner Vorgehensweise gewonnene Profil des Täters eine hinreichende Anzahl von Schleifen, Bögen und Wirbeln mit dem Persönlichkeitsbild des Werner M. teilt, um von einer „begründet“ kaum noch anzuzweifelnden Identität beider sprechen zu können, wird sich am Ende zeigen.
Die banale kaufmännische Erwägung, dass sich mein Büchlein ungleich besser verkaufen ließe, wenn es in entsprechend marktschreierischer Aufmachung das Lied jener singen würde, die von einem unerhörten Justizskandal berichten zu können glauben, sollte ausreichend Gewähr dafür bieten, dass eine etwaige Voreingenommenheit meinerseits sich zumindest schon mal nicht gegen Werner M. richten würde.
Doch bevor wir medias in res gehen, gilt es zunächst, uns auf eine gemeinsame Sprachregelung zu einigen, ohne die wir Gefahr laufen, gepflegt aneinander vorbeizureden.
Wenn etwas geeignet erscheint, uns in diesem Bemühen zur Hand zu gehen, dann wohl der oft scherzhaft zitierte Blick auf den Wortlaut der einschlägigen Gesetze.
Und siehe da, Der erweist sich auch an dieser Stelle als besonders lohnend, weil es der sogenannte „erpresserische Menschenraub“, wie wir sehen werden, faustdick hinter den Ohren hat.
A. Kein Delikt wie jedes andere
Wer einen Menschen entführt oder sich eines Menschen bemächtigt, um die Sorge des Opfers um sein Wohl oder die Sorge eines Dritten um das Wohl des Opfers zu einer Erpressung (§ 253) auszunutzen, oder wer die von ihm durch eine solche Handlung geschaffene Lage eines Menschen zu einer solchen Erpressung ausnutzt, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren bestraft. (§ 239a/1 StGB)
………
Verursacht der Täter durch die Tat wenigstens leichtfertig den Tod des Opfers, so ist die Strafe lebenslange Freiheitsstrafe oder Freiheitsstrafe nicht unter zehn Jahren. (§ 239a/3 StGB)
Verspricht der kernige Gesetzestitel des oben zitierten Paragraphen 239a StGB, „erpresserischer Menschenraub“, fast schon so etwas wie eine pralle Räuberpistole mit aller Drum und Dran, so ist der doch recht sperrige Text von dessen erstem Absatz geeignet, den erwartungsfrohen Leser schlagartig zu ernüchtern.
Man mag das als exemplarisch für die Lehre vom Recht im Allgemeinen und die vom Strafrecht im Besonderen halten oder auch nicht – Tatsache ist, dass uns derlei Titel die urbayrischen Wurzeln des deutschen Strafrechts immer mal wieder mahnend ins Gedächtnis rufen. Sich dann und wann seiner Anfänge zu besinnen, hat wohl noch niemand geschadet, jemand wesentlich weitergebracht allerdings auch nicht unbedingt.
„Erpresserischer Menschenraub“ kann bei näherer Begutachtung Spuren semantischen wie rechtssystematischen Schädlingsbefalls nicht verhehlen, macht aber als zünftiger Aufhänger ungleich mehr her als die vergleichsweise blutarme und auch nicht eben süffige „Entführung zum Zwecke der Lösegelderpressung“, die gut und gern als anspruchsvoller Titel einer Gebrauchsanleitung durchgehen würde.
Hüben wie drüben wird jedenfalls bereits aus der Formulierung deutlich, dass wir es mit einem zusammengesetzten Delikt zu tun haben, dessen zweiphasige Struktur sich rein begriffsbildungstechnisch beispielsweise mit dem „Einbruchsdiebstahl“ vergleichen ließe.
Von diesem unterscheiden sich die Tatbestandsmerkmale des § 239a allerdings nicht nur durch ihren offensichtlich viel größeren Unrechtsgehalt, sondern auch durch ihre zeitliche Dehnung. Eine reine Äußerlichkeit, so schein es, die aber bei genauerem Hinsehen strukturrelevant ist.
Kann schon der Entführungsteil des Delikts, je nach den Umständen des Einzelfalles, eine für die Begehung von Straftaten im Allgemeinen eher unüblich lange Zeit in Anspruch nehmen, gilt das erst recht für den Erpressungsteil, dessen prekärer Schwebezustand sich bisweilen über Tage, Wochen und mehr hinzieht.
So wurde ein Enkel des Zeitungsverlegers Axel Springer bei seiner Entführung Mitte der achtziger Jahre stundenlang in den Kofferräumen mehrerer Autos zum Zwecke seiner Desorientierung scheinbar durch die halbe Republik gefahren, bis seine Kidnapper endlich am Ort der vorübergehenden Gefangennahme angekommen waren.
Und ein in Italien gekidnappter Enkel des amerikanischen Milliardärs Paul Getty befand sich geschlagene fünf Monate in der Hand seiner kalabrischen Entführer, bis man sich endlich mit Opa auf die Höhe des Lösegeldes geeinigt hatte.
Was unsere Aufmerksamkeit auf zwei weiteres Kennzeichen dieser Deliktart lenkt – Anzahl und Status der Opfer.
Als Geisel, die ich hier „Primäropfer“ nennen möchte, kommen für die meisten Kidnapper entweder Kinder oder körperlich eher schwach konstituierte Personen in Frage, von denen wenig bis gar keine physische Gegenwehr zu erwarten ist. Was sich nicht unbedingt in einer umso schonenderen Vorgehensweise der Täter niederschlägt.
Auf eben diesen Sachverhalt nimmt der englischsprachige Terminus „Kidnapping“ Bezug, der das Schreckbild eines mitten in der Nacht aus seinem Bettchen gerissenen und entführten Kleinkindes nach dem Muster des Lindbergh-Falles oder dem des deutschen „schwarzen Mennes“ evoziert, der in den neunziger Jahren des nachts Kinder aus Jugendherbergen und Landheimen verschleppte – wenn auch nicht mit dem Ziel der Lösegelderpressung.
Durch die Erpressung werden nicht nur die Geisel als Primäropfer in Mitleidenschaft gezogen, sondern auch deren Nächste, die ich als „Sekundäropfer“ bezeichnen will, zur Mitwirkung gezwungen.
„Erpresserischer Menschenraub“ könnte den Eindruck erwecken, als handele es sich hierbei rechtssystematisch um eine besonders schwere Form der Erpressung, im Rahmen derer das erforderliche Drohpotenzial nicht etwa durch den legalen oder illegalen Erwerb beispielsweise vitaler geschäftlicher oder peinlicher privater Geheimnisse, sondern durch den „Raub“ eines nahestehenden Menschen geschaffen wird.
Dem ist nicht so. Kern dieses zusammengesetzten Tatbestandes ist und bleibt die freiheitsberaubende und damit potenziell die körperliche Unversehrtheit der Geisel gefährdende Entführung. Die sich in aller Regel „nur“ gegen Vermögenswerte der Geisel selbst oder deren Nächste richtende Erpressung gehört wegen ihres geringeren Unrechtsgehalts eigentlich ans Ende dieses gedanklichen Kompositums, der „reißerische“ Titel mit „Entführung zum Zwecke der Lösegelderpressung“ vom Kopf auf die Füße gestellt.
Mal ganz abgesehen davon, dass wir „Menschenraub“, von dem auch im problematischen Verhältnis der beiden deutschen Staaten oftmals die Rede ging, heutzutage eher im ethnisch-völkerrechtlichen Zusammenhang der Verschleppung von Kindern oder weiteren Teilen der Zivilbevölkerung besetzter Gebiete verwenden.
Wenn der von den Entführern angestrebte „Erfolg“ – im strafrechtlichen Sinne – eintreten soll, muss eine Brücke der Kommunikation von Phase eins zu Phase zwei geschlagen werden. Mit diesem Zwang zur Kontaktaufnahme, dem die Täter unterliegen, korrespondiert auf Seiten der Sekundäropfer eine Mitwirkungspflicht in Gestalt der Bereitstellung des geforderten Lösegeldes.
In dieser notwendigen Wechselseitigkeit liegt ein weiteres Kennzeichen der Deliktart, der zugleich als ihr erster neuralgischer Punkt gelten muss. Die zweite und meist noch kritischere Sollbruchstelle ist offensichtlich der Moment der Lösegeldübergabe.
Wie oft Kommunikation auch ohne individuelles Verschulden schon im banalen Alltagsgespräch scheitert, wissen wir alle aus unserem privaten oder beruflichen Erleben. Strenggenommen sind nur erstaunlich wenige von uns wirklich in der Lage, mündlich oder schriftlich genau das zum Ausdruck zu bringen, was sie tatsächlich meinen. Es gehört zu den ausgesprochen merkwürdigen und beängstigenden Phänomenen dessen, was wir Sprache nennen, dass sich die Wörter auch ohne die Mitwirkung Dritter in unserem Munde oder auf dem Papier liebend gern gegen uns zu wenden scheinen, als könnten sie Gedanken lesen und wüssten daher besser, was wir eigentlich auf dem Herzen haben. Dann kramen sie aus der Mottenkiste unseres oft sehr beschränkten Wortschatzes Ausdrucksformen hervor, die dies gegen unseren erklärten Willen erkennen lassen.
Denken wir uns jetzt noch den Stress aller Beteiligten einer Entführung / Erpressung hinzu, potenziert sich die Gefahr von Missverständnissen und daraus resultierenden Pannen dramatisch.
Bei der Abwägung von Quantität und Qualität der Kommunikation müssen beide Seiten äußerste Vorsicht walten lassen. Täter dürfen keinen Zweifel an ihrer Entschlossenheit zur Durchsetzung ihrer Forderungen aufkommen lassen, sollten aber jedes Wort wägen, um der Polizei nicht ungewollt Hinweise auf ihre Identität zu geben.
Die Sekundäropfer können versuchen zu feilschen, dürfen aber keine Zweifel an ihrer grundsätzlichen Zahlungswilligkeit wecken. Jeder noch so winzige falsche Zungenschlag hüben oder drüben kann die Transaktion zum Nachteil der in diesem Austausch allein weitgehend handlungsunfähigen Geisel zum vorzeitigen Scheitern bringen.
Aber auch die vorübergehende Allmacht der Kidnapper hat ihre Grenzen, denn darüber, ob man ihrer Forderung nach der Nicht-Einschaltung von Ermittlungsbehörden nachkommt oder nicht, haben sie jedenfalls bei deren geschicktem Verhalten so gut wie keinerlei Kontrollmöglichkeit.
Diese Art Hängepartie kann auf beiden Seiten zu einer nervlichen Überforderung führen, die sich umso schneller einstellenwird, als weder Täter noch Sekundäropfer vermutlich je zuvor mit dieser Deliktart in Berührung gekommen sind und es für derlei Premieren nur wenige allgemein verbindliche Verhaltensregeln geben kann. Unter den Folgen dieser Überforderung und eventuell daraus resultierenden Kurzschlusshandlungen leiden wird erneut stets die sozusagen immobilisierte Geisel.
Was uns zu einem weiteren Kennzeichen der Entführung als Deliktsorte sui generis führt: der generell mangelnden „Eignung“ und Erfahrung der Täter, deren Ungeschicklichkeiten gerade im Bereich Kidnapping zu auffallend häufigen Pleiten, Pech und Pannen führen.
Entführungstäter sind oft mit vielerlei „Gassen“ vertraute Kleinkriminelle oder gar bislang unbescholtene Ersttäter, denen mindestens zwei Eigenschaften gemein zu sein pflegen: nackte finanzielle Not und die Illusion, mit der Entführung eine Deliktart ausgemacht zu haben, die ihnen eine Gewähr dafür bietet, auf relativ risikoarmem Wege hohe Erträge erzielen zu können.
Diese an der Börse des Lebens selten aufgehende Gleichung erweist sich auch im Verbrechen meist als Milchmädchenrechnung. Überfälle auf Banken oder Geldboten sind in der Regel mit der Androhung von Waffengewalt verbunden und setzen ein gewisses Know-how voraus, das man sich durch „Übung“ oder das Absolvieren einer regelrechten „Lehrzeit“ an der Seite erfahrener Gangster aneignen kann.
Entführungen sind auch schon mit etwas List und Tücke möglich, bedürfen jedenfalls nicht unbedingt der Androhung von Waffengewalt und reduzieren so die Gefahr fü die Kidnapper, bei der Tatausführung selbst schwer verletzt oder gar ums Leben gebracht zu werden. Eine Zeit der „Lehre“ oder des Anlernens ist hier, bei der klassischen „Einmal-Tat“ Entführung, nicht möglich, scheint aber á Priori auch nicht erforderlich.
Denn was soll schon schiefgehen? Der schwächlichen Geisel wird man schnell habhaft und deren Nächste werden das Lösegeld schon irgendwie aufbringen und berappen.
Geradezu systematisch von vielen Tätern verdrängt wird dabei die auch ihnen fraglos aus dem Alltag bekannte Erfahrung, dass so gut wie nichts je im ersten Versuch so klappt, wie sie es sich vorgestellt hatten. Viele Schüsse gehen erst mal in den Ofen, einfach, weil die Risikofaktoren entweder nicht richtig eingeschätzt oder ignoriert wurden.
Warum sollte das ausgerechnet bei einer so relativ komplexen Tat wie der Entführung / Erpressung anders sein? Welche Probleme logistischer und psychischer Natur sie sich mit dem Kidnapping tatsächlich aufgehalst haben, merken Täter meist erst spät und sind dann geneigt, kopflos zu reagieren.
Dieses beinahe zwangsläufige Kausalverbindung illustriert gewissermaßen im Zeitraffer das Beispiel der Entführung und Ermordung des Eustachius Hell im Jahre 1976.
Der Kidnapper dieses, damals sechsjährigen Jungen stand nach eigener Aussage kurz vor der Verübung eines Bankraubes, als ihm, der er quasi schon mit der Hand an der Schusswaffe vor dem Schalter stand, das Herz in die Hose sank und er nach dem Verlassen der Bank spontan entschied, stattdessen den Jungen zu entführen, der das Pech hatte, zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort zu sein.
Als die Geisel ihn bereits nach wenigen Stunden mit kindlichem Gequengel tierisch zu nerven begann, brachte er den Knaben um, noch bevor es zu einer Kontaktaufnahme mit dessen Eltern kommen konnte.
Dass die mangelnde Erfahrung der Täter also eine eher schlechte Nachricht für die potenziellen Geiseln ist, macht sie noch nicht zu einer wirklich guten für die Ermittlungsbehörden.
Denn erstens hinterlassen auch ungeübte Täter nicht zwangsläufig auch verwertbare Spuren und zweitens laufen vorhandene Spuren immer dann gern ins Leere, wenn die betreffenden Täter bislang keinen Anlass zu erkennungsdienstlicher Erfassung gegeben haben. Folglich bläst man, wie im Fall Ursula Herrmann durchdekliniert, reflexhaft zu einem groß angelegten Halali und hofft im Stillen auf den berühmten Zufallstreffer.
Natürlich bin ich mir des Umstandes bewusst, dass es topographisch und sozio-ökonomisch dazu wie geschaffene Regionen in Europa und der Welt gibt, in denen eine an sonstigen Erwerbsquellen arme Bevölkerung Entführungen neben Drogenschmuggel zu einem regelrechten Gewerbe erhoben haben.
Dieses Phänomen ist jedoch nicht allein kriminologischer Natur, sondern historischen, soziokulturellen, ökonomischen und anderen Phänomenen geschuldet, die ebenso wenig Gegenstand dieser Analyse sind wie etwa die Entführung zur ausschließlichen Befriedigung des Geschlechtstriebes oder der Mordlust, die Kindesentführung mit dem alleinigen Ziel, den Nachwuchs dauerhaft der Verfügungsgewalt eines der beiden leiblichen Elternteile zu entziehen, die Entführung von Leichen wie derjenigen Charly Chaplins Ende der siebziger Jahre oder die Geiselnahme im politisch-zivilen oder politisch-militärischen Zusammenhang.
Den meisten dieser verschiedenen Erscheinungsformen, die in den für Nuancen wenig empfänglichen Medien oft unterschiedslos als „Entführung“ etikettiert werden, ist zwar das Tertium des rechtswidrigen Freiheitsentzuges gemein. Doch weisen sie schon auf den zweiten Blick derart viele Unterschiede im Detail auf, dass jeder Versuch, sie als Mitglieder ein und derselben „Großfamilie“ zu behandeln, keinen wesentlichen Erkenntnisgewinn verspricht.
In unseren „gemäßigten“ Breiten sind schon Serienmörder glücklicherweise eher selten und Serienentführer so gut wie unbekannt. Daran ändert auch die kriminalhistorisch belegte Geschichte vom Vater und Sohnemann nichts, die Mitte der neunziger Jahre erst einen kleinen Jungen und einige Zeit später nach der offenbar missverstandenen Devise „einmal ist kein Mal“ dessen wohlhabenden Frankfurter Onkel entführten und ermordeten, weil die Lösegeldübergabe nicht so lief, wie man es sich vorgestellt hatte und die Polizei den Tätern dicht auf den Leib zu rücken drohte.
Die beiden abartigen Kidnapper in Scott Franks Film A Walk Among the Tombs (dt. „Ruhet in Frieden“, 2014) agieren aus einer gemischten Motivlage heraus, die hoffentlich nur Fiktion bleibt und jedenfalls hier nicht zur Diskussion steht.
Ursula Herrmann wurde zwar nicht im strengen Sinne ermordet, kam aber durch das Verschulden ihrer Entführer zu Tode, was den ebenfalls oben zitierten Text des Absatzes 3 des § 239a StGB auf den Plan ruft.
Dessen Formulierung bedient sich des adverbial verwendeten Adjektivs „leichtfertig“, dem an der Nasenspitze anzusehen ist, dass es sich nicht um einen streng juristischem sondern einen eher gemeinsprachlichen Begriff handelt. Was, so fragt man sich, sprach gegen das bewährte „fahrlässig“?
Im Gegensatz zu „leichtfertig“ oder vergleichbaren Adjektiven / Adverbien besitzt die Fahrlässigkeit einen juristischen Stammbaum, der ihre Verwendung an dieser Stelle unmöglich macht.Die Legaldefinition im § 276 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) bezeichnet Handeln (oder Unterlassen) dann als „fahrlässig“, wenn dabei „die im Verkehr erforderliche Sorgfalt“ außer Acht gelassen wurde.
Obwohl das Strafrecht einem strengen Analogieverbot unterliegt, scheut es sich als echter Opportunist nicht, dort, wo es ihm angeraten erscheint, in benachbarten Revieren wie hier im Zivilrecht zu wildern.
Dass der Begriff für die Qualifikation anderer Deliktformen als der sogenannten „fahrlässigen Tötung“ im Sinne des § 222 StGB ungeeignet ist, zeigt etwa das konkrete Beispiel einer mit überhöhter Geschwindigkeit durch eine geschlossene Ortschaft heizenden PKWs, dessen Fahrer den Wagen nicht mehr rechtzeitig vor dem Zebrastreifen zum Stoppen bringen kann, so dass ein Fußgänger tödlich verletzt wird.
Hätte der Fahrer die im Verkehr – hier konkretisiert als Straßenverkehr – erforderliche Sorgfalt walten lassen, seine Geschwindigkeit entsprechend an die Verkehrssituation angepasst und jedenfalls die zulässige Höchstgeschwindigkeit nicht überschritten, hätte er den Fußgänger sehr wahrscheinlich nicht am Bein erwischt, so dass es unter dem Strich bei einer rechtlich völlig unerheblichen banalen Ortdurchfahrt geblieben wäre. Die Fahrlässigkeit also ist mit anderen Worten, das die Strafwürdigkeit der Handlung begründende und damit entscheidende Element.
Auf den Tatbestand Entführung mit Todesfolge projiziert, würde die Verwendung des Begriffes „fahrlässig“ im Umkehrschluss bedeuten, dass ein Kidnapping als solches rechtlich unbedenklich wäre und erst durch die fahrlässige Herbeiführung der Verletzung oder des Todes der Geisel zur Straftat würde, was zweifellos weder im Sinne des Gesetzgebers wäre noch im Interesse potenzieller Geiseln läge.
Um uns, mit diesen grundsätzlichen Erwägungen gewappnet, an die Analyse den besonderen Umstände des Falles Ursula Herrmann wagen zu können, sollten wir, die wir hunderte Kilometer vom Ort und rund vierzig Jahre vom Zeitpunkt der Handlung entfernt sind, uns im nächsten Schritt bemühen, das Geschehen in seinen raum-zeitlichen Zusammenhang zu bringen und uns selbst auf einen echten time warp einlassen.