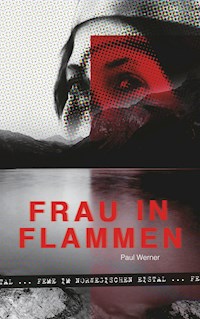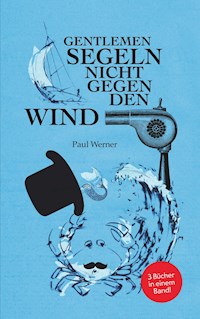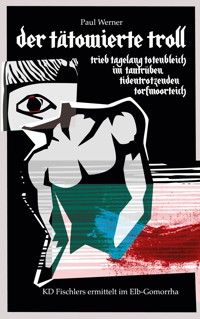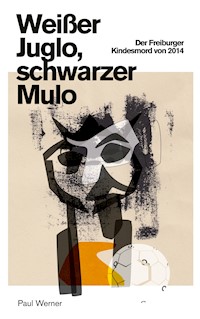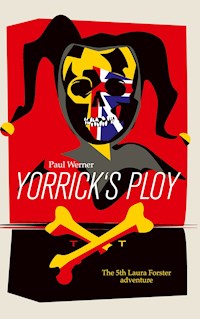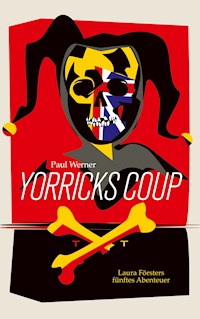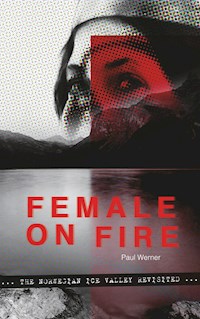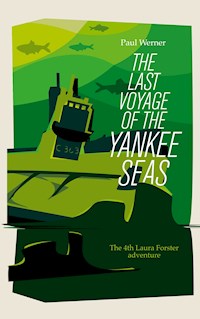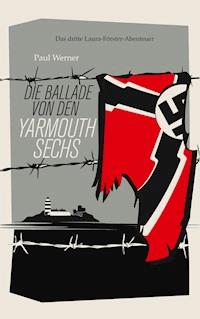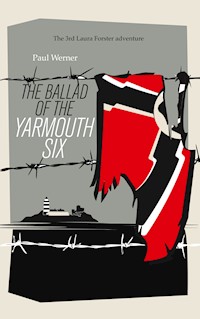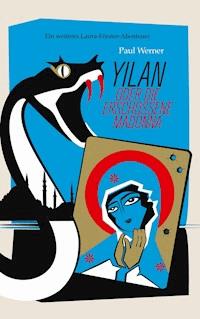
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Laura Förster Trilogie
- Sprache: Deutsch
In diesem zweiten Band der "L.-F."-Trilogie wird eine als erfolgreiche Unternehmerin und Ziehmutter des kleinen Ignace jun. gereifte Laura Förster aufs Neue von ihrem Erzfeind Hakan dem Leisen aus ihrer Hamburger Komfortzone aufgescheucht. Diesmal geht es auf der Jagd nach der legendären Ikone der Erschossenen Madonna, für deren Wiedererlangung weder Griechen noch Russen und schon gar nicht der so mysteriöse wie skrupellose Verbrecher, der sich die Schlange nennt, vor Mord und Totschlag zurückschrecken. Erneut gerät Laura nicht zuletzt durch die Intervention ihrer "schrecklichen" Schwester Solitaire zwischen die Fronten und wird diesmal kreuz und quer durch die Ägäis gehetzt. Die packende Handlung kulminiert in der Stadt der Städte, dem irrlichternden Schmelztiegel europäischer, arabischer und asiatischer Völker, Religionen und Kulturen namens Istanbul. Von den Ufern des Bosporus nur einen Steinwurf entfernt, liegt das "vergessene" Archipel der sogenannten Prinzeninseln im Marmarameer. Auf deren größter, Büyük Ada, befindet sich ein riesiges hölzernes, inzwischen halb verfallenes griechisches Waisenhaus. In diese unheimliche Arche der Verlorenen Seelen müssen Laura und Solitaire sich zur Geisterstunde begeben, um den tödlichen Showdown mit der Schlange zu bestehen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 536
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
ERSTES KAPITEL
Der Professor
Im Taborlicht
Der dritte Passagier
ZWEITES KAPITEL
Ein unerwarteter Anruf
Der Riese
Die Festung
DRITTES KAPITEL
Die Erschossene Madonna
Neues vom Meister
Die Achterbahn
VIERTES KAPITEL
Teufels Beitrag
Der Inquisitor
Das Wappen
FÜNFTES KAPITEL
Noch in selbiger Nacht
Die Dominikaner
Unternehmen Baklava
SECHSTES KAPITEL
Der lauschende Kontrabass
Die rote Kapelle
Das Dreckige Dutzend
SIEBTES KAPITEL
Der Leuchtturm
Der Neue Mensch, eine Rückrufaktion
Orpheus’ Kinder
ACHTES KAPITEL
Der Ferman
Der Archipel des Vergessens
Der Schacht
NEUNTES KAPITEL
Die Ratte
Der Aufzug
Die Arche der Verlorenen Seelen
ZEHNTES KAPITEL
November Rain
Die tanzenden Derwische
Steuerbord heim
ERSTES KAPITEL
1. Der Professor.
Die verstohlenen Blicke, die der bärtige, hagere, hoch aufgeschossene Calogero im Kafeneion zu den Drei Brüdern auf sich zieht, sind nicht allein seiner asketischen Gestalt und seinem ungewöhnlichen Aufzug geschuldet. Außerhalb der Grenzen des Athos fällt ein Mann wie er in weißer Tunika mit breitem schwarzem Stoffgürtel, einer schwarzen Capa und den nur von einigen ausgefransten Bastbändseln zusammengehaltenen Sandalen unweigerlich auf, gar keine Frage. Doch schließlich müssen selbstentsagungsvoll lebende Einsiedler dann und wann die Heilige Schrift und die neunschwänzige Katze der Selbstgeißelung beiseitelegen und die vertraute Umgebung ihrer wie ein Seeschwalbennest in schwindelnder Höhe an die senkrecht ins Meer abfallende Felswand gehefteten Zelle verlassen. Sei es, um einen Arzt aufzusuchen, bei einer Behördengang vorbeizuschauen oder den zur Neige gehenden Lebensmittelvorrat zu ergänzen.
Ein Calogero jedoch, der den mühevollen Abstieg ins Dorf allem Anschein nach auf sich nimmt, nur, um nicht auf seinen morgendlichen Espresso verzichten zu müssen, den sie hier sketo, also Kaffee „ohne alles“ nennen, muss wissen, dass sein Auftritt bei den für jedwede Abwechslung dankbaren Dorfbewohnern unweigerlich zum Tagesgespräch wird. Ob die tuschelnden und grinsenden Dörfler mit der Kleiderordnung der Einsiedlermönche soweit vertraut sind zu erkennen, dass es sich bei diesem Calogero um einen Professor, sprich einen Vertreter seiner Zunft auf dem Sprung zum sogenannten Vollkommenen handelt, darf bezweifelt werden.
Bei genauerer Betrachtung reduziert sich seine Gegenwart ohnehin auf die bloße Physis. Den Kopf fast gänzlich in der Kapuze seiner Capa vergraben, scheint sich der Professor in das Schneckenhaus tiefenentspannter Meditation zurückgezogen zu haben, so dass die seichte Aufgeregtheit der Welt an ihm abprallt. Weder die aufdringlich plärrende Theodorakis-Musik vom roten „Bluhu-hut“, das den Lippen der Geliebten beim Kuss ihren bitteren Geschmack verleiht, noch das Gemurmel, Geklapper oder die gelegentlichen halblauten Lachsalven seiner Tischnachbarn stören ihn augenscheinlich. Nicht einmal das Geschrei und Gejohle der gegenüber auf dem Hof der verlassenen Schule bolzenden Kinder scheinen an sein Ohr zu dringen. Er hat seinen unbequemen hölzernen Stuhl leicht nach hinten gegen die weiß getünchte Wand gekippt, so dass sein rechter Fuß vorübergehend die Funktion eines der beiden vorderen Stuhlbeine übernimmt, während sein linker in der Luft baumelt. Vor einer Stunde etwa hat der jüngste Spross des letzten überlebenden der Drei Brüder unter dem Gelächter der Gäste einen Glasperlen-Rosenkranz oder Komvoloi über den hochragenden großen Zeh des Professors drapiert, aber selbst dieser alberne, an Blasphemie grenzende Streich hat den Mann nicht aus der unermesslichen Tiefe seiner Gedanken – oderreißen können.
So sitzt der Mann weiterhin am äußersten linken Rand der Terrasse regungslos auf der Kippe. Würde sich sein schwarzer Wollgürtel über dem diskreten Anflug von Bauch nicht regelmäßig heben und senken, könnte man annehmen, der Professor, der vermutlich seit langem allem Weltlichen den Rücken gekehrt hat, sei an diesem Morgen hierhergekommen, um nicht auch in Einsamkeit zu sterben.
Die Natur selbst verzweifelt vermutlich am schier unerschöpflichen stoischen Potenzial dieses Mannes. Falls ihm die flimmernde Mittagshitze unter seiner schwarzen Kapuze zusetzt, wovon eigentlich auszugehen sein dürfte, lässt sich der seltsame Calogero auch derlei natürliche Unbill nicht anmerken. In dem Maße, da die Sonne zügig dem örtlichen Meridian zustrebt, verkürzt sich der Schattenwurf der Platane, der dem Professor bis vor kurzem noch angenehme Kühle spendete. Hätte er seinen rechten, bis zu den Fingerspitzen von der Capa verhüllten Unterarm nicht auf den wackligen kleinen runden Tisch gestützt, würde der Professor vermutlich nach und nach wie der Schattenstrich einer Sonnenuhr an der weißen Wand entlang allmählich von der Zwölf auf die Zwei gleiten.
Immer wieder lassen sich laut summende, metallisch mattblaue Schmeißfliegen und die eine oder andere auf Krawall gebürstete Wespe auf seinen lieblos gestutzten, ungepflegten und da und dort eingerissenen Fingernägeln nieder, ohne auch nur ein leises Zucken zu provozieren. Die Spitzen seiner Mittel- und Zeigefinger ruhen auf einer zerknüllten Papierserviette, die der Wirt ihm zu seinem sketo dagelassen hat. Wie jeder Kaffee wird auch dieser ungefragt von einem Glas inzwischen stark getrübten lauwarmen Wassers begleitet, an dessen Oberfläche sich eine dünne Schicht feinen Platanen-Haarstaubs gebildet hat, der sich wie Asbestfasern tief in Bronchien und Lungen einnisten und dafür empfänglichen Menschen äußerst hartnäckigen Husten verursachen kann.
Ein sanfter Windhauch, kaum stärker als der Luftwirbel eines schlagenden Schmetterlingsflügels, streicht plötzlich wie ein behutsames Zupfen an einer Saite der Äolsharfe durch das großblättrige Laub der Platane und lässt die Papierserviette erzittern. Sogleich kommt Bewegung in den Mann. Mit einem Ruck hebt sich sein Kopf in der Kapuze und lässt sein bislang auf die Brust gesenktes bärtiges Kinn erscheinen. Sein Rücken löst sich von der Fassade, an die er eben noch angeleimt schien. Mit entschlossenem Stampfen übernehmen die vorderen Stuhlbeine wieder ihre Funktion. Als der Professor auf diese Weise nach vorn katapultiert wird, rutscht die Kapuze ein wenig weiter nach hinten und gewährt einen kurzen Blick auf die Gesichtszüge des mit einer Tonsur versehenen Calogero. Das wachsbleiche Antlitz war offenbar schon lange nicht mehr der Sonne ausgesetzt und gliche einer von Meisterhand aus parischem Marmor gehauenen Totenmaske, wären da nicht die lebhaften, wachsam die Kundschaft auf der Terrasse taxierenden Augen. Die dichten, buschigen Brauen waren wohl ursprünglich zusammengewachsen, werden aber nun von einer vertikalen Narbe getrennt, die sich von der Nasenwurzel bis zu jenem Punkt auf dem Schädel zieht, an dem sich bei Männern mit voller Haarpracht üblicherweise der Scheitelansatz befindet.
Rasch sind Schädel und Gesicht auch schon wieder in der Kapuze versunken. Die beiden Fingerspitzen des Mannes geben die Papierserviette achtlos frei, die sogleich von einer zweiten, schon merklich heftigeren Brise vom Tisch geweht wird. Der Professor erhebt sich von seinem hölzernen Stuhl, der sich, vom Gewicht des Mannes befreit, ächzend und knackend in seine vorherige Form zurückbiegt. Auch der Calogero reckt und streckt sich, als müsse er den Knochen seiner imposanten Anatomie ihren angestammten Platz zuweisen, die zusammengeschnurrten Bänder dehnen und die steifen Gelenke ölen. Mit seiner Linken zieht er einen schlabbrigen Geldschein aus einer der zahlreichen Innentaschen, mit denen seine Tunika ausgestattet sein dürfte und schiebt ihn unter das überschwappende Wasserglas. Erst jetzt bemerkt er den Komvoloi um seinen Zeh, schüttelt missbilligend den Kopf, hebt ihn auf und steckt ihn zerstreut ein. Dann schreitet er gemessenen, aber dank seiner schieren Beinlänge raumgreifenden Schrittes auf leise schmatzenden, Oblaten-dünnen Sohlen über die glänzenden, glatten Marmorplatten, mit denen das abschüssige Gässchen gepflastert ist, von dannen. Während der feine Platanenstaub wie nuklearer Fall-out auf seine Kapuze und Schultern rieselt, steuert er die tiefer gelegene Ortsmitte und den Hafen an.
Kaum ist er um die erste Ecke gebogen, die ihn abrupt den Blicken der im Kafeneion verbliebenen Landsleute entzieht, erheben sich wie auf Kommando zwei Männer, die bis jetzt auf der anderen Seite der Terrasse gesessen haben. In ihren abgewetzten Jeans und karierten kurzärmeligen Hemden geben sie den textilen Gegenentwurf zum Calogero ab und entlarven sich zugleich als Touristen. Angesichts ihres auffälligen Verhaltens könnte ein unvoreingenommener Beobachter durchaus den Eindruck gewinnen, sie folgten dem Professor auf dem Fuße.
Als das kahlköpfige und graubärtige letzte Exemplar der Drei Brüder seines Amtes waltet und den Tisch des Calogero abräumt, bückt er sich auch nach der Serviette, hebt sie auf und entfaltet sie wie einen an ihn adressierten, aber dem schlampigen Postboten aus der Tragetasche geglittenen Brief. Seine Neugier hat Methode.
Die Funktion des Zuträgers und informellen Mitarbeiters der Obrigkeit gehört in den Städten traditionell zum Leistungsumfang der lokalen Kioskbesitzer, die genau darauf achten, welcher Stammkunde welche Zeitung zu lesen pflegt. Der Umstand, dass sich das gemeine Volk seit Jahren sowieso kaum Zeitungen leisten kann, erleichtert den Überblick.
Auf den Inseln und Dörfern des Festlands fällt diese Aufgabe je nach augenblicklicher Konjunktur und politischer Couleur den Popen oder den Tavernen-Besitzern zu. Diesmal freilich scheint sein Befund dem Wirt Probleme zu bereiten. Die Notiz, die der Calogero auf der Papierserviette hinterlassen hat, ist ausgesprochen kryptischer Natur: Yıan steht da nur. Ein einziges Wort, nicht einmal korrekt geschrieben. Dem Wirt ist die lateinische Schrift nicht so geläufig wie sein eigenes griechisches Alphabet, aber dass ein „fränkisches“ i normalerweise einen Punkt trägt, weiß er schon. Und er ist sicher, dass der gelehrte Calogero es weiß. Also warum setzt er ihn nicht?
Vor wenigen Wochen erst hat der Wirt einem Gast gelauscht, der von geheimen Botschaften und ganzen Mikrofilmen fabulierte, die man mit Hilfe modernster Methoden angeblich auf einen simplen i-Punkt komprimieren könne. Gut und schön. Aber was bedeutet es, wenn der i-Punkt fehlt? Eine Warnung? Eine Chiffre? Der Wirt wischt sich mit dem Küchentuch über die Stirn, schüttelt dann das Tuch aus und hält die Serviette näher an seine vom grauen Star gezeichneten Augen, für die er, unterstützt vom ambulanten Augenarzt, einem entfernten Verwandten, staatliche Blindenhilfe in dreistelliger Höhe bezieht. An der kryptischen Natur der Notiz ändert das nichts. Quasi zur Beweissicherung asserviert er die Serviette, nimmt Tasse, Glas und Geldschein an sich, fegt mit dem losen Ende des Tuchs den Staub vom Tisch und verschwindet wieder im Innern des Kafeneions.
Der Professor ist inzwischen ins Labyrinth der schattigen Gässchen eingetaucht, durch die nun ein böiger Wind streicht. Der launische Meltemi, der in Minuten von null auf hundert beschleunigt und genauso schnell wieder zur lähmenden Flaute verkommt, scheint jedes Jahr früher einzusetzen. Mit wehender Capa und geblähter Kapuze gleicht der Mann einem gespenstischen Piraten, der den kleinen verschlafenen Inselhafen heimsucht und tyrannisiert, weil er einst von dessen Bewohnern verraten und ausgeliefert wurde.
Die zwei- bis dreistöckigen Häuschen links und rechts sind nicht nach Zykladenart weiß getüncht, wie die Taverne oben auf dem Hügel, sondern aus solidem Stein gebaut und mit roten Dachziegeln versehen, was auf ansehnlichen Reichtum schließen lässt. Ihre Fassaden stehen einander so dicht gegenüber, dass sich die bei offenem Küchenfenster kochenden Frauen fehlende Zutaten jederzeit über die Gasse hinweg anreichen können en, ohne sich gefährlich weit aus dem Fenster lehnen zu müssen. Da und dort sorgen brückenförmige Torbögen für verbesserte Statik und bieten nebenbei kraft ihrer inzwischen allerdings prekär gewordenen Begehbarkeit einen Zuwachs an Wehrhaftigkeit. Von hier oben pflegte man nämlich bis in die jüngste Vergangenheit im Gewirr der Sträßchen umherirrende feindliche Eindringlinge, die mit Rüstung, Schild und Schwert oder kurzer Stoßlanze in der Regel bestenfalls paarweise vorankamen, mit Steinen, Pfeilen oder siedend heißem Öl zu traktieren.
Gerade ist der Professor in den schmalen Schatten eines solchen Torbogens getreten, als er innehält, wie wenn er etwas Wichtiges vergessen oder übersehen hätte. Eine Weile steht er regungslos da und betrachtet, scheinbar in Gedanken versunken, die Auslage im vergitterten Schaufenster eines auf sakrale Kunst und gottesdienstliche Utensilien spezialisierten Lädchens. Die Tür des Geschäfts, das laut Aushang landesüblich spät zu öffnen und früh zu schließen pflegt, wenn es nicht, wie an manchen Tagen, morgens gar nicht öffnet und nachmittags trotzdem früh schließt oder bisweilen auch nur vormittags öffnet und am frühen Nachmittag schließt, tut sich wie von Geisterhand auf. Das helle Klingeln eines kleinen Glockenspiels verbreitet so kurz vor Ostern eine gleichsam jenseitige Atmosphäre. Der Calogero nickt dem von außen unsichtbar bleibenden Besitzer kurz zu und tritt scheinbar wortlos durch die von innen aufgehaltene Tür.
Noch hat sich die Tür nicht mit neuerlichem Geklingel geschlossen, da tauchen wie aus dem Nichts die beiden Männer mit den kurzärmligen karierten Hemden auf. Nun, da die Quecksilbersäule allmählich die kritische Marke überschreitet, jenseits derer auf dem Planeten Griechenland regelmäßig alles Leben erlischt, wird die aufgeheizte Unterstadt sogar von den sonst allgegenwärtigen Rudeln streunender Hunde gemieden. Die meisten Läden haben stählerne Gitter vor ihre Türen montiert oder eiserne Vorhänge herabgelassen, als erwarteten ihre Besitzer den Durchzug einer Horde plündernder und brandschatzender Vandalen. Wer sich jetzt der Hitze aussetzt, anstatt sich daheim oder im Hotelzimmer vor einen jeden Augenblick abhebenden Ventilator zu hocken, den Kopf in den Kühlschrank zu stecken, in einem heftig chlorierten Pool zu treiben oder im seichten Meerwasser zu planschen, muss verrückt sein - oder einen sehr triftigen Grund für sein exzentrisches Verhalten haben.
Die beiden Männer dürften den Professor beim Betreten des Ladens beobachtet oder zumindest noch das verräterische Türglöckchen gehört haben. Sie beziehen zu beiden Seiten des Schaufensters so Stellung, dass sie von innen nicht gesehen werden können. Dann greifen sie unter ihren Hemden in ihre Jeansgürtel und ziehen kurzläufige Revolver hervor, die sie offenbar so griffbereit mit sich führen, wie unsereiner sein Smartphone. Der Umstand, dass sie die Waffen nicht über dem Bauch, sondern über dem Gesäß tragen, lässt die Annahme zu, dass es sich um europäische und nicht um amerikanische Killer handelt.
Allem Anschein nach spekulieren die beiden darauf, dass der Professor den Laden auf die gleiche Weise verlassen wird, wie er ihn betreten hat. Als Ortsfremden ist ihnen nicht bewusst, welche Tücken die hiesige Architektur aufzuweisen hat. Erst als der eine der beiden, der die Sonne im Rücken hat und nicht, wie sein Kollege, von ihrem grellen Licht geblendet wird, den schnell wachsenden Schatten bemerkt, der sich auf den hellen Marmorplatten des Pflasters abzeichnet und gleichsam nach ihm greift, erkennt er die Gefahr. Er wirbelt um die eigene Achse und feuert zwei, drei ungezielte Schüsse Richtung Sonne. Der Schatten gehört niemand Anderem als dem plötzlich auf dem Torbogen erschienenen Calogero. Der böige Wind pfeift durch die Gasse, wirbelt Staub, Blätter und Papierschnipsel zu einer Wolke auf, die alle Konturen verwischt und den Männern unten am Laden in die Augen beißt. Dem Professor greift er so heftig unter die Soutane, dass der Diener des Herrn für einen Augenblick einem riesigen schwarzen Raubvogel gleicht, der seine unfassbar langen Schwingen ausbreitet, um sich vom Torbogen auf seine kurzzeitig verwirrte Beute zu stürzen. Sein schütterer Haarkranz und der wehende Bart sind dem unerbittlichen Zerren des Windes ausgesetzt, der die Kapuze längst nach hinten geweht hat. Während er vor den Kugeln abtaucht, die der Mann von unten auf ihn feuert, greift er mit der Rechten in den Ärmel der Soutane und zieht seinerseits eine kleine halbautomatische Pistole. Bevor er sie jedoch in Anschlag bringen kann, hat die „Beute“ ihre Verwirrung überwunden und stürzt, unablässig um sich feuernd, im wilden Zick-Zack in Deckung.
Die diesjährige Schonzeit für Mönche scheint definitiv abgelaufen. Der wehrhafte Calogero entscheidet sich für den strategischen Rückzug, militärischen Laien auch als Flucht geläufig. Er hetzt, hüpft, hastet und hechtet von Flachdach zu Flachdach, um seinen Verfolgern, die ihm auf der Straße nachjagen, kein leichtes Ziel zu bieten. Die Akrobatik des Professors ist umso bewundernswerter, als er einen viereckigen, etwa aktenordner-großen Gegenstand unter seinen linken Arm geklemmt hält, der seine Bewegungsfreiheit enge Grenzen zieht.
Jedes Mal, wenn die beiden den taumelnden Calogeroins Visier genommen haben, feuern sie, was die Trommeln hergeben, so dass sie fast so häufig mit Nachladen wie mit Schießen beschäftigt sind. Vermutlich haben sie nicht mit einer solch wilden Hatz gerechnet, sonst wären sie sich wohl automatische Waffen besorgt. Das Heulen und Pfeifen des sich nach und nach zum Sturm aufschwingenden Windes verweht das Echo ihrer Schüsse und das unheimliche Singen der Projektile größeren Kalibers. Kugeln klatschen mit sattem Schmatzen in die Fassaden, sprengen Stücke grauen Mörtels und roten Ziegels ab, bringen Dachpfannen und irdene Blumentöpfe zum Zerplatzen, zerlegen dunkelblau bemalte hölzerne Fensterläden und zersplittern Glasscheiben oder prallen als tückische Querschläger mit metallischem Klang von gusseisernen Balkongeländern ab. Nichts ist vor den Revolvern der Männer sicher, nicht einmal die auf einer langen Leine zum Trocknen aufgehängten Kalmare: erst von Dreizack-Spießen durchbohrt und dann stundenlang auf Steinen weichgeklopft, werden sie nun obendrein von verirrten Projektilen regelrecht zerfetzt.
Der Professor seinerseits hat keine Gelegenheit, auch nur einen einzigen Schuss abzugeben. Er scheint vielmehr allein darauf bedacht zu sein, den Gegenstand, den er unter der Capa in der Linken trägt, mit seinem eigenen Körper vor den Kugeln zu schützen. Die scharfen viereckigen Umrisse des Objekts zeichnen sich dann und wann deutlich unter der Soutane ab. Was immer es ist - ein Bild, ein Tablett, eine Akte - er muss es in dem Laden abgeholt haben, vor dem ihm die Killer auflauerten Womöglich haben die beiden es weniger auf den Mann selbst, als vielmehr auf diesen ominösen Gegenstand abgesehen, denn sie verfehlen offenbar lieber den Professor, als dass sie den Gegenstand treffen. Was ihr bislang bemerkenswert schwaches Schießergebnis erklären würde.
Mit einer Geschicklichkeit, die man seinem ungelenk wirkenden Körper nicht zugetraut hätte, läuft der Professor weiter, springt und klettert auf die auf halber Höhe liegende Dorfkirche zu, die zum anstehenden Osterfest wie alljährlich von orthodoxen Gläubigen und Pilgern der Nachbarinseln überquellen wird, jetzt aber noch zwischen den mäßig besuchten Gottesdiensten gähnend leer dasteht. Als der Mönch hinter dem von der Kirche getrennten Glockenspiel Deckung sucht, spielen die abprallenden und in alle Richtungen schwirrenden Querschläger seiner Verfolger auf den Glocken und Glöckchen unterschiedlicher Größe eine vielstimmige Melodie vom Tod.
Endlich scheint er es wider alles Erwarten doch noch unversehrt in die Kirche geschafft zu haben. Der schwarze Calogero verschwindet im Inneren des glücklicherweise unverschlossenen Gotteshauses. Damit hat er sich wenigstens vorübergehend eine kleine Atempause verschafft. Seine Jäger müssen sich nun vorsehen, um nicht unversehens selbst zu Gejagten zu werden. Unter anderen Umständen könnten sie sich in aller Seelenruhe eine Zigarette nach der anderen anzünden und geduldig warten, bis der Calogero die Kirche wieder verlässt, denn für immer drin bleiben kann er ja nicht. Doch die wilde Schießerei hat inzwischen mehr und mehr aufgebrachte Dorfbewohner mobilisiert. Überall öffnen sich zum Teil zerschossene Fenster, treten wütende Männer schimpfend und zeternd ins Freie. Einige von ihnen sind sogar mit Jagdflinten und uralten Karabinern bewaffnet, als gelte es, eine drohende Invasion des Erzfeindesabzuwehren. Die beiden Killer müssen sich also beeilen, wenn sie ihren Auftrag noch heute erledigen und trotz allem dem geballten Volkszorn entgehen wollen. Sie sprechen sich kurz ab und nähern sich zügig der schweren hölzernen Pforte, die nur angelehnt ist und mit rostigem Knarren nachgibt. Kein weiterer Laut dringt nach außen. Sie treten schnell ein und versperren die Pforte sofort hinter sich mit einem schweren Riegel, so dass die zeternden Einheimischen erst einmal draußen bleiben.
In der Kapelle empfängt sie der penetrante Geruch von Weihrauch, heißem Wachs, ranzigem Öl, Holzpolitur und Bohnerwachs, mit einem ordentlichen Schuss abgestandenem Schweiß und süßlichem Eau de Cologne. Reich verzierte, verschiedenfarbige Öllämpchen und versilberte Weihrauchfässchen hängen wie rundliche Vogelkäfige an ellenlangen Ketten von der Decke. In einem mit Sand gefüllten Kupferbecken stecken drei dünne, wie eben erst aufgestellte und entzündete Kerzen. Keine Menschenseele ist zu sehen oder zu hören. Am Boden hat der eine der beiden Killer Blutstropfen entdeckt, deren Spur sich vom Eingang mitten durch das Kirchenschiff bis zur Ikonenwand zieht. Die Männer nicken einander grimmig zu: nicht alle Kugeln haben ihr Ziel verfehlt, wie es scheint. Behutsam, ihre Revolver weiterhin schussbereit, folgen die Männer mit leise über den Bodenmarmor schlurfenden Sohlen der Spur, die vor dem mittleren Durchgang der Ikonostase abrupt endet.
Die beiden mögen brutal und gnadenlos in der Ausübung ihres Gewerbes sein. Ihren Glauben oder Aberglauben haben sie deshalb noch lange nicht ad acta gelegt. Vielmehr gleichen sie sizilianischen Mafiosi, die nur Stunden, nachdem sie die ganze Familie eines Rivalen ausgelöscht haben, in die Kirche gehen, um für die Gesundheit ihrer an Gicht und Osteoporose leidenden Mütter zu beten. Ihr anerzogener Respekt vor den Ritualen der Gläubigkeit die beiden orthodoxen Killer vor ein Dilemma. Möglicherweise nur wenige Meter von ihrem Opfer entfernt, dürfen sie das Adyton oder Allerheiligste nicht durch die mittlere Tür der Ikonenwand betreten, denn diese ist ausschließlich Popen und anderen ausgewiesenen kirchlichen Würdenträgern vorbehalten.
Erneut beraten sich die beiden, diesmal nur durch Zeichensprache, verharren einen Augenblick lauschend und trennen sich dann, um, jeder auf seiner Seite, den auch Laien zugänglichen seitlichen Durchgang zu benutzen. Sie finden das Allerheiligste zwar nicht leer, aber doch ohne den Professor vor. Der Mann scheint sich mit göttlicher Hilfe in Luft aufgelöst zu haben oder vor der Zeit als verdienter Knecht Gottes in den Himmel aufgenommen worden zu sein. Die beiden Männer blicken einander an und zucken ratlos mit den Schultern. Höhere Gewalt, Vorsehung oder göttlicher Wille ist nicht ihr Ding und auch nicht im Kleingedruckten ihres Vertrags berücksichtigt. Sie sichern ihre Waffen, stecken sie wieder unter die Gürtel und steuern einen Nebenausgang an. Nicht, weil sie glauben, der Professor könnte ihnen durch ihn entwischt sein, denn dann fände sich hier eine Blutspur wie die zur Ikonostase führende. Nein, aber der Seitenausgang erspart ihnen voraussichtlich die Konfrontation mit den Dorfbewohnern und dem inzwischen auch eingetroffenen Arm des Gesetzes.
Während der eine der beiden die Kirche verlässt, wendet sich der andere an der Tür noch einmal um und geht auf die Ikonostase zu. Aufmerksam studiert er die Bilderwand, als argwöhne er allen Ernstes, dass sich der Calogero kraft irgendeiner Zauberformel geschrumpft hätte und ähnlich dem gesuchten Joker in einem Wimmelbild mit dem Hintergrund einer der Ikonen verschmolzen sei. Als sich auch dieser letzte Versuch, den wundersamen Calogero auszuheben, als untauglich erweist, folgt der Killer seinem Komplizen ins Freie, wo die beiden sich mit unschuldiger Miene als unbeteiligte Touristen ausgeben, die lediglich die Kirche besichtigt haben.
Im Hafenbereich, wo von mittäglicher Ruhe ohnehin keine Rede sein kann, mischen sie sich mühelos unter die Leute und nehmen schließlich an einem freien Tisch der belebtesten Hafentaverne Platz. Wären Sie nicht ganz und gar damit beschäftigt, von hier das Menschengewühl vor sich nach dem angeschossenen Calogero abzusuchen, würden sie jetzt Zeugen eines seltsamen Zwischenfalls werden können, der sich in geringer Entfernung hinter ihnen abspielt.
Etwas landeinwärts versetzt und mehr oder minder in die erste, wassernahe Häuserreihe eingebettet, steht ein kioskartiger kleiner runder Turm mit blauer Kuppel und winzigen vergitterten Fensterchen. Der Bau, etwas kürzer, aber kaum dicker als eine doppelte Litfaßsäule, hatte ursprünglich die Aufgabe, eine Quelle abzuschirmen, deren Wasser Heilkraft zugesprochen wurde und insofern der ganze Stolz des Orts war. Wer hieraus schöpfen wollte, musste einen Obolus entrichten, dessen Höhe sich nach dem Gutdünken des jeweiligen Bürgermeisters richtete. Durch das allmähliche Austrocknen der Quelle ihrer eigentlichen Mission beraubt, wurde diese architektonische Kuriosität über die Jahrzehnte zunehmend zur inoffiziellen Werbefläche und Hundetoilette. Besondere Popularität erfreut sie sich seit jüngstem bei Scotty, einem militanten Boxerrüden, der seit seiner Sterilisierung eher nachtragend-heimtückisch als gelassener geworden war. Er terrorisiert die Nachbarschaft und betrachtet das Hundepissoir als seine private Fazilität. Gebühren für die Benutzung durch andere Hunde oder menschliche Wildpinkler kann er zwar nicht erheben, aber eifersüchtig die Säule bewachen schon. So manche ambulante Promenadenmischung könnte als Beweis für diesen Tatbestand schlecht verheilte Bisswunden vorweisen.
Auch an diesem Mittag hebt Scotty gerade grazil und mit irgendwie provozierender Eleganz das rechte Hinterbein an „seinem“ Pissoir, als ein von außen kaum als solches zu erkennendes Türchen des Gebäudes auffliegt und den in diesem Moment ob seiner vorübergehenden Dreibeinigkeit destabilisierten Rüden mit Schwung auf die Straße befördert. Der Hund, nur kurz über diese unerwartete Wendung der Dinge verblüfft, setzt sogleich zu einer wütenden Attacke an. Aber angesichts des Mannes in Schwarz, der da tief gebückt aus der Säule tritt, um sich sogleich zu seiner wahren Körpergröße aufzurichten, besinnt er sich eines Besseren und läuft stattdessen zähnefletschend einer Katze nach, die das Schauspiel mit einem für Scottys Geschmack eine Spur zu ironisch geratenen „Miau“ zu kommentieren gewagt hat.
Im Hin und Her des geschäftigen Hafenbetriebs mit seinen brechend vollen Tavernen und Cafés, dem Geklimper und Geklapper des Geschirrs, dem Gehupe der Autos und Knattern der Mopeds scheint niemand von dem mit einer blutenden Schusswunde der Unterwelt entstiegenen Professor Notiz zu nehmen. Warum auch? Geistliche, selbst solche mit ungewöhnlicher Tracht, gehören schließlich ebenso ins alltägliche Straßenbild griechischer Städte wie etwa die lauthals unverständliches Zeugs krähenden Losverkäufer. Der einzige, der die tröpfelnde Blutspur bemerkt haben wird, die der Geistliche bei jedem seiner Schritte hinterlässt, ist der ob seiner respektlosen Behandlung immer noch beleidigt knurrende Scotty, dem die impertinente Katze natürlich entwischt ist.
Als der Professor mit seinem Bild unter dem Arm an der letzten Taverne am entfernten Ende der Hafenmeile vorübergegangen ist und auf die Reihe der mit dem Heck zum Kai vertäuten Yachten zuhält, passiert er zwangsläufig die hafenseitige Einmündung einer sehr schmalen Verbindungsgasse, die kluge Stadtplaner hier zwischen den dicht stehenden Häusern gelassen haben, damit zumindest schlanke Fußgänger von der Uferpromenade schnell zur parallel verlaufenden Hauptgeschäftsstraße des Orts gelangen können.
Genau auf Höhe dieser Gasse wird der Calogero plötzlich von drei, vier Händen an der Capa gepackt und in die kaum mannsbreite Lücke gezerrt, bevor er auch nur Zeit hat, seine Waffe zu ziehen oder laut um Hilfe zu rufen. Vergeblich versucht er, sich der brutalen Angreifer zu erwehren, die möglicherweise mit den Killern von soeben gemeinsame Sache machen und sich hier für den Fall auf die Lauer gelegt haben, dass die Hatz weiter oben erfolglos enden sollte. Einer der Räuber schlägt den Professor nach kurzem Gezerre schließlich mit dem Griff seines Revolvers bewusstlos.
Während der Calogero zur Erde sinkt, entreißen ihm die Angreifer das dünne Päckchen, das er so lange gegen seine Jäger verteidigt hat. Dann lassen sie ihn mit seinen beiden blutenden Wunden an Kopf und Schulter auf der steinigen Erde liegen und machen sich aus dem Staub.
2. Im Taborlicht.
„Christos voskrjes! Christus ist auferstanden!“ Mit dem wenn auch etwas verfrühten traditionellen russischen Ostergruß auf den Lippen betritt der untersetzte, drahtige Pilger in beiger Cargo-Hose, vom salzigen Schweiß gekennzeichnetem T-Shirt, Sonnenhut und festen Bergstiefeln die winzige Kapelle zum Licht des Erlösers. So schmucklos das Sandsteinkirchlein wirkt, so unvergleichlich ist seine Lage auf dem Gipfel des Bergs Athos, der dem nördlichsten der drei Finger der Chalkidiki-Halbinsel seinen wohlklingenden Namen leiht. Der Ausblick auf diesen nördlichen Teil der Ägäis zählt ohne Zweifel zu den erhabensten, die Vorstellungskraft jedes Erstbesteigers übertreffenden Erlebnissen, die der Wanderer auf den Spuren des Allmächtigen irgendwo in diesem Garten Eden namens Griechenland erhoffen darf und für das er vermutlich jederzeit gern wieder hierher zurückkommt, auch wenn der Aufstieg schweißtreibend ist.
Der fröhliche Pilger ist nicht zum ersten Mal hier oben. Er wusste mithin vorher, auf welche Strapazen er sich bei dieser Bergwanderung einlassen würde. Als er sehr früh am Morgen aufgestanden ist und noch vor Sonnenaufgang mit leichtem Gepäck den ersten Kilometer gewundener Wege und Pfade beherzt in Angriff genommen hat, tat er dies auch im Hinblick auf die klassische Wallfahrt nach Zagorsk, für die es aller Voraussicht nach in diesem Jahr zeitlich nicht reichen würde.
Bis zum Erreichen der Baumgrenze war der Aufstieg ein durchaus erfrischendes Vergnügen, so dass der Pilger sich wiederholt dabei ertappte, wie er spontan die ersten Takte eines gregorianischen Chorals anstimmte und, gleichsam vor Schreck über den schrägen Klang seiner eigenen Stimme, sogleich wieder verstummte.
„Wenn der liebe Gott gewollt hätte, dass du zu den Don Kosaken stößt, Michajl,“ so sein Musiklehrer in der Peterhofer Schule schon vor vielen, vielen Jahren recht sarkastisch, „dann hätte er es sicher nicht verabsäumt, dir eine Stimme zu geben, die dafür hinreichend tauglich ist, glaubst du nicht auch? Nicht jeder Gesang, der angeblich schneller zum Himmel steigt, als jedes Gebet, ist dort uneingeschränkt willkommen, argwöhne ich jedenfalls. Bei manchen Tönen, die da ungebeten zu Ihm dringen, hält sich der Allmächtige vermutlich beide Ohren zu.“
Die Tonfestigkeit Gottes war eine Sache für musikalische Theologen oder vielleicht eher für kanonische Musiker. Jetzt und hier jedoch, außer Hörweite seiner Mitmenschen, allein mit sich, dem lieben Gott und Mutter Natur besaß Michajl gerade genug Kühnheit, seine Stimme wenigstens für Augenblicke zum Ruhme des Allmächtigen zu erheben.
Mit dünner werdender, immer weniger Schatten spendender Vegetation und zunehmender Tageshitze konnte von Vergnügen und Frische bald keine Rede mehr sein. Michajls Beine wurden bleischwer, Schweiß floss ihm in Strömen von der hohen Stirn über Hals, Bauch und Rücken hinab bis in die Socken. Etwa alle halbe Stunde musste er kurz anhalten und einen Schluck aus seiner am Rucksack baumelnden Wasserflasche nehmen, einem zerbeulten Relikt aus dem Zweiten Weltkrieg, das er vor Jahrzehnten auf einem Moskauer Trödelmarkt erstanden hatte und seitdem in Ehren hielt. Fast eine geschlagene Stunde pausierte er schließlich, wenn auch mit einem Hauch schlechten Gewissens auf einem Felsvorsprung, auf dem er zunächst in stiller Andacht verharrte. Da man vom Ausblick allein nicht satt wird, schob er dann etwas Brot, ein fettiges Ende russischen Kolbaso und ein paar Scheiben Hartkäse nach und lauschte dazu der Musik von Enigma auf den Kopfhörern seines MP3-Players. Dergestalt revitalisiert, hat er schließlich den Gipfel des Athos erstürmt.
Bevor sich seine ungeschützten Augen nun an das schummrige Licht im Innern der groben, unverputzten und nur mit zwei lächerlich kleinen Fensterchen versehenen Kapelle gewöhnt haben, schallt ihm aus dem Halbdunkel die klassische österlichrussische Replik entgegen, die man mit „... er ist in Wahrheit auferstanden!“ zu übersetzen pflegt.
Der Mann, der Michajl in der Kapelle erwartet hat, ist nur unwesentlich größer als der Pilger. Seine leicht gebeugte Statur lässt jedoch ahnen, dass ihn mehr als nur ein paar verträumte Jährchen vom Alter des Pilgers trennen. Als er Michajl ein, zwei Schritte entgegenkommt, so dass der Lichtschein des Fensters auf sein Gesicht fällt, ist der Pilger über die Ähnlichkeit des Mannes mit Vladimir Iljitsch Lenin nachgerade fassungslos: die gleiche hohe Stirn, die durchdringenden, feurigen Augen, Schnurrbart und Kinnbärtchen sind wie von der Todesmaske des einbalsamierten Führers der Bolschewiki abgekupfert.
Die beiden Russen umarmen und küssen einander stumm und innig auf die Wangen wie zwei frühchristliche Verschwörer, die sich an diesem leicht überschaubaren und für Römer wie Juden gleichermaßen schwer erreichbaren Ort zu einem konspirativen Treffen im Zeichen des Menschenfischers verabredet haben.
„Ich freue mich, dich gesund und wohlbehalten zu sehen, Bruder Arkadij,“ sagt Michajl, nimmt den Strohhut ab, wischt sich über die Stirn und legt seinen Rucksack auf den Boden.
„Aber warum sich ausgerechnet hier oben verabreden, Bruder, wo wir uns doch viel einfacher unten in der Bibliothek des Rossikons hätten sprechen können?“
Arkadij lächelt, was seiner Ähnlichkeit mit dem meist von fanatischem Ernst erfüllten Lenin vorübergehend zerstört.
„Die bequemen Lösungen sind nicht immer die besten, Bruder. Diskretion ist ein hohes Gut, auch in unseren Kreisen. Besonders in unseren Kreisen, Bruder Michajl, Mischa. Ich muss dir nicht sagen, wie unendlich neugierig und redselig die Menschen im Allgemeinen und Mönche im Besonderen sein können – russische zumal, und nicht nur, wenn sie getrunken haben, Bože moj. Nicht umsonst habe ich wieder und wieder die Einführung des Schweigegelübdes für die Bewohner des Rossikons gefordert, aber unser Bruder Patriarch, Gott halte weiterhin seine schützende Hand über ihn, ist mir bis heute, wie du weißt, nicht auf diesen Weg gefolgt. Wie man munkelt, ist er selbst einem Schwätzchen unter Brüdern nie abgeneigt. Aber das hast du nicht von mir, hörst du!“
Er seufzt und hebt die Arme in gespielter Verzweiflung.
„Außerdem bildete ich mir ein, etwas Bewegung und frische Luft würden dir nach den Monaten deiner freiwilligen Einsamkeit und selbstgewählten Kasteiung in der Lawra von Sergiljew Posad nur guttun. Hat sie dir etwas gebracht? Die Einsamkeit, meine ich? Hast du in Augenblicken asketischer Verzückung das Antlitz Gottes erblickt? Oder hast du nur, Gott sei’s geklagt...“, er rückte etwas näher an Michajl heran und senkte seine Stimme zu einem heiseren Flüstern, „... hast du nur die erotischen Wonnen genossen, die dem Vernehmen nach mit manchen Geißelungspraktiken Hand in Hand gehen?“
Michajl schüttelt sein Haupt.
„Weder noch, Bruder, weder noch. Wenn ich ehrlich sein soll, sah ich in meinen Halluzinationen meist nur die lila Kuh.“
„Die was?“
„Die lila Kuh von dieser deutschen Schokoladen-Reklame. Ich musste dauernd an Schokolade denken, Milchschokolade vor allem. Was, Bruder Arkadij, wenn die lila Kuh im Zentrum des Universums stünde, das sich seinerseits nicht als mehr als ein kosmisches Überraschungsei entpuppt?“
„Keine Blasphemie, ich muss doch sehr bitten, Michajl. Die Lawra scheint dir den Verstand geraubt zu haben. Hast du sie mit?“
„Die Kuh?“
„Die Ikone, Michajl, die Ikone. Du erinnerst dich vage an den Anlass unseres heutigen Treffens?“
Michajl nickt und deutet auf seinen Rucksack.
„Natürlich, Bruder, sie ist da drin.“
„Kann ich sie einmal sehen, bevor sich die Dunkelheit herabsenkt?“
Michajl macht sich am Rucksack zu schaffen.
„Selbstverständlich, Bruder Arkadij. Im Laufe meines langen und beschwerlichen Aufstiegs war mir bisweilen, als werde die Madonna ungeduldig, als wolle sie schon aus eigener Kraft gen Himmel fahren, was sie mir als umso leichtere Last erscheinen ließ.“
Endlich hat er die zahlreichen Schnallen und Riemen gelöst, mit denen sein Rucksack verschlossen war und zieht ein schmales Päckchen heraus, das mit demjenigen des unglücklichen Professors identisch scheint.
„Man hat es dir sicher schon zugetragen: sie den Griechen aus den frevelhaften Händen zu winden, gestaltete sich letzten Endes weit schwieriger als ursprünglich gedacht. So diffizil, dass ich, nun ja, zeitweise fast schon selbst nicht mehr an den Erfolg der Operation geglaubt habe. Es gab Augenblicke, ja, es gab derer, in denen mich mein an sich unerschütterliches Gottvertrauen im Stich zu lassen drohte.“
„Lass’ mich raten: bis dich die lila Kuh mit dem Milchschokolade spendenden Euter wieder auf den rechten Weg zurückführte?“
Michajl verzichtet darauf, den Sarkasmus Arkadijs seinerseits mit Ironie zu parieren und händigt seinem Vorgesetzten stattdessen das Päckchen aus. Der entfernt sogleich fahrig das schützende Ölpapier, mit dem das Bildnis umwickelt ist. Dann kehrt er der offenstehenden Tür den Rücken und hält die zum Vorschein gekommene Ikone mit beiden Händen in die Höhe, so dass ihre schützende silberne Riza das einströmende letzte rötliche Sonnenlicht des Tages spiegelt.
„Wundervoll! Einzigartig! Diese göttliche Reinheit der Linien, die Tiefe der Farben, die raffinierte Schlichtheit des Gewandes, die Erhabenheit ihres Antlitzes. Ein Meisterwerk, Bruder, ein einmaliges Meisterwerk. Und keine Spur mehr von den beiden Schusslöchern. Wer hat eigentlich diese ausgezeichnete Restaurierung vorgenommen?“
Er verstummt, erliegt der geradezu hypnotischen Anziehungskraft des Bildnisses.
„Keine Ahnung“, erwidert Michajl.
„Aber darin bestand ja wohl auch der Zweck der Übung, die Schusslöcher verschwinden zu lassen, sonst hätten wir sie ja auch gar nicht unserem Ritus gemäß neu weihen können.“
„In der Tat, Bruder, so ist es. Und wo lag nun das besondere Beschaffungsproblem, Bruder?“, fragt Arkadij und folgt der Ikone mit den Augen, bis sie wieder im Rucksack Michajls verschwunden ist.
„Nun, du weißt ja, Bruder, die Griechen und ihre Geschenke, so eine Sache. Sie hatten einen ihrer besten Männer auf die Ikone angesetzt, einen gewissen ... Atha ...“
„Athanassios meinst du? Den Professor? Im Ernst? Bist du sicher?“ unterbricht ihn Arkadij und pfeift leise durch die Zähne.
„Das ist sein Name, von einer Professur weiß ich nichts.“
„Er ist ein griechischer Calogero im Range eines Professors. Das hat nichts mit dem akademischen Titel zu tun. Er hat es bis zum persönlichen Adjutanten des Ökumenischen Patriarchen in Konstantinopel gebracht. Nicht schlecht für einen frommen Höhlenbewohner, oder? Spezialist für unorthodoxe Missionen, Black Ops in Sandalen, wie der Genosse Kowalski das unlängst nannte.“
„Hat einen schrulligen Humor, der Genosse Kowalski, findest du nicht? Erinnert mich an den Genossen Stalin. Der erzählte offenbar gern solche Brüller, während vom Hof und aus den Kellern der Lubjanka die Schreie der Gefolterten und die Salven der Erschießungskommandos drangen. Sonniges Georgien, aber lassen wir das.“
Michajls unerwartete Erwähnung des prominenten russischen Massenmörders lässt die Männer einen Augenblick verstummen. Die Sonne ist untergegangen und die erlahmende Seebrise trägt gerade genug feuchte Kälte nach oben, um die beiden frösteln zu lassen. Michajl zuckt mit den Schultern, als wolle er die von ihm selbst geweckten Geister der Vergangenheit möglichst rasch wieder abschütteln.
„Listig wie Odysseus, stark wie Herakles, skrupellos wie Achill dieser Athanassios. Zwei von uns angeheuerte Bulgaren haben ihn drüben auf der Insel im Kugelhagel einmal quer durch den Ort gejagt, bis zur Kirche. Dort sei er urplötzlich wie vom Boden verschluckt gewesen. Kein schlechtes Bild, wie sich später herausstellte. Er war nämlich in einen geheimen Gang abgetaucht, der bis zur ausgetrockneten Quelle am Hafen führt. Stammt wohl noch aus der Zeit der osmanischen Besatzung, als unsere griechischen Brüder im Glauben viel Fantasie und Schweiß darauf verwenden mussten, ihre Aktivitäten unter die Erde zu verlegen. Daraus resultiert ein vielfach verzweigtes Netz unterirdischer Räume und Passagen auf dem Festland wie auf den Inseln, manche noch begehbar, andere verschüttet. Man muss schon genau wissen, was wohin führt, wie immer im Leben.“
„Nichts im Vergleich zu dem unterirdischen System des Kremls, meines Erachtens. Nicht, wenn man bedenkt, dass Iwan der Schreckliche eine ganze Bibliothek da untergebracht hat, die ja, wie du weißt, bis heute nicht gefunden wurde. Nein, als Maulwürfe können uns die Griechen nicht das Wasser reichen. Aber ich schweife ab. Was geschah dann?“
„Nun, Bruder, wie du schon sagst, völlig verblödet sind wir ja schließlich auch nicht. Ich hatte bereits so eine Ahnung, dass Athanassios die beiden auf ihn angesetzten bulgarischen Tollpatsche düpieren könnte und lag mit einem Bruder meines Vertrauens am Hafen auf der Lauer, für alle Fälle. Die Insel besitzt ja keinen Flugplatz. Wenn der Professor sie mit der Ikone verlassen wollte, musste er irgendwann am Hafen auftauchen. Genau so kam es. Wir konnten ihn überwältigen und ihm die Ikone entreißen. Doch das hätte nur wenig gebracht. Athanassios hatte nämlich noch weitere Asse im Ärmel. Glücklicherweise nahm ich mir die Zeit, das Päckchen zu öffnen und genauer nachzusehen, bevor wir an Bord der Liwadija gingen. Und was soll ich dir sagen, Bruder, dieser gerissene Sohn einer räudigen Hün... Verzeihung, dieser Athanassios also hatte es tatsächlich fertiggebracht, die Madonna gegen ein Bildnis des heiligen Johannes des Täufers auszuwechseln. Nicht schlecht, eh? Hat was, finde ich. Tausche eine Madonna gegen Johannes.“
Arkadij schnalzt bewundernd mit der Zunge.
„Das brachte mich kurz ins Grübeln. Wenn er nicht selbst betrogen worden war, wofür bei seiner Schläue eigentlich wenig spricht, und er also die Madonna tatsächlich im Laden ausgehändigt bekommen hatte, war der einzige Ort, an dem er den Austausch hatte vornehmen können, die Kirche. Also bin ich noch mal nach oben gestiefelt, habe mich durch die Menge der aufgebrachten Dörfler gedrängt und, was soll ich dir sagen, Bruder, da hing sie, die Madonna, zweite Reihe von oben, dritte von links, dort, wo eigentlich der heilige Johannes seinen Platz hat.“
„Unglaublich! Das grenzt an Blasphemie. Und der Professor?“
„War angeschossen und trug bei dem Gerangel mit uns im Hafen eine Kopfverletzung davon. Aber er wird’s überleben, denke ich. Die Schmach, uns nicht übers Ohr gehauen zu haben, wird ihn länger quälen als die erlittenen Verletzungen.“
„Der Ökumenische Patriarch wird die Sache nicht so leicht auf sich beruhen lassen wollen, fürchte ich.“
„Werden sehen. Mit Gottes Hilfe ... Wie geht’s jetzt weiter?“
„Genau nach Plan, hoffe ich. Von hier gelangt die Madonna per Hubschrauber und Schiff auf die Krim und von dort per Flugzeug weiter nach St. Petersburg, in die Kathedrale Peter und Paul. Wenn alles glattgeht.“
„Woran du nicht so recht zu glauben scheinst, Bruder?“
Arkadij zuckte mit den Schultern.
„Sagen wir, ich bin mit zunehmendem Alter noch etwas misstrauischer geworden, als ich es ohnehin war. Davon abgesehen, hast du dich um Kirche und Land verdient gemacht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das höheren Orts unbemerkt bleibt. Ein Platz im Beirat der Kathedrale wird demnächst aller Voraussicht nach vakant, aus, sagen wir, biologischen Gründen. Als Direktor des Beirats kann ich natürlich nichts versprechen, versteht sich, demokratische Wahl und so weiter, aber mir ist, als hörte ich deinen Namen bereits Erwähnung finden. Wir alle sind dir zu großem Dank verpflichtet.“
Michajl wehrt bescheiden ab. „Man tut mit Gottes Hilfe, was man kann. In die Lawra möchte ich allerdings in der Tat nur sehr ungern zurück. Einsiedlertum macht schwermütig und Selbstgeißelung ist auch nicht mehr, was sie anscheinend mal war, wenn man den Altvorderen glauben darf.“
Die Nacht hat die Gelegenheit genutzt und ist unbeachtet über Land und Meer hereingebrochen. Die beiden Männer treten aus der Kapelle ins Freie, wo der Himmel Myriaden von Lichtpunkten flackern lässt.
„Apropos, wie kommst du eigentlich wieder hinunter ins Tal, Bruder Arkadij?“
„Soll das heißen, du traust mir den Weg nicht mehr zu, Bruder Michajl? Glaub’ mir, ich stehe sicherer auf den Beinen, als es offenbar den Anschein hat.“
„Natürlich, davon bin ich überzeugt. Ich meine nur, in der Dunkelheit kann man leicht vom Pfad der Tugend abkommen und in ungeahnte Abgründe des Verderbens fallen.“
Arkadij ist sich plötzlich nicht sicher, ob die Doppelbödigkeit der Worte Michajls dreiste Hinterfotzigkeit oder im Gegenteil das Produkt seiner Naivität ist. Spinnt er insgeheim vielleicht schon Intrigen gegen ihn? Will er seinen jüngsten spektakulären Erfolg bei der Mission Madonna zu seinen Gunsten ausschlachten, um sich beim Genossen Kowalski einzuschmeicheln und ihm, Arkadij, seinen Direktorenposten streitig zu machen? Hat Arkadij eine Schlange an seinem Busen genährt? Vorsicht, Bruder, einen Arkadij reinzulegen haben schon ganz andere versucht und wurden letzten Endes für ihr Bemühen doch nur mit einem schlichten Holzkreuz auf dem einen oder anderen provinziellen Gottesacker belohnt.
„Amen, Bruder, und genau dessen eingedenk habe ich, mit Verlaub, meine private Himmelfahrt organisiert. In meiner Position genießt man gewisse Privilegien, die zwar nicht an jene der Kurienkardinäle des Vatikans heranreichen, Gott behüte uns vor solch maßloser Hybris. Aber immerhin, auch als Orthodoxe müssen wir unser Licht nicht unter den Scheffel stellen. Und was sind Privilegien, wenn man sich nicht ab und zu ihrer bedient? Ungedeckte Wechsel, wertlose Glasmurmeln.“
Er kramt eine Taschenlampe hervor, knipst sie an und sieht auf seine Armbanduhr.
„Es müsste jeden Moment soweit sein, Bruder. Ich wünsche dir deshalb jetzt bereits sicheren Abstieg und alles Gute für das weitere Fortkommen im Namen des Herrn ...“
Wie aufs Stichwort fällt plötzlich ein unerträglich grelles Lichtbündel von schräg oben auf die beiden Russen. Michajl weicht instinktiv zwei Schritt zurück. Für ein paar verstörende Sekunden glaubt er wirklich, Zeuge der angekündigten und durch das Licht der Erleuchtung eingeleiteten Himmelfahrt Arkadijs zu werden. Erst als er das Brummen des Motors, überlagert vom hellen Singen der Rotorblätter eines offenbar schallgedämpft fliegenden Stealth-Hubschraubers registriert, der sich allem Anschein nach gegen die Windrichtung der Kapelle nahezu geräuschlos genähert hat, begreift er, was vor sich geht.
Oder vielleicht doch nicht? In der Dunkelheit kann der Hubschrauber im zwar überschaubaren, aber sehr unebenen Gelände nicht gefahrlos aufsetzen. Da hier oben andererseits auch kein Baum wächst, muss der Pilot keine Rücksicht auf die spärliche Vegetation nehmen und kann seine Maschine bis auf etwa Mannshöhe zu Boden drücken und in dieser niedrigen Höhe schweben lassen. Die beiden Russen halten sich die Hände vor die Augen, um nicht vom Scheinwerfer oder vom aufgewirbelten Staub geblendet zu werden. Arkadij hat sich seinen Rucksack übergestreift und schickt sich gerade an, mit Michajls Hilfe an Bord des Hubschraubers zu steigen, als zwei schwarz vermummte und offenbar bis an die Zähne bewaffnete Gestalten mit Sturmhauben aus der Maschine springen und die Läufe ihrer Maschinenpistolen auf die völlig fassungslosen Russen richten.
„Wo ist sie?“, ruft eine der Gestalten auf Englisch.
Allmählich dämmert es Arkadij und Michajl, dass sie es nicht mit dem bestellten fliegenden Taxi, sondern mit einem anderen, feindlichen Helikopter zu tun haben. Setzen die beiden angesichts dieser überraschenden Wendung auf ein neuerliches Manöver des Professors, werden sie enttäuscht, denn die Stimme, die sie gerade hören, ist zwar recht tief angesiedelt, dennoch unzweifelhaft die einer Frau.
„Wo ist sie“, wiederholt die Amazone. „Proschu njemedljenno otvetit’, brat’,ja,“ wiederholt die Frau auf Russisch.
„Ichch frage nicht noch einmal.“
Das Russische verleiht ihrer Stimme eine unüberhörbare Schärfe und suggeriert den beiden Männern, die ihre Hände über den Kopf gehoben haben, dass dies keine leere Drohung sein könnte. Arkadij weist zur Kapelle, wo Michajls Rucksack mit der Ikone liegt. Um diese und nur um diese geht es den Räubern anscheinend.
„Davajt’je, poschli, towarischtschi! Geh’ und hol sie“, befiehlt ihm die Frauenstimme.
„Otschen’ ostoroženko, keine Tricks, bitte, sonst nehmen wir euch mit und werfen euch aus dem Hubschrauber, ponjali drug druga, nije li tak?“
An einer solch privilegierten Stätte nahe dem Himmelszelt erschossen zu werden, wäre jetzt auch nicht unbedingt das Schlimmste, denkt Michajl. Wenn schon tot, dann wenigstens an einem Ort wie diesem, niedergestreckt in Ausübung seiner Pflichten, noch dazu im Streit mit einem offensichtlich gefallenen Engel. Aber lebendig in tausend Meter Höhe oder mehr aus einem Hubschrauber geworfen zu werden, ist nicht annähernd so verlockend. Er geht langsam rückwärts, bis er die Tür erreicht. Dann dreht er sich um und holt seinen Rucksack. Er setzt ihn demonstrativ vor den vermummten Gestalten auf die Erde, öffnet ihn und entnimmt ihm die eingewickelte Ikone.
Die Frau senkt den Lauf ihrer Waffe und nimmt das Bildnis entgegen. Während ihr Begleiter – Größe und Statur verraten den Mann – eine Stablampe auf das Päckchen richtet, wickelt die Frau die Ikone aus, betrachtet sie kurz und packt sie wieder ein.
„Bitte vorsichtig damit...“, ruft Michajl in schlechtem Englisch, das die Vermummten möglicherweise sowieso nicht hören können und macht reflexhaft einen Schritt nach vorn, der leicht sein letzter hätte sein können, wenn die Dame mit der Maschinenpistole einen etwas nervöseren Zeigefinger hätte.
Der gefallene Engel behält jedoch die Übersicht und feuert lediglich eine Salve zur Warnung in die Luft. Dann zieht sich die Frau zum immer noch in niedriger Höhe schwebenden Hubschrauber zurück. Sie wirft die Ikone zum Entsetzen der Russen wie ein UPS-Päckchen auf einen der Sitze und klettert an Bord, während ihr Komplize die Russen in Schach hält. Schließlich wechseln sie die Rollen: Während er zur anderen Seite des Hubschraubers läuft und einsteigt, richtet sie ihre Waffe auf die Russen. Eigentlich eine unnötige Vorsichtsmaßnahme, denn weder Arkadij noch Michajl haben es für erforderlich gehalten, Waffen auf den Athos zu bringen, was man ihnen andererseits auch nicht unbedingt ansieht.
Kurz bevor der Pilot den Hubschrauber jäh hochzieht, ruft der Engel den Russen noch etwas zu, das nur beim näher an der Maschine stehenden Michajl ankommt. Zudem hält Arkadij sich seine Ohren zu, um den schmerzenden Lärm wenigstens etwas zu dämpfen. Dann dreht der Hubschrauber nach Süden ab, ohne die beiden schnell zu Punkten schrumpfenden Gestalten am Boden voreilig aus dem Lichtkegel des Scheinwerfers zu entlassen.
Als der Hubschrauber vom Boden aus nur noch ein irrlichterndes Glühwürmchen am funkelnden Sternenhimmel ist, kommen die beiden allmählich wieder zu Sinnen.
„Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen“, sagt Michajl.
„Amen“, nickt Arkadij.
„Der Patriarch?“, fragt Michajl leise.
Arkadij schüttelt energisch den Kopf.
„Glaube ich nicht. Der hätte den Professor geschickt. Eine Frau? Wer beauftragt eine Frau mit so etwas?“
„Jemand, der sichergehen will, dass die Sache auch wirklich klappt?“
Entweder entgeht Arkadij die feine Ironie Michajls oder er stellt sich mit der wachsenden Neigung des Alters zu selektiver Wahrnehmung taub. Dann entnimmt er seinem Rucksack ein Satellitentelefon und wählt eine sehr lange Nummer. Es dauert eine Weile, bis im nächtlichen Moskau jemand abhebt.
„Hallo? Genosse Kowalski? Genosse ... Ja, hier Arkadij Wassiljewitsch ... Genau der, von der Operation ... Nein, leider nicht, Genosse Kowalski, es ist uns gerade etwas dazwischengekommen. Was soll ich sagen, man hat uns beraubt. Ja. Nein, wissen wir leider nicht. Zwei Personen ... eine davon eine Frau.“
Lenin zuckt und hält das Telefon ein wenig weiter von seinem Ohr weg.
„Kein Grund zur Blasphemie, Genosse Kowalski. Allem Anschein nach ist der Kreis der ... Interessenten größer, als wir ahnen konnten. Das kompliziert die Sache natürlich. Ich muss um Back-up nachsuchen, um ...“ Erneut hält Arkadij das Telefon auf Abstand.
„Wladimir Wladimirowitsch? A čërt voz’mi. Speznas? Im Ernst jetzt? Ich verstehe. Wie?“
Er bedeckt kurz das Mikrofon mit der Hand und wendet sich Michajl zu, der Anstalten macht, auch etwas beizusteuern.
„Genosse Kowalski, ich höre gerade, die Frau hat uns ihren Namen zugerufen. Warum, weiß der Kuckuck. Vielleicht, um ihre Visitenkarte zu hinterlassen, so eine Art Gaunerehre womöglich. Wer kennt sich schon in diesem Milieu aus. Oder mit Frauen. Wie? Ja, sicher, Genosse, ganz Ihrer Meinung. Klang jedenfalls wie ..., eh, klang wie bitte?“
Er lehnt sich zu Michajl, der ihm ins andere Ohr spricht. „Voltaire? Volière oder Molière. Wie, Genosse? Solitaire? Ach, Sie kennen sie?“
Es folgt eine weitere kurze Tirade, die Arkadij an sich abperlen lässt, indem er das Telefon nervös vorüberhuschenden Fledermäusen hinhält.
„Verstanden, Genosse Kowalski. Sicher, wir bleiben am Ball, machen Sie sich keine Sorgen. Versteht sich, ausführlicher Bericht mit Kopien an FSB, GRU, FPS, RWE, Pardon, SWR, Abteilung subversives was? ... Wie bitte? Ach ja, verstanden. Sicher, sobald wir mehr über die Zusammenhänge wissen. Over, znatschit, out.“
Er hängt auf und legt das Telefon zurück in seine Tasche.
„So, wie es aussieht, Mischa, und ich gebe dir das unter dem Siegel strenger Verschwiegenheit weiter, so wie es aussieht, hat inzwischen sogar der Genosse Präsident Blut geleckt, ich meine, bildlich, du verstehst, was ich meine. Hat die Angelegenheit zur Chefsache erklärt. Du kennst ja seine merkwürdige Leidenschaft fürs Detail. KGB’ler der alten Schule eben. Ich muss dir nicht ausbuchstabieren, was uns blüht, wenn diese Operation in die Hose geht. Dann wirst du dir noch wünschen, deine Lawra nie verlassen zu haben und dich nach den Abenden mit Selbstgeißelung sehnen, das garantiere ich dir. Wir müssen diese Frau auftreiben, diese Voltaire, Molière ...“
„Solitaire“, korrigiert ihn Michajl.
„Was auch immer“, knurrt Arkadij.
Seltsamer Name. Heißt so nicht ein Spiel?“
Michajl nickt.
„Ja, ein Kartenspiel. Als Hauptpreis winkt ein unbefristeter Urlaub im Gulag unserer Wahl.“
3. Der dritte Passagier.
Wie zu Beginn eines jeden Wochentags herrscht auch heute Morgen heilloses Gedränge auf der Landungsbrücke des Fähranlegers Kabataş der Istanbuler Sehir Hatları oder Stadtlinien, deren Schiffe so gut wie alle Stadtteile am Goldenen Horn, Bosporus und Marmarameer miteinander verbinden. Die für europäische Verhältnisse spottbilligen Fähren dienen den weniger begüterten einheimischen Pendlern als erschwingliches und, bei normalen Witterungsverhältnissen, äußerst zuverlässiges Transportmittel. Touristen und kurz entschlossenen „Aussteigern“ bieten sie die Möglichkeit, dem ganz gewöhnlichen Irrsinn des wuseligen Tollhauses Istanbul ein Stündchen oder zwei zu entrinnen, ihre Lungen mit Seeluft zu füllen, zu sich zu kommen und, an guten Tagen, sogar ein wenig Sonnenschein zu tanken oder einem Schwarm Tümmlern beim Buckeln zuzusehen.
Ganz allein mit sich und seinen Gedanken ist der Tourist zwar auch da draußen nie – wie sollte er, in diesem Ballungsgebiet mit seiner Bevölkerung, deren genauen Umfang zwar niemand so genau zu kennen scheint, aber jeder bedenkenlos auf etwa fünfzehn Millionen zu beziffern bereit ist. Dazu gesellt sich der Umstand, dass mindestens die Hälfte dieser Leute Tag und Nacht in Bewegung scheint, was die Gesamtmenge gefühlt verdoppelt. Doch wenn man die Augen schließt, sich den Wind um die Ohren wehen lässt und bei einem Glas heißen Tees und einem Simit oder Sesamkringel dem Kreischen der gierigen Möwen lauscht, kann man sich kurzzeitig auf einer Kreuzfahrt durch die Kleine Antillen wähnen.
Wer viel Zeit hat oder sie sich einfach nimmt, kann eines der beiden hauptsächlichen maritimen Istanbuler Ausflugsziele ins Auge fassen – den Bosporus bis zu seiner Mündung ins Schwarze Meer oder das Archipel der – im Westen – so genannten Prinzeninseln, die bei den prosaischeren Türken einfach nur die Inseln heißen. Solch lapidarer und bei oberflächlicher Betrachtung leicht herablassend wirkender Umgang mit Toponymen hat in diesem Teil der Levante System und bildet eine Tradition, der Istanbul selbst seinen Namen verdankt.
Fragte man bis in die Neuzeit einen Reisenden der Gegend, wohin er denn fahre, reite oder wandere, so pflegte der in aller Regel auf Griechisch zu antworten: eis tin poli, also „in die Stadt“. Dabei konnte er es im Bewusstsein belassen, dass der neugierige Fragesteller schon wusste, was gemeint war: nicht etwa Athen, Alexandria oder Korinth, sondern Konstantinopel, das damals ähnlich zum Inbegriff der Stadt schlechthin geworden war, wie in späteren Epochen Rom oder heutzutage New York. Eis tin poli verschliff sich im Laufe der Zeit zu Is-tan-bul, das von den meisten Griechen, wahrscheinlich in Verkennung seines griechischen Ursprungs, auch heute noch zugunsten des älteren Konstantinopel gemieden wird, obwohl dieser Name ja eigentlich eher nach Rom zurückverweist - nur ein Beispiel von vielen für die Begriffsverwirrungen, denen man in diesem Schmelztiegel der Religionen, Sprachen und Kulturen erliegen kann.
Bei der Taufe von Schiffen, nicht zuletzt von liebgewonnenen Fähren, werden auch die Türken oft wesentlich expliziter. Das Angebot ist im Prinzip unerschöpflich, reicht theoretisch von M/S Aliye bis zur M/S Zarife und weit darüber hinaus. Das jedoch wäre banal und gleichsam herzlos gegenüber einem Transportmittel, auf dem man Tag für Tag Stunden verbringt und das daher mit den Jahren gewissermaßen zur Familie gehört. Nur so ist wohl zu verstehen, dass die gerade anlegende Fähre nicht nur promoviert wurde, sondern noch höhere akademische Weihen erlangt hat. An Bord der Professor Dr. Ömer Karamanoğlou zu gehen, heißt, stolz Schulter an Schulter mit der intellektuellen Elite des Landes zu stehen. Und Stolz darf getrost als eine der wesentlichsten türkischen Sekundärtugenden betrachtet werden.
Ganz so, als biete sich mit dem Eintreffen dieser Fähre der Mühseligen und Beladenen hier und jetzt gegen die Zahlung des Charonspfennigs die allerletzte Gelegenheit, dem Verhängnis durch die Überfahrt von der europäischen zur asiatischen Seite zu entgehen, stürzen bei Kabataş Männlein und Weiblein, Kind und Kegel mit und Sack und Pack, Gedränge und Geschiebe geradezu panikartig auf das Schiff. Schließlich gilt es, die Lieblingsplätze in der Einheits-Holzklasse des wie ein Eisenbahnwaggon möblierten Salons an Oberdeck zu ergattern. Unternehmungslustige Passagiere meist jüngeren Alters ziehen, zumal im Sommer, die Sitzbänke im Freien entlang der Reling an Backbord und Steuerbord vor. Hier kann man nicht nur die Seele, sondern auch die nackten Füße baumeln und von einer der ab und zu hochschwappenden Wellen benetzen lassen.
Zwei Männer in dem Alter, das man gern das „gesetzte“ nennt, sind eben erst hastig einem gelben Taxi entstiegen und schaffen es unter dem anspornenden Gejohle der anderen Passagiere gerade noch über die primitive eiserne Stelling an Bord. Dann wird diese über den Zement schrabbernd und knirschend eingezogen. Die Professor Dr. Ömer Karamanoğlou legt dreimal diskret tutend ab und nimmt so rasch und beinahe geräuschlos Fahrt auf, dass man meinen könnte, sie sei nicht mit einem konventionellen Dieselmotor, sondern mit einem aus dem Stand eindrucksvoll beschleunigenden Elektroantrieb ausgestattet.
Die beiden Männer sind lässig, aber so ausgesucht unauffällig gekleidet, dass sie schon wieder Verdacht erregen. Für Berufspendler eine Spur zu alt, für Touristen eine Spur zu bodenständig, für Rentner eine Spur zu elegant, für Inselbewohner eine Spur zu urban, stellen sie den Beobachter vor die Frage, was sie wohl auf dem Dampfer zu suchen haben. Sie steigen auf dem großzügig breit gehaltenen Niedergang an Oberdeck, durchqueren den Salon, der eine leicht hinkend, der andere eher leichtfüßig tänzelnd, und klemmen sich wie zwei Bierzeltgäste draußen auf dem zugigen Vordeck des Schiffs, das Seeleute die Back nennen, zwischen eine der heute Morgen praktisch verwaisten, am Boden festgeschraubten grobschlächtigen Holzbänke und den ebenfalls fest verschraubten langen, ungedeckten Tisch. Unterhielten sie sich nicht leise auf Türkisch, würde man sie vielleicht für griechische Gläubige halten, die kurz vor dem orthodoxen Osterfest zum Kirchlein des Heiligen Georg auf der Insel Büyük Ada pilgern.
Der simple Name dieses größten Eilands des Archipels liefert einen neuerlichen Beweis für die nüchterne Sachlichkeit der als levantinisch-überbordend verschrienen Türken. Mit etwas weniger Wohlwollen könnte man es freilich auch als Fantasielosigkeit brandmarken, zumal ihre ehemaligen Besitzer die Insel als Prinkipo kennen. Das ist zwar auch nicht wirklich griechischen, sondern „fränkischen“ Ursprungs, hat aber etwas mehr Stil und Eleganz als das einfältig anmutende Echo des kindlichen türkischen „Sieh mal, Abi, große Insel, maşallah!“
Das hiesige religiöse Brauchtum will es, dass die christlichorthodoxen Pilger den langen und sehr steilen, ja, fast vertikalen Weg zur Kapelle des Heiligen Georg im Schweiße ihres Angesichts erklimmen. Das Kirchlein liegt auf dem Gipfel des höheren der beiden Höcker, die der Insel von Ferne das Aussehen eines Kamels verleihen, das den Schuss zur Teilung der Fluten überhört hat und nun für immer bis Unterkante Oberlippe im Wasser feststeckt.
Der beschwerliche Aufstieg der Pilger ist in etwa vergleichbar mit dem allerdings auf allen Vieren zu absolvierenden Bußgang zur Panagia Evangelistria oder Marienkirche der Zykladeninsel Tinos. Während man sich dort mit Wonne aufs Pflaster wirft und kriechend an den Rand des physischen Zusammenbruchs bringt, belässt man es hier beim aufrechten Gang und begnügt sich damit, bunte Schleifchen und Stoffbänder an die Büsche und Bäumchen links und rechts des kopfsteingepflasterten Wegs zu binden. Das hat etwas dezidiert Folkloristisches und zieht deshalb auch Angehörige anderer Glaubensrichtungen an, so dass die christliche „hadsch“ zu einer Art ökumenischen Volksfestes wird.
Sobald die Professor Dr. Ömer Karamanoğlou die Häfen von Kadikoy und Bostanci hinter sich gelassen hat, ist sie nur mehr zur Hälfte ihres beachtlichen Fassungsvermögens von mehreren hundert Passagieren gefüllt und das von Vokalharmonien dominierte, sich gern auf dem nichtssagenden „şey“ oder Dingsbums ausruhende, wie kollernde Glasmurmeln klingende Türkisch erhält plötzlich ernsthafte Konkurrenz in Form von herablassend geknödelten griechischen Sibilanten, für deren halbwegs kprrekte Aussprache ein passgenaues Gebiss unerlässliche Voraussetzung ist. Da Zahnersatz aber von den notorisch klammen Krankenkassen selten erstattet werden, steht es mit der Artikulation dieser altehrwürdigen Sprache heutzutage milde gesagt nicht zum Besten.
„Verdammtes Griechenvolk“, murrt der tänzelnde der beiden Spätankömmlinge mit leicht tuntigem Tonfall und wirft sich schleunigst in seinen über den Arm gefalteten dunkelblauen Trenchcoat, mit dessen Hilfe er dem Fahrtwind zu trotzen gedenkt.
„Werden Jahr für Jahr mehr, genau wie diese syrischen Flüchtlinge, efendim. Wahrscheinlich rechnen sie damit, dass wir es nicht merken, bis sie eines Tages die Inseln kampflos zurückerobert haben.“
Um seinen Hals schmiegt sich der Kragen seines schwarzen Rollis wie der oberste Teil eines auf Abstand kratzig wirkenden Büßerhemds. Seine modische Sonnenbrille mit dem Top-Gun-Spiegeleffekt ist wohl eine Art Vorschuss auf die bald einsetzende Sommerfrische.
Sein Gegenüber trägt eine schwarze Lederjacke, schwarze Cordhose und ein den Hinterkopf freilassender Basecap der New York Yankees.
„Sollen sie“, entgegnet der Yankee gelassen.
„Ich bin nicht scharf drauf. Von mir aus können sie sie jederzeit wiederhaben. Verschwinden doch sowieso beim nächsten Erdbeben alle spurlos im Meer, aus dem sie gekommen sind. Inşallah, Gottes Wille geschehe.“
Die Stimme des Yankees ist seltsam schwach, kompensiert die fehlende Durchschlagskraft aber durch eine schrille Höhe am Rande weibischen Keifens.
„Efendim, Ihre Seelenruhe möchte ich haben“, lacht der tuntige Trenchcoat mit dem Büßerhemd.
Der Yankee zuckt mit den Schultern.
„War nicht immer so. Das Ergebnis von viel Meditation und Selbstfindung.“
„Ja, kann ich mir vorstellen. Was soll man im Knast auch sonst groß machen. Aber um auf unser Geschäft, unser siftah, zurückzukommen, Abi. Ich spiele auch hier wieder nur den ehrlichen Makler, wie Sie wissen. Der Auftraggeber selbst ist mir nicht einmal persönlich bekannt. Alles, was ich weiß - es soll sich um eine zahlungskräftige Person handeln, bona fide, und zwar so was von.“
Der Yankees setzt sein Basecap ab und streicht sich über den Schädel. Seine Kopfhaut ist weder ganz kahl, noch im landläufigen Sinne behaart, gleicht eher einem stacheligen Kaktus. Sein linkes Ohr ist nur noch zur Hälfte vorhanden, so als hätte ein Raubtier ihm den unteren Teil abgebissen. Die deutlich sichtbare Narbe, die mit der entstellenden Verwundung einhergeht, ist zu frisch, als dass es sich um eine Kriegsverletzung handeln könnte – eher um die Hinterlassenschaft irgendeines Schusswechsels zwischen verfeindeten Istanbuler Banden.
Ein durch die Gänge zwischen den Tischen und Bänken wieselnder çaici nähert sich mit seinem runden metallenen Tablett voller tulpenförmiger Gläser und aufeinandergestapelter Sesamkringel dem Tisch der beiden. Die Männer nehmen je eines der Gläser mit dampfend heißem „Hasenblut“, wie die Türken ihren Tee wegen seiner rötlichen Farbe nennen. Dann bitten sie um ein paar simit, die sie der Einfachheit halber zweiteilen. Der nervös wirkende Trenchcoat zündet sich obendrein noch eine Zigarette an. Angesichts seines Erregungszustandes ist zu befürchten, dass er jeden Augenblick in die Zigarette beißen und den Kringel anzünden wird.
„Der Auftraggeber kennt meine Preisvorstellung?“, fragt der Yankee nippt an seinem Tee, wobei er ein Stück Würfelzucker zwischen die Zähne klemmt.
„Affirmativ“, entgegnet der Trenchcoat, dessen Sprachgebrauch den ehemaligen Militär verrät oder simuliert.
„Sagen wir, er weiß, dass Sie sich Ihre Dienste fürstlich entlohnen lassen.“
Der Trenchcoat senkt seine Stimme und lehnt sich zum Basecap über den Tisch, so dass dem fast die Zigarettenasche in den Tee fällt.
„Geht mich ja absolut nichts an, aber warum jemand bereit ist, so viel Asche für eine dämliche Ikone rüberzuschieben, ist mir ein Rätsel.“
„Die Faszination, die für Leute wie mich von Ikonen ausgeht, einem Moslem wie Ihnen näherzubringen, hieße, einem von Geburt an Blinden Farben zu beschreiben.“