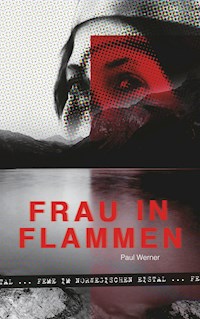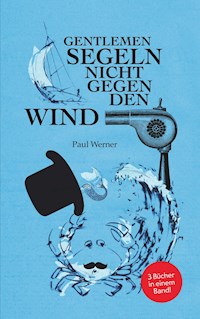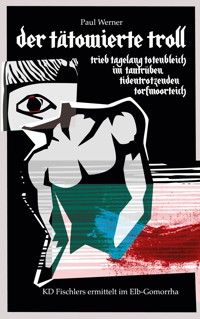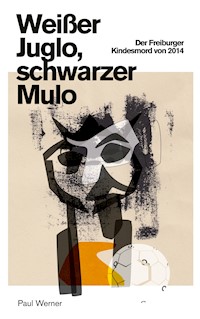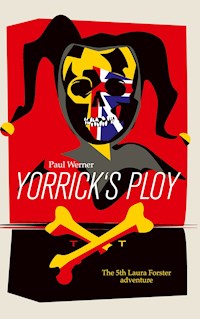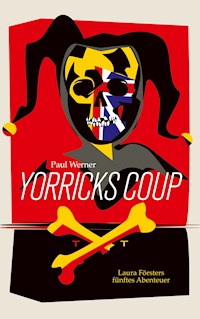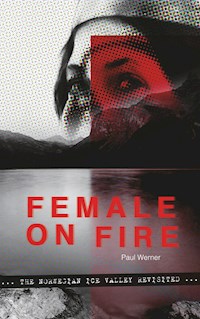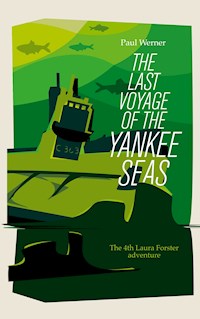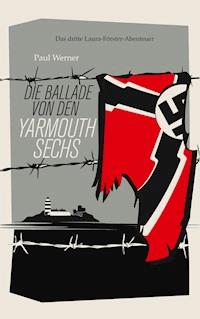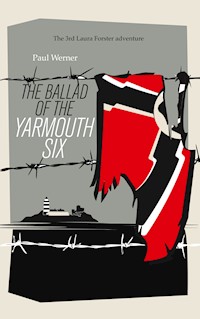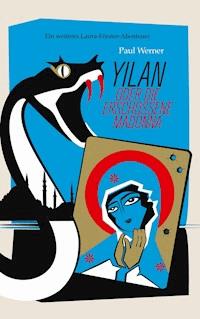8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
"Wir sind alle tot" ist der Titel dieses Buches und zugleich derjenige der ersten von drei Geschichten, in denen der Autor der "Frau in Flammen" in gewohnt detektivischer Manier nach den Ursachen dreier Flugzeug-Katastrophen fahndet, die jede für sich Furore machten. In der Titelgeschichte schlägt einer DC-3 am 22.12.1991 in die Kuppe des Hohen Nistlers, eines Berges nahe Heidelberg ein. CFIT, Pilotenfehler, schreckliches Versehen, ja, aber ... Albert Guay, der "Minutenmann" von Québec, bringt am 09.09.1949 die DC-3, in der sich unter anderem seine eigene Frau befand, mit einer Zeitzünder-Bombe zum Absturz. Ein Wimpernschlag der Ewigkeit und sein teuflischer Plan wäre aufgegangen ... Das "Tal der Schatten" ist der nicht zuletzt von deutschen U-Boot-Wracks übersäte Grund der gefürchteten Biscaya. Sie wurde am 01.06.1943 auch zur letzten Ruhestätte einer zivilen DC-3 der BOAC, die mit einer Reihe von VIP´s auf dem Wege von Lissabon nach Bristol von einer Staffel JU 88 C-6 abgeschossen wurde: Zufall oder Absicht, lautet seitdem die quälende Frage ... Ein passant vermittelt Werner jede Menge zeitgeschichtlicher, kulturhistorischer und flugtechnischer Zusammenhänge und flicht autobiographische Fetzen von großem Unterhaltungswert ein ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 384
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Paul Werner
Inhaltsverzeichnis
Anstelle eines Vorworts
Wir sind alle tot
Der Hohe Nistler
„Bunkerlow", die zweite
Bis hier hör' ich die Motoren
Der Albatros schlüpft
Mensch oder Mechanik?
Willkommen an Bord
Ihr Pilot heute ist
Ich seh' etwas
Das Interview
Niemand so blind
Es könnte zu Turbulenzen kommen
Wir sind alle tot
Eine Frage der Kontrolle
Der Fremdling
Der Minutenmann
Große Erwartungen
Das Nadelöhr
Der gefallene Engel
Die Engelmacherin
Ein Zwischenfall
Am Kap der Stürme
Spurensuche
QED
Im Tal der Schatten
Flug 777
Der turbulente Wartesaal
Das Ibis-Nest
Der Mahlstrom
Diener zweier Herren
Die Liste
Der versteinerte Wald
Im Tal der Schatten
Anstelle eines Vorworts
Zugegeben, „Wir sind alle tot" ist kein wirklich „schöner" Buchtitel, wenn auch einer, der zur apokalyptischen Corona-Zeit unserer Tage zu passen scheint.
Keine Sorge, ganz so schlimm wird es nicht kommen, weder hier noch im Alltag. Außerdem: nicht ich, sondern das Leben hat die Geschichten geschrieben. Ich fungiere hier nur als Anwalt, als Notar. Und als solcher habe ich keine andere Wahl, als das zu Papier zu bringen, was das Schicksal, das ja so gern den Hobel ansetzt, mir aufträgt.
Aber da wir gerade dabei sind. Jede Geschichte braucht ein Vehikel, das ihre Handlung vorantreibt. Hier, in diesem Buch, ist es ein Flugzeug, das die drei Erzählungen lose miteinander verbindet. Nicht irgendeines, sondern die legendäre Douglas DC-3 A, bei den Briten auch als „Dakota", bei uns in Deutschland als „Rosinenbomber" bekannt. Die Amerikaner hatten gleich ein halbes Dutzend Kosenamen für sie.
Eine Hommage von vielen also, die der berühmten Maschine mit den breiten Schwingen und den dicken Ballonreifen im Laufe der seit ihrer „Geburt" Mitte der dreißiger Jahre verflossenen Dezennien zuteilwurde?
Nicht wirklich. Natürlich befassen sich Teile des Buches mit Geburt und Werdegang der DC-3. Das sind wir ihr schuldig, schließlich dient sie auch uns in gewisser Weise als zuverlässiges Transportmittel. Und um eine Propellermaschine wie diese vom Boden abheben zu lassen, bedurfte es schon ein Geringes mehr an Technik als, sagen wir, bei Aladins fliegendem Teppich.
Doch bin ich weder Flugzeugingenieur noch Aeronautiker, sondern Schriftsteller. Was mich interessiert, sind Menschen in allen Lebenslagen und Facetten, von denen wir mindestens so viele besitzen wie die „Dakota" Nieten.
Den Protagonisten des Buches, die vor allem ihre Schwächen, ihr Scheitern teilen, schulden wir Authentizität und Zurückhaltung im Urteil.
Sich in einem nicht einmal sonderlich dicken „belletristischen Sachbuch" wie diesem dreimal auf völlig andere zeitliche, geographische und personelle Gegebenheiten einstellen und dabei ganz nebenbei noch das eine oder andere technische Detail verarbeiten zu müssen, ist für den Leser nicht einfach. Aber glauben Sie mir, für den Autor auch nicht gerade ein Zuckerschlecken.
Warum sich überhaupt erst an eine solche Arbeit machen, zumal es ja weniger um die Triumphe des technischen Intellekts, als um Abgründe der Seele geht, in die wir quasi im Sturzflug hinabtauchen?
Als Aischylos, der antike Athener Tragöde, der als einfacher Hoplit an der Schlacht von Salamis teilgenommen hatte, sich anschickte, seine Erfahrungen oder besser noch seine Folgerungen daraus zu Papier zu bringen, geriet ihm das ephemere Heldenepos über die siegreichen Griechen unter der Hand zur unsterblichen Tragödie über die persischen Verlierer. Warum? Doch wohl, weil er das Gefühl hatte, wir alle könnten aus der logischen Kausalität einer Niederlage und der Art und Weise, mit ihr tunzugehen, mehr lernen als aus den Zufälligkeiten eines uns in den Schoß gefallenen Sieges.
Und schließlich behandeln auch die berühmtsten antiken Mythen vom Fliegen vor allem Abstürze wie den des der Sonne zu nah gekommenen Ikarus oder den der Helle vom Rücken des Golden Vlies in die Dardanellen, die bei den Griechen Hellespont heißen – das Meer der Helle eben. Einzig mögliche Folgerung: die unergründliche menschliche Seele kennt nicht nur die Angst vorm sondern auch die Lust am Scheitern.
Hat die DC-3 uns so etwas wie ein Vermächtnis hinterlassen? Keine Ahnung. Falls ja, steckt ein gerüttelt Maß davon in diesen drei Geschichten, die einfach zu gut sind, als dass man sie so einfach liegen lassen dürfte.
In „Wir sind alle tot" ringt ein Pilot, der seine DC-3, in der Fliegersprache, kontrolliert ins Gelände des Odenwaldes flog, quasi aus dem Jenseits um Rehabilitation, indem er anklagend auf das mitwirkende Verschulden einer Gruppe von reichlich unbedarften Filmemachern verweist, die nach Kräften zum Absturz der Maschine beitrugen.
Der "Minutenmann“ von Québec wähnte in grenzenloser narzisstischer Selbstüberschätzung das Schicksal an seiner Seite, als er den teuflischen Plan fasste, mit Hilfe einer DC-3 seine Ehefrau zu ermorden. Doch muss auch er bald erkennen, dass das unnahbare Scheusal Schicksal mit uns Sterblichen keine Deals eingeht.
Das „Tal der Schatten" auf dem Grund der Biscaya, Friedhof unzähliger Bomber, Jagdflugzeuge, Schiffe und U-Boote, wurde 1943 auch zur letzten Ruhestätte einer DC-3 namens „Ibis" der KLM, die in britischen Diensten die gefährliche Route Bristol – Lissabon bediente. Versehen oder Vorsatz lautet seitdem die Frage, die sich in ungebrochener Brisanz an den Abschuss von Flug 777 durch acht deutsche JU 88-„Zerstörer" knüpft.
So wurde, um ein Wort Winston Churchills abzuwandeln, die Douglas Commercial DC-3 „Dakota" zu einem Mythos, der wie eine Mumie in Legenden gewickelt und, in einen luftdicht verschlossenen Sarkophag gelegt ward. Machen wir uns, mit Mund- und Nasenschutz gebührend gesichert, gemeinsam an ihre Exhumierung.
Humpty-Dumpty saß auf der Mauer
Tat 'nen Fall von ganz kurzer Dauer
Alle Rösser und Mannen des Königs erheblich
Sich mühten um Humpty-Dumpty – vergeblich.
(L.Carroll, Alice im Wunderland, m.Ü.)
Wir sind alle tot
1. Der Hohe Nistler
Vom Fenster meines Schlafzimmers in Handschuhsheim, örtlich auch „Hendse", einer jahrhundertelang selbständigen Ortschaft, die mit ihrer Eingemeindung 1903 schlagartig zum einwohnerstärksten Heidelberger Stadtteil avancierte und in dem früher einmal tatsächlich die Fertigung von Handschuhen florierte, schaue ich jeden Morgen und Abend mit oft leicht verquollenen Augen auf den langgestreckten Sattel, der die beiden Gipfelkuppen der mir zugekehrten Westseite einer dicht von dunkelgrünem Mischwald bedeckten und in die Höhenzüge des Odenwaldes eingebetteten Erhebung miteinander verbindet. Da man im deutschsprachigen Raum die terminologische Grenze zwischen „Hügel" und „Berg" bei etwa 300 Metern Höhe zu ziehen pflegt, darf der mit knapp 500 Metern fast doppelt so hohe Hügel es sich zu Recht ausbitten, im Folgenden gefälligst als „Berg" angesprochen zu werden.
Immer dann, wenn die aufgehende Sonne sich früh morgens in diesen Sattel schwingt, als wollte sie den Berg mit seinen beiden Höckern reiten wie der Beduine sein Kamel, brauche ich nicht den kehligen Singsang eines Muezzins, um zu erfassen, dass das zentrale Gestirn unserer Galaxie wieder einmal den nördlichsten Punkt auf seinem alljährlichen scheinbaren Spaziergang durch die Ekliptik erreicht hat und die Anzahl der mit Tageslicht gesegneten Stunden von nun an zunächst unmerklich, dann aber plötzlich umso rapider abnimmt. Fast so, wie im richtigen Leben, wo es vielen von uns nach dem Überschreiten unseres Zenits so erscheint, als würde der geflügelte Wagen der Zeit immer schneller dahinjagen. Da hätte es eigentlich keines uns schelmisch die Zunge ausstreckenden Einsteins bedurft, uns die Relativität der Zeit näher zu bringen. Auf die dazu gehörige Formel wären wir zur Not irgendwann auch noch gestoßen, so einfach wie sie sich darbietet.
Das sowohl ob seiner beachtlichen durchschnittlichen Höhe als auch wegen seiner schieren Masse beeindruckende Mittelgebirge des Odenwaldes, zu dem dieser, wie der burschikose Mark Twain gesagt hätte, Berg mit den beiden Titten geographisch-geologisch gehört, erhebt sich im Norden offenbar genau beim Darmstädter botanisch-zoologischen Institut. Das nenne ich mal eine präzise Angabe, die aus dem wabernden Nebel des Ungefähren herausragt wie die Spitze des Teide aus den Wolken des Atlantiks und dem Gebirge zudem einen der Gegend angemessenen akademischen Anstrich verleiht. Vom Neckar, dem Fluss der Schwaben, Ortsfremden auch als „Neggar" oder, politisch unkorrekt, gar als „Nigger" bekannt, ist der Odenwald hier so weit entfernt, dass man den Eindruck gewinnen kann, er wolle dem wie alles Schwäbische halt etwas sparsam geratenen Flüsschen gleichsam hochnäsig den Rücken zukehren.
Doch davon darf man sich so wenig beirren lassen wie der Freier von der kalten Schulter der Umworbenen. Alles nur Schein. Bevor man sich's versieht, rückt er – der Odenwald, nicht der Freier – dem Neckar nach Süden hin nämlich schneller auf den Leib, als man es einem derart hüftsteif wirkenden Gebirgsmassiv zutrauen würde, um ihn bei der Heidelberger Alten Brücke zu überqueren und auf der anderen Flussseite abgespeckt als „Kleiner Odenwald" fortzusetzen. Der endet dann wahrscheinlich bei der ausgelagerten Bibliothek des Instituts für Sinologie und Koreanistik der Uni Heidelberg.
Angesichts solch artiger Verrenkungen möchte sich auch das eher träge Flüsschen, das wegen seiner durchgehend geringen Wassertiefe bei mäßig abfallendem Gelände nur mit Hilfe zahlloser, dicht aufeinander folgender Schleusen mühsam schiffbar gehalten werden kann, nicht lumpen lassen. Dank eines mächtigen Stauwehrs plustert es sich auf, bis es nahezu Talsperren-Breite erreicht. Jenseits des Stauwehrs atmet es dann wieder aus wie eine etwas dralle Braut nach dem Ablegen der Korsage und teilt sich schnurstracks in zwei Läufe. Der östliche Teil besteht aus einem sorgsam eingehegten schiffbaren Kanal, der, vorbei an einzelnen vor sich hindösenden Anglern, unter der viel befahrenen A 6 hindurch Richtung Schwabenheimer Schleuse schwappt, gurgelt und schlappt und in dem zwei sich begegnende Binnenschiffe einander gerade so eben passieren können, ohne dass eines die Bordwand des anderen küsst.
Interessiert von Kormoranen mit ausgebreiteten feuchten Schwingen beobachtet, benutzen die meisten Fische derweil den westlichen, flachen, weitgehend naturbelassenen Arm, der auf seinem plätschernden Weg zur Mündung in Mannheim langgestreckte Landzungen zu Flussinseln macht, die man bei uns im Norden, auf Weser oder Elbe, wohl wegen ihrer knapp Fußballfeld-großen Erstreckung, gern „Werder" nennt.
Als Mann der See eher an unverstellte Sicht auf die Kimm gewöhnt, die nur eigefleischte Landratten „Horizont" titulieren, tue ich mich mit Bergen, die mir nachhaltig die Aussicht auf die Weite der Landschaft verwehren, grundsätzlich so schwer wie mit eisenpumpenden Hünen, deren breite Schultern mir im Kino den Blick auf die Leinwand versperren. Berge haben so etwas enervierend Allzeitliches, finden Sie nicht? Ihr unausgesprochenes und dennoch wie das Echo des Urknalls ewig nachhallendes „Wir waren immer schon hier und werden noch da sein, wenn du schon längst die Gänseblümchen düngst" scheint mir geradezu darauf angelegt, uns Menschen unsere unverschuldete Kurzlebigkeit als kosmische Eintagsfliegen penetrant vor Augen führen zu wollen. Gewiss, die Ozeane gibt es auch schon etwas länger als uns, aber sie wissen das durch dauernde Veränderung ihres Antlitzes diskret zu kaschieren.
„Dann hättest du eben an der Küste bleiben sollen," höre ich da jemanden aus der letzten Reihe lauthals höhnen. Ja, vielleicht. Sicher sogar. Doch Möwenschiss und Wattwurmgewölle sind, wie mir ein Fischer aus dem idyllischen Finkenwerder vor kurzem noch bei einer Buddel Korn glaubhaft versicherte, auch nicht alles im Leben. Und auf Dauer überlebt, wenn wir Darwin glauben dürfen, letzten Endes nur, wer hinreichend anpassungsfähig bleibt und sich dem Wechsel zumindest nicht schon aus reinen Bequemlichkeitsgründen verschließt.
Die Lobeshymnen einer teuren Freundin auf das Klima, die Infrastruktur, das intellektuelle Ambiente und, für Menschen meines Alters auch nicht zu unterschätzen, die medizinische Rundum-Versorgung im Dreistromland zwischen Rhein, Main und Neckar klang derart verlockend, dass ich mich, selbst im nahen Schwarzwald geboren, vor einigen Jahren entschloss, den blanken Hans zwar auch fürderhin über den grünen Tang zu loben, dies aber fortan vorsichtshalber von terra firma aus zu tun. Und zwar ausreichend weit weg von der Küste, um nicht doch noch deren Sirenengesang zu erliegen.
Apropos Namen. Als wesentlicher, wenn auch vielfach unterschätzter Faktor unserer westlichen Kulturen, dienen sie allgemein zur Personalisierung und Individualisierung und können als solche jedenfalls den beneidenswerten Zeitgenossen, die ein gutes Namensgedächtnis besitzen, eine Aura wohliger Vertrautheit schaffen helfen. Weshalb beispielsweise Mustafa Kemal, genannt Atatürk, in den zwanziger Jahren darauf bestand, dass seine Untertanen sich endlich mal Familiennamen zulegen sollten, anstatt dauernd nur als „Ali", „Mehmet" oder eben „Mustafa" durch die Gegend zu ziehen. Von denen gingen schließlich tausend auf ein Lot – was auch immer das mm heißen soll. Die Untertanen ließen sich nicht lumpen, sondern griffen tief in die Kuriositätenkiste, um mit Nachnamen aufzuwarten, die all jenen, die der türkischen Sprache mächtig sind, zum nicht versiegenden Quell der Heiterkeit wurden. Andererseits, immer noch besser, als E.T.A. Hoffmanns Manier, deutschen Familien jüdischen Glaubens Nachnamen wie „Katzenellenbogen" anzuhängen. Ein weites Feld ...
Ortsnamen, von Erdkundelehrern, einer in den Zeiten von Google Earth und GPS in ihrem Bestand anscheinend akut gefährdeten Spezies, gern auch Toponyme genannt, sind oft so alt und obskur, dass sich ein heutiger, an nüchterne Fakten gewöhnter Mensch rein gar nichts darunter vorzustellen vermag. Der Name „meines" besagten Berges zum Beispiel, auf den ich zwangsläufig jeden Morgen und Abend starre wie George Clooney im hypnotischen Feldversuch auf die Ziege, macht mich, ehrlich gesagt, auch nicht wirklich kundiger.
Mit der Heidelberger Variante des Kurpfälzischen nicht zuletzt wegen dessen eklatanter Nominativ/Akkusativ-Schwäche immer noch ein wenig auf Kriegsfuß, kommt mir der „Hohe Nistler" ausgesprochen spanisch vor. Bei etwas gutem Willen erinnert er mich zumindest im Winter an den Whistler Mountain von British Columbia, Kanada, obwohl er andererseits so gar nicht an dessen Dimensionen heranreicht.
„Nesteln" ist eigentlich ein sehr hübsches, weil anschauliches deutsches Verb. Eine Verkleinerungsform, die uns in einem passenden Bild vor Augen führt, wie jemand verspielt-halbherzig an etwas herumwerkelt wie ein Vogel an seinem noch im Rohbau befindlichen Nest, mal einen Zweig von hier nach da schiebt oder ein Klümpchen Grasnarbe so zielsicher ablegt, als folge er einer in seiner DNA gespeicherten Blaupause „Nest". Und jemand, der nestelt, ist eben ein Nestler oder von mir aus alt-mittelhochpfälzisch ein Nistler.
Klugscheißer, eine ihrerseits jedenfalls in Deutschland absolut nicht in ihrem Bestand gefährdete Spezies, werden an dieser Stelle einwenden, dass Berge weder nesteln noch nisteln, sondern allenfalls Vögeln die Gelegenheit zu dergleichen Beschäftigungen geben können. Linguistisch-funktional ausgedrückt, sind sie patientes, nicht agentess – Erduldende und keine Agierenden. Nun gut, aber in einer verwunschenen Gegend, in der man einander fröhlich „ein guter Tag" wünscht und den Kaffee mit dem freundlichen Hinweis „Hier iss Ihren Cappuccino" serviert, gehört die Verwechslung von agentes und patientes wahrscheinlich noch zu den leichteren Übungen. Macht auch gar nichts, schließlich setzt sich das ja bis in die sogenannte „Hochsprache" fort, von der ich als Kind immer annahm, damit sei die während des Hochamts in der katholischen Kirche halb geleierte, halb gechantete Litanei gemeint.
Nehmen Sie zum Beispiel den berühmten „blinden Passagier", der ja nicht so heißt, weil er selbst sehbehindert wäre und sich quasi auf das Schiff verlaufen hätte – wiewohl auch diese Variante einiges für sich hat – sondern weil er sich an Bord gestohlen und die Schiffscrew ihn, wenn er denn Glück hat, nicht sofort bemerkt hat. Logik strahlt das alles nicht aus. Muss es aber auch nicht. Im Gegenteil. Ihre leicht chaotische, weil jederzeit zur Sprengung angeblich unabänderlicher Formerfordemisse bereiten Struktur verleiht der Sprache zumindest im Alltagsgewand ja gerade ihre immerwährende schöpferische Ambivalenz. Dies wiederum macht sie zur letzten Bastion der Menschheit gegen die Allmachtsfantasien wild wuchernden Algorithmen und künstlicher Intelligenz.
Toponyme wie dieses hat der Volksmund geprägt und nur er weiß mit letzter Sicherheit, was damit gemeint war, oder gemeint ist. Deutungsversuche sind insofern wohlfeil. Vielleicht verdankt der Berg, der die Gemeinde Handschuhsheim nach Norden von der benachbarten namens Dossenheim abgrenzt, seinen Namen ja dem Umstand, dass er ursprünglich besonders viele Nistplätze für auffallend große Vogelarten bereithielt, die bei ihren Streifzügen über dem Sattel schon von Weitem zu erkennen waren und dem Berg sein Gepräge verliehen. Diese Adler, Falken und Bussarde wären dann freilich von der Anlage des inzwischen wieder stillgelegten Steinbruchs zum Porphyr-Abbau nachhaltig vergrämt worden.
Persönlich neige ich eher der These zu, dass der Berg mit seinen beiden Kuppen und dem sie verbindenden Sattel von Ferne betrachtet, das Bild eines riesigen, hoch gelegenen und gewissermaßen unübersehbar einladenden Nestes abgibt. Das wäre dann allerdings schon etwas für die dinosaurierhafte Vogelbrut à la Jurassic Park.
Warum also dem Hohen Nistler einen längeren Text widmen, wenn sich dessen Autor doch so gar nicht wirklich von ihm angezogen fühle? Gemach, Brauner, der Berg und ich, wir sind einander nicht so fremd, wie es diese Zeilen nahelegen. Vielmehr teilen wir ein düsteres Geheimnis, das an dieser Stelle publik zu machen ich ehrlich gestanden immer noch zögere. Aber warum aus seinem Herzen eine Mördergrube machen.
Es begab sich nämlich in jener längst in die hintersten Gemächer des Palastes meiner Erinnerungen verbannten Zeit, da ich noch mitten in einem anderen und dabei recht aufreibenden Berufsleben stand und nicht im Traum daran gedacht hätte, mich eines Tages im betulichen Heidelberg zur Ruhe zu setzen, dass meine oben bereits erwähnte teure Freundin und ich es uns zur Gewohnheit machten, dem Brüsseler Hamsterrad bisweilen zu entsteigen und dieses oder jenes Wochenende gemeinsam und geruhsam in Heidelberg zu verbringen. Dort unterhielt die Dame meines Herzens, die mit der damals immer etwas schmuddelig wirkenden belgischen Hauptstadt nicht so richtig warm zu werden verstand, eine kleine blitzblanke Zweizimmer-Zweitwohnung. Doch, doch, das konnte man sich damals durchaus noch leisten.
Dabei fiel uns natürlich auf, dass Heidelberg sich jedenfalls an Wochenenden regelmäßig in einen veritablen Freizeitpark zu verwandeln pflegte. Da wurde auf den Pisten zwischen nummerierten „Gewannen", sprich Feldern und Äckern, auf Teufel komm raus geradelt, geskatet, gejoggt, geritten und nordisch gewalkt. Auf den Rasenflächen am Fluss, die hier prosaischer „Wiesen" und nicht, wie am Rhein, „Auen" heißen, waren Yoga und Tai-Chi, aber auch Frisbee, Fußball und Beach Volley angesagt. Und auf dem Fluss selbst gaben sich Segler, Ruderer, Drachenbootfahrer und Stechpaddler ein Stelldichein.
Einem so massiven Aufgebot an bewegungssüchtigen Menschen und Möpsen kann man sich auch als Phlegmatiker schwer entziehen. Und obwohl von klein auf eher der Radlertyp, ließ ich mich bei der einen oder anderen Gelegenheit dazu hinreißen, unter der Führung meiner Freundin die tierisch steilen Hänge des Odenwalds zu erklimmen.
So auch an jenem Sonnabend, als wir vom Basislager nahe der Tiefburg zum sogenannten Weißen Stein aufbrachen, einem Nachbarn des Hohen Nistler, von dem ich damals jedenfalls namentlich noch nicht gehört hatte, obwohl er auch zu jener Zeit schon dort gestanden haben dürfte, wo er sich heute befindet, aber auffallend wenig Aufhebens von sich machte.
Was ich auch nicht ahnte, aber sehr schnell begriff, war die Tatsache, dass meine Freundin trotz einer mehr als rudimentären Ortskenntnis im unübersichtlichen Gelände schnell mal die Orientierung verlor. Für sich genommen kein Beinbruch, sondern eine menschliche Schwäche, mit der ich, der ich nie Pfadfinder war und Wälder wegen der unberechenbaren Wildschweine weitgehend mied, durchaus sympathisieren konnte. Problematisch werden solche Schwächen regelmäßig erst dann, wenn sie von dem Bemühen begleitet werden, mangelnde Sachkenntnis durch eine umso ausgeprägtere Dezidiertheit der Meinung, des Urteils zu kompensieren. Dagegen im vorliegenden Falle anzukommen, ist dann für einen Ortsunkundigen wie mich naturgemäß doppelt schwer.
Der langen Rede kurzer Sinn: wir verliefen uns wie Brad Majors und Janet Weiss zu Beginn der Rocky Horror Picture Show und landeten sozusagen am Haus des Frank N. Nistler. Als von Wanderern eher selten frequentierter Berg war dieser vermutlich über unseren Besuch ähnlich verblüfft wie wir über sein Verharren an dieser Stelle.
Die Wanderung zog sich. Irgendwann schlug ich mich, einem unabweislichen Ruf der Natur folgend, seitwärts in die Büsche, um nach einem geeigneten Ort zu suchen, an dem ich mich unbeobachtet würde erleichtern können. Dabei landete ich plötzlich auf einer Kuppe, die ich zwar nicht direkt als Lichtung im forstwirtschaftlich-technischen Sinne bezeichnen würde, die aber doch etwas heller und weniger dicht bewachsen wirkte als der Rest des uns umgebenden Waldes. Noch bevor ich dazu kam, weitere Vorbereitungshandlungen durchzuführen, beschlich mich dasselbe mulmige Gefühl wie Jahre zuvor, als ich mich auf den Shirley Heights der Kleinen Antilleninsel Antigua plötzlich auf einem Friedhof mit Gräbern von Seeleuten aus der karibischen Zeit des Kapitäns und späteren Admirals Lord Nelson wiederfand. Gräber, die, stark verwittert, als solche für mich auf Anhieb nicht zu erkennen gewesen waren.
Sie wissen sicher, was ich meine, auch wenn Sie noch nicht in der Karibik waren: so ein mulmiges Bauchgrimmen, das man gelernt hat, als Warnung vor einer undefinierbaren Gefahr zu verstehen und zu respektieren.
Ich hielt sofort inne, sah mich etwas genauer um und hatte dann den Eindruck, diesmal versehentlich auf die geheiligte Erde eines Friedhofs von Waldindianern getreten zu sein, wie ich sie aus den wunderbaren Erzählungen J.F. Coopers zu kennen glaubte.
Schuld daran waren allerlei an Baumstämmen und Zweigen baumelnde Effekten von Personen, die, so die naheliegende Vermutung, nicht mehr unter den Lebenden weilten und an die vermittels dieser Objekte erinnert werden sollte: kleine Taschen, Bilder, Stoffschleifen und dergleichen mehr. Besonders angetan hatte es mir eine Herren-Armbanduhr, die gleichsam als doppeltes Memento an einem Baumstamm befestigt und auf 11.37 Uhr stehengeblieben war.
Ich machte mich trotz praller Blase schleunigst vom Acker beziehungsweise von der Kuppe und folgte meiner Nscho-tschi, die bereits so weit vorausgeeilt war, dass sich mir der hässliche Verdacht aufdrängte, sie hätte mich nörgelnden Quälgeist womöglich abhängen wollen. Das hätte sie sich sparen können, bin ich doch als sehr hartnäckig bekannt, wenn's um etwas geht.
Schon, um der berühmten Chronistenpflicht Genüge zu tun, sollte ich erwähnen, dass wir letzten Endes doch noch zum Restaurant auf dem Weißen Stein gelangten. Allein, mir war der Appetit auf Maultaschen und Co. vergangen.
Wie relativ richtig ich mit meiner Mutmaßung vom „Indianerfriedhof" gelegen hatte, erschloss sich mir erst viel später. Das damals vermutlich schon dort aufgepflanzte Holzkreuz hatte ich nicht wahrgenommen, wohl, weil ein dunkles hölzernes Objekt im Wald leicht zu übersehen ist und ich vorwiegend nach oben geblickt hatte, dorthin, wo der seltsame Christbaumschmuck hing. Den braunen Sandstein-Findling, der heute als Gedenkstein jene Stelle markiert, hätte ich vermutlich nicht übersehen, aber der stand damals noch nicht dort. Und da auch meine Internet-Affinität in jener Zeit wenig entwickelt war, dauerte es schon eine ganze Weile, bis ich mich über die wahre Natur des Ortes und den Absturz der Douglas DC-3 A DCCCC auf dem Hohen Nistler vom 22.12.1991 genauer kundig gemacht hatte. Eine der größeren Katastrophen der deutschen zivilen Luftfahrt bei der 28 Menschen ihr Leben lassen mussten. Obwohl „mussten" hier vielleicht unangebracht ist, gab es doch wohl selten einen Absturz, der so überflüssig gewesen wäre wie dieser.
Das Fliegen, präziser, die Benutzung des Verkehrsmittels Flugzeug, war in jenen Tagen noch unabdingbarer Bestandteil meiner Dolmetschertätigkeit und solange ich nicht unter einer so absolut hysterischen Flugangst litt, wie sie etwa ein italienischer Brüsseler Kollege manifestierte, der sein Leben absurderweise lieber dadurch doppelt und dreifasch gefährdete, indem er selbst Dienstreisen etwa nach Athen mit dem eigenen Auto durchführte, wollte ich mir durch die leicht morbide anmutende Beschäftigung mit einem solch spektakulären Flugzeug-Unfall wie diesem auch keine Flug-Phobie selbst induzieren.
Andererseits ließ mich während all jener Jahre die Erinnerung an diese seltsame Episode nicht los. Ich fühlte mich wie Ali, der treue Diener des Sultans, der des Morgens auf dem Markt von Bagdad versehentlich dem Tod ins Auge blickt, mit dem er eigentlich erst abends in Samarra sein Stelldichein hat. Insofern ist „Wir sind alle tot" auch der Versuch einer paradoxen Vergangenheitsbewältigung durch fiktive Rationalisierung, wenn Sie mir noch folgen.
Nun, da ich altersbedingt ein wenig fatalistischer gestimmt bin als zuvor und umso unbelasteter in ein Flugzeug steige, beschloss ich, der Saga vom Hohen Nistler die Stirn zu bieten und mich einigen der Fragen zu stellen, die sich für mich als Laie mit dem Absturz der „Dakota" weiterhin verbinden.
Nicht, um alte Wunden aufzureißen, Gott behüte. Dazu liegen die Ereignisse am Nistler ebenso wie die der beiden folgenden Geschichten hoffentlich auch schon etwas zu weit zurück. Und erst recht nicht, um mich sensationslüstern am Grauen der Nachlese eines solchen Absturzes zu weiden. Vielmehr bin ich davon überzeugt, dass es einigen von Ihnen so geht wie mir, der ich bis vor kurzem nicht so recht nachzuvollziehen vermochte, was eigentlich damals wirklich genau geschah und warum es zu diesem folgenschweren Crash kommen konnte.
Auf den ersten Blick eine müßige Übung, scheint die Ursache des Absturzes doch in Form menschlichen Versagens hinreichend geklärt. In Wahrheit verschieben summarische Verdikte wie dieses der damals noch zuständigen Flugunfall-Untersuchungsstelle beim Verkehrsministerium die Sache nur eine Tür weiter. Die Frage muss doch lauten: wer hat wo, wann und warum die falschen Entscheidungen getroffen, die in ihrer Summe zum Absturz führten?
Eines ist es, jemandem die (Haupt-)Schuld an einem Unfall zu geben, etwas ganz andere, ihm mit Urteilen wie „poor airmanship" von vornherein jegliche berufliche Kompetenz abzusprechen und ihn damit zur Unperson zu machen. So einfach und eindeutig liegen die Dinge erfahrungsgemäß eher selten.
Dass den führenden Personen des damals an Bord befindlichen und beim Absturz umgekommenen Filmteams um den Regisseur Martin Kirchberger auf den entsprechenden Internetseiten noch heute Kränze geflochten werden, sei ihnen von Herzen gegönnt. Dass man nach näheren Angaben über die beiden beteiligten und ebenfalls umgekommenen Piloten jedoch mit der Lupe suchen muss, scheint mir zumal dann ungerecht, wenn man, wie wir im Folgenden noch sehen werden, das Filmteam von einem sehr ausgeprägten mitwirkenden Verschulden am Crash nicht freisprechen kann.
Nach meiner persönlichen Erfahrung aus dem Bereich der Seefahrt sind solch katastrophale Ereignisse so gut wie nie monokausal geartet, sondern ergeben sich letzten Endes mit durchaus tragisch zu nennender Zwangsläufigkeit aus einer Kette menschlicher Befindlichkeiten und daraus resultierender Fehlreaktionen. Das macht solche Unfälle bisweilen zu den sichtbaren äußerlichen Erscheinungsformen innerer Konflikte. Ich kann mich tagelang über die relative Inkompetenz und Dreistigkeit eines Crewmitgliedes ärgern. Das enthebt mich jedoch nicht der Verpflichtung, seinen etwaigen Einwand in einer krisenhaften Situation zu überdenken, denn er könnte ja wenigstens dieses eine Mal tatsächlich Recht haben.
Ursachenforschung ist das gerade Gegenteil von Verschwörungstheorien. Wo letztere aus einem Gefühl der existenziellen Ohnmacht heraus obskure höhere, uns Menschen übel gesonnene Mächte dingfest machen und damit erst recht zur Verschleierung beitragen, dreht die Ursachenforschung mühsam und unspektakulär Steinchen für Steinchen um und hält sich bei der Beantwortung der Frage, was genau passiert ist, ausschließlich an die Evidenzen. Die Frage nach der Schuld stellt sich wie im strafrechtlichen Schema erst ganz am Ende und wird, wenn überhaupt, in aller Regel differenziert und umsichtig zu beantworten sein.
Man kann und wird mir zweifellos entgegenhalten, dass ich als fliegerischer Laie für eine derartige Analyse nicht fachkundig genug sei. Das ist zutreffend und auch wieder nicht. Denn erstens geht es hier, wie auch in den anderen beiden DC-3 Geschichten, nicht allein um technisch-fliegerische Belange, sondern auch und vielleicht sogar in erster Linie um psychologische und allgemein menschliche Zusammenhänge, die solchen Katastrophen wie der vom Hohen Nistler ungewollt den Weg bereiten.
Und zweitens hat mich mein früherer Beruf eines Dolmetschers gelehrt, dass sich so gut wie nichts der gedanklichen Nachvollziehbarkeit entzieht. Eine entsprechende Motivation vorausgesetzt, kann man sich mit viel Disziplin und Beharrlichkeit in fast alles einarbeiten und hineindenken. Ich muss nicht selbst mit dem Skalpell hantieren können, um zu begreifen, was ein Chirurg tagtäglich zu leisten hat. Und ich muss nicht Pilot sein, um mich ins Cockpit einer JU 88 oder einer DC-3 versetzen zu können.
Gerade die zurzeit immer noch grassierende Corona-Krise hat uns alle gelehrt, nicht jeden Unsinn zu glauben, der von dieser oder von jener Seite an uns herangetragen wird. Kein Experte erleichtert im besten Falle das eigene Urteil, ersetzen kann er es nicht.
Dass blindes Vertrauen in angeblichen Sachverstand ungesund sein kann, zeigt uns nicht zuletzt der vermeidbare Crash der DC-3 am Hohen Nistler. Hätte auch nur einer der als Passagiere einspringenden Komparsen die Reiseroute kritisch hinterfragt, wäre es vermutlich nie zum Absturz gekommen.
Experten, auch das habe ich in meiner früheren Tätigkeit gelernt, sind oft genug Fachleute nur im Nachhinein und erkennen sich anbahnende Entwicklungen in aller Regel nicht früher als Sie und ich. Welcher Experte hätte den Fall der Mauer, das Attentat auf die New Yorker Zwillingstürme der WTO oder auch die Beinahe-Implosion des Euro vorhergesehen?
Als Jean Béranger, der Sachverständige für Unfallursachen-Untersuchung der Canadian Pacific Railway, von dem im „Minutenmann" die Rede gehen wird, vor den Wrackteilen der nahe Québec abgestürzten DC-3 stand, hatte er bis dato nur Zugunfälle, aber noch nie einen Flugzeug-Crash zu begutachten gehabt, war selbst nur selten geflogen und besaß natürlich auch keinen Pilotenschein. Trotzdem brauchte er keine Wochen, keine Tage, sondern nur Stunden, um Drittverschulden als Ursache dieses Absturzes zu diagnostizieren. Das Attentat einem bestimmten Täter zuzuordnen, war dann eine etwas schwierigere, aber ebenfalls lösbare Aufgabe. Wer lange genug suchet, der wird irgendwann auch fündig.
Anlass des Geschehens am Hohen Nistler war Regisseur Martin Kirchbergers satirisches Kurzfilmprojekt „Bunkerlow". Folglich muss unsere Ermittlungsarbeit auch genau bei diesem beginnen.
2. "Bunkerlow", die zweite
Der Unglücksflug der DC-3 A DCCCC vom 22.12.1991 war als Abschluss und durchaus vergnüglicher Höhepunkt der Dreharbeiten im Rahmen des von Regisseur Martin Kirchberger offenbar selbst ersonnen satirischen Kurzfilmprojekts mit dem wortspielerischen Arbeitstitel „Bunkerlow" fest eingeplant. Man hatte an den Tagen zuvor bereits um die Maschine herum am Boden gefilmt, jetzt wollte man endlich auch in der DC-3 drehen, während diese sich in der Luft befand. Die Anwesenheit einer Bauchtänzerin unter den Statisten gibt Grund zu der Annahme, dass man es dabei ordentlich krachen lassen wollte. Wer war Martin Kirchberger und wie sah sein satirisches Konzept im Einzelnen aus?
„Kurzfilme" sind im Grunde genau das, was ihr Name besagt, wobei die Länge natürlich leicht variiert, für gewöhnlich aber bei etwa dreißig Minuten liegt. Historisch gesehen, stieg der Kurzfilm jedenfalls in den USA zwischen dem Ende des Ersten Weltkriegs und dem Ausbruch der Weltwirtschaftskrise zur eigentlichen Urform dessen auf, was die Welt dann als typisches Hollywood-Produkt von neunzig oder mehr Minuten Länge kennen und schärten lernte. Mit dem Aufkommen der Spielfilme wurde der Kurzfilm in die Nische vor allem episodenhafter schwarz-weißer Slapstick-Stummfilm-Streifen zu Klimpermusik-Begleitung wie die Buster Keatons oder Charly Chaplins sowie, immer noch in schwarz-weiß, aber bereits in Tonfilmform, Stan Laurels und Oliver Hardys verwiesen.
In den fünfziger und sechziger Jahren erlebte der Kurzfilm in all seinen Schattierungen noch einmal eine regelrechte Renaissance, bevor er dann in den siebziger Jahren zwar nicht völlig in der Versenkung verschwand, aber doch weitgehend marginalisiert wurde, weil mit ihm an den Kinokassen kein Staat zu machen war und er den eigentlich die Konten der Produzenten und Verleihfirmen füllenden Langfilmen die wertvolle, weil nur jeweils einmal zu vergebende Projektionszeit stahl.
Der oft angestellte Vergleich des Kurzfilms mit der Kurzgeschichte hinkt insofern gewaltig, als dem Kurzfilm eine narrative Struktur eigen sein kann, aber nicht unbedingt sein muss. Für die Short Story hingegen, die ja nicht ohne Grund „Geschichte" heißt, ist sie konstitutiv und damit unentbehrlich. Ganz davon abgesehen, dass Vergleiche über mediale Grenzen hinweg stets gewagt und selten aussagekräftig sind. Ich kann die Zuschauer unter Umständen mit einer losen Folge völlig unverbundener Bilder als „Augenschmaus" dreißig Minuten lang unterhalten, was moderne Musikvideos bisweilen ja auch zu versuchen scheinen. Eine wie auch immer eingestellte Leserschaft mit dem Vortragen völlig unverbundener Sätze als dadaistischer „Ohrenschmaus" dreißig Minuten lang bei der Stange zu halten, wäre vermutlich nicht einmal einem Klaus Kinski in Hochform vergönnt gewesen.
Formal-inhaltlich unterliegt der Kurzfilm keinerlei Normen oder Konventionen, was ihn zum Beispiel für Novizen als erster Einstieg in die Filmkunst geeignet erscheinen lässt, ihn gleichzeitig aber auch für arrivierte Regisseure wie Steven Spielberg, George Lucas oder Martin Scorcese, die irgendwann einmal als Kurzfilmer begonnen haben, zwischendurch dann des Hollywood-Einerleis überdrüssig wurden, als Experimentierfeld interessant macht. In jüngerer Zeit hat vor allem die kommerzielle Werbung mit ihren auf wenige Sekunden Dauer „eingedampften" Stories großen Einfluss auf das Kurz- und Langfilmgeschehen ausgeübt.
Da selten jemand ins Kino geht, nur um sich einen einzigen Kurzfilm anzusehen, werden diese vor allem auf Festivals wie den schon seit den fünfziger Jahren existierenden Oberhausener Kurzfilmtagen in Blöcken zusammengefasst dargeboten, die unter einem bestimmten Motto stehen oder einem konkreten Thema gewidmet sein können.
Jahrgang 1960, wurde der gebürtige Rüsselsheimer Kirchberger gern als junger deutscher Nachwuchsregisseur bezeichnet. Eine etwas dubiose Ehre, übersieht sie doch geflissentlich den Umstand, dass ein Rainer Werner Fassbinder in diesem Alter schon die Kleinigkeit von drei Kurz- und etwa zwei Dutzend abendfüllenden Spielfilmen abgedreht hatte.
Ein unfairer Vergleich? Vielleicht, aber andererseits ein bei objektiver Betrachtung durchaus aufschlussreicher. Im Gegensatz zur Münchner Rampensau Fassbinder entstammte der provinzielle Rüsselsheimer Kirchberger nicht dem Schauspielmilieu und wuchs noch dazu in einem auf den ersten Blick wenig kulturaffinen und innovativem Schaffen eher misstrauisch gegenüberstehenden Umfeld auf.
Als Absolvent der Offenbacher Hochschule für Gestaltung und ohne jede eigene schauspielerische Erfahrung war er, der sich auch als Sänger und „Wendemaler" versuchte, eher das, was man wohlwollend ein Multitalent nennt und hatte weder das Filmen noch sonst irgendwas von der Pike auf gelernt. Der Baum, von dem er gefallen war, streckte seine Äste in Bauhaus-Manier nach allen Seiten aus und gab den Studentinnen und Studenten die Wahl zwischen Design, Architektur, Malerei und, neben weiteren, eben auch Film. Das ist ein in seinen Auswirkungen nicht gering zu achtender Unterschied, der wenigstens zum Teil erklärt, weshalb Kirchberger sich mit dieser Kunstform alles in allem eher schwertat.
Im Übrigen gab er als Anführer der Rüsselsheimer „Spaßguerilla" den lustigen Rebellen, protestierte und demonstrierte unter anderem gegen die Startbahn West – wer tat das damals nicht – und ging zum Lachen, nein, nicht in den Keller, sondern nach Mainz, in die Heimat der Heinzelmännchen und Hofsänger.
Zum Filmen fühlte er sich vergleichsweise spät berufen, hatte mit Gleichgesinnten wie dem Kameramann Ralf Malwitz und dem Drehbuchautor Klaus Stieglitz die auch nicht ganz ernst gemeinte Filmgesellschaft „Cinema Concerta" gegründet. Emst gemeint oder nicht, handelt es sich insofern um einen recht anspruchsvollen Titel, als das concerto traditionell die Ambition verfolgt, zwei gegensätzliche und auf den ersten Blick absolut unvereinbare Ideen oder Konzepte auf überraschend-kurzweilige Art miteinander zu verbinden.
Darin liegt ein wenig die Tragik der Spätberufenen, dass sie ihre jeweiligen Vorstellungen von Kunst unter Umständen bereits weitgehend fortentwickelt haben, ohne mit dem Rüstzeug des jeweiligen Gewerbes hinreichend vertraut zu sein, um solche Vorstellungen auch stilsicher und erfolgreich in die Praxis umsetzen zu können. Ich mag die tollsten Vorstellungen von exotischer Fusionsküche hegen, doch wenn ich nie Gemüse blanchiert, Fischfilets gebeizt oder eine Sauce Bemaise aufgeschlagen habe, laufe ich Gefahr, grandios zu scheitern.
Dass dies der Fall Kirchbergers gewesen sein könnte, darauf deutet der missliche Fakt, dass seine bis dato gedrehten acht Kurzfilme allesamt gefloppt hatten. Was, da wir gerade bei der Küche waren, unter anderem an Kirchbergers manieristischer Gurkenobsession gelegen haben mag, die der Kritik anscheinend sauer aufstieß.
Trotz solcher Rückschläge am Ball zu bleiben, setzt überdurchschnittliches Selbstvertrauen oder ein gerüttelt' Maß an Unbelehrbarkeit voraus. An Minderwertigkeitskomplexen, so viel lässt sich schon jetzt sagen, litt Kirchberger offenbar nicht. Aber erste Eindrücke können bekanntlich täuschen.
Der Lauf der Dinge schien ihm jedenfalls recht zu geben. Für die Verwirklichung des Projektes Nr.9 stellte die Filmförderung Kirchberger die angesichts seiner bisherigen Misserfolge erstaunlich hohe Summe von DM 95.000 zur Verfügung. Gut, er muss die Damen und Herren davon überzeugt haben, dass es diesmal nicht um Gurken, sondern um ein Thema mit unmittelbar aktuellem politischem Bezug gehen würde. In einem solchen Fall besteht bei einer Ablehnung erhöhter Begründungsdruck, den sich die Filmförderung vielleicht nicht aussetzen wollte. Dann schon lieber den Mann bezahlen und gut ist's. Trifft ja keinen Armen. Außerdem müssen die noch nicht abgerufenen Mittel aus haushaltstechnischen Gründen gegen Ende eines Jahres oder einer Rechnungsperiode raus, sonst gibt's demnächst entsprechend weniger.
Rüsselsheim, da war doch was ... Der Name der Stadt findet bei mir einen positiven Widerhall, habe ich doch nur die besten Erinnerungen daran. An den Namen, wohlgemerkt, nicht an die Stadt als solche. Von der sah ich nämlich nie auch nur eine Kirchturmspitze. Ein Paradoxon, das der näheren Erläuterung bedarf.
Mein Vater, während des Krieges Angehöriger der Luftwaffe, aber nicht beim fliegenden Personal, hatte nach kurzer französischer Gefangenschaft, der er sich so schnell wieder entzog, dass er nicht mal Zeit fand, ein paar französische Floskeln zu lernen, in Wuppertal, seiner Heimatstadt, alsbald eine Anstellung als Hausmeister und Fahrer beim Arbeitgeberverband „Metall Nordrhein" gefunden, dessen leitende Persönlichkeiten damals ebenfalls noch mit mindestens einem Fuß im Knobelbecher standen. Der Verband residierte während der fünfziger und sechziger Jahre standesgemäß in einer Elberfelder Villa der sogenannten Gründerzeit nahe dem dortigen Landgericht. Warum ausgerechnet in Wuppertal, das ja meines Wissens nicht einmal eine nennenswerte eigene metallverarbeitende Industrie besaß, sondern allenfalls durch den Bau der Schwebebahn an der Wende vom neunzehnten zum zwanzigsten Jahrhundert zum Großabnehmer für Essener Kruppstahl geworden war, ansonsten aber eher für seine Farben und Lacke sowie einen Haufen skurriler Sekten und Freizeitprediger wie Bruder Johannes Rau bekannt war, ist mir ein Rätsel geblieben, spielt hier aber auch keine entscheidende Rolle.
Fakt ist, dass ich, wiewohl aus kleinbürgerlichen Verhältnissen, durch diese Laune des Schicksals wohlbehütet in einer hochherrschaftlichen Villa aufwuchs, fast wie das Söhnchen von Graf Protz.
Eine im Prinzip schizophrenogene Konstellation, mit der ich als Einzelkind aber ganz gut zu leben lernte. Ich machte mir ein Vergnügen aus allerlei Rollenspielen, empfing meine angestaubten Kumpels aus der Nachbarschaft wie König Arthur die Ritter der Tafelrunde und winkte an jedem ersten Mai den mit roten Bannern und Transparenten vorbeidefilierenden Gewerkschaftskohorten so huldvoll zu, als seien die nur gekommen, mich zu grüßen wie die Todgeweihten den kleinen Nero.
Alle paar Jahre war ein neuer Dienstwagen fällig und da „Metall Nordrhein" sich offenbar keinen Mercedes leisten konnte oder wollte, Opel hingegen sowohl erschwinglich als auch irgendwie politisch korrekter fand, fuhr mein Vater regelmäßig nach Rüsselsheim, um dort das gar nicht mal so alte gebrauchte Gefährt gegen das neue einzutauschen. Ich durfte ihn bei diesen Gelegenheiten jedes Mal begleiten. Warum, weiß ich nicht, darum gebeten hatte ich nicht. Vielleicht war mein Vater immer aufs Neue von dem Vorgang emotional so überwältigt, dass er alleine auf sich gestellt damit nicht fertig wurde. Oder er wollte mir die Symbolik des sich in immer größere und schnellere Autos übersetzenden gesellschaftlichen Aufstiegs näherbringen und zur Nachahmung ans Herz legen.
Sei's drum. Von der Stadt Rüsselsheim sah ich dabei, wie gesagt, null, nada. Im Gegenteil. Hätte man mir eines Tages reinen Wein eingeschenkt und mich wissen lassen, dass eine Stadt dieses Namens gar nicht existiert, sondern nur eine Chiffre für den Erwerb aufregend neu riechender Opel war, hätte mich das nicht sonderlich überrascht. Doch Adam Opel und seine „AG", die ich für die Abkürzung des Mädchennamens seiner Frau hielt, waren real und hatten mich gleichsam unwissentlich adoptiert.
Im schwer mit Zelt und Hausrat beladenen und unter der Last ächzenden Olympia krochen meine Eltern und ich über die Alpen nach Italien. Nicht auf dem Brenner, den überließen wir den österreichischen Weicheiern, sondern knackig über den Schweizer Sankt Gotthard, dessen Name in meinen Kinderohren einen Klang wie Donnerhall hatte und aus dessen Gipfelnebeln ich vor meinem geistigen Auge jederzeit den lieben Gott höchstpersönlich in Lederhose und Rucksack sowie mit dem knotigen Wanderstock des Alm-öhi in der Faust heraustreten sah.
Bergauf qualmten alle Zylinder des Olympia-Motors um die Wette. Bergab folgte dann die Klammeräffchen-Nummer: mein Vater verwuchs mit dem Steuerrad, meine Mutter hatte beide Hände am Knauf des Schalthebels, damit der Gang nicht raussprang und wir den Hang hinabschossen wie Max Bolkart die Sprungschanze. Großes Kino.
Dem Rekord verpasste ich bei meinen ersten eigenen Fahrversuchen zunächst eine schicke Beule, dann einen weniger schicken Kolbenfresser. Meinem Vater, ehemaliger Ringer und Grobmotoriker, brach mehrmals der in die Steuersäule integrierte Schalthebel ab wie trockenes Reisig, auf das sich ein Gorilla gelehnt hatte. Nichts von alledem konnte unser Vertrauen in den Mann mit dem irgendwie alttestamentlich anmutenden Namen Adam Opel erschüttern. Gab es auch eine Eva Opel, die vom Baum der Erkenntnis genascht und daraufhin die Kurbelwelle erfunden hatte?
Kapitän und Admiral nahmen quasi meine väterlicherseits subsidiär angedachte Marinekarriere vorweg, zu der es aus Gründen, die Adam Opel allerdings nicht zu vertreten hat, dann ebenso wenig kam, wie zu der Fliegerlaufbahn, die eigentlich meines Vaters erste Wahl für mich gewesen war.
Wo war ich stehengeblieben? Martin Kirchberger, richtig. Dass der junge Mann früh einen Hang zur Satire entwickelte, muss nicht weiter verwundern. Zum einen erlebte er das tagtägliche Treiben in seiner Heimatstadt wohl oft genug als klamottenhafte Realsatire. Und zum anderen wird einem gebürtigen Rüsselsheimer die Satire dank der Nähe zu Frankfurt/Main ja regelrecht in die Wiege gelegt. Schließlich waren es Mitglieder der sogenannten „Neuen Frankfurter Schule", die als erste erfolgreich damit begannen, das bewegte Nachkriegsgeschehen der Bundesrepublik in ihrem Magazin pardon satirisch aufs Korn zu nehmen. Schon die Namen sowohl der Einrichtung als auch des Magazins trieften vor augenzwinkernder Ironie.
Die „neue" Frankfurter Schule verstand sich als Gegenentwurf zur „alten" der Theodor Adorno, Max Horkheimer und weiterer philosophisch-soziologischer Koryphäen. Und den Zeichnern und Textern der pardon lag natürlich nichts ferner, als sich für ihre entlarvenden Unverschämtheiten in vorauseilendem Gehorsam etwa zu entschuldigen. Das galt umso mehr für das ab 1979 erscheinende, von einigen Abtrünnigen der NFS gegründete Konkurrenzblatt Titanic, das sich im Gegensatz zur pardon als hinreichend anpassungsfähig erwies, um sich, auch durch die satirische Frischzellenkur der Wende neu belebt, bis in unsere Tage hinüberzuretten.
International hatten filmisch vor allem die Männer von Monty Pythons Fliegendem Zirkus mit ihren satirischen Sketchen und Filmen den Ton angegeben, bis der Truppe um John Cleese und Eric Idle eine erste Trennung im Jahre 1983 das Todesglöckchen läutete.
Die Produktion inhaltlich-thematisch weit gestreuter Kurzfilme von Essaycharakter und höchstens 30 Minuten Länge griff während ihrer Renaissance in der Bundesrepublik der sechziger Jahre derart um sich, dass man mit den Zelluloidstreifen vielleicht noch nicht die Straßen pflastern, aber immerhin mehr und mehr Kurzfilmfestivals bestücken konnte, deren ältestes, wie gesagt, erstmals im WM-Jahr 1954 in Oberhausen stattfand.
Malocherstädte und Kurzfilmfestivals scheinen irgendwie füreinander bestimmt, passen jedenfalls besser zueinander als harte körperliche Arbeit und melodramatische Langfilmschinken à la Vom Winde verweht. Stoff für eine germanistische Magisterarbeit, die es, wenn ich jetzt kurz darüber nachsinne, wahrscheinlich schon längst gibt. 1994 gesellten sich sozusagen im Gedenken an Kirchberger auch die Rüsselsheimer Filmtage hinzu. Und das muss ja längst noch nicht das Ende der Fahnenstange sein. Jedem Provinznest sein eigenes Kurzfilmfestival, so lautet die ultimative Zielsetzung. Das Medium ist eben doch nicht die Botschaft, wusste schon Karl Lagerfeld, sonst wäre er nicht so rastlos drauflosknipsend durch die Pariser Szeneviertel gegeistert.
Videos, „Spots", „Clips", „Trailer", das eine oder andere originelle Werbefilmchen und vieles andere mehr brachten den ehedem etwas linkisch daherkommenden dokumentarischen Kurzfilm mit oder ohne hintergründigem Murmelkommentar und leicht esoterischem Inhalt wie einen alten Opel Blitz wieder zum Laufen.
So hartnäckig-bösgläubig man uns Germanen Humorlosigkeit und Mangel an Selbstironie nachsagt, wird kaum einer dieser ausländischen Verleumder ernsthaft in Abrede stellen wollen, dass wenigsten schon mal die bissige Satire, bei der einem gelegentlich das Lachen im Halse steckenbleibt, nicht erst seit Bert Brecht in Deutschland aber so was von einer angestammten Heimstatt hat.
Satire also hatte sich auch Kirchberger mit seinen Filmen, die er scherzhaft „Mockumentaries" nannte, auf die Fahne geschrieben, mit der er regelmäßig von seinen wilden Nächten in Mainz nach Rüsselsheim zurückkehrte. Erfolglos, ja, aber gerade aus misslungenen Projekten lässt sich bekanntlich am meisten und besten lernen. Dazu muss man sich etwas näher mit dem Wesen dem im Grunde parasitären literarischen Genre Satire befassen.
Da sie sich meist der Techniken der Parodie bedient, braucht die Satire stets eine Gussform oder Kokille, die sie nicht mit flüssigem Metall, sondern mit der Vitriolsäure ihrer satirischen Absicht füllt, um dann den eigentlichen satirischen Gegenstand in dieser ätzenden Flüssigkeit zu zersetzen. Je enger die innere Verbindung von Kokille und satirischem Gegenstand, desto gelungener die Satir. Wohlgemerkt, im Prinzip. Die sklavische Befolgung eines Rezeptes garantiert noch längst kein gelungenes Gericht, wie man weiß.
In der Kürze liegt die Würze, sagt der Volksmund zu Recht. Wer im Bemühen, seine Pointe für jedermann verständlich zu machen, zu lange auf ihr verharrt, läuft Gefahr, den Fisch zu ertränken. Daher die Beliebtheit des dokumentarischen Kurzfilms als Kokille für die satirische Parodie. Das geht sogar so weit, dass man bisweilen den Eindruck haben kann, das „documentary" sei eigentlich nur für die Zwecke der Parodie aus der Taufe gehoben worden.
Ein bissiger Kollege behauptete einmal von dem am Set wie im Privatleben oft bärbeißig dreinschauenden englischen Schauspieler Charles Laughton, er stünde stets mit einem solchen Flansch im Dekor herum, als erwarte er geradezu, jeden Augenblick mal wieder beleidigt zu werden. In diesem Sinne scheint der dokumentarische Kurzfilm stets nur darauf zu warten, wieder mal parodiert zu werden.
Seine wie auch immer zustande gekommenen Streifen nannte Kirchberger, wie gesagt, „Mockumentaries", linguistisch gesprochen eine wortschöpferische Synkope der englischen Begriffe„mock" („spöttisch") und „documentaries".
Wortspiele sind stilistische Tischbomben, mit denen man sparsam umgehen sollte. Denn erstens zünden längst nicht alle und zweitens ist der Knalleffekt im besten Falle schnell wieder verpufft. Zurück bleibt dann nur stinkender Pulverdampf.
Dass Kirchberger in den beiden genannten Fällen, „Mockumentaries" und „Bunkerlow" auf das Englische rekurriert, ist sicher kein Zufall. Schon aus objektiv linguistischen Gründen wie zum Beispiel dem verschwenderischen Überfluss an homophonen Einsilbern oder der Fülle nur scheinbar austauschbarer „Doubletten" germanischen und romanischen Ursprungs, die beeindruckende stilistische Nuancierungen ermöglichen, eignet sich das Englische für Wortspiele ungleich besser als das Deutsche. Nicht nur Shakespeare, sondern auch Magazine wie Punch oder The Economist, ja, die englische Medienlandschaft insgesamt, wären ohne oft die Grenzen des guten Geschmacks überschreitenden „puns" oder Wortspiele schlechterdings undenkbar.
„Mockumentaries" ist für den durchschnittlich gebildeten Deutschen, auf den sie ja zugeschnitten scheinen, sicher unmittelbar verständlich. Bei „Bunkerlow", das nur in englischer Aussprache überhaupt Wirkung entfaltet, dauert es vielleicht ein paar Sekunden länger, bis der Groschen fällt. Ein ausgesprochener „Brüller" ist weder das eine noch das andere.
Um was geht es eigentlich in „Bunkerlow"? Auf ihren nackten Plot reduziert, soll in der Satire dargestellt werden, wie tüchtige Verkäufer einer Gruppe wohlhabender Bürgerinnen und Bürger quasi aus dem Flugzeug heraus angeblich atombombensichere Luftschutzbunker als preiswerten Bungalowersatz aufschwatzen. Den Kulminationspunkt der bizarren Verkaufsaktion bildet der Abwurf einer Bombenattrappe, der die Bunkerdecke am Boden widersteht – was die Kauflust der Kundenschar natürlich nur noch befeuert.
Die Kokille wird hier offenkundig von einer Schein-„Doku" über die sattsam bekannten sogenannten Kaffeefahrten gebildet, im Rahmen derer ältere Menschen zunächst irgendwo in die Pampa gekarrt werden, wo man ihnen dann, fernab aller Verbraucherzentralen, Heizdecken oder andere Objekte des täglichen Bedarfs, die diese Leute so dringend benötigen, wie ein Loch im Kopf, zu horrenden Mondpreisen unter Anwendung gar nicht so sanften moralischen Drucks andreht.
Das breitere Thema der Immobilienspekulation lag 1991 ebenso auf der Straße wie dasjenige des Ausbruchs kriegerischer Auseinandersetzungen im Nahen Osten und auf dem europäischen Pulverfass Balkan.