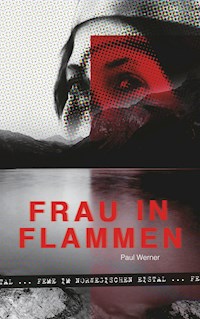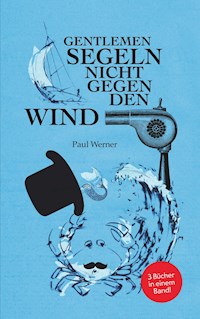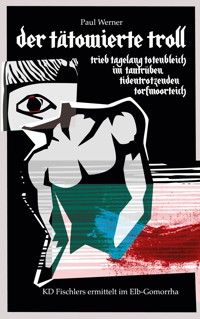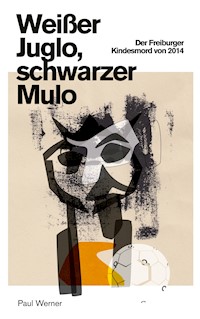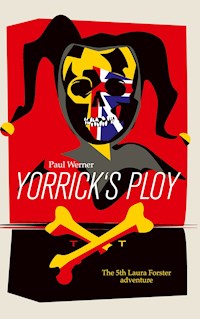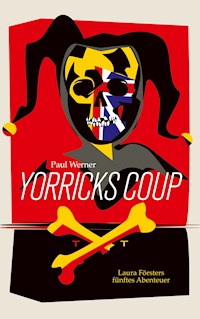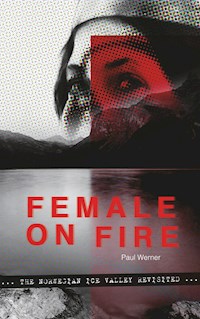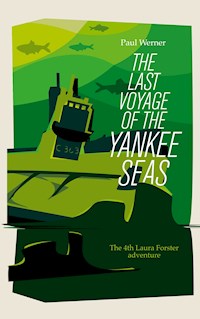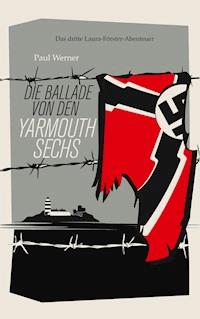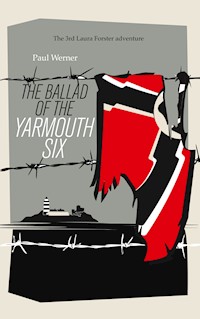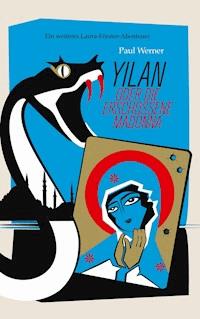Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Laura Förster Trilogie
- Sprache: Deutsch
Eine mysteriöse Yacht im Nachlass ihres kürzlich verstorbenen Vaters führt die nüchtern-sachliche hamburger Unternehmertochter Laura Förster in die verrückte Welt "jenseits des Spiegels" namens Karibik, in der die Gesetze der Logik nichts gelten und Menschenleben nichts zählen. Kaum auf Guadeloupe, dem Liegeplatz der Yacht, gelandet, wird sie von einem Quartett ebenso hartgesottener wie skurriler Drogensöldner in einen mörderischen Tanz verwickelt, in dessen Turbulenzen Laura sowohl ihren Verstand, als auch die Grundfeste ihrer gesichert geglaubten Existenz einzubüßen droht. Charismatische Anführerin der Gruppe ist die raubeinige Solitaire, deren Spontaneität und Skrupellosigkeit Laura verabscheut und bewundert. Vom Vergeltung für erlittene Schmach übenden türkischen Drogenbaron Hakan "dem Leisen" quer durch die Kleinen Antillen gejagt, wachsen die beiden gleichaltrigen Frauen trotz ihrer charakterlichen Gegensätze zu einem unwiderstehlichen "Duo infernale" zusammen, das am Ende erkennt, dass es in der Tat mehr als Seelenverwandtschaft verbindet. Alle Fäden des halluzinierenden Reigens im Schatten eines vernichtenden atlantischen Hurrikans scheinen in den Händen der unsichtbar allgegenwärtigen Yellow Dancer zusammenzulaufen ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 557
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Erstes Kapitel
Der Fels
Drei Herren in Weiß
Toten Manns Hand
Zweites Kapitel
Die Erbin
Die Flucht
Der Buffalo Soldier
Drittes Kapitel
Das Phantom
Der Einäugige
Garben der Persephone
Viertes Kapitel
Der Marsch der Zehntausend
Abenddämmerung
Der Unsinkbare
Fünftes Kapitel
Salziger Fluss
Eine Frau namens Solitaire
Schneewittchen trägt Tanga
Sechstes Kapitel
Die Äquatortaufe
Blumen des Bösen, verwelkt
Im Drachennest
Siebtes Kapitel
Griechenland liegt am Strand
Der barmherzige Kapitän Trigorin
Die Schwarze Königin
Achtes Kapitel
Der fromme Bernard
Solitaires Universitäten
Der tanzende Henkel
Neuntes Kapitel
Baron Samedi
Die Irokesin
Schutzengels Himmelfahrt
Zehntes Kapitel
Die Patin
Penelopes Odyssee
Drei Herren in Schwarz
ERSTES KAPITEL
1. Der Fels.
Die Frau schwimmt um ihr Leben. Verzweifelt peitschen ihre nackten Arme das aufgewühlte Meer. Ruckartig rollt ihr Torso in wiegendem Wechsel nach links und nach rechts. Laut keuchend ringt ihr weit aufgerissener Mund ein ums andere Mal nach Luft, bevor ihr Kopf erneut in den Fluten verschwindet. Welle auf Welle packt die Frau von der Seite und schleudert sie mit jähem Ruck auf den schäumenden Kamm. Dort oben rammt sie wieder und wieder der tosende Meltemi mit der Wucht eines fahrenden Zuges. Weiße Gischt schlägt ihr ins Gesicht und lässt sie für Augenblicke erblinden. Dann fällt sie wie leblos in den fauchenden Abgrund windstiller Wellentäler. Bleiern werden ihre Arme und Beine, immer hektischer die röchelnden Atemzüge. Erbarmungslosen Hammerschlägen gleich dröhnt ihr jagender Puls bis in die Spitzen ihres dunkel glänzenden Haars. Ihre Lungen sind zum Bersten gebläht. Ihr Magen kann das Meersalz nicht halten. Mal um Mal würgt, hustet und erbricht sich die Frau. Ihre Augen schmerzen wie von Säure verätzt. Ihre brennende Haut hängt in Fetzen wie versengtes Pergament.
Klarer Gedanken ist die Frau längst nicht mehr fähig. Nur ihr stählerner Wille treibt sie voran. Durchhalten! Nicht aufgeben! Jetzt bloß nicht schlappmachen! Alles, nur nicht wie eine über Bord gefallene Katze in den Fluten elend ersaufen! Nicht irgendwo in der trüben Tiefe Aalen, Krabben und Würmern zum Futter werden.
Immer wenn gar nichts mehr geht, stellt die erschöpfte Frau den mörderischen Kampf ein, dreht sich auf den Rücken und lässt sich für Augenblicke mit ausgebreiteten Armen in den Wogen treiben. Solange die Frau atmet, trägt sie die See, so lautet das stillschweigende Abkommen. Glänzende Gestirne über ihr tanzen in der mondlosen Nacht wie funkelnde Glasperlen eines verrückten Kaleidoskops.
„Einfach loslassen,“ flüstert aus dem Dunkel eine verführerische Stimme, die sie ungebeten nun schon seit Stunden begleitet. „Warum gibst du nicht nach, ich fange dich auf, versprochen!“ Wind und Strom treiben die Frau nach Süden. Dort aber wohnt das Nichts. Mit dem markerschütternden, halb erstickten Schrei verendender Kreatur hält sie sich die Sirene vom Leibe, dreht sich auf den Bauch und stellt sich aufs Neue dem schier aussichtslosen Kampf.
Jedes Mal, wenn eine „siebte“ Welle sie ganz weit emporschleudert, locken vermeintlich nahe Irrlichter der Küste die Frau. So geht das tödliche Spiel nun schon seit Stunden. Je näher die Frau der rettenden Küste zu kommen scheint, desto weiter rücken die Lichter von ihr ab. Doch dann, urplötzlich, schiebt sich ein buckliger, schwarz dräuender Schatten zwischen die Frau und die Lichterkette. Gleich einem sich träge aus den verborgenen Schluchten des Meers erhebenden Leviathan türmt er sich gebieterisch vor ihr auf. Zögerlich, gleich einem scheuen Einsiedlerkrebs lugt ihr Bewusstsein aus seinem schützenden Panzer luftspiegelnder Halluzinationen. Quälend langsam wird ihr klar, was sich ihr da in den Weg stellt: nichts weniger als ihre Erlösung! Eine winzige Felseninsel, ein pechschwarzes Stück Gneis in der dunklen Flut. Unbewohnt, unbeleuchtet, unbeachtet hebt es sich schemenhaft gegen die Lichter von Lesbos‘ Nordwestküste ab. Seine Sattelform und die helmartige Wölbung, kaum höher als der Mast einer Segelyacht, lassen keinen Zweifel daran, um welche Insel in diesem Reich labyrinthischer Archipele es sich handelt. Fast hat die Frau sie erreicht. Von neuer Hoffnung beseelt, wuchtet sie sich voran. Noch wenige hundert Meter, dann wird sie endlich wieder festen Boden unter ihren Füßen spüren und sich von ihren unsäglichen Qualen erholen können.
Zuvor jedoch muss sie das tödliche Mahlwerk des Klippengürtels überwinden. Felskanten scharf wie Haifischzähne lauern dicht unter der wogenden, schäumenden Oberfläche. Nicht umsonst sind die von Verwesung geblähten und von gieriger Meeresfauna angenagten Körper Ertrunkener vielfach von tiefen Schnittwunden entstellt. Solch grässliche Verletzungen geben unmissverständliche Kunde von den schauerlichen Dramen, die sich, von keiner Menschenseele verfolgt, an entlegenen Gestaden zugetragen haben. Bereits vom Angesicht der Küsten in trügerischer Sicherheit gewiegt, fielen die Unglücklichen auf brutale Weise doch noch der grausamen Arglist der See zum Opfer.
Beim keuchenden Luftholen ist der Frau, als könne sie bereits das hellere Klatschen der Brandungswellen vom dunkleren Grollen der südwärts ziehenden Phalanx der geschlossenen Wogen unterscheiden. Sobald diese auf den jäh ansteigenden Meeresboden treffen, werden sie aus der Monotonie ihres gleichförmigen Rollens gerissen. Die Wellen geraten gleichsam ins Stocken, stauen sich auf und richten sich empor wie scheuende Pferde vor einem unvermittelt auftauchenden Hindernis. Ein Mensch, der zwischen den Hammer der sich überschlagenden Brecher und den Amboss eines dem Meer eisern die Stirn bietenden Riffs gerät, zerschellt in Tausend Teile wie eine zu Boden gefallene Porzellanfigur.
Die Frau ist sich der tödlichen Gefahr bewusst, hat der Urgewalt der See aber nichts mehr entgegenzusetzen. Das fahle Licht der ab und an durchscheinenden dünnen Mondsichel in ihrem Rücken ist zu schwach, ihr den sicheren Weg durch die Klippen zu weisen. Anhaltendes Wetterleuchten über den Berggipfeln von Lesbos vor ihr blendet sie mehr als dass es ihr hilft. Beim neuerlichen Zucken eines sich vielfach verästelnden Blitzes bemerkt sie zu ihrer Rechten ein winziges Fleckchen Sandstrand sich rasend schnell nähern. Das ist ihre einzige Chance. Sie mobilisiert ihre allerletzte Energie, um sich aus der eisernen Umklammerung der Brandung zu befreien und auf das leichentuchgroße Stück Strand zuzusteuern. Einen Moment lang sieht es so aus, als habe sie es bereits verpasst. Dann hebt sie eine gnädige Brandungswelle donnernd über den Klippengürtel und wirft sie wie fauliges Treibholz auf den grobkörnigen Sand der düster aufragenden Felseninsel.
Fast wird ihr zerschundener Körper von der Wucht des Aufpralls zerschmettert. Aufbrüllen will sie wie eine waidwund geschossene Raubkatze, doch ihrer ausgetrockneten Kehle entringt sich nur ein dumpf ächzendes Stöhnen. Lange liegt die Frau reglos im Bläschen werfenden weißen Algenschaum, der die Grenze zwischen Land und Meer markiert. Als weigere sich die eifersüchtige See, vorschnell von ihrem Opfer abzulassen, leckt sie mit langen feuchten Zungen nach den blutenden Füßen und Beinen der Frau. Doch selbst die Macht der See kennt ihre Grenzen. Hier und heute kann sie ihr grimmiges Werk nicht vollenden. Dafür malträtiert nun der unablässig wütende Meltemi den von Sonne und Salz gebeizten Körper der Frau.
Das lautlose Gewitter ist nach Süden weitergezogen. Zaghaft kehrt das Leben in die Frau zurück. Mit zitternder Hand nestelt sie an ihrem Bein und zieht ein langes Kampfmesser mit Sägezahnklinge aus dem umgeschnallten Schenkelholster. Ihre blutenden Hände umklammern den Griff. Langsam hebt die Arme über den Kopf und rammt die kurz aufblitzende Klinge bis zum Heft in den feuchten Sand, als wolle sie der noch zuckenden Insel den Todesstoß versetzen. Dann zieht sie sich Stück für Stück am Griff den Strand hinauf. Wieder und wieder treibt sie die Klinge in den Boden und kriecht so unendlich mühsam Meter um Meter weiter, bis sie am Fuß des „Helmes“ angelangt ist. An den löchrigen Unebenheiten des porösen Vulkangesteins finden ihre tastenden Finger vorübergehend Halt. Er genügt ihr, den Oberkörper aufzurichten und sich mit dem schmerzenden Rücken gegen den rauen, Schmirgel gleichen Fels zu lehnen.
Sie versucht aufzustehen, doch ihre krampfenden und aufgerissenen Beine versagen ihr den Dienst. Stöhnend wendet sie sich um und kniet schließlich vor dem Helm wie eine Pilgerin, die unsägliche Mühsal auf sich genommen hat, um an diesem gottverlassenen Ort einem von der Nachwelt vergessenen Märtyrer zu huldigen, der hier einst allzu opferbereit sein gering geschätztes irdisches Leben aushauchte. Die aus zahlreichen Schürfwunden blutende Brust der Frau hebt und senkt sich weiter in rasendem Tempo wie die rot glühenden Kolben eines gepeinigten Motors.
Der torkelnde Sternenhimmel über ihr erbleicht bereits in banger Vorahnung des ersten Morgengrauens, als sich die Frau endlich laut stöhnend erhebt. Schlank, mittelgroß, dunkelhaarig und von makellosem Körperbau, gleicht sie, im Halbdunkel leicht gebeugt stehend, der noch blutenden, an die Palme gelehnten Leto kurz nach ihrer schmerzvollen Niederkunft mit den vom Göttervater höchstpersönlich gezeugten Zwillingen Apollo und Artemis. Eine Halbgöttin, so gut wie nackt in den zerrissenen Lumpen von Shorts und T-Shirt, stützt sie sich an den kalten, feuchten, rissigen Fels. Auf unsicheren Beinen hangelt sie sich an der schroff aufsteigenden Wand entlang, als suche sie nach einem Sesam-öffne-Dich, der ihr auf die Zauberformel hin Einlass gewährt. Das grobkörnige Sandstrahlgebläse des Sturms trifft sie nun mit Myriaden winziger glasharter Geschosse von vorn und macht noch den kleinsten ihrer Schritte zum reinen Kraftakt. Die Frau könnte sich abwenden und dem Wind den Rücken zukehren. Auf der anderen Seite des „Helms“ angelangt, würde sie vermutlich alsbald Schutz vor dem Wind finden. Doch sie scheint unbeirrbar in ihrem Starrsinn, der Wucht des Sturmes um jeden Preis trotzen zu wollen.
Schließlich greifen ihre Finger ins Leere, ertasten ihre Hände eine scharfe Abbruchkante im Gestein. Eine niedrige Höhle, kaum größer und tiefer als ein von halbherzigem Bergbau ehedem verworfenes Sprengloch, tut sich zur Rechten der Frau auf. Ihre eben noch fehlgeleitet erscheinende Zielstrebigkeit lässt ahnen, dass sie um die Existenz dieser Höhle wusste. Gebückt kriecht sie in das schwarze Loch, in das ihr der wütend aufheulende Sturm nicht folgen kann.
Als sich ihre Augen an das schummrige Zwielicht gewöhnt haben, bemerkt sie zu ihren Füßen einen schwach glänzenden Gegenstand. Sie beugt sich hinab, greift danach und zieht eine halb im Sand verscharrte Plastikflasche hervor, die vermutlich schon vor Wochen und Monaten von einem der seltenen Besucher der Insel zurückgelassen wurde. Ein Fischer vielleicht, der hier vor einem Sturm wie diesem Schutz gesucht und nach dessen Abflauen die Flasche mit einem Rest Trinkwasser etwaigen künftigen Leidensgenossen vermachte. Die Frau hat Mühe, den von der Hitze ungezählter Tage mit der Flasche verschweißten Schraubverschluss mit ihren steifen, wunden Fingern abzudrehen. Schließlich packt sie das runde Stück rotes Plastik mit den Zähnen und dreht die Flasche, bis der Verschluss aufbricht und abfällt. Der faulige Geruch, der ihr aus der Flasche entgegenschlägt, dreht ihr den Magen um. Angewidert verzieht sie das Gesicht. Doch höllischer Durst überwindet jeden Ekel. Sie schluckt das lauwarme Wasser in gierigen Zügen. Dann setzt sie die Flasche wieder ab und stößt einen lauten Rülpser aus, der wie zur Bestätigung mehrfach von den Wänden der kleinen Höhle widerhallt.
„Willkommen im schönen Neandertal,“ murmelt die Frau auf Englisch, ringt sich ein freudloses Lächeln ab und kriecht auf allen Vieren weiter nach links. Dort stößt sie alsbald auf einen wie versandfertig auf einer Holzpalette getürmten quadratischen, etwa hüfthohen Stapel der von einer militärischen Persenning umhüllt ist. Über das Ganze hat man zur lieblosen Tarnung eilig ein schief hängendes Netz geworfen, in dessen grobe Maschen da und dort ein paar trockene Zweige gesteckt wurden. So relativ niedrig er ist, nimmt der Stapel doch einen Großteil der Höhle ein.
Die Frau zückt erneut ihr Messer und durchschneidet erst das Netz, dann die Leine, deren einzelne Bahnen die Plane fest verschnüren. Plötzlich hält die Frau inne. Eine seltsame Ausbeulung in der Plane erregt ihre Aufmerksamkeit. Es könnte sich um eine Sprengfalle handeln, die allzu Neugierige zerreißen soll, kaum dass sie unbefugt Hand an den Stapel legen. Ganz behutsam durchtrennt die Frau die letzten Knoten und zieht die Plane Zentimeter um Zentimeter zu sich, um sofort nachzugeben, sollte sie den Widerstand eines etwaigen Auslösedrahtes spüren. Endlich ist es geschafft. Die Frau wirft die Plane mit einem entschlossenen Ruck zur Seite.
Der Stapel auf der Palette setzt sich aus mehreren Schichten ziegelsteingroßer, in schimmernde Plastikfolie verpackter und mit Klebestreifen umschlossener Päckchen zusammen. Mitten auf der obersten Schicht, nur etwa einen Meter vom Kopf der knienden Frau entfernt, richtet sich eine halb zusammengerollte, ungehalten zischende Schlange gerade soweit auf, dass sie der Frau mit einem einzigen wuchtigen Stoß ihre spitzen Giftzähne in die bleichen Wangen schlagen kann.
Die Frau weicht nicht zurück, sondern drückt ihren Rücken durch, so dass sich ihr Oberkörper aufrichtet und versteift. Ihre vom Stapel verdeckte rechte Hand wandert fast unmerklich nach oben. Die auffälligen dunklen „Brauen“ über den Augen der aufgeregt züngelnden Schlange geben sie als Hornviper zu erkennen. Ihr Biss ist für gesunde Erwachsene selten tödlich, wiewohl schmerzhaft und infektionsträchtig. Gelänge es dem Reptil, seine Zähne in den Kopf der Frau zu bohren, wären deren vitale Funktionen allerdings ungleich stärker bedroht, es bestünde vermutlich Lebensgefahr. Die seltsam unnachgiebige Frau weicht dem Zweikampf dennoch nicht aus, sondern starrt unverwandt auf die Viper und erwidert deren drohendes Zischen mit einem Laut von ähnlich klingender Warnfunktion.
Das Reptil denkt offensichtlich nicht daran, seine Höhle kampflos zu räumen. Die Frau hebt langsam ihre freie linke Hand in Kopfhöhe und bewegt die abgespreizten Finger wie in einem Schattenspiel zur Zerstreuung einer Kinderschar grazil hin und her. Das Ablenkungsmanöver gelingt. Der Stoß der Schlange erfolgt zwar zielgenau, aber um Bruchteile zu langsam. Ihr vermeintliches Opfer zieht die linke Hand blitzartig weg und trennt mit einer gedankenschnellen Bewegung der Sägezahnklinge von unten nach oben der Schlange den Kopf vom Körper, indem sie das schwerkontrollierbare Trägheitsmoment des ins Leere stoßenden Reptils geschickt zu ihren Gunsten nutzt.
Die Frau spießt den herabgefallenen Kopf zwischen den Brauen auf und blickt der Schlange in die Augen, als misstraute sie der übel beleumundeten Spezies über deren Tod hinaus. Als sie sich vergewissert hat, dass alles Leben aus dem Reptil gewichen ist, schleudert sie den Kopf im hohen Bogen in die See. Den Schlangenkörper, der im Todeskampf zuckt und sich windet wie ein der Hand entglittener Gartenschlauch, wirft sie in den Sand.
Dann widmet sich die Frau den wasserdicht verschlossenen Päckchen. Sie zieht eines heraus, durchsticht die Verpackung und entnimmt mit der Messerspitze eine winzige Probe des mehlig weißen Pulvers. Einige von den immer noch salzigen Geschmacksknospen ihrer Zunge verkostete Milligramm genügen ihr offenbar, Art und Qualität des Stoffes zu bestimmen. Die Probe scheint zu ihrer Zufriedenheit auszufallen. Die Frau verklebt das Päckchen wieder notdürftig und schiebt es in den Stapel zurück.
Inzwischen ist es taghell und die Seevögel der Felseninsel stimmen ihr keifend kakophonisches Morgenkonzert an. Der Meltemi tobt unvermindert weiter und raubt den ersten Strahlen der tief über dem östlichen Horizont stehenden Morgensonne einen Großteil ihrer wärmenden Kraft. So gut es eben geht, verbindet die Frau ihre zahlreichen klaffenden Wunden mit den Fetzen ihrer Kleidungsreste. Um Entzündungen oder gar einen tödlichen Wundstarrkrampf zu vermeiden, braucht sie jetzt viel Glück, denn auf ärztliche Hilfe kann sie bei fürs erste nicht zählen.
Mit wenigen geschickten Schnitten verwandelt sie die steife, vom Salz der feuchten Luft getränkte Persenning in einen groben zeltartigen Umhang, dessen Saum bis auf die Erde reicht. Sie streift den improvisierten Poncho über und sieht sich um, als suche sie einen Spiegel. Schließlich zwängt sie sich in einen schmalen Spalt zwischen der Rückseite des Stapels und der Höhlenwand. Hier fühlt sie sich gegen Wind, Schlangen und neugierige Blicke gleichermaßen gefeit. Die Schiffe auf der DardanellenRoute passieren die Felseninsel ohnehin zu weiträumig, als dass man selbst von ihren hoch aus dem Wasser ragenden Brücken Einzelheiten der Küstentopographie erkennen könnte. Mit dem Auftauchen von Fischern zur Unzeit, ein lästiges Merkmal dieses unberechenbaren Berufsstandes, ist in diesem Wetter ausnahmsweise auch nicht zu rechnen. Gerade ihre Abgelegenheit, Unansehnlichkeit und abweisende Unzugänglichkeit sind Trümpfe, mit denen sich die Felseninsel ortskundigen Schmugglern als Versteck für Konterbande jeder Art empfohlen haben dürfte.
Die Frau wickelt den selbstgefertigten Poncho eng um ihren ausgelaugten Körper, rammt das Messer neben sich in den Boden und schließt die Augen. Eine Uhr trägt sie nicht. Wozu auch? Dringende Termine stehen offenkundig nicht an und sobald sie erwacht, wird ihr das Licht der Nachmittags- und Abendsonne die ungefähre Tageszeit verraten. An ein Entkommen von der Insel ist vorläufig nicht zu denken. Der Meltemi heult unablässig um die Höhle und jeder Versuch, über die entfesselte See schwimmend die Küste von Lesbos zu erreichen, käme Selbstmord gleich. Nur wenige Augenblicke vergehen, bis ihr Kopf in den Nacken fällt und aus dem halb geöffneten Mund ein leises Schnarchen dringt.
2. Drei Herren in Weiß.
Wann genau die drei ganz in Weiß gekleideten Herren im Hafen von Mithymna angekommen waren, wusste im Nachhinein keiner der Stammgäste von Yannis „Lächelndem Delfin“ mit Sicherheit zu sagen. Geschweige denn, woher sie stammten und was sie auf Lesbos zu suchen hatten. Wie vom jenseitigen Dasein unsäglich gelangweilte Untote auf Kurzurlaub im Diesseits hockten die Palikaria vor ihren fingerhutgroßen, zur Hälfte auch noch mit mehligem Satz gefüllten Kaffeetässchen. Einzig das diskrete Klicken der farbigen Glasperlen ihrer Komvolois, die sie geistesabwesend durch die schwieligen Finger gleiten ließen, durchbrach die andächtige Stille des Kafeneions und verriet das Vorhandensein mehr oder minder intelligenten Lebens. Als seien sie im Jenseits auch des fruchtlo9sen Zählens überdrüssig geworden, offerierten die Palikaria dem Allmächtigen ihre Vaterunser und Avemarias dergestalt in grob pauschalierter Form. Petros, der bärtige Besitzer des unlängst eröffneten ersten „Hyperrmarktes“ am Platz, behauptete ungefragt steif und fest, er habe die drei bei einsetzender Dunkelheit mit ihrem namenlosen offenen blauen Motorboot einlaufen hören. Aber da Petros regelmäßig auch über mancherlei Episoden mit tieffliegenden Ufos berichtete, sobald genügend Raki seine ewig ausgetrocknete Kehle hinabgeflossen war, gaben die Freunde im „Delfin“ schon seit einiger Zeit nicht mehr viel auf seine fragwürdigen Einlassungen.
So oder so schuf die Anwesenheit der Herren in Weiß eine ungewohnt nervöse, ja, bedrohliche Atmosphäre. Trotz ihrer sicherlich nicht ganz billigen Anzüge wirkten die drei irgendwie ungepflegt und reichlich zerknittert. Yannis kamen sie vor wie gleichsam wegen wiederholter Unbotmäßigkeit des Paradieses verwiesene und selbst noch vom an sich wenig wählerischen Meer angeekelt ausgespuckte Erzengel. Das Boot hatten sie zudem so laienhaft schludrig vertäut, dass sein Rumpf im wachsenden Schwell beständig gegen den grobkörnigen Zementkai schabte und das Gelcoat bereits hässliche Kratzer aufwies. Kein Gepäck, kein Ölzeug, nicht einmal Schwimmwesten schienen sie an Bord zu haben – ahnungslose Stadtmenschen eben, die sich aus welchen Gründen auch immer aufs Meer verirrt hatten und prompt beinahe auf ihm umgekommen wären.
Keine Türken, da waren sich die Alten von Mithymna sicher. Türken hätten sie zwar nicht verstanden, aber zweifelsfrei an ihrer Sprache erkannt. Wirkten eher wie robuste Geldeintreiber irgendeiner wenig zimperlichen kaukasischen Inkassofirma, die bis über beide Ohren verschuldeten armen Schweinen die Haut über die Ohren zu ziehen gewöhnt waren. Ihre obszön enganliegenden weißen Hosen wurden schnell zum Gegenstand verstohlener Blicke und ironischer Bemerkungen der Frauen sowie allzu offenkundig von Neidgefühlen motivierter Empörungsrituale der Männer von Mithymna. Was man beim Nähen der Hosen an Material eingespart hatte, war bei der Konfektion der viel zu weit geschnittenen weißen Sakkos wieder draufgegangen. Unablässig getragen, da waren sich die Palikaria einig, würden sich die Anzüge im schmuddeligen Ambiente von Mithymna alsbald in unansehnliche Kittel voller Schweiß- und Staubflecken verwandeln. Was immer die Männer hierhergetrieben hatte, lange aufhalten wollten sie sich ursprünglich wohl eher nicht. Doch nun saßen sie in der Falle, waren von einem alljährlich wiederkehrenden Sturm ungewisser Dauer eingeweht, mit dessen unberechenbaren Launen sie offenbar nicht vertraut waren.
„Estragon, Thymian und Origano,“ nannte sie Yannis, in dessen einziges unansehnliches Fremdenzimmer direkt über dem „Delfin“ sich die drei umgehend eingenistet hatten – weniger aus wohnästhetischer Überzeugung denn aus Mangel an Alternativen. Für ihre etwaige Zugehörigkeit zur Mafia sprach ihr offenkundiger Mangel an Stil und Lebensart sowie ihr spektakulärer Konsum der Makkaronara, die Maria, Yannis‘ auf dem linken Bein lahmende und vor allem wohl deshalb immer nicht verheiratete Schwester mit viel Liebe zubereitete. Doch Petros schwamm wie gewohnt gegen den Strom der Mehrheitsmeinung. Die typischen Handlanger der sizilianischen oder sardischen „Familien“, behauptete er, pflegten nicht mit Motorbooten unterwegs zu sein. Dafür hatten sie nach all den fettigen Teigwaren schon viel zu empfindliche Mägen. Dem mochte so sein oder nicht: lange mussten die Palikaria Petros auch diesmal nicht bitten, ihnen zum zehnten oder elften Mal die urbane Legende vom kugeldurchsiebten Mafioso zu erzählen, auf dessen Gehirn die Gerichtsmediziner bei der Obduktion eine eintätowierte Empfehlung für die bekannte neapolitanische „Pizzeria Schirokko“ fanden. Alle kannten die Story auswendig, warteten dessen ungeachtet jedoch wie beim ersten Male begierig auf die Pointe, die niemand so zwerchfellerschütternd komisch schürzen konnte, wie Petros.
Schleuser vielleicht, die sich entgegen ihren Gepflogenheiten dieses eine Mal selbst zu weit aufs Meer hinausgewagt hatten und vom unvermittelt auffrischenden Meltemi überrascht worden waren? Aber für Schlepper schienen sie viel zu schwer bewaffnet. Zwar legten sie so gut wie nie ihre Sakkos ab, aber wenn sie sich gelegentlich beim Kartenspiel geräuschvoll in die Haare gerieten und mit den Armen erregt in der Luft fuchtelten, konnten die Griechen den einen oder anderen Blick auf die stattlichen Pistolengriffe in ihren Achselholstern erhaschen. Diese großkalibrige Artillerie diskret zu verbergen war wohl auch der Hauptgrund für die auffällige Übergröße der Sakkos.
Dimitri und Vangelis, die beiden altgedienten Dorfpolizisten, waren dem „Delfin“ bald nach der Ankunft der Herren in Weiß auffallend ferngeblieben. Waffen, wie sie die Fremden trugen, kannten die beiden nur aus amerikanischen Filmen, die mit einiger Verspätung im Kino von Mytilini anzulaufen pflegten. Ihren eigenen halbautomatischen Pistolen, deren Patronen sich häufig in der Kammer verfingen und deren Schlitten ihnen nach dem ersten oder zweiten Schuss gern schon mal auf die Füße fielen, waren bestenfalls geeignet, angefahrenen und im Straßengraben verendenden Hunden schneller ins Jenseits zu verhelfen. Estragon, Thymian und Origano hätten derlei museale Handfeuerwaffen nur ein mitleidiges Lächeln abgerungen. Und solange die „Mafiosi“ sich ruhig verhielten und keinen Streit mit den Hiesigen anzettelten, war es sicher klug, auf abwartendes Stillhalten und großzügige Duldung zu setzen.
Dass die Dauer des Meltemi selbst für Einheimische nur schwer einschätzbar war, weil sie sich in der Regel nach Stunden bemaß, bisweilen aber über Wochen erstreckte und dabei viele Menschen regelrecht in den Wahnsinn trieb, hatte Yannis versucht, den Fremden in seinem ungeschlachten Englisch klar zu machen. Griechisch verstanden die Herren glaubhaft gar nicht und die Sprache, die ihnen zur Verständigung diente, war wiederum den Griechen total unverständlich.
Mit seinen fatalistischen Wetterprognosen trug Yannis nicht gerade zur Aufheiterung der drei mürrischen Fremden bei. Eigentlich hätte es solcher Vorhersagen gar nicht bedurft, denn von ihrem Zimmer über dem Kafeneion genossen die drei Herren einen beneidenswert privilegierten Ausblick über den zurzeit ausgestorbenen Hafen und vor allem die sich jenseits der Molen austobende See. Das Rauschen der Wogen und die enervierend klappernden Fensterläden waren nicht zu überhören und ließen sie offenbar auch nicht einschlafen, denn ihre Zimmerleuchten brannten bis spät in die Nacht.
Andere Ortsfremde in ihrer Situation hätten die unfreiwillige Wartezeit vermutlich dazu genutzt, sich ein wenig in der Gegend umzutun und einige der durchaus bemerkenswerten Sehenswürdigkeiten in Augenschein zu nehmen. Doch denen brachten die drei Herren in Weiß das gleiche demonstrative Desinteresse entgegen, wie den Griechen im Kafeneion, die im Großen und Ganzen Luft für sie blieben. Stundenlang saßen Estragon, Thymian und Origano wie angenagelt rittlings auf ihren unbequemen Holzstühlen, schwitzten ihren Raki aus, kaum dass sie ihn getrunken hatten und knallten mit grimmiger Verbissenheit ihre Karten wie grifflose Fliegenklatschen auf den Tisch.
Obgleich die Fremden zumindest auch keine Händel mit den Einheimischen suchten, fühlten die sich vom häufigen Gezänk der drei zunehmend belästigt, weil sie das ständige Theater beim Tavli-Spielen störte – wiewohl sich auch dieses nicht völlig geräuschlos vollzog. Mal hatte der eine offenbar die Karten falsch gegeben, mal der andere angeblich falsch ausgespielt, mal der Dritte seinen Einsatz zu spät angemeldet, wie es schien, kurz, irgendeinen Blitzableiter für die frustrierte Grundstimmung der Herren gab es immer. Besonders Estragon, der lange Dürre mit dem nervös-grundlosen Schulterzucken, schien leicht erregbar, war wohl ein ganz schlechter Verlierer. Thymian und Origano, die beiden Normalwüchsigen - untersetzt und kahlköpfig der eine, schlank und schwarz gelockt der andere - hatten sich besser im Griff.
Diese seltsame Sprache? Nicht einmal Kostas, der als LKW-Fahrer in Europa weit herumgekommen war, wusste zu sagen, in welch gutturalem Idiom diese Männer kommunizierten. Umgänglich wie er war, sprach Kostas sie mal auf Englisch, mal in schlechtem Französisch und schließlich sogar in gebrochenem Deutsch an, erntete aber nur finstere Blicke und abwehrendes Kopfschütteln, als hätte er die Herren um Geld angebettelt. Angesichts solch geringer Gegenliebe gab Kostas auf, schenkte den Fremden bald auch keine Aufmerksamkeit mehr. Wenn sie absolut unter sich bleiben wollten, bitte sehr! Mit Yannis verständigten sich die Fremden überwiegend wie Taubstumme in Zeichensprache. Die anderen Gäste mit ihren speckigen Kappen, verfilzten Jacken und klackenden Komvolois hatten für sie offenbar den Status abgewetzten Mobiliar.
Touristen hätten die drei mit ihrem seltsamen Gehabe vermutlich irritiert, aber Urlauber verliefen sich so früh in der Saison selten hierher an die Westküste. Nicht abreißende Medienberichte über die chaotische Flüchtlingslage auf mehreren Inseln, insbesondere aber auf Lesbos, sorgten für ein fremdenverkehrsfeindliches Karma der Insel und taten vermutlich ein Übriges, Erholungssuchende auf sonnige Ziele an anderen Mittelmeergestaden zu verweisen.
Am Morgen des dritten Tages legte sich der Meltemi fast so unvermittelt, wie er losgeschlagen hatte. Dieses rasche Auf- und Abschwellen, typisch für diesen spezifischen Etesienwind, sorgte dafür, dass es nur Minuten dauerte, bis auch die eben noch überschäumende See sich wieder beruhigt hatte und die Unschuldige gab. Die Fremden, inzwischen alle mit Dreitagebart, durchgeschwitzten Hemden und verstaubten Sakkos, zahlten Yannis aus. Der kleine kahlköpfige Thymian, offenbar der Wortführer der drei, präsentierte lässig ein Bündel blassgrüner amerikanischer Präsidentenporträts und hielt es Yannis unter die Nase wie ein Magier, der sein „Medium“ aus dem Kreise der Zuschauer bittet, eine scheinbar x-beliebige Karte aus dem Päckchen zu ziehen und sie sich genau einzuprägen. Der Grieche zupfte vorsichtig ein paar der sich aufrollenden Dollarscheine aus dem Bündel und strich sie auf der feucht glänzenden Tischplatte glatt. Als er sah, dass der Kahlköpfige die bescheidene Summe nicht einmal eines Blickes würdigte, ärgerte sich Yannis, nicht ein paar Dollar mehr abgegriffen zu haben.
Umringt von Griechen traten die drei ins Freie. Offenbar hatten sie es wirklich sehr eilig, den Staub Mithymnas von den italienischen Schuhen zu schütteln. Unten am Hafen angekommen, füllte Estragon Treibstoff aus mehreren mitgeführten Kanistern in den Tank des blauen Bootes. Da er keinen Trichter benutzte und auch nicht gerade über eine besonders ruhige Hand zu verfügen schien, floss bald ein dünnes Rinnsal gelblichen, stinkenden Benzins über das Relingssüll den Rumpf hinab ins Hafenbecken. Sofort bildete sich ein bunt schillernder Ölfilm, der sich in Windeseile auszubreiten begann. Der schwarzgelockte Origano wartete ungeduldig, bis der Lange mit dem Einfüllen fertig war und drehte dann sichtlich verfrüht den Zündschlüssel um. Der Motor sprang nicht an. Kein Wunder, konstatierten die umstehenden Fischer fachkundig, hoben die Augenbrauen, schüttelten den Kopf oder nickten einander zu. Vermutlich war der Motor abgesoffen. Oder die betagte Startbatterie hatte die mehrtägige Zwangsruhezeit nicht überlebt.
Petros war wie stets ein Quell unerbetener Ratschläge, doch die Herren verstanden ihn nicht. Nach einer kurzen Pause versuchte es der Lockige noch einmal. Der Motor machte ein paar zögerliche Umdrehungen, als wolle er die Erwartungen der zahlreichen Gaffer im Hafen nicht gar so schnöde enttäuschen. Dann besann er sich eines Besseren und startete schließlich mit explosionsartigen Fehlzündungen und viel blauem Qualm durch. Die drei „Mafiosi“ warfen die Leinen los, kurvten knapp um den unter Wasser durch unsichtbare Aufschüttungen tückisch verbreiterten Molenkopf, legten mit Schwung den Hebel „auf den Tisch“ und fuhren mit Vollgas in nördlicher Richtung davon. Ihre fleckigen weißen Sakkos flatterten im Fahrtwind beim Ritt auf dem flachen, kiellosen, von Wellenkamm zu Wellenkamm hüpfenden „Kiesel“ von Motorboot.
Die Dorfbewohner schlugen dreimal in schneller Folge das orthodox „verkehrte“ Minimalkreuz mit dem Gebinde aus Daumen, Zeige- und Mittelfinger, das wie eine ratternde Blindstichmaschine stets nur den obersten Hemd- beziehungsweise Blusenknopf umkreist. Schnell wich ihr Wettinteresse am vermutlichen Ziel der drei einer allgemeinen Erleichterung über deren eiligen Abgang. Offenbar führte ihr Weg die Fremden zur türkischen Küste, von der sie gekommen sein mussten. Weiter sollten sie sich im eigenen Interesse mit diesem kleinen offenen Boot auch nicht wagen, fand Petros, zumal sie von Seefahrt und Navigation nicht viel zu verstehen schienen.
„Wenigstens haben sie Glück mit dem Wetter,“ sagte Yannis noch mit einem flüchtigen Blick zum Himmel und hatte Recht damit. Wo immer sie anzukommen gedachten, die See würde ihnen an diesem Tag keine unüberwindlichen Probleme schaffen. Zu normalen Zeiten hätte ihnen die hier im Grenzbereich zwischen Griechenland und der Türkei wissbegierig patrouillierende Küstenwache einen Strich durch die Rechnung machen können. Aber die Zeiten waren alles andere als normal. Die wenigen einsatzbereiten Fahrzeuge der Küstenwache hatten auf der Ostseite von Lesbos mit havarierten oder sinkenden Flüchtlingsbooten alle Hände voll zu tun. Aufgrund der andauernden dramatischen Rettungsaktionen bei gleichzeitigen drastischen Etatkürzungen stand weder hinreichend Personal noch genügend Material für die Kontrolle des Bootsverkehrs entlang anderer Küstenabschnitte zur Verfügung. Das war heute vielleicht auch gut so, denn nach den Tagen frustrierenden Wartens hätten die drei „Mafiosi“ vermutlich bei der erstbesten Gelegenheit rücksichtslos drauflos geballert.
3. Toten Manns Hand.
Kaum hat das blaue Motorboot die nordwestliche Spitze der Insel Lesbos erreicht und befindet sich damit außer Sichtweite der Leute von Mithymna, zieht es eine scharfe Kurve nach Backbord und hält auf die offene See zu. Eine geschlagene Stunde bleibt es auf seinem westlichen Kurs, bis es selbst vom höchsten Punkt der Inselküste betrachtet unter die Kimm gefallen ist. Offenbar wollen die drei Männer unbeobachtet sein und nehmen dafür auch mancherlei Umwege auf sich. Erst als sie dieses Zwischenziel erreicht zu haben glauben, ändern sie den Kurs wieder und lenken den Bug des Bootes diesmal nach Südosten, wo sich nach einiger Zeit ganz allmählich die Silhouette eines sattelförmig aus dem Wasser ragenden Felsens mit helmartigem Buckel abzeichnet.
Die aufkommende leichte Brise aus Nord und der in diesem Seegebiet zügig nach Süden setzende Strom treiben die Männer in rascher Fahrt voran. Auf Höhe der Sattelinsel drosseln sie die Geschwindigkeit und drehen eine langsame, eng gezogene Ehrenrunde. Entweder misstrauen sie dem Frieden oder sie suchen eine geeignete Stelle zum Anlanden. Schließlich entdecken sie eine Lücke im Klippengürtel. Nachdem auch ihr Misstrauen verflogen scheint, lassen die drei das Motorboot austrudeln und setzen es kurzerhand laut knirschend auf den Sand eines winzigen Fleckchens Strand.
Der Kahlköpfige steht vorn am Bug mit einer Leine in der Hand und fällt fast vornüber, weil er die Wucht der absichtlichen Strandung offenkundig unterschätzt hat. Dann springt er steifbeinig von Bord, kommt aber nicht weit genug vom Bug weg und landet deshalb mit beiden Füßen knöcheltief im Algenschaum, der sich wie die Sahnedekoration auf der Torte den Strand entlangzieht. Laut fluchend macht er die beiden anderen dafür verantwortlich, dass er sich seine sündhaft teuren italienischen Designerschuhe ruiniert hat. Auf Geheiß des grinsenden, unaufhörlich mit den Schultern zuckenden Langen am Steuer befestigt der Kahlköpfige seine Leine provisorisch am nächstgelegenen größeren Stein. Er lässt sich seine Jacke aus dem Boot zuwerfen, zieht seine Schuhe und Strümpfe aus und stapft schwerfällig durch den feuchten Sand geradewegs in Richtung der niedrigen, bei Tage aber deutlich sichtbaren Höhle. Die beiden im Boot halten währenddessen nach Fischern Ausschau, die wie so oft zum ungelegenen Zeitpunkt am falschen Ort auftauchen könnten.
Fast hat der Kahlköpfige den Höhleneingang erreicht, als der Stapel im Sonnenlicht blitzender Drogenpäckchen in sein Blickfeld rückt. Er stutzt, bemerkt, dass weder Plane noch Tarnnetz den Stapel bedecken. Wer immer die Päckchen hier abgeladen hat, wäre vermutlich nicht davongefahren, ohne sie gegen Wind und Wetter irgendwie zu schützen. Und er hätte die Päckchen sicher auch nicht einfach lose auf dem Sand gestapelt, sondern eine Holzpalette oder zumindest einige kurze Bretter untergelegt. Es hat zwar tagelang gestürmt, aber eine festgezurrte Persenning fliegt nicht einfach davon oder löst sich in Luft auf. Der Kahlköpfige pfeift leise durch die Zähne, dreht sich zum Boot und zieht seine Pistole aus dem freiliegenden Achselholster. Routiniert prüft er das Magazin, entsichert und lädt die Waffe durch. Seinen beiden Kumpanen ist durch den Kahlköpfigen die Sicht auf die Höhle verdeckt. Als sie ihn jedoch seine Waffe ziehen sehen, tun sie es ihm sofort wortlos gleich.
Das metallische Geräusch der hin- und hergleitenden Schlitten ihrer Pistolen ist noch nicht verhallt, da stürzt sich wie aus dem Nichts ein riesiger Raubvogel mit markerschütterndem Schrei vom Scheitelpunkt des helmartigen Hügels mit den Klauen voran auf den Kahlköpfigen. Als die furchterregende Erscheinung im aufspritzenden Sand landet, ist der erste der drei bereits ein Opfer ihrer Sägezahnklinge.
Die beiden anderen haben nur Sekundenbruchteile, ihrer Verblüffung Herr zu werden. Die Gestalt im wehenden Poncho hat den in sich zusammensackenden Kahlköpfigen mit der Linken aufgefangen und mit ihrer Rechten seine Pistole in der verkrampften Schusshand auf die beiden Männer im Boot gerichtet. Während sie kniend den Kahlköpfigen mit der Linken als Kugelfang vor sich hält, betätigt sie mit seinem Zeigefinger den Abzug. Fünf, sechs Schüsse ertönen in rascher Folge. Zwei Kugeln der „Mafiosi“ schlagen in die zuckende Leiche des Kahlköpfigen ein, die restlichen vier treffen die beiden im Boot. Der Lange fällt über Bord und klatscht ins seichte Wasser, das sich sofort rot färbt. Der Schwarzlockige feuert im Todeskampf noch in die Luft, bevor er über der Lehne des Steuersitzes zusammenbricht.
Die Frau im Poncho stößt den Körper des Kahlköpfigen von sich und zieht ihr Messer aus seinem Nacken. Dann durchsucht sie seine Kleidung und nimmt den kurzläufigen Smith & Wesson Kaliber 38 an sich, den sie in seinem Knöchelholster fühlt. Sie leert seine Brieftasche, findet aber keine Papiere oder Karten, die Aufschluss über die Herkunft oder Nationalität des Kahlköpfigen liefern könnten.
Im Boot stürzt sie sich auf das Trinkwasser in zwei Plastikflaschen, die sie in gierigen Zügen leert. In der Backskiste steht eine Kühlbox mit uralten schimmeligen Sandwiches und etwas angefaultem Obst. Sie hebt die Box an, stellt sie auf den Kopf und verschlingt hastig alles Essbare, das auf den Boden des Bootes fällt. Dann setzt sie sich in den Sand und streift ihren Poncho ab. Nackt bietet sie einen mindestens ebenso erschreckenden Anblick wie verkleidet. Ihre Oberschenkel und der ganze Oberkörper sind von mehrere Tage alten Schürfwunden bedeckt, über denen sich Blutkrusten gebildet haben. Blau unterlaufene streifenartige Blutergüsse auf ihrem Rücken lassen sie wie eine wegen Meuterei ausgepeitschte, kielgeholte und schließlich auf diesem Eiland zurückgelassene Meuterin erscheinen. Ihr linker Oberarm wurde im gerade überstandenen Feuergefecht von einem Streifschuss getroffen. Sie kriecht auf allen Vieren zum Kahlköpfigen, reißt sein verschwitztes, blutverschmiertes Hemd in Streifen und verbindet laut stöhnend ihre Schusswunde.
Eine Weile bleibt sie wie in Trance im Sand sitzen, bis irgendwo auf See ein gleichmäßig brummender Motor das aufgeregte Geschrei der Möwen übertönt. Die Frau erwacht aus ihrem Tagtraum. Hier auf der Felseninsel würde sie nicht mehr lange unentdeckt bleiben. Fände man sie jedoch in der Gesellschaft dreier toter Männer, hätte sie vermutlich alle Mühe, den tatsächlichen Hergang der Ereignisse glaubhaft genug zu schildern, um selbst halbwegs ungeschoren davonzukommen.
Sie fischt den Langen am Kragen aus dem Wasser, dreht ihn auf den Rücken und zieht ihn an Land. Als sie ihn von seinen Habseligkeiten befreit hat, entkleidet sie ihn und breitet seine Sachen zum Trocknen aus. Den Schwarzgelockten stößt sie aus dem Boot und untersucht auch ihn auf Waffen und Wertgegenstände. Gegenüber Polizei oder Küstenwache hätte sich keiner der drei ausweisen können, was die Frau darauf schließen lässt, dass es sich bei den drei Herren um Auftragskiller oder Handlanger handelt, die gewohnheitsgemäß bei der Abwicklung ihrer Geschäfte keinerlei Papiere mit sich führen, die auf ihre Identität schließen ließen. Falls sie überhaupt in die Verlegenheit gerieten, sich lebend stellen zu müssen. Zumindest dieser Teil ihres Kalküls ist aufgegangen.
Schließlich schleift die Frau die Leichen über den Sand in die Höhle und setzt sie gleich neben dem Eingang mit den Rücken gegen die Felswand. Wo sich bei dem Langen und dem Schwarzgelockten vor kurzem noch die Augen befanden, klaffen nun dunkelrote Einschusslöcher. Selbst für einen ausgesprochenen Kunstschützen wäre dies unter den erschwerenden Umständen des Kampfes ein bemerkenswertes Ergebnis. Ein schwarzer Brandfleck mit halb verkohlten Holzresten im Sand ist alles, was von der Palette übrigblieb und zeigt, dass es der Frau während ihres Zwangsaufenthaltes irgendwie gelungen sein muss, ein Lagerfeuer zu machen.
In der Jackentasche des Langen hat sie einen Satz Spielkarten gefühlt, die sie nun mit geübter Hand durchmischt und „gerecht“ verteilt. Zur gesummten Melodie von Kenny Rodgers‘ Gambler drückt die Frau ungerührt jedem Toten sein Blatt des Tages in die Hand.
„Gentlemen, das Spiel lautet Texas Hold Them,“ instruiert sie die drei, „und dass mir keiner mogelt, sonst komme ich zurück. Das wollt ihr nicht.“ Dann überlässt sie die drei den Möwen und wendet sich dem Drogenstapel zu.
Päckchen auf Päckchen wirft sie in ihren ausgebreiteten Poncho und zerrt dann das Ganze über den blutigen Sand hinunter zum Wasser. Dreimal schleppt sie sich hin und her bis alle Päckchen im Motorboot liegen und der löchrige Poncho sie verdeckt. Alle Waffen und Wertsachen verstaut sie in der überquellenden Backskiste. Die Kleidungsstücke des Langen sind inzwischen leidlich getrocknet. Die Frau streift seine Hosen, Hemd und Sakko über.
„Scheiß Prêt-à-porter,“ murmelt sie und versucht, die tatsächlich viel zu weiten und zu langen Kleidungsstücke, die sie zur albernen Vogelscheuche machen, notdürftig auf ihre Konfektionsgröße zu trimmen. Der improvisierte Verband am Oberarm hat sich gelöst, Blut dringt durch die Baumwolle und ziert den Ärmel des Sakkos mit einem sich langsam vergrößernden roten Fleck.
Die Frau wirft einen letzten kritischen Blick in die Runde und startet den noch warmen Motor, der sofort anspringt. Ein paar Mal klopft die Frau mit der Rechten auf die Treibstoffanzeige am Steuerstand und nickt zufrieden, als der Zeiger sich endlich bequemt, sich gemächlich in Richtung „Halb“ zu bewegen.
Die Frau in Weiß steigt aus und will gerade die Schlinge vom Stein lösen, als sie stoppt. Noch einmal betritt sie die Höhle und macht sich an den Spielkarten zu schaffen. Dann wirft sie den dreien mit der Rechten einen Kuss zu, macht die Leine los und schiebt das Motorboot langsam vom Strand weg. Als es in tieferes Wasser gerät und von den ersten größeren Wellen erfasst wird, kann die Frau sich gerade noch rechtzeitig an Bord wuchten, bevor es unwiederbringlich abtreibt.
Das Boot entfernt sich im Rückwärtsgang langsam weiter von den Klippen, bis die Frau auf „volle voraus“ wechselt. Ein Schwarm erwartungsfroher Tümmler empfängt das Boot wie eine gute alte Bekannte und vollführt routiniert einige seiner Standardsprünge und atemberaubenden Zick-zack-Schwenks. Als die Belohnung in Form von zugeworfenen Fischen ausbleibt, ziehen die Tiere pfeifend und knackend wie wasserdichte Volksempfänger weiter. Bald ist das Boot nur noch ein dunkler Punkt, der ausgelassen auf einer wie mit der Wasserwaage gezogenen Kimm hin und her tanzt.
ZWEITES KAPITEL
1. Die Erbin.
„...und als in praktischen kaufmännischen Angelegenheiten ebenso wie in kniffligen Personalfragen alles in allem noch, mit Verlaub, reichlich unerfahrene geschäftsführende Gesellschafterin in spe der ROLA Logistik GmbH werden Sie auf absehbare Zeit die sachkundige Unterstützung durch einen so gewieften Unternehmensberater wie Herrn Lothar-Günther Löwitsch sicherlich zu schätzen wissen, eh, zu schätzen wissen. Herrn Löwitschs Ernennung findet, wenn ich das noch hinzufügen darf, die volle Zustimmung unserer Gesellschafter, die hier durch meine Kollegen Dr. Helmstätt und Dr. Münster-Wagenfels vertreten werden, eh, vertreten werden. Außerdem hat sich Lothar-Günther Löwitsch schon bei der gelegentlichen Vertretung Roberts, äh, Ihres verehrten Herrn Vaters, bestens bewährt, wie Ihnen nicht entgangen sein wird. Darf ich angesichts dieser, durchaus eindrucksvollen Referenzen annehmen, dass Sie mit meiner, äh, mit unserer Wahl einverstanden sind? Laura? Ehm, Laura, jemand zuhause?“
Dr. Heinz-Ludwig Schmidt-Öhlenschläger, der langjährige Justiziar der ROLA-GmbH, zog seine wieselflinken buschigen Augenbrauen über der randlosen Halbbrille stirnrunzelnd zusammen und hielt in seinem fließenden Vortrag einen Augenblick irritiert inne. Er räusperte sich und blickte streng über die spiegelnden Gläser hinweg auf sein „in sich ruhendes“ Gegenüber.
Laura Förster errötete wie eine Schülerin, die sich in der ungeliebten Mathe-Stunde vom pedantischen Lehrer beim Simsen unter dem Tischplatte ertappt fühlte. Sie war fast eingenickt und richtete sich nun mit einem so heftigen Ruck in ihrem Stuhl auf, dass dessen lederbezogene Lehne wie ein trockener Ast unter der Last eines Elchhufes knackte. Dann nestelte sie nervös an einer widerspenstigen Strähne ihres brünetten Haars, das sie straff nach hinten gebürstet und zu einem ansehnlichen Vogelnest von Dutt hochgesteckt hatte.
„Wie, was? Ja, ich meine, sicher. Entschuldigen Sie meine kurze Absenz, ich schlafe zurzeit schlecht, eigentlich gar nicht.“
Der leicht vorwurfsvolle Unterton des Justiziars wich augenblicklich dem Ausdruck warmen Mitgefühls. Jahrzehntelange Erfahrung im Umgang mit Mandanten jeglicher Couleur einerseits und allen nur denkbaren Vertretern von Judikative und Exekutive andererseits hatte ihn stufenlos situatives Umschalten auf das jeweils angesagte Register gelehrt.
„Aber natürlich, Laura, ich denke, dafür haben wir alle vollstes Verständnis, eh, Verständnis. Wüssten es allerdings auch zu schätzen, nicht wahr, wenn Sie Ihrem nachvollziehbaren Schlafbedürfnis, mit Verlaub, an anderer Stelle den gewünschten Raum gewähren würden.“ Dr. jur. Schmidt-Öhlenschläger war offensichtlich daran gewöhnt, seine Zuhörer bildlich gesprochen voll konzentriert bis atemlos an seinen fleischigen Lippen hängen zu haben. Für die etwas Langsameren pflegte er einzelne sinnstiftende Elemente in der Hoffnung pointiert zu wiederholen, dass sie sich ihnen auf diese Weise besser dauerhaft einprägen würden.
Laura hatte sich mit den rhetorischen Idiosynkrasien des Anwalts nie ganz anfreunden können. Die schizophrene hanseatische Gepflogenheit, Gott und alle Welt beim Vornamen zu nennen und sie dennoch gleichzeitig zu siezen, sah sie ihm als landsmannschaftlich bedingte sprachliche Schizophrenie noch am ehesten nach. Was sie wirklich nervte, waren seine affektierten Rückgriffe auf solche fremdsprachlichen, vor allem französischen Wendungen, deren sorgfältig kalkulierte Wirkung auf eine mit dem Arsenal klassischer Rhetorik weniger vertraute Zuhörerschaft allein schon dafür sorgte, dass die geringe Aussagekraft solcher Phrasen kaum mehr auffiel.
Gleich zu Beginn dieser wichtigen Sitzung mit dem Ziel der Regelung des unternehmerischen Nachlasses von Lauras völlig unvermittelt aus dem Leben gerissenen Vaters hatte Dr. Schmidt-Öhlenschläger höflich, aber bestimmt unterstrichen, dass er in seiner Eigenschaft als Vorsitzender der Runde Unaufmerksamkeit so wenig tolerieren werde wie zeitraubende Geschwätzigkeit. Damit hatte er lästige Wortmeldungen, die zu schier endlosen Diskussionen über den Bart des Propheten hätten führen können, bereits im Keim erstickt und der Sache sicherlich gedient. Dennoch: Laura wunderte sich nicht zum ersten Male über die beneidenswerte Selbstsicherheit des Mannes. Als Justiziar hatte er in kaufmännischen oder unternehmerischen Belangen der ROLA GmbH „eigentlich“ keinerlei echte Leitungsbefugnis, besaß genau genommen nicht einmal Prokura und war insofern vom geschäftlichen Standpunkt betrachtet nur unwesentlich beschlagener als Laura. Doch genoss er den Vorteil der frühen Geburt. In den oft von ihm glorifizierten Anfangsjahren seiner Zusammenarbeit mit Robert Förster hatte er relativ schnell strategisch wichtiges hierarchisches Terrain erobert, das er dank seines umfangreichen Herrschaftswissens und kraft seiner universalen Vernetzung bislang wirksam gegen jede Konkurrenz zu verteidigen wusste.
„Ja, wie schon gesagt, wir alle hier können durchaus nachvollziehen, was nach einem solch harten Schicksalsschlag in Ihnen vorgeht, eh, vorgeht. Aber das fügt sich ausgezeichnet, ich wollte sowieso gerade vorschlagen, dass wir an dieser Stelle kurz unterbrechen. Eine kleine Pause dürfte uns allen guttun, wir sind ja nicht auf der Flucht.“
Er lachte als einziger in der Runde über seine scherzhafte Bemerkung, gönnte seinen flinken Brauen eine Pause und drückte den Knopf der Sprechanlage: „Deb Kaffee bitte, Frau Weißberger.“ Die Sekretärin ließ prompt die bereitstehenden Heißgetränke und das dazu gehörige Gebäck von der Praktikantin servieren. Der Anwalt stand derweilen auf und öffnete eines der hohen, schmalen Fenster des Konferenzraumes einen Spaltbreit. Sofort drang das gleichförmige Brummen des Verkehrslärms aus der Straßenschlucht zu ihnen in die fünfzehnte Etage hinauf. Irgendwoher schlug eine Kirchturmuhr bedächtig erst vier helle, dann elf dunklere Töne, an die sich wie zur Bestätigung das markerschütternde Dröhnen einer Schiffssirene anschloss. Zwischen den Schlägen acht und neun erschallte ein peitschenartiger Knall, der Laura zusammenzucken ließ. Vermutlich nur eine Fehlzündung, aber in diesen Tagen der Selbstmordattentate und Amokläufe konnte man nie wissen. Laura lief es kalt den Rücken herab, woran nicht allein die feuchtkalte Hamburger Aprilluft Schuld trug.
„Wir sind ja nicht auf der Flucht,“ murmelte sie leise. Da war sie durchaus nicht so sicher. Nach allem, was in den letzten Tagen und Wochen auf sie eingestürmt war, hatte der Gedanke an einen hastigen Rückzug durchaus etwas für sich. Sie hob den Kopf von dem Aktenberg, der ihren Laptop analog zu begraben drohte, und blickte aus dem Fenster auf die graue Stadt. Den ganzen Morgen schon hatten sich trommelnder Eisregen und kurze Perioden bleiernen Sonnenlichts das Regiment über Hamburg streitig gemacht. Der Monat wurde seinem wetterwendischen Ruf durchaus gerecht.
Laura griff nach ihrer schwarzen Prada-Jacke auf dem Nebenstuhl. Heinz Marquardt, der dynamische Steuerberater der Firma und Vermögensberater ihres Vaters, half ihr, die Jacke um ihre Schultern zu legen. Sein leicht anzügliches Lächeln war Laura ebenso peinlich wie der bloße Anflug körperlichen Kontaktes. Beides im Zusammenspiel hätte einem wachen Beobachter einen Grad von Intimität suggerieren können, der tatsächlich nicht bestand – jedenfalls nicht, soweit es Laura betraf.
Im Verlauf der zwei Stunden, die sich ihre Sitzung bereits hinzog, hatte Laura nur mit einiger Mühe ihre Konzentration aufrechterhalten können. Sie gestand es sich nicht gern ein, aber in Wahrheit fühlte sie sich von der Situation überfordert und argwöhnte, dass man ihr das auch am Gesicht ablesen konnte. Eine völlig neue Erfahrung für sie, die in ihrem Bekanntenkreis sonst als unerbittlicher Kontrollfreak gefürchtet war. Sicher, ihre ganze sündhaft teure BWL-Ausbildung mit Schwerpunkt Speditionswesen in Deutschland, den USA und in England war völlig darauf ausgerichtet gewesen, ihr irgendwann die Leitung des „Ladens“ zu ermöglichen. Aber nun, da das scheinbar ach so ferne irgendwann sich im Handumdrehen zum gebieterischen jetzt mauserte, scheute Laura vor der Last der Verantwortung zurück. Wie sollte man sich ernsthaft auf eine Eventualität vorbereiten, von der man inständig hofft, dass sie in absehbarer Zeit nicht eintreten wird? Klar, dass man so etwas weit vor sich herschiebt. Manche Dinge lassen sich nicht simulieren.
Und schließlich - mit dem plötzlichen Herztod ihres Vaters hatte objektiv betrachtet niemand rechnen können, am allerwenigsten wohl Laura. Im Rückblick erinnerte sie sich an keinerlei verdrängte Anzeichen oder unmissverständliche Vorboten wie Kammerflimmern, Herzrasen, Rhythmusstörungen, Brustschmerzen oder Armlähmungen. Und da er von „Schamanen in Weiß“, wie er sie nannte, nie viel gehalten hatte, war er nur äußerst selten zum Arzt gegangen und hatte nicht einmal seinen fraglos hohen Blutdruck regelmäßig kontrollieren zu lassen.
Dazu schien es keinen dringenden Anlass zu geben. Nach zwei Jahrzehnten aufopfernder Tätigkeit für die selbst gegründete ROLA-Logistik GmbH hatte sich ihr Vater in jüngster Zeit immer häufiger unter allen möglichen Vorwänden vom Tatort entfernt und seinem einzigen, dafür umso leidenschaftlicher gepflegten Hobby gefrönt, dem Segeln. In seinem Lieblingsrevier, der Karibik, musste er langsam so bekannt sein wie ein bunter Hund, hatte Laura oft gedacht.
Sie hätte ihn bitten können, sie als sein einziges Kind das eine oder andere Mal auf eine seiner Spritztouren mitzunehmen. Doch erstens lag ihr nicht sonderlich an Booten. Der chronische Platzmangel, die häufigen schmerzhaften Kollisionen mit unnachgiebigen Teilen der Inneneinrichtung, das Geschaukel, die eklige, irgendwann durch jedes noch so atmungsaktive Kleidungsstück dringende Feuchtigkeit und das alberne Gerede von Skippern, die nach eigenem Bekunden ab morgen ohne zu zögern die Welt umsegeln würden, wenn sie nicht regelmäßig den Rasen mähen oder den Hund Gassi führen müssten, gingen ihr regelmäßig auf den Wecker.
Außerdem hatte sie früh begriffen, dass ein weltlichen Genüssen keineswegs abgeneigter, so langjähriger wie körperlich unversehrter Witwer von der Statur eines Robert Förster im Garten Eden namens Karibik Formen der Entspannung und Zerstreuung suchte und fand, die er ungern mit irgendwelchen Bekannten, ganz sicher aber nicht mit seiner eigenen Tochter zu teilen bereit gewesen wäre.
Wann immer er sichtlich gut erholt von seinen „Safaris“ zurückkehrte, schien er gelöst und aufgekratzt, als hätte er dräuende Probleme aufgeplatzten Kokosnüssen gleich an den Stränden über oder unter dem Wind zurückgelassen. Und dann, ja, dann war er eben im Anschluss an eine ziemlich belanglose morgendliche Routinebesprechung aus dem Aufzug getreten, war kurz gegen die Wand getorkelt und schließlich tot über dem Putzmittel-Trolley der entsetzten iranischen Reinemachefrau auf dem frisch gefeudelten Korridor zusammengebrochen. Einfach so, ohne einen letzten kryptischen Halbsatz, über dessen verborgene Botschaft man noch wochen- und monatelang trefflich hätte rätseln können. Trotz nur mäßigen Alkoholkonsums und eines zwar herzlichen, aber beherrschten Appetits, der stets diesseits aller roten WW-Linien blieb. Das Rauchen hatte er kurz nach dem frühzeitigen Krebstod von Lauras Mutter, vor nunmehr fast zwanzig Jahren, bereits im Wege des kalten Entzugs aufgegeben. Da Robert kein Testament hinterlassen hatte, trat ohne weiteres die gesetzliche Erbfolge ein und da keine anderen leiblichen Verwandten in absteigender Linie existierten, wurde Laura zur Alleinerbin. Die Erbmasse umfasst Roberts Mehrheits-Gesellschaftsanteile ebenso wie sein nicht haftendes Privatvermögen. Daraus folgerte zwar nicht zwingend, dass auch die Geschäftsführerfunktion ihres Vaters automatisch auf Laura übergehen würde, doch wäre jede andere Lösung von vornherein konfliktträchtig erschienen. Es sei denn, Laura hätte gegen eine angemessene Abfindung von sich aus darauf verzichtet, in geschäftliche Belange der ROLA reinreden zu wollen. So oder so ein gefährlicher Drahtseilakt ohne sicherndes Netz.
„Man steckt einfach nicht drin,“ hatte der launige Kommentar des herbeigeeilten Notarztes gelautet, nachdem alle Wiederbelebungsversuche ohne die erwünschte Wirkung geblieben und alsbald beendet worden waren. „Man steckt nicht drin.“ Was genau der nervös blinzelnde Arzt damit gemeint hatte, blieb sein Geheimnis. Vermutlich eine Verlegenheitsfloskel, mit der er sich selbst und die schockierten jeweiligen Hinterbliebenen bei jeder seiner unvermeidlichen Niederlagen zu trösten pflegte.
Natürlich gebrach es Laura nicht am Verständnis dafür, dass ein laufendes Unternehmen, seine Belegschaft, Zulieferer und Kundschaft nach einer so brutalen Zäsur rasch Klarheit über die künftige Führungsstruktur gewinnen musste. Nägel mit Köpfen, wie Dr. Schmidt-Öhlenschläger es ausdrückte. Das moderne, unendlich verzweigte, von unglaublich vielen Unsicherheitsfaktoren heimgesuchte und allen Widrigkeiten zum Trotz stets beinhart getaktete Logistikgewerbe war schon durch seine „Gefahrgeneigtheit“ labil genug, als dass es auch noch eines längeren Gezerres um die höchstpersönliche Nachfolge bedurft hätte. Wer in diesem Haifischbecken zappelte oder zauderte, war erledigt. Ein destabilisierendes Ereignis wie der Tod des langjährigen Chefs war eine günstige Gelegenheit, die international gut aufgestellte ROLA GmbH zu schlucken und sich damit einen ungeliebten Rivalen vom Halse zu schaffen.
Gut, ja, schon klar, alles nachvollziehbar. Aber so kurz nach der Bestattung, die sie als Einzelkind eines wenig verwandtschaftsaffinen Vaters praktisch „einhändig“ hatte organisieren müssen, fühlte Laura sich solch nüchternen strategischen Erwägungen nicht gewachsen. Noch schwirrten ihr allerlei Diskussionen über die Auswahl des Sarges, der Aussegnung, der Totenfeier, des Leichenschmauses und der Kränze durch den Kopf. Noch dröhnten ihr die Ohren vom Trauermarsch der sündhaft teuren Kapelle und von der schlichten, sich an einem Bibelzitat ausrichtenden Grabrede des Pfarrers. Vor ihrem geistigen Auge sah sie immer wieder den sich mit gnadenloser Endgültigkeit langsam ins Grab senkenden Sarg, atmete den Duft der Blumengebinde auf dem nach Lehm und Humus riechenden Grabhügel. Eher unterschwellig war ihr dabei ein riesiger Strauß gelber Helikonien aufgefallen, den sie mit Sicherheit nicht bestellt hatte. Zwar kannte und schätzte sie diese tropische, oft etwas wächsern wirkende Blumenart von ihrem Aufenthalt in Florida und Louisiana, fand sie aber auf einem Hamburger Friedhof eher unangebracht. Blumenhändlers Schnapsidee.
Wenigstens um die Grabstätte als solche hatte sie sich in diesen Zeiten des allgemeinen Platzmangels auf kommunalen Friedhöfen keine Sorgen machen müssen, die hatte Robert nämlich bei der Beerdigung Frederikes gleich für sich reservieren lassen. Der Tod ihrer über alles geliebten Frau beziehungsweise Mutter hatten Robert und Laura in ihrer Trauer zu einer verschworenen Gemeinschaft werden lassen. Trotz der vielen Tausend Kilometer, die oft genug zwischen ihnen lagen, war der Kontakt nie abgebrochen. Dank Telefon, Mail, Skype, WhatsApp und anderer moderner Kommunikationsmittel hatten sie fast täglich miteinander konferiert, telefoniert, einander konsultiert und gelegentlich „konspiriert“, wie Robert zu sagen pflegte.
Gemeinsam verlebte Wochen in ihrer Villa in Blankenese besaßen Seltenheitswert und wurden daher von beiden umso intensiver genossen. Laura war sich bewusst, dass ihr Vater sie in vielerlei Hinsicht als Ersatz für seine Frederike betrachtete. Das schmeichelte ihr einerseits, machte ihr aber auch Angst. Oft genug hatte sie ihm durch die Blume nahegelegt, sich doch wieder eine feste Partnerin anzulachen und ihm zu verstehen gegeben, dass sie volles Verständnis dafür aufbringen und ihn durch freundliches Wohlverhalten tatkräftig unterstützen würde. Doch für ihn schien das kein Thema. Falls dann und wann vielversprechende „Kometen“ seine Umlaufbahn kreuzten, hatte Robert sich dergleichen nicht anmerken lassen. Das mochte Ausdruck des Respektes sein, den er für Laura und deren enge Verbundenheit mit ihrer Mutter hegte.
Im Grunde war und blieb Robert Förster eben ein zugeknöpfter Hanseat, der wenig Einblick in seine jeweilige Gemütslage, geschweige denn in seine sicher nicht langweilige Vergangenheit gewährte. Sollte Robert Förster eines Tages seine Menschenmaske entgleiten und der Mann sich als Marsbewohner zu erkennen geben, würde das nach Lauras Einschätzung kein Mitglied seines Mitarbeiterstabes veranlassen, auch nur mit der Wimper zu zucken. Die Lehrlinge, Gesellen und Meister der örtlichen Freimaurerloge würden vermutlich umgehend den Stab über ihn brechen, wiewohl das interplanetarische Image eigentlich bestens zum außerirdischen Firlefanz der verschwiegenen Bruderschaft St. Johannis‘ passen sollte. Die wesentlich erdverbundeneren Damen St. Paulis hingegen würden vermutlich zu Protokoll geben, sie hätten es immer schon gewusst, aber man hätte sie ja nie gefragt. In der Zwischenzeit beriet Laura ihren Vater in Sachen Kleidung, Frisur, Styling und auf Wunsch sogar in solchen geschäftlichen Angelegenheiten, deren umfassende Erledigung sie sich selbst durchaus zugetraut hätte.
Sah sie von seiner Vergangenheit ab, über die Eltern häufig wohlweislich Stillschweigen bewahren, gab es praktisch kein Thema, das sich ihren Gesprächen und Diskussionen verschlossen hätte. Ganz sicher nicht Lauras erste sexuelle Abenteuer und frühe Erfahrungen mit Cannabis und allerlei synthetischen Drogen. Erstere dienten beiden als unerschöpflicher Quell ausgelassener Heiterkeit. Bei Letzteren hingegen verstand Robert wenig Spaß, verlor sogar häufig die Fassung und schien sich schlagartig in einen moralinsauren Drogenfahnder zu verwandeln. Aber solche Gespräche waren im Grunde Einbahnstraßen.
„Milch, Zucker?“ Die Praktikantin gab sich alle Mühe, den Kaffee mit der Routine einer erfahrenen Kellnerin zu servieren. Laura nahm ihren schwarz, wie ihr Vater das zu tun pflegte und betrachtete die junge Blondine mit einer Mischung aus Neugier und Neid. Schließlich gingen Gerüchte, Dr. Schmidt-Öhlenschläger habe die Betreuung der Praktikantin, Lisa hieß sie wohl, quasi zur Chefsache gemacht. Wenn dem wirklich so war, gab beider augenblickliches Verhalten keinerlei Anlass zu weitergehenden Rückschlüssen.
Einen samtenen französischen Cognac hätte Laura jetzt nicht verschmäht, traute sich aber nicht, als einzige zu dieser frühen Stunde ein Glas zu bestellen. Wer immer demnächst an der Spitze der ROLA GmbH stehen würde – eine Frau im Rufe einer Alkoholikerin sollte es besser nicht sein. Gerüchte jeder Art machten am „Tor zur Welt“ schneller die Runde als in Winsen an der Luhe. Laura war die ach so freie Hansestadt mit ihrer feuchten Kälte, ihren regenschwangeren Westwinden, ihren vernichtenden Sturmfluten und ihrer arthritischen Bürgerschaft im Grunde ebenso verhasst wie ihrem Vater. „Verkauf doch die Anteile und lass uns nach Florida ziehen. Oder in die Karibik,“ hatte Laura ihn bisweilen aus der Reserve zu locken versucht.
„Du hast doch Geld genug gescheffelt. Was willst du noch in diesem Hort toter Seelen?“ Ihr Vater hatte ihr zwar grundsätzlich beigepflichtet, aber das Geschäft ließ ihn offenbar nicht los. Sicher brauchte er bei aller Exzentrik, derer er gelegentlich fähig war, die strukturierende Kraft der täglichen Routine. In abgerissenen Jeans und mit tief in die Stirn gezogenem Stetson auf einem propellergetriebenen Air Boat beim Alligatorenfang in den schlangenverseuchten Gewässern und Sauergrasflächen der Everglades konnte man sich einen Robert Förster allerdings auch nur schwer vorstellen.
Halbe Sachen waren erst recht nicht sein Ding. Er übereilte nichts, vergeudete aber in entscheidenden Augenblicken auch keine wertvolle Zeit. Wenn er eine günstige Gelegenheit sah, einen lukrativen Deal unter Dach und Fach zu bringen oder einen Konkurrenten auszustechen, konnte er gnadenlos zuschlagen und über Leichen gehen, wie man so sagt. Nur auf diese bisweilen brutal anmutende Weise war es ihm gelungen, sein Startkapital rasend schnell zu mehren und seine ursprüngliche „Sofa-Spedition“ zu einem veritablen Logistik-Imperium auszubauen. Nie war er dabei der Versuchung erlegen, die geschmeidigen Entscheidungsstrukturen der GmbH auf dem Altar eines zwar kapitalträchtigen, aber die individuelle unternehmerische Gestaltungsfreiheit auch durch vielerlei Auflagen einengenden Umwandlung in eine AG mit anschließendem Börsengang zu opfern, wie Dr. Schmidt-Öhlenschläger ihm das oft genug eingeflüstert hatte.
„Ausgezeichnet, sollen wir dann wieder?“ Solange Laura zurückdenken konnte, war der Justiziar Robert Försters rechte Hand und juristisches Orakel. Er zählte sich zur Elite der Hamburger „Hundertschaft“, wie er es großspurig nannte, und versäumte keine Gelegenheit anzufügen, dass er sich diesen privilegierten Status nicht auf Golf- oder Tennisplätzen erschwitzt hatte. Robert unternahm nichts Geschäftliches und wenig Privates, ohne ihn vorher konsultiert zu haben. Vermutlich hätte er auch eine künftige zweite Gattin ihm vor allen anderen zur Begutachtung präsentiert, wenn die denn irgendwann am Horizont aufgetaucht wäre. Laura lächelte beim Gedanken daran.
Gleichzeitig traute Robert ihm aber offenbar nicht über den Weg, sonst hätte er Laura wohl nicht so oft zur Vorsicht gemahnt. Wie ihrem Vater gelang, diesen mentalen Spagat auf Dauer durchzustehen, war Laura zwar ein Rätsel, aber seine Warnungen hatten ihre Wirkung auf sie nicht verfehlt. Dem Doktor der Rechte war erkennbar nichts Menschliches fremd, am allerwenigsten skrupelloses Gewinnstreben und fein gewobene Intrigen. Er kannte alle versehentlichen Lücken und ideologisch motivierten Inkonsequenzen des geltenden Steuerrechts, fraß sich wie eine geduldige Raupe durch jedes noch so kompliziert erscheinende regeltechnische Blattwerk und war in der Lage, „Schlupflöcher in Kevlar-Westen“ zu nagen, wie Lauras Vater es einmal scherzhaft beschrieb.
„Irgendwann aber glauben Menschen wie er, sie könnten über Wasser laufen,“ hatte Robert ihr immer wieder eingeschärft. „Spätestens dann wird es Zeit, sich von ihnen zu trennen.“
Einleitungen wie diese verhießen nichts Gutes, wusste Laura: Zeit für eine kleine Vorlesung über Roberts Lieblingsthema.
„Die Praktiken wirtschaftlicher Organisationen gleich welcher Art unterscheiden sich nicht grundsätzlich von denjenigen krimineller Vereinigungen. Wie sollten sie auch, teilen sie doch die gleiche Zielsetzung - Profitmaximierung durch Marktbeherrschung. Die Vorgehensweisen von Banken oder Konzernen sind allenfalls ein wenig komplexer, undurchsichtiger, aber um kein Jota weniger skrupellos. Welchen Unterschied macht es, ob du einen Konkurrenten umbringen lässt oder seine Existenz durch die Knüpfung eines lebensnotwendigen Kredits an praktisch unerfüllbare Wucherbedingungen vernichtest? Das prekäre Gleichgewicht solcher Strukturen macht Nachfolgekriege hier wie da zu regelrechten Blutorgien im übertragenen wie im Wortsinne. Verwandtschaft oder Freundschaft zählen da wenig. Nicht umsonst sind Bürgerkriege so fürchterlich gnadenlos. Vergiss‘ das nie, wenn du eines Tages auf meinem Sessel Platz nimmst. Nur wer als Letzter auf den eigenen Beinen steht, überlebt. Das Messer im Gewande trägt stets dein scheinbar bester Freund oder engster Vertrauter. Eine Klinge in meinem Rücken würden vermutlich Ludwigs Fingerabdrücke zieren, deshalb versuche ich, vom Wissen und Scharfsinn des Mannes zu profitieren, drehe ihm aber ungern länger als notwendig den Rücken zu.“
„Das Brutus-Syndrom?“
Robert hatte herzlich gelacht, was bei ihm selten vorkam.
„Das Doktor-Brutus-Syndrom, wenn schon, so viel Zeit muss wohl sein.“
Laura gehörte zum exklusiven Zirkel jener, die die graue Eminenz wenn auch nur in privaten Zusammenkünften beim Vornamen nennen durften. Dessen ungeachtet würde sie im Konfliktfalle gegen ihn und sein monumentales Insiderwissen um das nicht immer ganz orthodoxe Geschäftsgebaren der ROLA GmbH herzlich wenig ausrichten können, das war ihr klar. Andererseits durfte sie sich nicht einfach seinem Diktat unterwerfen, wollte sie im Unternehmen künftig eine minimale Bewegungsfreiheit bewahren und ernst genommen werden. Vermutlich hielt er sie, zumal in der jetzigen Situation, für labil und manipulierbar, paktierte vielleicht sogar längst mit der übernahmebereiten Konkurrenz und baute den smarten Herrn Löwitsch als trojanisches Pferd auf. Laura brauchte unbedingt Bedenkzeit, musste für eine Weile Abstand gewinnen, ohne als Fahnenflüchtige ihr Gesicht zu verlieren. Dazu bedurfte es vor allem eines plausiblen Anlasses.
„Dr. Schmidt-Öhlenschläger, bitte hören Sie,“ nahm sie den Gesprächsfaden auf, bevor ihn der Anwalt mit routinierter Leichtigkeit zu einem unentwirrbaren Knoten schürzen konnte.
„Ich bin Ihnen selbstverständlich für Ihre Hilfe sehr dankbar und kann mir im Augenblick auch niemanden vorstellen, der diese Beraterrolle besser auszufüllen wüsste, als Herr Löwitsch. Zumal mein Vater in der Tat stets in den höchsten Tönen von ihm zu sprechen pflegte,“ log Laura, ohne zu erröten.
„Und ich bin mir natürlich auch darüber im Klaren, wie dringend die Sache ist. Dennoch muss ich mir etwas Bedenkzeit erbitten. So, wie ich meinen augenblicklichen Gemütszustand einschätze, traue ich mir keine weitreichenden Entscheidungen zu. Ich bitte um Nachsicht.“
Nervös strich Laura zum wiederholten Male ihre widerspenstige Haarsträhne hinters Ohr und trank einen Schluck Wasser. Sie wartete darauf, dass sich Widerspruch erhob, aber niemand schien sonderlich überrascht. Laura begriff. Sie hatten von vornherein mit dieser Reaktion gerechnet. Der Doktor würde sicher unverzüglich seinen Plan B aus der Tasche ziehen. Deshalb musste sie sofort entschlossen nachlegen.