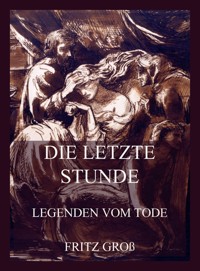
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Fritz Gross wurde 1897 in Wien als Sohn des jüdischen Edelsteinhändlers Herman Gross geboren, kämpfte im Ersten Weltkrieg, in dem er einige seiner engsten Freunde verlor, und zog danach nach Deutschland, wo er an verschiedenen Orten in unterschiedlichen Berufen arbeitete; nachdem Adolf Hitler an die Macht gekommen war, zog er nach England, ließ sich schließlich am Regent Square in London nieder, wo er eine Leihbibliothek für andere Flüchtlinge aufbaute, und das Haus zu einem Treffpunkt wurde. Er starb 1946. In "Die letzte Stunde" erzählt er vom Ableben berühmter Persönlichkeit, darunter Beethoven, Buddha, Galileo Galilei, Goethe, Kant, Lessing, Lincoln, Mohammed und vielen anderen. Vermutlich ist vieles frei erfunden, dennoch frägt sich der Leser zwangsläufig, ob es sich nicht genauso abgespielt hat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 412
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Die letzte Stunde
Legenden vom Tode
FRITZ GROß
Die letzte Stunde, Fritz Groß
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN: 9783988681973
Quelle: http://digital.bib-bvb.de/view/bvb_mets/viewer.0.6.5.jsp?folder_id=0&dvs=1743592003299~649&pid=17884991&locale=de&usePid1=true&usePid2=true.
www.jazzybee-verlag.de
INHALT:
AISCHYLOS. 1
ALEXANDER.. 2
ALTENBERG... 3
AMUNDSEN.. 5
ANDERSEN... 6
ATTILA.. 7
AUGUSTINUS. 8
BACH.. 10
BAKUNIN... 11
BALZAC.. 12
BAUDELAIRE.. 13
BEETHOVEN... 14
BISMARCK.. 16
BLANQUI17
BÖRNE.. 18
BRUCKNER.. 19
BÜCHNER.. 20
BUDDHA.. 21
BYRON... 23
CASANOVA.. 24
CAESAR.. 25
CELLINI26
CERVANTES. 28
CLEMENCEAU.. 30
COMENIUS. 31
CORVIN... 32
CROMWELL.. 34
DANTE.. 35
DANTON... 36
DAUMIER.. 37
DEHMEL.. 38
DIDEROT.. 40
DOSTOJEWSKi41
EISNER.. 42
EMPEDOKLES. 43
ENGELS. 44
FERRER.. 46
FEUERBACH.. 47
FLAUBERT.. 48
FRANCE.. 49
FRIEDRICH.. 51
GALILEI52
GAUGUIN... 53
GEYER.. 54
GOETHE.. 56
GOGH.. 57
GOYA.. 58
HANNIBAL.. 59
HEBBEL.. 60
HEINE.. 62
HERZEN... 63
HEYM... 64
HOFFMANN... 65
HÖLDERLIN... 67
HOLZ.. 68
HUSS. 69
IBSEN... 70
IKARUS. 71
JACOBSEN.73
JAKUBOWSKI74
JAURÈS. 75
JESUS. 76
JOGISCHES. 78
KANEHL.79
KANT.. 80
KATHARINA.. 81
KIERKEGAARD... 83
KLABUND... 84
KLEIST.. 85
KÖBIS. 86
KOLUMBUS. 88
KROPOTKIN... 89
KUNGFUTSE.. 90
LANDAUER.. 91
LAOTSE.. 93
LASALLE.. 94
LEHMBRUCK.. 95
LENIN... 96
LESSING... 98
LEVINE.. 99
LIEBKNECHT.. 100
LILIENCRON.. 101
LINCOLN.. 103
LONDON.. 104
LOYOLA.. 105
LUTHER.. 106
LUXEMBURG... 108
MACHIAVELLI109
MAHLER.. 110
MARAT.. 111
MARC.. 113
MARX.. 114
MATEOTTI115
MEHRING... 116
MICHEL.. 118
MICHELANGELO... 119
MOHAMMED.. 120
MOLIÈRE.. 121
MOSES. 123
MOZART.. 124
MÜNZER.. 125
NAPOLEON... 126
NESTROY.. 128
NIETZSCHE.. 129
NOVALIS. 130
NUNGESSER.. 131
ODOAKER.. 133
ÖDIPUS. 134
PAASCHE.. 135
PETER.. 136
PLATO... 138
POE.. 139
POPPER.. 140
PROUDHON... 141
RAIMUND... 142
RATHENAU.. 144
REED... 145
REISSNER.. 146
REMBRANDT.. 147
RILKE.. 149
ROBESPIERRE.. 150
RODIN... 151
ROUSSEAU.. 152
SACCOVANZETTI153
SALOMO... 154
SAVONAROLA.. 156
SCHILLER.. 157
SCHOPENHAUER.. 158
SCHUBERT.. 159
SCHUMANN... 161
SHAKESPEARE.. 162
SOKRATES. 163
SPARTACUS. 164
SPITTELER.. 166
STENDHAL.. 167
STIFTER.. 168
STIRNER.. 169
STRINDBERG... 170
SUNYATSEN... 172
SWIFT.. 173
TIMUR.. 174
TOLSTOI176
TRAKL.. 177
TURGENJEW... 178
VERDI179
VERHAEREN... 181
VERLAINE.. 182
VOLTAIRE.. 183
WAGNER.. 184
WASHINGTON... 185
WEDEKIND... 187
WEININGER.. 188
WEITLING... 189
WHITMAN... 190
WILDE.. 191
ZILLE.. 193
ZISKA.. 194
ZOLA.. 195
ZWINGLI196
AISCHYLOS
Auf dem Felsen des Prometheus. Der Greis ruht. Um ihn Stille und Wolken. Der Aetna spiegelt im Meer. Die Winde wohnen in seinen Haaren. Wenn er die Augen schließt, küsst ihn die Sonne. Über ihm, ein zitternder Punkt im All, ein Adler. Der hängt im Himmel und wartet auf Aas, das ihm nicht entrinnt. Unten in den Tälern Siziliens tönt Lachen von Mädchen. Eumeniden, die Wohlgesinnten, hüten sie seinen Tod? Ein Hirte ruft, ist es Orestes, den seine Triebe jagen? Keine Frage ist da und keine Antwort. Die Schüler sind weit. Weit ferne die Ehren, ferne die neunzig Pergamente, in denen steht, was er schuf. Seine Seele spricht mit Kratos und Bia, den ewigen Geschwistern. Sie sitzen an seiner Seite, schauen ins Tal wie er. Ohne Anfang und ohne Ende ist ihr Gespräch. Ohne Furcht ruht auf ihnen, den Göttern, sein Blick, da er um sein Ende weiß. Sie schrecken ihn nicht, er weiß, dass sie nur Sterbenden nahn. So weiß er mit ihnen zu plaudern, weiß die Zeit zu nützen, weiß, dass nichts mehr kommt nach den Tagen, nach den Stunden, die er noch zu leben hat. Über die Seele sprechen sie, über den Spielball von Ahnung und Schuld, Über die Sünde, Über die Sünde der Menschen, Über das Schicksal der Götter. Kratos blickt ihn an. Seine ungeheuren Arme ruhn auf den nackten Schenkeln. Über seinem Kopfe schweben die Flammen, die Flammen des Herakles. Aus kleinen Augen glimmt die tierische Kraft. Er schweigt, aber sein Gesicht ist verzerrt von der Anstrengung des Denkens. Kaum wagt er zu atmen, dass er nicht ein Wort des Gespräches verliert. Neben ihm Bia, die Schwester, die gebändigte Stärke, neben der Ur-Kraft von Kratos. Sie trug das Gewand und das Stirnband Iphigenies. Auch sie betrachtete den Sterbenden, der zu ihr sprach wie zu einer Mutter. Nicht die Ermordung seiner Mutter. Bia, trieb Orestes durch die Welt. Jedes Kind, das die Hülle seiner Mutter durchbricht, tötet seine Erzeugerin. Es war etwas anderes. Göttin. Vielleicht war es der Schatten Agamemnons, mit der blutenden Stirn. Vielleicht war es das gebrochene Auge eines Hundes, der auf der Landstraße starb. Wie wenig wissen wir vom Leben. Wie wenig weiß ich, der Dichter, vom Leben meiner Geschöpfe. Einen Gott schuf ich mir und nannte ihn Zeus, einen Bruder gestaltete meine Kraft. Ihm ward der Name Prometheus. Ich sah sie nie, sah sie so wenig wie Euch. Götter, die Ihr mein Sterben bewacht. Aus dem Aetna quoll Rauch. Aus der Erde hervor klang Rollen wie menschliches Stöhnen. Die Sonne war im Sinken. Die Götter hüllten sich enger in ihre Gewänder. Aber der Greis sah nicht Sonne noch Untergang, er sah nur den Tempel der Akropolis, an dem sein Orestes niederbrach. In den Lüften ein Schrei, drohend, qualvoll, ein grässlicher Akkord: Das Gelächter der Erynnien. Aus den Wolken ein Pfeil, einer Sonne Strahl, die Stimme des Phoebus Apollo. Keuchend lag er da. Orestes, seine Rippen flogen. Schaum vor dem schreienden Mund. Über ihn gingen, achtlos, die Bürger Athens. Achtlos des Leides unter ihren Füßen, voll Neugierde nach der neuesten Tragödie ihres Aischylos. Alle gingen sie, in den weißen Peplos gehüllt, sprachen von Fest und Gelagen. Unter ihnen stöhnte die Kreatur. Auf dem Sims des Tempels Geier und Krähen, das Volk der Erynnien. Krächzend und schnatternd, aber die Athener achteten ihrer nicht. Orestes schrie auf. Lauter antworteten die Vögel. Jetzt war auch der dunkle Punkt vom Himmel gefallen. Der riesige Adler kreiste über des Sterbenden Haupt. Er wartete. Die Götter waren fort. Nur der Aetna war da. Der Himmel. Ganz ferne das Meer, das Meer Athens. Athen, seufzte er, und sein Kopf fiel auf die Brust. Da war auch der Adler schon auf dem Toten. Stumm hackte sein harter Schnabel auf dem erkaltenden Leib.
ALEXANDER
Er schlief. Vor seinem Lager hockten sechs Ärzte und beobachteten ihn. Über seinem Haupte glänzten die Standarten der Länder und Provinzen, die er erobert hatte: Kleinasien. Kappadozien. Kilikien. Aegypten. Assyrien. Hyrkania. Areia. Drangiana. Gedrosien. Arachosien. Baktrien. Indien. Karmanien; neben seinem Bette stand seine Leibwache. Sklaven, je zwei aus den eroberten Provinzen, sehr zum Unwillen der Makedonier, denen er sich immer mehr entfremdete. Seine drei Frauen blieben in den Frauengemächern, der Großkönig sah sie nicht gern im offenen Teil des Palastes. Der Großkönig war ein Jüngling, er war knapp dreiunddreißig Jahre alt und musste jetzt sterben. Er war vergiftet worden. Die Ärzte stritten leise miteinander, sie stritten sich schon drei Tage und konnten sich nicht einigen. Sie waren aus allen Teilen des riesigen Reiches und einer kannte kaum des anderen Sprache. Wie Alexander, der sich und den sie den „Großen“ nannten, seine Leibgarde aus den mannigfaltigsten Völkertypen gemischt hatte, so hielt er es auch mit seinen Ärzten. Feldherren und Frauen. Die Makedonier waren ganz in den Hintergrund getreten, seitdem ihnen der Großkönig nach der Verschwörung der Kallisthenes. Parmenion und Philotas misstraute. Nach der Hinrichtung dieser drei, die früher seine Vertrautesten gewesen waren, war Angst. Hass und Misstrauen an die Stelle der Liebe und Ergebenheit getreten. Alexander, der Jüngling, dem noch kein Gift den Leib zerriss, ritt durch die Wüste. Immer in der Richtung den Pyramiden zu. Je näher er ihnen kam, desto ferner erschienen sie ihm. Er ritt auf einem weißen Rosse, hinter ihm sein Gefolge, dann im weiten Abstand sein ganzes Heer. So war er durch Griechenland geritten, so hatte er Kleinasien durchquert, so hatte er am Granikos und bei Issos gesiegt. Er blieb immer der gleiche, der Schimmel, den er ritt, das Gefolge, das ihn begleitete, wechselte so oft wie der Feind, den er schlug. Der Zwanzigjährige war Herr über Griechenland und Makedonien. Nach fünf Jahren beherrschte er Asien. Der Priester am Fuße der Pyramiden hatte ihn als den Sohn des Himmels begrüßt und seit diesem Tage wusste er, dass er der Herr der Welt war. Er ritt durch die Welt. Wenn er nicht ritt, nachts, lag er in Burgen. Schlössern und Städten und trank und liebte. Wenn er nicht liebte, schlug er sich mit dem Feind. Siegend durchritt er die Welt. Der Fiebernde träumte noch einmal die Eroberung und den Brand des persischen Königsschlosses. Es war die Nacht, da er Roxane zu seinem Weibe machte. Aber es trieb ihn weiter, er, der die Welt des Westens kannte, weil sie seine Heimat war, hatte jetzt Sehnsucht, die Grenze der Erde im Osten zu erforschen. Jenseits Indiens, das Meer des Ostens, zog ihn an. Den Indus überschritt er. Den Hyphasis sollte er nicht überschreiten. Den Ganges sollte er nicht mehr sehen. Die Truppen wollten nicht weiter. Es war seine erste, seine einzige Niederlage. Es war der Tag seines Unterganges. Er kehrte um. Zwischen Susa und Babylon pendelte er unsicher hin und her und gab dem ungeheuren Reich Gesetze und eine Verfassung. Wer hatte ihn vergiftet? ,,Wer“ schrie er und fuhr hoch. Die Ärzte erschraken. Sie versuchten ihn zu beruhigen. Aber das Fieber stieg. Die Adern schwollen ihm an, er schrie andauernd. Er nahm sein Schwert von der Wand und schleuderte es auf einen der Ärzte. Da entwichen sie alle, auch die Leibgarde trieb er hinaus. Ptolemäus wachte an seinem Lager die ganze Nacht. Makedonier waren wieder in seiner Nähe. Er fand wieder Ruhe, fühlte sich in Sicherheit. In der Nacht starb er. Es war eine heiße schwere Juninacht. Nebenan weinten Frauen.
ALTENBERG
Ein dauerndes Gedränge vor dem Einzelzimmer im Allgemeinen Krankenhaus, in dem der Dichter lag. Peter Altenberg, der berühmte Dichter war da! Heute wird er sterben, hat der Wagner-Jauregg gesagt! Das wird eine schöne Leiche werden! Die schöne Leiche lag, noch lebendig, in dem großen weißen Bett und schaute auf die Decke. Blumen waren im Zimmer. Blumen, die der Dichter hasste. Nichts totes wollte er um sich haben, das ganze Leben lang und jetzt lag er inmitten von Pflanzenleichen. Schöne Mädchen kamen, sahen ihn an, berührten flüchtig seine Hand, verschwanden wieder. Der ganze Männertrakt auf der internen Station war in Aufruhr. „Pupperl“, tönte es und „pssst“, alles war in Erregung, alles stand jenseits der Ordnung. Sein Atem ging flüchtig und leicht. Die letzte Schlafmittelvergiftung war zu tief gewesen. Man hatte den Magen ausgepumpt. Was nützte es, wenn er es, der Sechzigjährige, in ein paar Tagen wiederholte. Seine Hände, die schönen, schlanken adeligen Hände, lagen flach auf der Decke, zuckten manchmal, lagen auf den Augen. Die Schwestern versahen ihren Dienst, kamen und gingen, scheuchten die Zuschauer vom Korridor, legten das Thermometer ein. Für sie war der sterbende Dichter der Fall 931. Engländer Richard, ledig, 60 Jahre, akute Alkoholvergiftung. Für sie war der Dichter ein kranker Mensch, war jeder Dichter ein kranker Mensch. Paula war nicht da. Man hatte ihr nach Innsbruck telegraphiert. Aber sie wird zu spät kommen. Klara betrat nicht das Krankenhaus. Wenn es nach ihr gegangen wäre, lag er, der Peter, jetzt bei Fürth oder Löw. Mitten unter dem Volk, der größte Dichter Österreichs. Wenn die wüsste, wie gerne Peter gerade hier lag, wie viel sicherer er sich fühlte bei diesem Wundermann Wagner-Jauregg als bei irgendeinem Sanatoriumslöwen. Er wird ihn schon gesund machen. Er will ja noch seinen sechzigsten Geburtstag erleben, in zwei Monaten. Im März, „Schwester“, fragte er irgendwohin in den Saal hinein, „wie sehe ich aus?“ „Sie sollten lieber schlafen“, sagte die eine mit hartnäckiger, aber sanfter Stimme. „Aber wenn ich nicht schlafen kann?“, meinte er, „Dann schließen Sie die Augen und zählen Sie bis eintausend,“ „Wozu“, fragte er sie. „Um einzuschlafen“. „Wie kann ich einschlafen, wenn ich doch zählen muss?“ Die Schwester, nicht dümmer und hübscher als ihre Mitschwestern, gab es auf. Der Dichter legte sich auf die Seite, begann zu zählen. Bis hundert, bis tausend. Es war still geworden. Da bemerkte er, dass er nur die einer zählte. Er errötete und begann wieder von vorne. Er verwirrte sich, die Zahlen tanzten in seinem müden abgearbeiteten Gehirn umher. Die Schwester schaltete das Licht aus und wünschte eine „Gute Nacht“. Die Nacht war schön. In den Wäldern sang der Wind. Vom Sonnwendstein leuchtete das Mondlicht zum „Erzherzog Johann“ hinunter. Drinnen tanzten die Paare. Draußen ging er mit Anka. Sie hatte ein schwarzes Kleid. Ihre Augen waren geschlossen, sie hatte sich in ihm eingehängt und er musste sie führen. An der Waldlichtung, hinter dem Tennisplatz, küsste er sie. Sie war fünfzehn Jahre. Er hatte kein Alter. Er spürte, die Nacht war schön. Sie wird nie, nie, nie wiederkommen. Eine andere Anka stand am Fuße des Sonnwendstein oder am Loser oder am Pinkenkogel und ein anderer Peter küsste sie. Das war schön. Er neigte den Kopf ein wenig auf die Seite. Es wurde ihm etwas schwindlig. Aber ehe er noch „Schwester“ rufen konnte, war er hinüber. Der Wind pfiff um das Spital.
AMUNDSEN
Er zitterte. Die Kälte schnitt durch die nassen Kleider hindurch, die sofort am Leibe angefroren waren. Vor zehn Minuten war er auf die Eisscholle gekrochen, nachdem er eine Stunde lang, an eine Planke geklammert, im Meer getrieben hatte. Die Katastrophe hatte Sekunden gedauert. In voller Fahrt war eine Stichflamme aus dem Motor geschossen; das Flugzeug fiel wie ein Stein ins Wasser. Francis, der Pilot, konnte sich nicht mehr aus dem Gurt befreien und war mit der Maschine sofort untergegangen. Er selbst hatte sich im letzten Augenblick freimachen können und war ins Wasser gesprungen. Eine Planke, die er im Wasser treibend gefunden hatte, rettete ihm das Leben. Jetzt lag er zitternd auf dem Eise und schnappte nach Luft. Das Herz begann wieder normal zu arbeiten. Er erbrach sich. Wasser und Keksreste. Sofort bekam er Hunger. Aber er hatte nichts bei sich. Er musste erfrieren oder verhungern. Die Scholle, auf der er trieb, war ganz klein, mit rauer Oberfläche. Er musste sich fest anklammern, um nicht abzurutschen; lange konnte er so nicht ausharren. Die Eisscholle trieb allein, ein paar hundert Meter weiter sah er einen größeren Eisberg. Er fühlte sich nicht stark genug, um durchs offene Wasser zu schwimmen. Er schrie. Das wärmte. Er schrie, um wärmer zu werden. Er schrie, um seine Stimme zu hören. Er schrie, um nichts unversucht zu lassen. Rettung zu suchen. Er schrie: „Hilfe!“, in allen Sprachen, die er kannte, aber er dachte keinen Augenblick lang, dass welche kommen konnte. Jetzt rutschte er wieder ab. Knapp überm Wasser erst konnte er sich wieder anklammern. Die Kleider rissen ihm die Haut auf, die Kälte ließ das Blut sofort gerinnen. Er schrie noch einmal. Es klang wie das heisere Brüllen eines Tieres. Dann schloss er die Augen. Ob er sich einfach ins Meer gleiten lassen sollte? Dann hatte alle Qual und Angst ein Ende. Er durfte nicht. Er wollte nicht. Solange noch Atem da war, das Herz schlug, solange musste ihn die Hoffnung am Leben erhalten. Als er die Augen wieder öffnen wollte, bekam er sie nicht auf. Vielleicht waren Tränen in die Wimpern gekommen und hatten ihm die Lider zugefroren. Er hielt sich die Hand vors Gesicht und hauchte gegen das Handinnere. Langsam taute er so seine Augen wieder auf. Die Sonne blendete ihn. Eine Ohnmacht kam langsam; er kletterte mit den letzten Kräften höher hinauf und legte sich in eine Kuhle, um nicht abzurutschen. Dann verlor er das Bewusstsein. In seinen Ohren dröhnten Propeller. War es seine Maschine? War es Nobiles Schiff? Kamen sie, ihn zu retten? Er schrie noch einmal. Aber keiner hörte den Schrei. Der Bewusstlose hatte den Schrei geträumt. Als er zu sich kam, trieb die Scholle ins offene Meer hinaus. Die Arme und Beine waren ihm abgefroren. Die Kälte kroch ins Herz. Überm Mund war keine Wolke des Atems mehr. Er wusste nicht mehr, ob er noch am Leben war. Er hatte keine Schmerzen. Er erfror.
ANDERSEN
Es war ganz still in der Stube. Nur die Uhr zerschnitt die Ruhe und ganz weit ferne lärmten die Straßenjungen. Hans Christian Andersen lag in dem großen Bett, bis an die Ohren zugedeckt und hatte die Augen geschlossen. Sein Atem ging schwer und die Stille und die Augusthitze bedrückten ihn. Beim Fenster saß Mathilde, seine mütterliche Freundin, und schlief, von den vielen Nachtwachen erschöpft. Andersen wollte nicht an den Tod glauben. Er hatte eine Reise vorbereitet, nach Italien. Der Siebzigjährige hatte jahrelang dafür gespart und monatelang hatte er sich schon darauf gefreut. In dieser lähmenden Nachmittagsglut machte seine Fantasie die ganze Reise mit und der Sterbende wusste nicht, ob er wachte, träumte oder schon tot war. Er kam sich vor wie das Mädchen mit den Schwefelhölzern, dessen Hinübergehen vom Elend des Lebens in den Glanz der Heimat er jetzt erlebte. Nun saß er auf dem Rücken des hässlichen Entleins und flog über das flache Land seiner Heimat. Ferne zu beiden Seiten erbrauste das Meer. Nord- und Ostsee grüßten ihn. Über Hamburg flog er hinweg und es bereitete ihm Lust, sich vorzustellen, wieviel Kinder jetzt wohl seine Märchen läsen. Dann steuerte sein Vogel gerade nach Süden, mitten über die dunklen Wälder hinweg. Da unten träumten die Bäume Märchen, viel schöner, als sie je ein Mensch erdenken konnte. Kleine Vögel kamen schnell nach oben gesaust, das Entlein zu begrüßen. Man hörte die Lerchen jubilieren und die großen Hummeln brummen. Er sah die Pferde langsam über die Felder gehen, gefolgt von pflügenden Bauern. Es war ein stilles, gesegnetes Land, und der Dichter freute sich, dass er es noch einmal sehen durfte. Bald aber endigten die Wälder und Felder der „Roten Erde", und sie flogen über den Lärm und den Rauch des Ruhrgebietes. Sie mussten jetzt ganz hoch steigen, denn der alte Mann hätte immer husten mögen. Da krabbelten Millionen Menschen herum, liefen, schrien, schwitzten; es sah von oben aus wie eine Hölle. Und der Dichter wurde traurig, er warf sich im Bett umher und stöhnte. Aber es hörte ihn keiner. Ganz traurig wurde er, denn er wusste, dass tief unten in der Erde auch noch viele tausende steckten und schufteten und schwitzten und fluchten. Und er wusste es, der Dichter, dass es für die keine Märchen und keine Erlösung gab, und er wusste es ganz genau, der Sterbende, dass sein ganzes Werk, dieses brave mühselige siebzigjährige Märchenleben nichts war gegen so eine neunte Stunde unter Tag. Und als sie schon lange weiter waren, und immer geradeaus südwärts flogen, immer den Rhein entlang, da fielen noch immer heiße Tränen von der armen eingefallenen Greisenwange. Aber als die großen Berge kamen, als es kühler wurde, da versiegten auch die Tränen. Pfeilschnell flogen sie über die Alpen. Da war es mächtig kalt. Aber als sie wieder das freie Land erreicht hatten, bestrahlte sie die Sonne des Südens. Da war der arme Dichter froh, dass er sie noch einmal erleben durfte, und er atmete sehnsüchtig die klare Luft. Es wurde langsam Abend. Und ganz weit ferne schimmerte schon die goldene Kuppel der ewigen Stadt. Die Glocken begannen zu läuten. Es schlug Ave. Er schlug die Augen auf. Es dämmerte schon. Da stieß das Herz noch einmal hoch, bis in den Hals hinauf, er machte noch schnell „Hhh“, und dann sank er befreit zurück. Mütterlein Mathilde war aufgeschreckt, kam schnell angewatschelt und kam noch gerade zurecht, ihm sanft und leise die Augen zuzudrücken.
ATTILA
Küsste er die schöne Ildicox, dann grinste hinter ihren nackten Schultern der Totenschädel des erschlagenen Bruders Bleda. Die anderen Frauen, die schönsten der Welt, ausgesucht und erprobt in siebzehn Heerzügen, umringten das Lager. Vor dem Zelt standen die Posten, die tapfersten und zuverlässigsten aus den Stämmen der Acatziren. Burgunder. Gepiden. Heruler. Langobarden. Ostgoten. Perser. Rugier. Thüringer, zwischen Indus und Rhein gehörte ihm die Welt. Er spielte mit den Haaren Honorias, der Schwester Kaiser Valentinians und beobachtete den Blick, mit dem Ildico die Römerin betrachtete. Vor dem Lager stand ein hölzerner Tisch, ein irdener Krug und ein Becher aus Holz. Er selbst schenkte sich ein, aber seine Züge erhellten sich nicht. Zu der Maske des toten Bruders Bleda hatte sich noch das Antlitz Rugilas, seines Oheims, gesellt, aus der breiten Wunde über den Augen quoll noch immer das Blut. Er erschauerte. Honoria legte ihren Kopf in seinen Schoß, er fuhr ihr leise übers Haar und schloss die Augen. Da verschwanden die Köpfe der Toten und nur ein Blitzen war da. Ildicos Nadel, die das Tuch über ihren Brüsten zusammenhielt, war verschwunden und sie lachte ihm zu. „Tanze ...“, sagte er heißer und trank. Musik war da und Ildico tanzte. Die Fackeln erlöschten, nebenan der Lärm aus der weiten Halle verstummte, nur das Klappern der Krüge auf den Bänken war zu hören. Ildico tanzte und Attila sah ihr zu. Zimbeln und Pauken begleiteten leise ihre Bewegungen und nur eine Fackel beleuchtete ihre Brüste. Sie war ein Dämon geworden und ihr Tanz war der Tanz eines erschlagenen Kriegers hoch in den Lüften über den katalaunischen Feldern. Sie suchte ihre toten Brüder, aber die toten Brüder waren nicht da. Sie wollte rufen, aber aus ihrer Kehle drang nur ein erstickter Laut. Sie tanzte, eine verwundete Seele vor den Siegern, sie tanzte vor Theoderich und Aetius. Attila, der Besiegte, war nicht da und Attila, der jetzt vor ihr saß, wurde finster und trübe, weil Ildico nicht vor ihm tanzte, sondern vor den Siegern. Leise rauschte die Musik, ein paar Flöten wimmerten, die Schreie der sterbenden Krieger. Ildico tanzte. Alle Frauen Attilas sahen auf sie, die das Lager des Königs teilen wird. Sie lagen auf Teppichen und Polstern, mit weit offenen Augen, blickten auf Attila, auf Honoria, deren Kopf auf den Knien des Königs lag, auf Ildico. Attila trank. Seine Augen wurden noch kleiner, noch stumpfer, noch düsterer, sein Blick erlosch. Nebenan war Stille. An den Türen bewegten sich leise die Wachen. Manchmal klirrten die Spangen der Weiber. Nur Ildico war ohne Spangen, sie bewegte sich kaum, nur ihre Brüste schwebten und ihre Knie schimmerten wie zwei kleine Monde. Ihr Gesicht war bleich, so bleich, ihre Augen umfassten Attila, fragten, fragten, mahnten. Es kam keine Antwort. Attila schlief. Ein trübes Lächeln im hässlichen Gesicht. Saß mit untergeschlagenen Beinen da, lebendig gewordener Gott, und schlief. Seine Finger spielten im Haare Honorias. Honoria schloss die Augen und lächelte. Ildico tanzte, jetzt kam sie langsam, langsam, unmerklich langsam näher. Die Frauen träumten. Ildico war wach und die Posten an den Türen. Aber sie kamen um einen Blitz zu spät. Ildicos goldene Nadel saß im Herzen des Königs. Der sank um, noch einmal öffnen sich die Augen, blicken klar und gut. „Tanze . . . Ildico . . . tanze . . . “ Ildico sinkt langsam zu Boden. Die Fackel brennt zu Ende. Es dämmert. Starr und stumm an den Türen die Wachen.
AUGUSTINUS
Er hatte sich in die Kirche tragen lassen und lag nun auf einer Bahre vor dem Altar. Die riesige Kirche dröhnte von dem Lärm der stürmenden Vandalen. Die Mönche umgaben ihren Bischof, leise murmelten sie Gebete. Die Schwester des Bischofs Augustinus. Perpetua, die Äbtissin, kniete an einem Seitenaltar. Steine flogen gegen die großen Fenster, manchmal klirrten die bronzenen Tore der Kirche vom Wurf der Geschosse. Augustinus lag mit geschlossenen Augen, leise atmend, auf seiner Bahre. Er trug die Gewänder des Ordens, weiße Unterkleider, schwarze Kutte, auf der Kapuze ruhte sein Haupt. Als die betenden Mönche ganz in seine Nähe gerieten, wies er sie mit müder Hand wieder fort. Er brauchte Raum zum Sterben. Die Lebenden konnten nicht sehen, dass zwei zu seinen Häupten saßen, still und unbeweglich, und warteten auf seinen Tod. Die Lebenden konnten nicht sehen, dass der eine ein uralter Mann war, mit langem weißen Bart, in den unaufhörlich Tränen fielen, sie konnten den anderen nicht erkennen, nicht seine unsterbliche Schönheit und nicht seinen verunstalteten Fuß, sie konnten nicht wissen, dass diese beiden Ambrosius, der Bischof und Satan, der Teufel waren. Sie konnten ja nicht hören, was die beiden miteinander sprachen, und sie konnten nicht erkennen, ob es der Sterbende verstand. Aber der Sterbende verstand jedes Wort, und jedes Wort fiel in sein Herz wie ein Stein. Und jeder Stein dröhnte in seinem Herzen wie draußen vor den Toren seiner Kirche die Steine und Geschosse der Vandalen dröhnten. Der Bischof Ambrosius sprach. Satan lauschte. Augustinus sah nicht den müden Mund seines Lehrers, er sah, durch die geschlossenen Lider hindurch, das spöttische Lächeln Satans, seines Feindes. Satans, den er hasste wie die Sünde und von dem er nicht loskam, wie von der Sünde. Ambrosius sprach: „Es gibt keine Schonung und keine Rettung, die Vandalen werden kommen und Deinen Leib von der Bahre wegreißen, sie werden den Altar zerschlagen und Deine Schwester schänden. Es ist kein Mitleid in der Welt und keine Liebe. Seit Adam ist die Sünde in der Welt, denn Adam, er wurde nicht von Gott geschaffen, sondern von Dir. Satan. Und Gott hat es gewusst, in seiner Allbarmherzigkeit, und nur Gott kann den leidenden Menschen in Gnade und Güte erretten. Du hast es gelehrt. Augustinus, mein Sohn, und diese Kirche zeugt hier von der Glut Deines Glaubens." Und Ambrosius, der uralte Lehrer des Sterbenden, in diesem Leben, schon lange tot und verwest, beugte sich vor seinem Schüler, dem sterbenden, um ihm zu danken. Aber Augustinus sah ihn nicht. Mit geschlossenen Augen sah er auf Satan, der an seinem Haupte saß, leise lächelte und auf das Triumphgeschrei der Mannen Genserichs hörte. Und Ambrosius sprach noch einmal unter Tränen: ,,Du hast es gelehrt und verkündet, mein Sohn, und Deine Lehre wird Tausenden von Menschen Ruhe und Trost sein. Wohl gibt es keinen Willen und alles ist vorbestimmt, alles ruht in Gott, aber des Menschen Trachten geht verschlungene Wege und keiner weiß von seinem Ende. Wohl fehlt dem Menschen die Kraft zum Guten, und die Welt der Versuchungen stößt ihn immer wieder in die Hölle seiner Leidenschaften. Aber Gott schickt uns alle Leiden, dass wir am Ende des Lebens erkennen seinen Willen und seine Herrlichkeit..." Er verstummte und sah entsetzt auf Augustinus, der lächelte. Es lächelte der Sterbende und Satan, beide sahen einander an. Da erschrak Ambrosius und wollte rasch seine Kutte über den Sterbenden breiten. Das ging wie ein Schatten über Augustinus Gesicht und die Mönche rückten näher zusammen. Da verging der Schatten auf des Toten Gesicht und ein Lächeln blieb zurück, es war nicht das Lächeln der Erlösung und der leeren Gnade, es war das Lächeln des Zweifels, das Lächeln Satans.
BACH
Seine Hand, die dicke, mächtige Hand, die gewohnt war. Kirchen zum Dröhnen zu bringen, wenn sie auf dem Manuale lag, sie ruhte jetzt kraftlos und schwer auf der Decke. Manchmal wölbte sie sich, dann klopfte der Mittelfinger den Takt zu einer Fuge, die er sich aus seinen Träumen heraus ersann. Er wusste es, dass ihn die Ärzte aufgegeben hatten. Seitdem die Augenoperation missglückt war, seitdem er wusste, dass er blind bliebe, hatte er alle Hoffnung und alle Lust zum Leben verloren. Durch das Fenster hörte er die Schüler von der Thomas-Schule Choräle singen. Aber es war etwas anderes, wenn sie unter ihm sangen oder wenn Altnikol, seiner Tochter Mann, sie überhörte. Unten im Hause lärmten die Kleinen. Johanna und Regine, in der Küche hantierten Magdalene, sein Weib und Liesgen, die Tochter. Er konnte sie aufschluchzen hören. Das hörte er mit seinen Ohren. Tief drinnen in ihm aber erklang eine andere Musik. Jetzt war es das Orgelkonzert seines Friedemann, diese wilde, seltsame Musik, die sein Sohn ihm einmal auf der Thomasorgel vorgespielt hatte und die er nicht mehr verstand. Und jetzt wieder war es eine Mottette, die Emanuel. Kantor in Potsdam beim König, ihm vorgespielt hatte, als er damals die Klaviere des Alten Fritzen einspielen musste. Jetzt waren die Söhne fort, manche schon als Kinder gestorben, und unten im Hause waren Anna Magdalena, sein Weib und die drei Töchter. Er ruhte mit geschlossenen Augen; wenn er sie einmal öffnete, dann war nur ein roter Nebel da und der bohrende Schmerz, das Licht auf ewig verloren zu haben. Langsam stieg aus der mächtigen Brust ein Ton; es folgte ein zweiter und wieder ein anderer; Bach sang. Es war eine Fuge, zu der er die Begleitung auf die Bettdecke klopfte. Das trieb er so stundenlang. Wenn die Frauen oder die Mädchen kamen, schickte er sie wieder fort; er wollte allein sein, eifersüchtig wachte er über seiner Musik; die letzte, die er machte. Als der Schwiegersohn später kam, begann er zu jammern, wie falsch die Thomasschüler gesungen hätten, einmal hätten sie sogar in reinen Quinten gesungen. Altnikol entschuldigte sich erstaunt und verlegen. Dann ließ er ihn Notenpapier. Schreibzeug und Tinte holen und diktierte ihm einen Choral „Wenn wir in höchsten Nöten sein“, diktierte er ihm. Aber später, als das Lied immer gewaltiger in ihm schwoll, als es stieg wie das Fieber, das seinen Leib jetzt durchraste, schrie er: „Streich die Überschrift aus, schreibe: „Vor Deinem Thron steh ich allhier“ und drängte ihn: „Schneller, schneller, es ist noch viel zu schaffen!“ Als die Ärzte kamen, ließ er auch die Kinder und das Hausgesinde kommen und gab jedem seinen Segen. Dann rief er noch einmal den Altnikol zu sich und bat ihn: „Spielt dann die Hohe Messe, zu meinem Gedenken. Ich habe sie zeitlebens nicht gehört, sie soll an meinem Todestag erklingen.“ Dann verloren sich seine Worte ins Phantasieren. Immer mächtiger brauste es aus ihm. Alle verließen das Sterbezimmer; sie ertrugen die Gewalt dieses Todes nicht. Er jauchzte und brummte und brüllte und sang; es war als ob ein vielstimmiger Chor ein Sanktus anstimmte. Dann wurde es stiller und stiller, die Kinder wagten sich wieder in die Stube. Nur noch sein Finger lebte, der eine Fuge auf die Decke klopfte. Dann zuckte die Hand noch einmal seltsam zurück und fiel dann schlaff zusammen. Keiner musste ihm die Augen zudrücken; er hatte sie schon vorher geschlossen.
BAKUNIN
„Ich bin dumm", sagte er mit erlöschender Stimme zu Reichel, der ihn besuchen kam. Er lag in einem kleinen hellen Zimmer in Hughs Krankenpension, wohin ihn sein Freund Vogt gebracht hatte. Viele waren nach Mattenhof gekommen, der Alte liebte Gesellschaft. Vogt und Hugh standen am Fenster, am Bette saß Dr. Robert Vogt, der Sohn des Professors, ferner Guiseppe Andrea, ein italienischer Schuster, und die beiden Krankenwärter Isenschmied und Lichtli. Bakunin lag, halb bekleidet, im Bett und litt unter einem ungeheuren Durst. Er konnte trinken, so viel er wollte. Hugh erlaubte ihm alles und der Alte wusste nur zu gut, dass dies die letzte Gnade war. Man diskutierte Fragen der Ethik, keiner sollte auf ihn besondere Rücksicht nehmen, er unterschied genau die einzelnen Sprecher. Er hatte in den letzten Tagen Schopenhauer gelesen und wollte eine Gegenschrift verfassen. Eine Ethik darf nicht vom Einzelnen ausgehen, eine Ethik muss von der Gemeinschaft ausgehen. Dieser Gedanke beschäftigte ihn, er stand in seinen Augen ausgezeichnet, wenn er sie fragte, ob es schon das Ende wäre. Alle sprachen mit ihm wie in früheren Tagen, als er noch unter ihnen auf und ab ging, dass der Boden knarrte unter seinen festen Stiefeln. Er riss wieder alle mit sich, die um das Bett des Sterbenden saßen. Als er aber plötzlich zusammenfuhr, wie von einem Schmerz zersägt, gingen sie leise, auf einen Wink Hughs. Ein Wärter saß in einer Ecke, sonst war er allein. Samstag, 1. Juli, viel Sonne im Zimmer. Im Halbschlaf war ihm, er stünde auf, marschierte durch sein ganzes Leben. Er schritt über die Fugen des Bodens und jede Fuge war eine Stadt. Eine Stadt, in der er ankam, die Glocke läutete, die zum Sturm rief, die Menschen führte, allein auf der Barrikade, allein in den Kerkern der ganzen Welt, allein, allein. Die Städte kamen und gingen in seiner Erinnerung, er kannte sie alle, liebte sie alle. Premuchino. Moskau. Petersburg, die ersten Schritte, die ersten Buchstaben, die ersten Prügel. Minsk. Twer. Wilna, erster Dienst, erstes Duell, erste Liebe. Berlin. Dresden. Wien, der Philosoph, der den Soldatenrock auszieht, der den Fürstentitel ablegt, der den Abschied nimmt. Bern. Genf. Zürich. Der Philosoph wird Revolutionär. Der Dreißigjährige spricht, arbeitet, lebt mit Herzen. Marx. Proudhon. Immer zwischen Brüssel. Köln und Paris. Und dann das Sturmjahr 48. Die Fieberjagd durch Europa. Wie eine lebende Brandfackel, wie eine rasende Glocke braust er durch die Welt. Wie ein Rasen ist dieser Wettlauf mit den brennenden Barrikaden. Jede Stadt grüßt ihn, jeder Stadt gehört sein Herz, in jeder Stadt entflammt es, erlöscht es aufs Neue. Paris. Frankfurt. Köln. Berlin. Breslau. Köthen. Leipzig. Prag. Dresden. Überall, wo Barrikaden wachsen, blüht, erblüht sein Herz. Das noch lebt, als die Asche der Trägheit wieder alles erstickt. Und dann, der Schritt wird endlich langsamer, stockender, schleppender, erinnerst Du dich noch, mein Herz, die Jahre der Haft, in den Zuchthäusern der Städte, die er vor Monaten durchflammte: Chemnitz. Dresden. Königstein. Prag. Olmütz. Petersburg. Daheim. Zum Tode verurteilt. Begnadigt. Sibirien. Zwölf Jahre in Fesseln. Der sich befreit, dem die Flucht gelingt, er ist ein Greis. Er ist der große Bakunin. Er ist leer, ausgebrannt. Noch ist die Asche, in der noch ein Funke glimmt, glühender als die Schlacken der Rechtsanwälte. Noch einmal quer durch den Kontinent, noch einmal: London. Brüssel. Paris. Der Süden lockt. Die Kälte freut ihn nicht mehr, der Süden wärmt den Erkaltenden. Florenz. Neapel. Locarno. Mailand. Genf. Zürich, der Kreis wird enger, schließt sich. Luft. Luft, er fällt, mitten im Wandern der Friede.
BALZAC
Die Fliegen quälten ihn, die Fliegen umgaben ihn, von dem Dunst, dem Gestank, dem Röcheln angezogen, und An, die Wärterin, seine Kinderfrau, uralt und vom Alter gekrümmt, konnte sie nicht verjagen. Die Fenster mussten geschlossen bleiben, drückende Augusthitze, er warf sich im Prunkbett hin und her und fand keinen Schlaf und keinen Tod. Ein paar Freunde kamen, sahen und gingen. Kamen wieder, alle Stunde einer, keiner hielt es in seiner Nähe aus, nur An blieb, nur An war um ihn, gab ihm zu trinken, legte die kühlen Tücher auf die fiebernde Stirn und scheuchte die Fliegen fort. Mittag. Stille. Die Hanka lag in einem Zimmer. Migräne, weinend, sie wagte sich nicht in das Zimmer des Röchelnden. Wenn er schrie, von Schmerzen gekrümmt, ging ein Beben durch sie, durchzuckte es sie wie ein Blitz. Er öffnete die Augen; die Kutte, bettelte sein Blick, die Alte holte die Mönchskutte, in der er schrieb, seit dreißig Jahren, ein Menschenalter lang, die weiße Kutte, getränkt in Schweiß, bewohnt von Motten, er legte sie sich aufs Gesicht, das kühlte. Aus den Löchern krochen die Motten. Herren und Damen, hunderte, tausende, seiner Geschöpfe, die er des nachts beschwor, dass sie aus den Winkeln seines Gehirns hervorschlüpften und aufs Papier marschierten und von dem Papier in die Ewigkeit. War er nicht ihr Sklave, der sie beschwor und gebar, in zehntausend schweren Nächten. War er nicht der Sklave des Monsieur Lovenjoul, der allmorgendlich erschien und das Manuskript nahm, raubte, stahl, entriss, das noch feucht war von Schweiß und Tränen? War er nicht der Sklave der Frau Hanka, jener ewigen Frau von dreißig Jahren, die nicht alterte und nicht starb. War er jemals frei. Nie. Nie! Er schrie es ins überheizte Zimmer, schrie es laut und weinend, dass An erschrak und die Fliegen und Motten auch. Und ein neuer Kampf flammte empor, aber er war schwach und bändigte nicht mehr die Gespenster der Nacht. Und erkannte nicht mehr die Freunde, die seine Blöße sahen und sich schämten in ihrer Ohnmacht. Aber die Nacht nahm kein Ende und am Ende stand das Nichts, „Licht“ schrie der Sterbende, und hundert Kerzen erhellten seinen Schlafsaal. Licht musste sein und die Augen sahen nur dunkle Schleier. Ganz nahe aber seinen Augen stand der Leuchter, in dem die beiden Kerzen brannten. Nacht um Nacht, wenn er die Welten erschuf. Nur ihr Licht sah er noch klar, nur ihr ängstliches Flackern. Langsam verging die Nacht, langsam erstarb das Herz. Mitten unter hundert Flammen lag er, und An durfte endlich das Fenster öffnen, dass die Fliegen und Motten fortflogen, und der nahende Morgen kühlte seine fiebernde Stirn. Draußen schrie die Hanka, ihre Stimme gellte in den Ohren der erschöpften Freunde, die nun stumm in den Winkeln des Hauses saßen und auf den Morgen warteten. Draußen schrie ein Vogel und der Mund des Toten blieb stumm und eng zusammengepresst. Aus den müden Augen Ans tropften die Tränen. Ihr großes Kind lag da und kein Leben war mehr in ihm. Da hüllte sie ihn ein in die weiße wollene Kutte und faltete seine Hände über Brust. Dann begann sie zu beten. Und ihre harte singende Stimme war bald der einzige Laut.
BAUDELAIRE
Alle Freunde hatten das Zimmer verlassen, nur die Mutier war noch da. Alle Fenster waren offen, aber der Sommer brachte ihm keine Erquickung. Noch nicht fünfzig Jahre alt und schon verbraucht, schon verbrannt. Eine Wunde war in ihm, wie ein Krebs fraß es seine Kräfte. Seit Jahren nur noch ein müdes Verlöschen. Seit Jahren hoffnungsloses Verströmen. Sein Leib war eine einzige Verwesung, aber sein Geist schuf die herrlichsten Gedichte. Er war einsam. Die Nacht liebte er. Samt und sterbende Blumen. Trank er blutroten Wein, dann strömte das gesunde Blut Christi in seinen verdorbenen Leib. Wie eine Wolke lag auf ihm ein Land. Land des Entsetzens und Land der Enttäuschung. Belgien, der Feind. Belgien, der Misthaufen, auf dem die Larven und Käfer des Leichenraubes krochen und sein Blut tranken. Betäubt, verzweifelt war er geflohen, begleitet vom Gelächter der Spießer. Aber Paris war nicht Rettung und Paradies, auch Paris war verwandelt, auch Paris war eine Hölle, es gab keine Rettung. Vom Bordell in die Kirche, von der Kirche in die Kneipe, hinter ihm Papiere, kreuz und quer die Zeilen neuer Gedichte, die Straßenjungen hoben sie auf und machten Schiffchen daraus, alles mündete in der Gosse. Noch sahen die Augen die Sterne. Mama ... Neben ihm saß die Mutter und betete. Er suchte ihre Hände, wollte sie berühren, streicheln. Aber die alte Frau hielt sie im Gebet geschlossen und Baudelaires weiße Hand fiel kraftlos zurück. Immer hatte er seine Hände ausgestreckt, immer seinen Leib, seinen Geist angeboten und verschenkt, man hatte ihn oft gebraucht, keiner hatte ihm gedankt. Zwischen Himmel und Hölle lag ein sterbender Mensch. Zwischen Himmel und Hölle war kein Platz für ein Bett, kein Raum für eine Erde, auf der man leiden konnte. Zwischen Himmel und Hölle flogen die großen Engel mit den dunklen Flügeln, und wer das Rauschen der schwarzen Flügel hörte, lag und starb. Er hatte keine Freunde gehabt und die Geliebten hatten ihn nie geliebt. Ein Stück seines Leibes, ein paar Perlen. Wein, ein paar Fetzen seiner verrückten Gedichte- So einsam war er, dass er das Beten seiner Mutter in sich trank wie die Musik eines tönenden Gottes. So schwach war er, dass ihm keine Blasphemie mehr einfiel, um sich über Gott zu mokieren. So ausgebrannt war er, dass in ihm keine Zeile eines Liedes mehr wohnte. So arm war er, dass in ihm nicht mehr Sehnsucht war nach Wein oder Haschisch. Er öffnete die Augen, er begann zu sehen, zu riechen. Es ekelte ihn vor seinem Sterben. Seine matten Augen suchten die Augen der Mutter. Sie hatte zu beten aufgehört und sah ihn an. Sie hatten sich nichts zu sagen. Sie war gekommen, um an seinem Lager zu beten, um dem Toten die Augen zuzudrücken. Sie waren einander fremd. Aus dem Auge des großen Sohnes gingen die Strahlen und suchten ein wenig Liebe, und ein großes Verzeihen. Aber aus den Augen der Mutter leuchtete keine Madonna. Da schloss er seine Augen und seufzte. Alles war fort, die Glocken von Montmartre, das Spatzengeschrei, die Glocke unten beim Krämer, das Summen der Fliegen und das Gebet der Mutter. Er wartete. Etwas musste doch kommen. Etwas. Ein Wunder. Es kam nichts. Es kam nichts. Das war das Ende. Ein wenig Knistern und ein verfliegender Rauch, so brannte ab eine Kerze.
BEETHOVEN
Ein verlassenes, verwahrlostes Zimmer. Die Fenster geschlossen. Dunst und Fliegen, von draußen Kindergeschrei, aus den Küchen Geruch. Im Bett sitzt, halb aufrecht, zwischen zerwühlten Kissen der Greis. Das Gesicht ist grau, verfallen, die Haare hängen wirr auf die Schultern. In einen zerrissenen Schlafrock gehüllt, liest er ein Buch, schleudert es manchmal fort und presst stöhnend seine Schläfen. Dann holt er sich das Buch, wieder und versucht weiterzulesen. Die Schmerzen, scheinen nachzulassen, er legt sich zurück und schläft ein. Sein letzter Gedanke ist: Er wird bald sterben. Er wird allein sterben. Karl, den Neffen, hat er fortgeschickt, den Arzt zu holen. Aber der ganze Tag ist vergangen und weder Karl noch ein Arzt sind gekommen. Die Nachbarn haben ihn vergessen. Die Köchin hat er fortgejagt. Er ist allein. Er schläft. Träume hat er keine. Aber ein tiefes D brummt in seinem Schädel und der Ton ist so stark, dass er ihn durch die Luft trägt. Immer höher, immer weiter. Ferne sind Menschen. Ferne die Tiere. Ferne Wiesen und Wälder. Er ist allein. Er und sein Ton, den er schuf und der ihn jetzt in den Himmel trägt. Und wie die Erde schon weit ist wie ein Stern — da kommen zu dem tiefen ,,D“ noch zwei andere Töne, „D‘‘-moll, der Akkord wird angeschlagen und Beethoven lächelt trotz der Schmerzen, die wieder wachsen. D-moll, das war sein letztes Werk, es ist abgeschlossen. Er kann sterben. Er kann ruhen. Und mit diesem Lächeln erwacht er. Das Zimmer ist voll Menschen. Ein Arzt ist da; Hummel. Schindler. Wolf. Sie haben Wein gebracht und er darf trinken. Trinken. Ahhh. Das tat wohl. Er sinkt zurück. Nun kommt der Arzt. Er behorcht die Brust. Beklopft, betastet den Leib. Der Bauch schmerzt. Der Arzt lächelt ihn an. „Aus??“ fragt er ihn. Und dieses Wort, schwer aus der Tiefe des Leibes herausgeröchelt, erklingt so gewaltig, so zwingend, dass der Arzt, er kennt ihn nicht, lächelnd bejaht. Die Freunde sehen zum Fenster hinaus. Einer schnäuzt sich etwas zu laut. Der Arzt ist gegangen. Einer geht. Arzneien besorgen, die andern winkt er heran und zeigt ihnen in einem von Händels Werken Stellen, die ihn aufs Tiefste beglücken. Die andern verstehen die Stellen, sind ganz Feuer und Flamme bei diesem stummen Musizieren. Einmal schaut er fragend auf: „Karl??“ Da holt einer einen anderen Band und er weiß alles. Es ist dunkel geworden, man holt Kerzen. Dann teilen sie sich die Nachtwache ein; er darf trinken, so viel er will. Und er muss nicht allein sein. Die Nacht vergeht. Er verliert das Bewusstsein. Schreit, deliriert, singt. Singt, schwer, dumpf. Töne, die noch keiner hörte. Am Vormittag kommt der Arzt, bleibt gleich da, die Freunde kommen allmählich alle. Ein Gewitter zieht auf, es wird finster, man holt Kerzen. Er erkennt nicht mehr das Licht. Er will aus dem Bett. Man überwältigt ihn. Er kämpft, kämpft, kämpft, droht mit Fäusten, brüllt, die Adern wollen springen, ein Ruck, er ist frei, er fällt zurück, ist tot. Das Gewitter vergeht. Einer löscht die Kerzen. Drückt die Augen zu. Sie halten Totenwacht.
BISMARCK
Er saß auf einem Baumstamm im Wald und sonnte sich. In der Frühe hatte er mit dem Enkel gespielt, der Säugling hatte ihn mit seinen großen Augen lange angesehen. Die Doggen hatten derweil im Hofe gespielt, an die Wiege des Kindes durften sie nicht heran. Jetzt hatten sie ihren Herrn für sich allein. Sie bewachten sein Träumen, der da schweigend vor ihnen saß und mit seinem Stock in dem Boden Figuren zog. Hohe Eichen. Stamm an Stamm, nur eine kleine Lichtung, in der der Dreiundachtzigjährige saß. Herzog von Lauenburg und Herr des Sachsenwaldes. Ein weicher Hut deckte die Glatze, nahm dem mächtigen Schädel die Luft. Den Hals umfloss ein weiches weißes Tuch. Die Joppe war offen, die Stiefel reichten bis an die Knie. Er wollte keine Menschen sehn, seitdem Johanna tot war, seitdem sie ihn, vor vier Jahren, verließ. Nicht Herbert, den Sohn, nicht Marie, nicht Wilhelm, nicht Johann, den Diener. Nur Otto, dem Säugling, sah er gern in die ernsten Augen und seinen Doggen kraute er gerne den Kopf. Müde. Gelebt. Geliebt. Gehasst. Müde. Nur das eine: Viel Sonne. Unnütz. Alles war gesagt und alles war geschrieben. Verwahrt. Er hatte sein Haus bestellt. Mochten andere die Siegel lösen. Müde. Wie leicht fallen die Augen zu. Durch das Niederholz kriecht ein Mensch, langsam, schwer. Auf seiner Spur Blut, zwischen Nadeln versickernd. Ein Soldat. Stille. Einsamkeit. Er bemerkt den Alten nicht. Er kriecht langsam an ihm vorbei. Ein Windstoß zerreißt die Stille. Ferne Kanonen. Gewehrknattern. Brüllen. Wie verflogen wieder, vorbei. Der verwundete Soldat ist noch da. Die Hunde sind ganz still. Er träumt also. Unendlich langsam kriecht der Sterbende durch den Wald. Ein Menschenalter weit ist der Weg von der Juliglut von Königgrätz zu der Juliglut dieser Schonung im Sachsenwald. Er schlägt die Augen auf. Der Soldat ist fort. An seinen Knien reiben sich die Hunde. Er streichelt sie. Nein, er ist nicht gekrochen, er ist nicht verwundet, er ist nicht gestorben, nicht bei Königgrätz und nicht bei Gravelotte. Auf silbernem Schimmel ragte der riesige Kürassier. Neben ihm hing welk und stumpf sein „Herr“, die bärtige Puppe. Er hob den Kopf hoch, hoch, aber die Eichen waren überall über ihm. Er senkte den Kopf und der Helm drückte ihn schwer, schwer. Müde, den kalten Händen entgleitet der Stock. Mag er liegen bleiben. Er möchte jetzt liegen. Bis über die Ohren die rote Daunendecke. Im Kamin Feuer. An seinem Bette Johanna. Sie liest den Faust. Wie Helena unter die Menschen tritt, bewundert viel und viel gescholten. Und er kann schlafen, schlafen, langsam einschlafen, langsam verdämmern. Ist Sterben schwer? Schwer im Alter Goethes und Kants. Wie einsam waren die, ihnen war nicht einmal die Schönheit und Kraft seiner Rüden. Herrgott, wie einsam ist der Mensch. Er hatte es weiter gebracht als der Minister Goethe, als der Professor Kant. Herzog war er, und reckte sich empor. Herzog und Herr des Sachsenwalds. Irgendwo saß ein neidischer verkrüppelter Zwerg und platzte vor Galle. Sollte er platzen. Irgendwo moderten die Tausende, die er in den Tod gehetzt. Für „Deutschland“. Mochten sie modern. Noch lebte er. Noch lebe ich. Noch atme ich Licht und noch trinke ich Licht. Noch sehe ich Cäsar und die Eiche, die stehen wird über meinem Grab. Aber jetzt kam er. Der kroch nicht. Der kam leicht und schnell, durch die Stämme hindurch. Die Hunde merkten ihn nicht. Cäsar .... Lächelnd sah er ihn an, legte ihm die Hand auf die Schulter. Langsam sank er um.
BLANQUI
Irgendwo wurde geschossen. Der Sterbende riss die Augen auf. Ach, er hatte geträumt. Paris, in dem sein Sterbebett stand, blieb ruhig. Blieb ruhig, wie es zehn Jahre lang ruhig geblieben war. Er hatte immer bereit gestanden, er hatte immer gewartet, auf den Tag, an dem sie wieder, wie anno 30, wie anno 48, wie anno 71. Barrikaden errichten würden. Wo Männer, von Pulver geschwärzt, mit der Flinte in der Hand kämpften, kämpften gegen das Gesindel des Bürgerkönigs, gegen die Scharen dieses Bonaparte. Er öffnete weit die Augen. Da drüben, woher die klaren Töne durch den Wintermorgen zu ihm drangen, lag Denis, das Arbeiterviertel. Auf dem Montmartre hatten sie geblutet und auf dem Pere Lachaise lagen sie begraben. Er lag noch nicht neben ihnen, aber bald wird er ihnen Gesellschaft leisten. Er versank wieder in einen leichten Schlummer. Die Nächsten seiner Umgebung, die sein Sterben bewachten, ließen ihn in Frieden und gingen ihren Geschäften nach. Er aber. Louis Blanqui, stand wieder auf der Barrikade. Jean, wir müssen zurück, bis zum nächsten Eck, sonst wird uns der Rückzug abgeschnitten. Merde. Kamerad, wir bleiben da. Louis hat uns hierhergestellt und wir bleiben hier, bis wir Umfallen. Da kommt er. Louis. Louis, vive Louis, vive le duc. Kameraden, es steht schlecht. Wir müssen räumen. Wir müssen uns zurückziehen. Sie kommen von allen Seiten. Sie schießen mit Kartätschen, sie werden das ganze Straßenviertel niederlegen. Schieße Kamerad. Mach Dir nichts draus. Wir werden es umso besser wieder aufbauen. Wer befiehlt hier? Du. Louis. Also, muss ich erst befehlen? Wir müssen räumen. Kameraden. Peng. Einer fällt. Peng, noch einer. Sie haben sich auf uns eingeschossen. Los. Leute. Barrikaden geräumt. In die Häuser rein, an den Häusern entlang. Rue Rivoli nächster Treffpunkt. Sie verschwinden. Ich stehe allein. Neben mir die eroberte Mitrailleuse. Sie sollen sie nicht haben, die wir ihnen nahmen. Er nimmt das Verschlussstück heraus, schlägt es entzwei. Die Kugeln kommen dichter. Verdammt, das ging gerade noch am Arm vorbei. Ist alles in Ordnung? Alles in Ordnung. Wo die Kartätschen wüten, quatscht Louis noch von Ordnung. Er geht, er läuft im Schatten der Bäume durch die menschenleere Gasse. Vorne sind sie schon an der Barrikade. Um die Ecke. Gerettet. Irgendwo gellen Schüsse. Irgendwo wird getötet. Irgendwo fallen Genossen. Rächt sie. Genossen! Nicht verzagt. Kameraden! Nicht ermüdet. Kollegen. Einmal im Jahrhundert steigen wir auf die Bretter, einmal rufen wir die Menschen auf, einmal sind wir Herren der Stadt. Einmal. Wir werden unser Leben teuer verkaufen! Wir werden es ihnen schon zeigen. Ahhh! Epate les bourgeois. Eine Kugel zerfetzt ihm die Bluse. Weg. Biest. Er wirft den Querschläger fort. Er rennt, bis er den Atem verliert. Er ist wieder bei den Genossen. Ein mächtiger Krach, eine Rauchsäule. Gut gewühlt. Louis. Das Geschrei der Reiter. Die Flüche. Trompeten. Glockenläuten. Glockenläuten. Notre dame. Notre dame la revolution. Es ist ganz still wieder geworden. Er schlägt wieder die Augen auf. Er ruft die Freunde. Marie. Pierre. Jean. Sie kommen, leise, besorgt, er fasst ihre Hand. Sagt den Genossen, dass ich bei ihnen war in der Stunde des Todes. Dass ich bei ihnen bleibe, im Leben, im Sterben, ihr. Euer Louis Blanqui. Sie wagen nicht, seine Hand loszulassen, die feste harte Proletenfaust, die langsam, ganz langsam erkaltet.
BÖRNE
Er saß am Schreibtisch und schrieb. Er schrieb einen seiner Briefe aus Paris, die für Deutschland bestimmt waren und die auch in Deutschland eine größere Wirkung hatten als in der Stadt seiner Wahl. Langsam hatte er sich mit allen verfeindet, man vertrug seinen Spott nicht. Heine, der einzige, mit dem er sich hätte verstehen können, war schon längst wütend geworden. Er war einsam. Seine größte Lust war das geschriebene Wort. Hier war er ein König. Hier war er unbesiegbar. Aber er schrieb ja nicht für den Ruhm. Und er schrieb nicht, um zu siegen. Er schrieb, um die Wahrheit zu sagen. In einer Zeit, wo es noch Monarchen gab. Polizei und Zensoren, in dieser Zeit gab es keine Freiheit des Einzelnen. Aber es gab auch keine Freiheit des Einzelnen in der Gemeinschaft. Man musste Geduld haben und warten können. Börne hatte diese Geduld. Er arbeitete nicht für sich. Er arbeitete für die Zukunft, für die Jugend, für das junge Deutschland. Und der es am meisten bedroht hatte, war seit fünf Jahren tot. Goethe. Goethe, der gigantische Spießer, dessen Riesenerscheinung die Entwicklung der Zeit aufhalten wollte. Dessen friderizianischer aufgeklärter Absolutismus vielleicht ins 18, aber nicht mehr ins 19. Jahrhundert gehörte. Goethe war tot, aber die Goetheaffen lebten weiter. Sie werden auch mich überleben. Geben wir dem jungen Deutschland Waffen. Waffen für das Gehirn und Waffen für die Faust. 1830 die Pariser Julirevolution war ein Spaß, ein Lustspiel; es wird eine Revolution kommen, des Geistes und der Hand, die keine lächerliche Angelegenheit sein wird. Sagen wir den jungen Leuten, die sie erleben werden, dass es dann auf mehr ankommen wird als auf schöne Reden und schöne Broschüren. Sagt ihnen, dass es Kräfte geben wird, die wir schon jetzt, in der Juli-Revolte, festgestellt haben. Sie werden berufen sein, die Revolution zu führen, vorwärts zu treiben, ihr ein Ziel zu weisen. Die Arbeiter werden diese Aufgabe haben, meine Herren Schriftsteller, meine Herren Dichter, die schlesischen Weber meines Kollegen Heine. Die werden das letzte Wort haben. Schade, dass ich es nicht mehr erleben kann. In jedem Brief, den ich nach Deutschland sende, möchte ich es schreiben, möchte ich es unterstreichen, nicht Ihr. Ihr jungen Deutschen allein, auch nicht Ihr, junge Franzosen. Italiener, Österreicher. Russen; die ganze Jugend, das ganze Europa muss es sein. Hätte ich doch nur Kraft, es noch einmal laut und klar zu sagen. Aber es wird dunkel und ich muss wohl gehen. Ich hätte es noch gerne erlebt. Die Geburt des jungen Europas. Nicht der Verstand, nicht der Witz, nicht die scharfe Feder, nein; ein treues Herz taugt mehr. Und eine feste starke Hand. Ein Wille, der die beiden eint. Er bekam keine Luft. Das Herz setzte aus, er sank halb vom Stuhl, blieb so liegen. Ein Bekannter, der ihn zufällig aufsuchte, fand ihn so, man konnte nicht einmal die Stunde seines Todes feststellen. Der Tote lächelte ganz fein, ein wenig spöttisch, die Augen waren geschlossen.





























