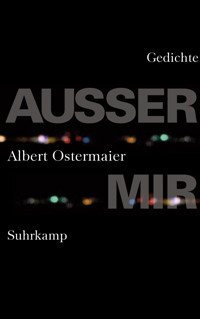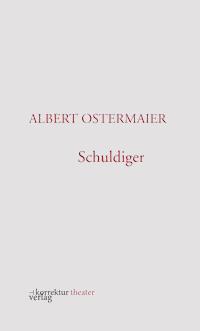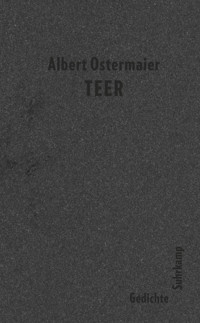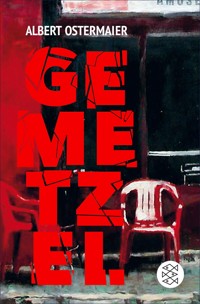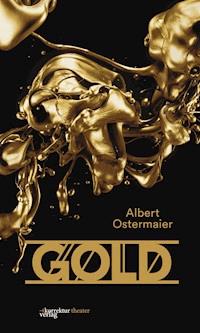Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Matthes & Seitz Berlin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Vor fünfzig Jahren wurde Pier Paolo Pasolini im römischen Ostia brutal ermordet. Das Verbrechen wurde nie aufgeklärt, und man spekulierte über seinen Tod mehr als über das, was er an unvergleichbaren Filmen, Büchern, Stücken, Zeichnungen, Pamphleten und Prophezeiungen hinterließ. Für Albert Ostermaier aber stehen, seit er selbst als Dichter zu schreiben begann, Pasolini und sein Werk gleich einem Fixstern über allem. Ihnen setzt er mit seinem Roman mit Pasolini nun ein leidenschaftliches Denkmal, indem er an Pasolinis Beschwörung der Poesie, an die nachgelassenen 112 Sonette, Hilfeschreie eines von seinem »Lebensmensch« Ninetto Davoli Verlassenen, anknüpft. Ostermaier bezieht sich dabei auf die zweisprachige Ausgabe der Sonette, Ein Unfall im Kosmos (2023 erschienen im Verlag Klaus Wagenbach), erstmals überhaupt ediert und übersetzt von Theresia Prammer. Gleich Pasolini geht Ostermaier dabei über die Grenzen – dem einen wie dem anderen ist alles Private politisch und alles Politische privat. In seiner empathischen Anverwandlung der Sonette Pasolinis und auf den Spuren dessen rätselhafter Ermordung zieht Albert Ostermaier alle Sprachregister und erfährt so in einer schonungslosen autobiografischen Selbsterkundung über sich, was er ohne Pasolini nie erfahren hätte: Die Liebe geht weiter.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 196
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
„And I need all the
Love I can get
And I need all the
Love that I can't
Get too“
Sisters Of Mercy, More
„Nothing left of all I loved
It all feels wrong“
The Cure, Endsong
„Ich weiß sehr wohl, wie widersprüchlich man sein muss, um wirklich konsequent zu sein.“
Pier Paolo Pasolini
Inhalt
Cover
Titel
Die Liebe geht weiter
Nimm deine Hände von mir, nimm deine Worte zurück. Fass mich nicht mehr an. Ruf mich nicht an. Schreib mir nicht mehr. Lauere mir nicht auf mit deinen Sätzen. Steh nicht vor meiner Tür. Brich nicht das Schloss vor meinem Herzen. Tritt mir nicht die Brust ein. Pack mich nicht. Zieh mich nicht an den Haaren durch dein Leben. Schrei mich nicht an. Sag mir nicht, was ich tun soll. Führ mich nicht vor, ich bin keine Trophäe. Komm mir nicht zu nah. Du bist schon zu nah. Du tust mir weh, lass das. Beiß in deine Faust. Betrink dich. Heul doch. Such dir einen Stricher. Schreib Gedichte. Schlag alles kurz und klein. Aber schlag nicht mich, nicht noch ein einziges Mal. Sonst schlag ich zurück. Und ich schlage nicht mit meinen Fäusten. Ich habe Fäuste, die für mich schlagen. Vielleicht ist auch mein Herz eine Faust. Die Faust in deinem Gesicht. Du hast mich überfahren. Jetzt überfahre ich dich.
Ostia im Regen. Natürlich muss es regnen, wenn ich komme. Nur Sonnentage zuvor, nur Sonnentage danach. Ein Winter, der sich wie ein Sommer anfühlen könnte. Vielleicht sogar mit diesem unwirklichen Blau in den Wellen, als würde der Himmel in ihnen baden und sich in ihrem Schaum überschlagen. Aber ich habe auf das Grau gehofft, die Unwirtlichkeit, die Unwirklichkeit, die die Zeit ausradiert, ein Grau für die erbarmungslose Gleichzeitigkeit der fehlenden Hoffnung in den Schatten der Mietskasernen. Das Aufblitzen der Sinnlichkeit, der Sommerwind auf der Haut, die Disteln im Rücken, die schnellen Nummern im Auto, während das Meer mit seinen Wellen stöhnt, sie gegen die Küste wirft. Der Ölfilm auf dem Wasser, die ewigen Möwen mit dem Klagen der Götter in ihrem Schreien.
Ostia im Regen ist wie ein Tarkowski-Film ohne Mystik: Brachflächen, Autowerkstätten, vergessene Parkplätze, schmutzige Strände mit wütend erschöpften Wellenkämmen. Wo er erschlagen wurde, wächst jetzt Gras drüber, ein Park. Es fühlt sich alles falsch an, als dürftest du nichts nachempfinden, keine Spuren, nicht der Gewalt, nicht des Todes, nicht des Lebens. Wucherndes Grün, ungepflegt, mit einem versteckten Trampelpfad, zu uneinsehbaren Ecken, wo sich vielleicht Männer lieben als Hommage an Pasolini, überall die falsch verstandene Liebe, der Übergriff, die Vereinnahmung.
Hier, an diesem trostlosen Ort, ist nichts spürbar, er lässt kalt. Das offene Gitter, die Masten der Segelschiffe, von denen außer ihnen nichts sichtbar ist. Ein phallisches Stakkato. Ein Nichtort als Tatort.
War es nicht ein Fußballfeld, ein Ascheplatz, zumindest eine Brache, wo sie gespielt haben, wo auch er gespielt hat. Warum hat man nicht einen Fußballplatz als Denkmal für ihn gebaut, zwei Tore mit Netzen im Wind. Mit Grasnarben. Warum nicht Bälle an die Kinder verschenkt mit seinem Gesicht. Stattdessen diese verquer verschlungene Skulptur, seine drei Ps am Boden, ein ausgedorrter Kranz, vertrocknete Rosen. Darunter das Gras. Der Schauplatz des Mordes als Naturschutzpark. Er war schon angekündigt auf Schildern mit römischen, gestürzten Säulen, wie sie auf allen Hinweisen zu Ausgrabungsstätten oder archäologischen Orten zu sehen sind. Sein Name auf diesen Schildern, irritierend, belustigend, aber auch beängstigend.
Ist er nur mehr Geschichte, römische Geschichte, ein Haufen Stein gewordene Literatur? Ich hatte mir alles schmutziger vorgestellt, verwahrlost. Ein paar Hundert Meter weiter an einem Strand finde ich die Stimmung, die ich mir erwartet hatte. Diese Mischung aus Meer und Verzweiflung, aus Armut und Sonne. Und wenn sie fehlt, bleibt nichts außer dem Grau und den Schornsteinen im Nebel, dem Blei im Himmel. Alles menschenleer, und dann plötzlich treten sie aus den Schatten, Blicke, befremdet, verwundert, aber sofort zurück im Alltag.
Wir fahren zurück im Regen. Bremslichter, Autobahnausfahrten, das alte Ostia wie ein Paradies am Wegesrand, beschattet von Prätorianer-Pinien. Schattenschön. Weiter bis in die Stadt. Das Lokal, in dem er kurz vor seinem Tod war, geschlossen, dunkel, die Gitter rostend. Die großen Buchstaben über dem Eingang. Es ist ein gefährlicher Ort geworden, hat er gesagt. Was ist gefährlicher als das Vergessen, das Vergessenwerden?
Ödipus wird seinen Vater töten, unausweichlich. Das Orakel sagt: Du wirst ihn töten. Du wirst mit deiner Mutter schlafen. Ich musste im Ehebett meiner Eltern zwischen meiner Mutter und meinem Vater schlafen. In der Mitte, der Ritze, wie mein Vater sagte. In der Falle. In dem Spalt, der sich nicht auftat wie die Erde, als ich wünschte, sie solle mich verschlucken. Aber sie tat es nicht.
Pasolini weiß: Sie werden mich töten, unausweichlich. Der Tod hat seinen Weg zu mir begonnen, ist nicht aufzuhalten. Das Gift ist im Blut. Die Blutschande. Er hat noch Fußball gespielt mit den Jungs auf der Asche, zwischen den Steinen. Seine Henkersmahlzeit eine Zigarette, ein Zug Glut. Als zöge er sein Herz ein. Als wäre es Asche danach und zerfallen.
Hier lieg ich von der Liebe erschlagen, schrieb John Donne. Und es war kein Regentropfen, der ihn erschlug.
Hat Pasolini den Tod gesucht, weil er die Liebe nicht mehr fand außer in seiner Sprache? Was war das letzte Bild vor seinen Augen? Ein Kopf voller Locken. Das Haupt der Medusa. Wo er starb und lag, steht heute ein Stein.
Ich schreibe einen Roman mit Pasolini, eine Geschichte mit seinen Geschichten. Er erzählt mir etwas über mich und ich erzähle ihm von mir, was er nicht mehr lesen kann. Unser Geheimnis, das wir teilen. Eine gefährliche Liebschaft mit einem Toten, der für mich lebendig wird. Wir sind in Gefahr – einer seiner letzten Sätze. Er hatte und hat wieder recht: Jeder kann der Nächste sein.
Flaubert nannte die wilden Träume seiner Bovary „romans“. Wenn es schwierig wird zwischen den Liebenden, alles sich verstrickt um die Schwanenhälse, nennt es auch Proust: „roman“.
Während des Schreibens hatten unsere Worte eine Affäre. Ich habe nicht gefragt, wie auch er nicht gefragt hat, habe mir genommen, was ich mir nehmen wollte. Als hätte ich nichts zu verlieren, wurde mir immer klarer, was ich verloren habe und was ich wiedergewinnen wollte. Das Kind wollte wieder Kind sein, aber nicht das Kind, das es unter den Händen der anderen war. Der Junge wollte in die Welt, die offenlag, doch ich verschlossen in meinem Zimmer. Den Schlüssel in der Faust, ich fand ihn nicht.
Ich rannte dem Ball nicht hinterher, ich stand zwischen den Pfosten und träumte davon, Tore zu schießen am anderen Ende des Platzes.
Ich musste wie er mit dem Daumen das Kreuz aus Asche auf meine Stirn malen, und verwischte es im nächsten Augenblick, eine Kriegsbemalung gegen den Feind, den ich noch nicht benennen konnte.
Seit ich ein junger Mann war, trug ich nur noch schwarz. Meine zweite Haut. Die Lederjacke. Die ich mir lieh von Brecht, von Fassbinder. Ich las Pasolinis Tod wie ein Gedicht.
Bücher sind Briefe. Ich habe sie mit dem Messer geöffnet, an den Seiten mich geschnitten. Mit diesem Buch schreibe ich ihm zurück.
Komm mir nicht zu nah, wenn ich deine Nähe suche. Wenn ich mit dir sprechen will, die Zunge in deinem Mund, verbissen in jedes Wort, das dir über die Lippen kommt. Was mir dein Körper sagt, ist Antwort genug. Nur in seiner Sprache will ich mit dir sprechen, hören, was deine Haut mir erzählt. Dein Schweiß, wenn ich mit den Fingern durch ihn streiche und sinnlose Zeilen ziehe, darauf doch nur ein Satz stehen könnte, den ich nicht aussprechen will. Wenn wir schweigen, bis auf unseren Atem, kann ich bei dir liegen und bleiben. Für den Moment. Vielleicht auch für den nächsten.
Er ist der Verlassene. Er ist von der Liebe verlassen, von allen guten Geistern, die jetzt Schatten sind, die seinen Blick verschatten. Der Bildausschnitt der Kamera zwischen seinen Fingern fingiert. Die Kamera, sein Auge. Er schießt ein Bild nach dem anderen. Er hat sie im Kasten, die Schatten. Und zwischen den Schatten liegt ein Lachen begraben. Jedes Wort schreit: Komm zurück, komm zu mir zurück. Ich war mit dir, ich war nie bei dir. Komm zurück. Du hast doch, was ich bin, was ich für dich bin, antwortet er. Er hat recht: Die Erinnerung hat mich nicht verlassen. Nur seine Hülle ist gegangen. Ja, mein Geliebter, du bist noch da. Selbst jetzt lässt du ihn nicht frei. Sperrst ihn ein in deinen Gedichten. Du verbietest ihm den Mund. Du knebelst ihn. Überschreibst ihn mit deiner Wahrheit.
Du fühlst dich allein. Soll mich das berühren, umstimmen? Ich war immer allein mit dir. Ist das wahr? Könnte ich es dir ins Gesicht sagen. Und gehen. Ich bin dankbar. Ist es nicht schlimmer, dir zu sagen, ich sei dankbar, als zu sagen, ich liebe eine Frau? Aber du musst nicht gehen, wenn du sie liebst. Du liebst sie doch nicht. Es ist die Kirche, es sind deine Eltern, der Kapitalismus, die dir sagen, du kannst nicht mit mir leben als Mann. Bleib bei mir als Frau. Nein, meine Frau ist keine Nebenfrau. Ich trete aus deinem Harem aus. Ich bin keiner mehr der Jungen. Ich bin kein Strichjunge, ich zieh dir keine Zeilen mehr. Ich bin durchgestrichen für dich. Aber bleibt nicht, dass ich dich geliebt habe? So wie ich dich lieben konnte.
Soll ich sagen als Freund? Soll ich Vater zu dir sagen? Willst du mit mir als mein Vater schlafen, weil ich mit meiner Mutter schlafen will? Nicht du bist Ödipus. Ich bin es. Und deshalb muss ich dich erschlagen. Ist es das, was du denkst?
Was macht seine Hand auf meiner? Oder habe ich sie in meine genommen. Die Hände auf der weißen Tischdecke. Auf meinem Blatt zwei Worte, die sich berühren möchten. Wollte ich das? Will ich das? Ein Unfall? Ein Umfallen? Ich liebe doch Frauen. Liebt er mich deshalb, weil ich Frauen liebe? Weil ich nicht zu bekommen bin und er bekommt mich, der Jäger die unerreichbare Beute. Er beobachtete seinen Speer beim Flug. Ich renne, renne davon. Aber er trifft mich. Trifft er mich? Im Rücken die Wunde. Im Rücken der Vater.
Ich stelle mir vor, wir würden uns als zwei Romanfiguren in einem der Höllenkreise begegnen, wo unsere Wirklichkeiten und Welten sich treffen, überschneiden, wir in Echoschleifen sehen, was war, kommen wird, zu kommen droht. Warum in der Hölle? Weil der Himmel kein Ort für uns wäre, es in der heiligen Helle keine Schatten gäbe, in deren Schutz wir verschwinden könnten. Weil es nicht diesen Raum zwischen den Zeilen gibt, der unser Raum ist.
Als du umgebracht wurdest, war ich kurz vor meinem achten Geburtstag. Damals fiel noch Schnee um diese Jahreszeit. Sicherlich zwang mich meine Mutter, diese roten Strumpfhosen zu tragen, bevor ich raus durfte, aus der Tür zu den Toren rennen, wo wir Fußball spielten, bis es dunkel war und wir bis auf die Haut durchnässt, schwitzend vor Kälte.
Wärst du ein Spieler gewesen, ich hätte dich nachgespielt, hätte mir mit dem Filzstift Pasolini auf meinen Rücken geschrieben und wäre über die Flügel gestürmt, hätte Spuren durch den Schneematsch gezogen, über das weiße Papier der Kinder, in das wir unsere Sehnsüchte als Laufwege schrieben mit glühenden Wangen und erfrorenen Füßen.
Der November war und ist immer ein dunkler Monat. Der Monat der Geister, Gespenster und unerlösten Seelen. Wenn die Kälte sich noch nicht in Schönheit verwandelt hat, wenn unter der Haut noch die Herbstsonne das Glück der sprühenden Farben erinnert. Der November ist der Monat des Todes, er beginnt mit Allerheiligen, den Gräbergängen, dem Rosenkranzbeten auf den Knien in den engen Bänken unter dem Singsang der alten Weiber, die der Sommer längst verlassen hat. Die Gebete, die dich durch die Mühle ziehen. Die strafenden Blicke, die prüfenden Augen, die ernsten Mienen, die falsche Frömmigkeit. Nur als Ministrant war Allerheiligen erträglich, den Weihrauchkessel schwenkend, im Schatten des Priesters auf dem Weg über die Friedhöfe, aus denen die Toten auferstanden sein sollen und ihre Knochen zurückließen unter den Grabsteinen, den Blumenkränzen. Der Schönheitswettbewerb der Gräber, der Laufsteg der Untoten. Die Angehörigen unter der Erde. Niemand gehörte mir an. Während ich im Treppenhaus meiner Großmutter mit meinem Onkel in meinem unerträglichen Kratzsamtanzug Fußball spielte, gabst du dein letztes Interview und sprachst von der Gefahr. Da leerten meine Verwandten die Flaschen, den Schnaps, schoben sich den Schinken zwischen die Lippen, da türmten sich die Tortenstücke, das große Fressen zu Ehren der Verstorbenen, an die sich keiner erinnerte. Die Tanten, die wie Shakespeares Hexen mit aufgesteckten Haaren die Zukunft orakelten und sich dabei widersprachen und einander ins Wort fielen. Der Tag der Toten, die ich nicht kannte, den Tod noch kaum kannte, nur die Rituale, die Särge, Trauerzüge, die Tränentrommelfeuer. Die bewegten Worte des Priesters, die erstickten Stimmen und das Schnitzel beim Leichenschmaus an der langen, endlosen Tafel der großen Säle der Gastwirtschaften. Die Ecken, in denen wir heimlich einen Zug der Zigaretten oder Zigarren nahmen, wie wir heimlich vom Messwein getrunken haben.
Der Tod war kein wirklicher Schrecken, nach Allerheiligen fing der Fasching an, aber manche verstellten sich schon an diesem Tag, als trügen sie Masken.
Warst du am folgenden Tag, an Allerseelen, abends in den Nachrichten? Dein Bild auf dem Fernsehschirm, dein Name im Radio. Der italienische Filmregisseur und Schriftsteller Pasolini ermordet in Ostia? Ich hätte deinen Namen nie vergessen.
Wir konnten uns nie begegnen, aber der Pasolini, den ich mir ausdenke, und ich, wir treffen uns wie zwei Tangenten im Unendlichen.
In der prallen Sonne steht der erste Satz. „Es war der heißeste Sommer seit langem.“ Dein Herz schlägt, es haut dich um. Die Gewalt der Liebe. Nimmt dir den Atem. Atemlos. Sans souffle. Vita Violenta. Amore Violenta. Die Liebe bricht alle Regeln, überschreitet alle Grenzen, nimmt von dir Besitz. Du bist besessen von ihr. Sie schmerzt. Dein Herz blutet. Du bist gefesselt und lässt dich fesseln. Liebe ist Freiheit. Wenn du liebst, verlierst du sie. Ich würde mein Leben für dich geben. Liebe kälter als der Tod. Es beginnt mit Hitze. Die Hitze steigt dir zum Herzen. Sonne ohne Schatten.
Es ist Sommer. Es war ein sehr heißer Tag im Juli. Zum ersten Mal der Lockenkopf. Ein Junge, gemacht aus Leben, vom Leben gemacht, von der Straße, auf der Straße. Am Ende 112 Sonette über die verlorene Liebe. Weil er, Pasolini, sich verlassen fühlt, zurückgelassen mit seiner Liebe. Nicht weiß, wohin damit. Weil sein Lockenkopf eine Frau liebt. Doppelte Kränkung. Liebeskrank schreibt er Gedichte. Als könnten sie ihn zurückgewinnen. Als läge die Wahrheit im Gedicht. Weil er im Gedicht ihn noch hat, weil er im Gedicht ihm gehört, weil er ihn in seine Kreuzreime zwingt, im Gedicht mit ihm klingt. Weil er ihn berühren kann, weil er sich im erinnernden Schreiben lebendig fühlt, weil plötzlich nichts vergangen ist und der Schmerz im Wort Lust bereitet. Weil er ihn überwältigt. Mit seinen Sätzen. Weil er sich überwältigt fühlt von seiner Sprache. Liebt er ihn noch? Oder liebt er nur mehr die Sprache allein und hat sie immer schon mehr als alles andere geliebt wie das Sprechen über sich.
Bertolucci war einer der Träger von Pasolinis Sarg. Er trug ihn zu Grabe, in der Hoffnung, dass er aufersteht. Dass er aus dem Grab aufsteht. Wie ein Rächer, wie in einem der Italo-Western. Ein Western voller lebender Toten, Zombies und mittendrin Pasolini, wie ein Erzengel auf Koks, mit dem Schwert, das alles einschlagen wird für das Reich des Pier Paolo, in dem die Liebe frei ist, die Armen reich, die Reichen arm sind, die Köpfe im Nadelöhr stecken. Ein Reich Gottes, verheißungsvoll wie der Rasen nach dem Regen, ein Reich, in dem es mehr Fußballplätze als Gefängnisse gibt.
Aber wo sind die Frauen? Wo ist Patrizia, meine Ehefrau, fragt sich Ninetto, die ewige Jugend, und sucht sie, aber jeder Gang in dem Rosenstrauchlabyrinth führt zu Pasolini, jeder Irrweg auf den rechten Weg, hinter jeder Ecke wartet er, die Versprechung, die Erlösung, während der Messias durch Mestre irrt und keiner ihn erkennt.
Bertolucci war der größte der Sargträger. Er hatte das Gefühl, er trage den Sarg allein. Wie schief Pasolini in seinem Sarg dort zwischen den vier Männern hing. Wie viel lieber hätte er es gehabt, dass sie ihn wie nach einem Sieg in die Luft werfen, statt an Seilen in die Tiefe der Erde zu lassen, wo er verfaulen wird, alle Schönheit verfallen zu Staub. Und seine Seele? Was passiert mit seiner Seele? Sie ist die Luft in einem Ball. Und da ist ein kleiner Junge, er nimmt Anlauf und schießt ihn weit über die Mauer in den Himmel. Bis du die Scheibe klirren hörst.
Sein Grab ist ein Grab.
Er liegt neben seiner Mutter
Begraben.
Unter dem Stein hält er
Ihre Hand.
Ruhelos ist sein Rest
Nicht das Schweigen. Das bleibt. Übrig bleibt
Was er zu sagen hat
Unerhört macht er sich
Vom Acker in die Sprache.
Seinen Frieden zu stiften
Wird er weiter Unfrieden
Stiften mit seiner Poesie.
Und seine Rose blüht
Gegen den Winter.
Ein Bild an meinem Schreibtisch, eine Fotografie in Klarsichtfolie. Die Bildunterschrift sagt Rom, nicht wann, nicht wer das Bild geschossen hat. Nur wer im Fokus ist, Pasolini, am linken Rand. Sein rechter Ellbogen ist abgeschnitten. Er trägt ein hellbraunes, eng geschnittenes Sakko, ein blau-grau kariertes Hemd, eine Jeans, die ihm das Geschlecht einschnürt, mit Falten, die wie mit Fingern auf es zeigen, als sollte sich darauf der Blick konzentrieren. Das rechte Bein ist sein Standbein. Er hat das linke darüber verschränkt, den schwarzen Schuh schräg auf der Kante, sein Spielbein. Die Hände hat er in die Hüften gestemmt, die Daumen in den braunen Gürtel gedrückt, die linke Hand an der goldenen Schnalle. Er trägt seine dominante Brille, spricht nach links zu jemandem, den oder die wir nicht sehen. Er spricht bestimmt, kann sein, er wird jeden Augenblick wütend, seine Stimme lauter, er wirkt ärgerlich. Vielleicht sagt er auch etwas Persönliches, trifft einen schwachen Punkt, legt mit den Worten den Finger in die Wunde. Das Ganze eine Probensituation: Man sieht keine Kamera, nur eine Fotografin im Hintergrund. Am äußersten rechten Rand des Bildes der noch blutjunge Ninetto. Auch sein linker Ellbogen abgeschnitten. Er wirkt durch den Kamerawinkel größer als Pasolini, ist näher an der Linse. Er trägt einen rostroten Rollkragenpulli, ein hellbeiges, mit braunen Strichen kariertes Sakko. Sein Blick geht zu Pasolini, er lächelt, eigentlich schmunzelt er sogar. Warum? Über das, was Pasolini sagt? Oder weil Pasolinis Hosenschlitz offen wirkt, was aber auch eine Täuschung sein kann, durch die Knöpfe, die die enge, straffe Hose halten müssen. Wahrscheinlich lächelt er wegen der Kritik. Vor ihm mit dem Rücken zur Kamera ein anderer junger Mann in einem weißen Leinenanzug, der mit dem rechten Arm um Ninettos Hüften greift. Als hätten die beiden getanzt und Ninetto löst sich gerade. Der junge Mann wirkt dynamisch, entschlossen, sein Kopf leicht nach vorne gesenkt, auch er hat Locken. Er hat harte, kantige Züge im Vergleich zu den weichen, fließenden Ninettos, der mit seiner linken Hand unentschlossen und ungeschickt den rechten Ellbogen des anderen Jungen berührt oder berührt hat, aber jederzeit bereit ist loszulassen.
Das Bild erzählt mehr, als es zeigt. Alles ist in Ninettos Blick auf Pasolini gerichtet. Es ist ein verschwörerischer Blick, ein Blick, der sagt, da gibt es eine Verbindung zwischen uns, die alles um uns verschwinden lassen kann. Da ist der mächtige Regisseur, das Bild von einem Mann, der uns seine Macht spür- und sichtbar macht, er bestimmt, was passiert und wie es zu sein hat. Er hat alles in der Hand. Aber das täuscht. Er ist nur die Marionette Ninettos. Und Ninetto weiß es, weiß, er ist das geheime Zentrum. Er kann ihn um den Finger wickeln, er hat ihn in der Hand. Ihm kann nichts etwas anhaben. Er führt seine eigene Regie, hat seinen eigenen Film im Kopf. Er wird ihn mit seinem so scheinbar unschuldigen Lächeln ans Kreuz schlagen.
Ich erkenne mich selbst nicht wieder. Als hätte ich mich je gekannt. Ich lebe das Leben, das man von mir erwartet, lebe meine Widersprüche, die Gleichung, die nicht aufgeht, die Brüche, bei denen ich unter dem Strich liege. Ich habe mich verrechnet, verrannt.
Was und wen ahme ich nach? Den, der auf meinen Namen hört? Die Figur, die ich für mich erfand? Eine Maske, die mit meinem Gesicht verwachsen ist. Das Nein, das mir nur als Ja über die Lippen kommt.
Die Literatur ist ein Stricher. Im Zwielicht zu schön, um wahr zu sein. Die alte Wahrheit und die Wahrheit des Alters, im schicksalhaften Licht, das kein Erbarmen kennt. Und dir den Trost spendet, dass du keinen anderen findest als ihre Strahlen auf deinem müden Gesicht.
Ich hätte gerne mit ihm Fußball gespielt. In Afrika, am Meer, in Rom, Marokko, am Strand, auf Asche, Sand, Staub, einer Wiese mit einem Tor aus hingeworfenen Jacken. Ich sehe ihn, wie er mit dem Ball am Fuß auf mich zuläuft, unsere Blicke sich treffen. Ich versuche mich so groß zu machen, wie ich es kann, ihm den Weg zum Tor zu verstellen, seine Bewegungen zu stören, zu täuschen mit einer Drehung. Will er mich umspielen? Und ich liege am Boden, die Hand ausgestreckt nach dem Ball, der unerreichbar ist. Ich darf mich nicht zu früh bewegen, muss stehen bleiben. Warten, Ewigkeitssekunden warten. Seine Augen suchen den Kontakt. Meinen Reflexen vertrauen, dem Unbewussten. Er kam über die Flügel, aber hier ist die Hölle für ihn, drohe ich ihm mit meinem gespannten Körper. Will er den Ball über mich heben? Mir durch die Beine spielen. Oder schießt er jetzt, trocken, aus dem Fußgelenk. Nein, er wird es versuchen, mich zu umkurven, er will den Ball ins Tor tragen. Komm, ich warte auf dich. Im nächsten Augenblick ist alles entschieden.
Ein Sonett. Ein vollendetes Gefäß. Die Ketten, in denen du frei bist. Die Ketten, ohne die Klang und Schönheit nicht zu haben sind. Die hohe Form, der hohe Ton. Das Erhabene. Petrarca. Shakespeare. Und du sprichst davon, dass du onanierst, Spermaflecken auf den Gedichten. Eine Landkarte erinnerter Orgasmen. Als der Sex ein Gedicht war. Aber jetzt ist das Gedicht der Sex. Du bist allein in deinem Bett mit deinem unerfüllten Begehren. Nur noch im Schreiben kannst du vergessen, dass es nicht mehr so ist, und im Moment des Schreibens kann es sein, wie es war. Aber schon im nächsten Satz ist die Enttäuschung, der Verlust, noch viel vollkommener.
Du solltest Terzinen schreiben. Du nimmst das Sonett und kotzt dich aus in ihm, besäufst dich, um zu grölen, zu spucken, zu denunzieren, anzuklagen, obszöne Verwünschungen dir aus dem Leib zu schreien. Als wäre dein Sonett eine Stricherkneipe, ein Bahnhofsstrich, als wäre es unter der Brücke, du fährst an den Buchstaben wie an käuflichem Sex vorbei und nimmst sie mit in deinen Alfa, gibst Gas, drückst durch, bis an den Rand der Stadt, die Parkplätze, Aussichtspunkte, immer im Schatten, in den Schattenrissen, nahe den Straßenlaternen, im Verschwommenen.
Die junge Haut. Die Jungs, die das Geld brauchen, das schnelle Geld für den schnellen Fick, den schnellen Blowjob. Und dann sitzt du allein vor der Schreibmaschine, dem leeren Blatt. Und von dem Tasten deiner Hände auf seiner Haut bleiben nur die Tasten der Buchstaben unter deinen Fingern. Die du schlagen kannst, auf die du einhämmern kannst mit deinen Flüchen, Verwünschungen, Todeswünschen. Aber du bist der Geschlagene. Geprügelte. Verzweifelte. Du ziehst das Sonett an wie deine Lederjacke und bist der Narr in ihr.