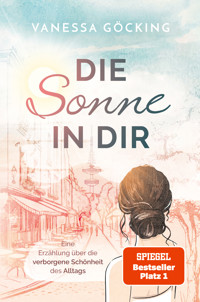Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: VANI Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Glücksgeschichten
- Sprache: Deutsch
Über das Geschenk der Selbstliebe und den Zauber des Neubeginns »Was, wenn das Ende vom ›Wir‹ bloß der Anfang vom ›Ich‹ ist?« Nach Kathys Trennung scheint ihre Welt in Trümmern zu liegen. Sie fühlt sich verloren und zweifelt, ob sie jemals wieder das Glück der Liebe erfahren wird. Doch dann beginnt eine Reihe von geheimnisvollen Postkarten ihren Briefkasten zu füllen, offenbar versehentlich an ihre Adresse gesendet und voller Geschichten über exotische Orte und aufregende Abenteuer. Getrieben von einer unerklärlichen Sehnsucht, folgt Kathy den Spuren der unbekannten Geschichtenerzählerin … Eine bezaubernde Erzählung über die Wiederentdeckung der eigenen Kraft und die Schönheit, die in jedem von uns verborgen ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 267
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Liebe in dir
Eine Geschichte über die Reisezum wahren Selbst
Vanessa Göcking
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie. Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Originalausgabe
1. Auflage 2025
Copyright © 2025 VANI Verlag GmbH
VANI Verlag GmbH, Teichgasse 5, 99880 Waltershausen
E-Mail: [email protected]
Website: www.vani-verlag.de
Instagram: vanessa.goecking
Alle Rechte, einschließlich die des vollständigen oder teilweisen Nachdrucks in jeglicher Form sowie das Recht der Vervielfältigung, Verbreitung und Übersetzung, sind vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Lektorat: Anke Schild
Umschlaggestaltung und Buchsatz: Laura Newman
ISBN 978-3-989-42459-3
Dieses Buch ist für
DICH,
damit du erkennst,
wie besonders du bist,
und dir erlaubst,
zu erblühen.
Vorwort
Es heißt, dass jedes Ende auch ein neuer Anfang ist. Doch was ist, wenn wir keinen neuen Anfang wollen?
Vielleicht befindest du dich gerade in einer solchen Situation, in der das Ende von etwas, das dir lieb und vertraut ist, unerträglich erscheint. Möglicherweise fühlst du dich verloren und unsicher, hast Angst vor dem Unbekannten, das vor dir liegt. Und wahrscheinlich stellst du dir genau aus diesem Grund immer wieder die Frage nach dem »Warum«.
Warum musste eine Sache, die dir so wichtig war, zu Ende gehen? Wieso musste sich alles ändern, gerade als du dachtest, du hättest deinen Platz in der Welt gefunden? Und weshalb musstest du loslassen, was dir so viel bedeutet hat und immer noch bedeutet?
Vor einem Jahr verließ mich der Mann, von dem ich dachte, dass er die Liebe meines Lebens sei, und an dessen Seite ich mich bis ans Ende meiner Tage sah. Und so baute auch ich mir mein eigenes Gefängnis aus ebendiesen Fragen. Ich zog die Mauern hoch, verschloss die Gittertür und warf den Schlüssel durch den schmalen Spalt in den dunklen Korridor meiner Gedanken. Innerhalb dieser Mauern war ich gefangen in einem endlosen Kreislauf von »Hätte ich nur …« und »Was wäre, wenn …?«. Die Welt erschien mir plötzlich grau, mein Schicksal trostlos.
Doch als ich am wenigsten damit gerechnet hatte, erschien ein Funken Hoffnung in all der Dunkelheit. Er erreichte mich in Form von überdimensionalen Postkarten, verfasst von einer mir unbekannten Absenderin und offenbar versehentlich an meine Adresse gesendet. Die Urlaubsgrüße entführten mich in entlegene Hafenstädte und an exotische Strände, in buddhistische Tempel und auf quirlige Märkte. Die knappen Schilderungen, die mich meist im Abstand einiger Tage erreichten, ließen mich traumhafte Inseln in Südostasien erkunden, mit Schildkröten schwimmen und die von mächtigen Wolkenkratzern gesäumten Straßenzüge Tokyos entlangwandeln. Es war, als hätte das Schicksal mir den Schlüssel gereicht, damit ich mein Gefängnis verlassen und in eine Welt voller Wunder und Möglichkeiten hinaustreten konnte.
Dies zu erkennen, hat zugegebenermaßen einige Wochen in Anspruch genommen, und es gelang mir nicht ohne die ermutigenden Worte einiger vertrauter Menschen. Doch letztendlich gab ich mir einen Ruck und setzte vorsichtig einen Fuß über die Schwelle meiner Gefängniszelle. Ich buchte ein Flugticket nach Kambodscha und begann eine Reise, wie ich sie mir zuvor niemals hätte erträumen können.
Meine Reise war nicht immer einfach. Es gab Tage, an denen die Sehnsucht nach dem Vertrauten mich fast überwältigte, Tage, an denen die Fragen und Zweifel zurückkehrten. Aber mit jeder neuen Erfahrung, die ich sammelte, rückte das Gefängnis weiter in den Hintergrund und die Welt um mich herum wurde größer und schöner.
Ich lernte neue Menschen kennen, Menschen, die ihre eigenen Geschichten und Kämpfe hatten und die mir zeigten, dass ich nicht allein war. Ich sah Orte von atemberaubender Schönheit, die mich daran erinnerten, wie einzigartig diese Welt und wie wunderbar das Leben ist. Und mit jedem Schritt, den ich machte, fand ich ein kleines Stück mehr von mir selbst wieder.
Heute stehe ich hier, immer noch auf meiner Reise, aber mit einem neuen Verständnis für das Leben und für mich selbst. Ich habe gelernt, dass das Ende von etwas nicht das Ende von allem bedeutet. Dass es möglich ist, loszulassen und weiterzugehen. Dass es in Ordnung ist, sich zu verändern und zu wachsen. Und das Wichtigste, was ich gelernt habe, ist, dass jedes Ende wirklich ein neuer Anfang ist. Ein Anfang, der vielleicht beängstigend und unsicher ist, aber auch voller Magie und Chancen. Ein Anfang, den wir zunächst womöglich nicht wollen, aber den wir brauchen, um uns selbst zu finden und um wahrhaftig zu leben.
Wenn also auch du vor einem Ende stehst und keinen neuen Anfang willst, dann erinnere dich daran: Du bist nicht allein. Es ist okay, Angst zu haben. Es ist okay, zu trauern. Aber es ist auch okay, weiterzugehen. Denn am Ende wartet immer ein neuer Anfang. Und wer weiß, welche wundervollen Wendungen dieser für dich bereithält?
Deine Kathy
Schwarze Nächte
Wie konnte er mir das nur antun?
Wie zum Teufel konnte er mich nach all den Jahren, nach den unzähligen Höhen und Tiefen, die wir zusammen durchgestanden hatten, einfach so sitzen lassen? Hatte er die guten Zeiten etwa vergessen? Und all die Träume und Wünsche, die wir uns noch gemeinsam erfüllen wollten? War das alles weggewischt aus seinem Kopf, als wäre es nie da gewesen?
Ständig stellte ich mir dieselben Fragen, und obwohl die Klimaanlage in diesem dunklen Hostelzimmer auf Hochtouren lief, kochte ich innerlich vor Wut. Ich kochte, weil ich elf Jahre meines Lebens verschwendet hatte! Ich kochte, weil ich meine Jugend, meine Nerven und mein Selbstwertgefühl für einen Mann aufgegeben hatte, der nicht bereit dazu war, für unsere Liebe zu kämpfen. Ich kochte, weil …
Das Kichern unter mir riss mich aus meinen Gedanken. Das Bett knarrte, dann hörte ich ein Flüstern.
»Das können wir doch nicht machen«, raunte eine weibliche Stimme auf Englisch. Sie gehörte einer blonden Sportskanone, die am selben Tag wie ich in dieser Unterkunft eingecheckt hatte und die ich auf Anfang zwanzig schätzte. »Eigentlich dürften wir nicht mal zusammen in einem Bett liegen.«
»Die anderen schlafen doch alle«, antwortete ihr Freund. »Das bekommt keiner mit.«
Wieder knarrte die Matratze, gefolgt von schmatzend-feuchten Kussgeräuschen. Ich drehte mich vom Rücken auf den Bauch und presste mein Kopfkissen auf die Ohren. Erste Aufgabe für morgen: Ohrenstöpsel besorgen.
Während mein Hochbett mal mehr, mal weniger rhythmisch schaukelte, sinnierte ich darüber, wie ich in diese missliche Lage gekommen war. Da die Nacht noch lang und an Schlaf nicht zu denken war, holte ich gedanklich aus und reiste im Geist zurück in meine frühen Zwanziger und zu dem Zeitpunkt, an dem das Unheil seinen Lauf genommen hatte …
Ich war schon immer ein durchschnittlicher Mensch gewesen. Auch wenn meine Mutter mir stets versicherte, dass ich etwas ganz Besonderes war, ein Rohdiamant, der nur noch geschliffen werden musste, wusste ich es besser: Ich war durchschnittlich. Ich war weder besonders hübsch noch besonders hässlich. Ich war nicht sonderlich klug, aber dumm war ich auch nicht. Egal, ob es um Schulnoten, sportliche Aktivitäten, die Anzahl an Freunden oder sonst irgendetwas ging: Ich stach niemals heraus, sondern bewegte mich zuverlässig in der sicheren Mitte.
Und ich fand das nicht einmal schlimm. Um ehrlich zu sein, verschwendete ich damals keinen einzigen Gedanken daran, etwas anderes als durchschnittlich sein zu wollen. Schließlich gab es so viele Menschen auf der Erde. Da konnte doch nicht jeder besonders sein, nicht jeder konnte in einer Sache alle anderen überragen! Allein das Vorhaben klang nach einer Menge Druck und darauf hatte ich überhaupt keine Lust.
Stattdessen wollte ich einfach glücklich sein. Ich wollte neue Dinge ausprobieren, experimentieren und Spaß haben. Auf keinen Fall durfte ein Tag dem anderen gleichen, denn nichts hasste ich so sehr wie Langeweile. Das führte dazu, dass ich im Monatstakt neue Hobbys ausprobierte, von Akrobatik über Kickboxen bis hin zu Seidenmalerei und Zauberei. Nach meinem Abitur ging ich zwei Jahre lang verschiedenen Gelegenheitsjobs nach, trug Zeitungen aus, arbeitete in einem Callcenter, mähte Rasen bei den Nachbarn und gab Erstklässlerinnen Nachhilfe in Deutsch. Schließlich drängten meine Eltern mich dazu, eine Ausbildung oder ein Studium zu beginnen, und nach langen Diskussionen folgte ich ihren Anweisungen. Völlig plan- und ziellos bewarb ich mich an einem Dutzend verschiedener Universitäten für fünf verschiedene Studiengänge und bekam zwei Zusagen: eine in Bremen für ein Studium in Betriebswirtschaftslehre und eine in Köln für das Fach »Antike Sprachen und Kulturen«. Ich entschied mich für Köln, weil »Ägyptologie« und »Klassische Literaturwissenschaft« bedeutend spannender klangen als »Mikroökonomie« und »Controlling« und die Stadt auch viel bunter war als meine andere Option. Nach Berlin, wo ich nur Absagen kassiert hatte, war Köln wohl der Ort, der die meisten verrückten Seelen anlockte, diejenigen, die anderswo nicht richtig reinzupassen schienen, und das zog mich in seinen Bann.
Ich suchte nach einem WG-Zimmer und wurde zu meinem Erstaunen sogar schnell fündig. Kurze Zeit später lebte ich mit einer Sportstudentin zusammen, deren Disziplin mir Angst machte, und einem Archäologiestudenten, dessen größte Entdeckung wohl die Essensreste bleiben würden, die er nach jeder Mahlzeit aus seinem viel zu langen Bart fischte. Die vierte im Bunde war eine promovierte Ärztin, die genügend Geld für eine eigene Bleibe ohne kuriose Mitbewohner besaß, aber – so sagte sie – aufgrund der Schichtarbeit nicht dazu kam, auf Wohnungssuche zu gehen.
Alles veränderte sich für mich, als ich auf einer Erstsemesterparty Andy kennenlernte. Andy war zwei Jahre älter als ich und befand sich bereits am Ende seines Studiums. Im Gegensatz zu mir war er zielstrebig, selbstsicher und diese Art Mensch, mit dem jeder befreundet sein möchte und den jeder anstarrte, wenn er den Raum betrat. Und obwohl auf besagter Party mindestens eine Handvoll Frauen und wahrscheinlich auch der eine oder andere Mann versuchte, seine Aufmerksamkeit zu gewinnen, war ausgerechnet ich es, der er sie schenkte.
Wir unterhielten uns an diesem Abend lange, und gegen zwei Uhr brachte er mich nach Hause, ohne mir Avancen zu machen – wie ein echter Gentleman eben. Wir tauschten unsere Nummern aus und schrieben uns bis in die frühen Morgenstunden. Ich lernte in dieser Nacht mehr über Andy, als ich über viele andere Menschen wusste, die ich zum Teil bereits seit meiner Kindheit kannte. Unser Gespräch war anders als die meisten Gespräche, die ich im Alltag führte. Es war tiefgründig und echt.
In den folgenden Wochen trafen wir uns zum Bouldern, gingen zusammen ins Kino und tanzen. Er half mir, mein WG-Zimmer zu verschönern, strich mit mir Wände und baute eine Kommode auf, die laut Prospekt eines großen schwedischen Möbelhauses blitzschnell zusammengeschraubt sein sollte, deren Bauanleitung mir in Wahrheit jedoch rasch den letzten Nerv raubte. Eines Nachmittags fragte er mich, ob ich ihn schon in die »Friendzone« abgeschoben hätte und es für einen Kuss zu spät sei. Natürlich war das nicht der Fall und so wurde ich mit Anfang zwanzig zum ersten Mal in meinem Leben geküsst – und es war das unglaublichste aller Gefühle!
Ab diesem Moment waren Andy und ich ein Paar, und ich erlebte mit ihm nicht nur meinen ersten Kuss, sondern auch viele andere erste Male: das erste Mal Sex, das erste Mal die »Pille danach«, das erste Mal Pärchenurlaub, das erste Mal die Eltern eines Mannes kennenlernen, mit dem ich in einer Beziehung war, und das erste Mal mit einem Partner zusammenziehen. Das erste Mal aus Versehen vor einem Partner pupsen und aus Scham beinahe im Erdboden versinken. Das erste Mal so laut streiten, dass die Nachbarn an der Tür klopfen und fragen, ob alles okay ist. Das erste Mal so sehr lieben, dass es wehtut. Das erste Mal vor Glück überschäumen. Das erste Mal das Gefühl haben, dass ich doch etwas Besonderes bin, nämlich die absolute Nummer eins für einen anderen Menschen.
Die kommenden Jahre vergingen zunächst langsam, dann immer schneller. Ich wechselte mehrfach mein Studienfach, meine Nebenjobs, die Farbe meiner Haarsträhnchen, meine Hobbys, meine Freunde und meine Vorstellungen von einem glücklichen Leben, doch eines blieb konstant: Andy. Und meine Liebe zu ihm.
Leider beruhte dies nicht auf Gegenseitigkeit, und irgendwann begann er, meine Makel doch zu sehen, sie anzusprechen und mich »besser« machen zu wollen. Was er vorher als »quirlig« und »bunt« wahrgenommen hatte, bezeichnete er nun als »unstet« und »sprunghaft«. Während er mich am Anfang für meine Kreativität, Flexibilität und Leichtigkeit bewundert hatte, forderte er zunehmend Disziplin, Geradlinigkeit und Ernsthaftigkeit ein. Wir stritten uns immer öfter und schließlich immer weniger – weil mein Freund mir aus dem Weg ging, mich mehr und mehr aus seinen Gedanken und seinem Alltag ausschloss. Und letztendlich auch aus seinem Herzen. Ausgerechnet an einem Freitag, dem dreizehnten, machte Andy mit mir Schluss und bewies wieder einmal, dass ich nichts Besonderes war. Ich war durchschnittlich und im Durchschnitt sind wir doch alle austauschbar …
Bunte Tage
Irgendwie hatten mich die nächtlichen Aktivitäten meiner Zimmergenossen dann wohl doch in den Schlaf gewippt; besonders erholsam war dieser allerdings nicht. So fand ich mich am nächsten Tag gähnend in einem Straßenrestaurant wieder, auf dem Tisch eine große Portion Gemüsecurry mit Reis und eine frische Kokosnuss. Glücklicherweise konnte ich meine verquollenen Augenlider hinter einer verspiegelten Sonnenbrille verstecken und ungeniert das bunte Treiben beobachten, das mich umgab: Dutzende von Touristen mit Rucksäcken und Käppis, ihre Smartphones und Spiegelreflexkameras gezückt, um den Moment festzuhalten. Kleine Kinder in schmutziger Kleidung, die ihnen selbst gemachte Armbänder, Schnitzereien, Kaugummis und Zigaretten anboten oder einfach nur so ihre zarten Hände nach ein bisschen Geld ausstreckten. Drei Mönche in leuchtend orangefarbenen Roben, die um Essen baten. Ein paar Autos und noch viel mehr Roller, Mopeds, Tuk-Tuks und andere kuriose Fahrzeuge, die alles andere als straßentauglich wirkten und zudem deutlich mehr Passagiere transportierten, als zulässig war. Auf einem Motorroller saß sogar eine ganze Familie, bestehend aus einem erwachsenen Paar, einem Jugendlichen, zwei Kleinkindern und einem Huhn. Keiner von ihnen trug einen Helm. Über allem spannte sich ein Labyrinth aus Stromkabeln und grellen Straßenschildern mit Aufschriften in Englisch und in schnörkeligem Khmer.
Doch es waren nicht nur die Augen, die in Phnom Penh, der Hauptstadt Kambodschas, mit neuen Eindrücken versorgt wurden; auch alle anderen Sinnesorgane kamen nicht zu kurz. Der beißende Gestank von Abgasen mischte sich mit dem würzigen Geruch von gegrilltem Fleisch und dem betörend süßen Duft von Jasmin- und Lotusblüten. Der Verkehrslärm mit all dem Gehupe und den Motorengeräuschen wurde von Straßenmusik, buddhistischen Gebetsgesängen und dem Klang von Tempelglocken durchbrochen. Zudem gab es zahllose Straßenverkäufer, die lautstark ihre Ware feilboten, von frisch gepressten Säften über frittierte Spinnen bis hin zu Haushaltswaren.
Für Menschen, die es laut, lebendig und vielfältig, aufregend und geschäftig mögen, ist Phnom Penh genau das Richtige. Wer mit Menschenmassen und Körperkontakt, mit Staub, Schmutz und hoher Luftfeuchtigkeit nichts anfangen kann, würde sich hier hingegen nicht sonderlich wohlfühlen. Ich gehörte zu der ersten Sorte, zumal mich die unendlichen äußeren Reize für einige Momente meinen seelischen Schmerz vergessen ließen.
Ich griff mit beiden Händen nach der Kokosnuss und zog genüsslich an meinem Strohhalm. Das süße, leicht nussige Kokoswasser war wunderbar erfrischend. Dann aß ich mein Mittagessen und kam nicht umhin zu bemerken, wie seltsam es sich anfühlte, allein in einem Restaurant zu sitzen – selbst wenn es sich bloß um ein einfaches Lokal mit Plastikstühlen und wild durcheinandergewürfelten Tischen handelte. Früher wäre ich niemals allein essen gegangen. Entweder war jemand anderes, meistens Andy, mit dabei, oder ich entschied mich für Take-away. Oder ich kochte eben selbst. Doch Andy war kein Teil meines Lebens mehr, und ich befand mich allein auf dieser Reise durch Asien, ohne jemanden, den ich als meine Gesellschaft betrachten konnte.
Eine Träne wollte sich aus meinen Augen lösen. Ich unterdrückte sie und räusperte mich. Dann kramte ich die Postkarten aus meiner Bauchtasche. Ich hatte sie immer dabei, obwohl sie mit ihrem größeren Format als dem üblichen DIN A6 nicht gut hineinpassten. Langsam schaute ich sie mir an, eine nach der anderen. Seit dem Beginn meiner Reise tat ich dies täglich, manchmal sogar mehrfach pro Tag, und entdeckte stets neue Details. Ich hielt inne, als ich die Karte betrachtete, die den majestätischen Tempelkomplex Wat Phnom in all seiner Pracht darstellte. Meine Augen waren auf die königlichen Löwenstatuen und das prächtige Bauwerk gerichtet, dessen reines Weiß und leuchtendes Gold einen starken Kontrast zum unendlichen Azurblau des wolkenlosen Himmels bildeten. Jedes Element des Tempels, von seiner erhabenen Architektur bis hin zu seinen kunstvollen Verzierungen, schien in der Karte eingefangen zu sein. Dann drehte ich die Postkarte um und las den Text, verfasst in einer kaum lesbaren winzigen Schrift, ein weiteres Mal.
Meine Liebe,
wie versprochen bekommst du von jeder meiner Reiseetappen eine Postkarte, und wir starten in der komplett kuriosen Hauptstadt Kambodschas. Es fühlt sich hier an, als hätte jemand einen Mixer genommen und Alt und Neu, Stille und Lärm, Licht und Dunkelheit mal ordentlich durchmischt. Das Ergebnis? Ein wilder Cocktail namens Phnom Penh.
Hier gibt es uralte Tempel voller Ruhe auf der einen und das quirlige Treiben der Einheimischen und der chaotische Verkehr auf der anderen Seite. Mönche düsen in ihren wehenden Roben auf Motorrädern an mir vorbei, und neben Menschen werden auch allerlei Waren und Güter auf den zweirädrigen Fahrzeugen transportiert: von Schweinen über Ölgemälde bis hin zu Matratzen.
Es ist, als würde die Stadt mein Innenleben widerspiegeln – den Tumult der vergangenen Wochen und Monate, all die Angst und die Zweifel, aber auch die Neugierde und Freude auf einen Neuanfang. Hier fühle ich mich verstanden und gleichzeitig rastlos. Doch wie heißt es noch mal in diesem Sprichwort? »Eine ruhige See hat noch nie einen guten Seefahrer hervorgebracht«? Nun, was soll ich sagen … Ich schätze, ich werde zu einer ganz grandiosen Seefahrerin heranwachsen.
Alles Liebe!
Sammy
Verrückt, wie gut diese Postkarte zu meiner aktuellen Verfassung passt, dachte ich mir. Es ist beinahe, als hätte ich sie selbst verfasst, als wäre sie meinem Inneren entsprungen und als wären die Worte von meinem Herzen aus direkt auf das Papier geflossen.
Ich verharrte für einige Sekunden regungslos in derselben Position, dann steckte ich den Stapel Urlaubsgrüße wieder in meine Tasche. Die Verfasserin der Postkarten war mir unbekannt, und ich wusste, dass die Botschaften ursprünglich nicht für mich gedacht waren. Die erste Karte, also jene, die über Phnom Penh berichtete, erreichte mich an einem Montag, drei Tage nachdem Andy mit mir Schluss gemacht hatte. Zunächst vermutete ich darin einen Fehler. Ich fragte die anderen Mieter in unserem Haus, ob jemand Post von einer gewissen Sammy aus Asien erwartete, aber erntete nur Kopfschütteln und Schulterzucken. Ich fragte auch in den Nachbarhäusern nach, konnte die wahre Empfängerin jedoch nicht ausfindig machen. So ließ ich das Thema vorerst ruhen.
Eine Woche später erhielt ich eine weitere Postkarte, diesmal aus Kampot, einer Hafenstadt im Süden Kambodschas, wie ich nach einer kurzen Google-Suche herausfand. Das Bild zeigte ein Fischerboot, das auf einem stillen Fluss im goldenen Licht des Sonnenuntergangs dahintrieb. Wieder schrieb Sammy an eine Person, deren Namen sie nicht nannte, und berichtete von der sinnlichen Schönheit des Ortes und der Freundlichkeit der Menschen, wobei sie in wenigen Worten auch die Herausforderungen andeutete, die sie in der Ferne zu meistern versuchte.
Ich stellte ein Foto der Postkarte in meinen Status und fragte meine Bekannten, ob sie eine Idee hätten, wie die Urlaubsgrüße ihre rechtmäßige Empfängerin erreichen könnten. Doch niemand konnte weiterhelfen. Also behielt ich sie und legte sie zusammen mit der ersten Postkarte in eine Box, die ich in meinem Nachtschränkchen aufbewahrte.
Ein paar Tage später, als der Postbote eine weitere Karte in meinen Briefkasten werfen wollte, kam ich gerade vom Einkaufen nach Hause und konnte ihn abfangen. Ich erklärte ihm, dass ein Missverständnis vorliegen müsse, da ich keine Freundin hatte, die durch Asien reiste. Der Postbote deutete auf die Versandadresse und erklärte, dass sie eindeutig an mich gerichtet sei, obwohl nur die Initialen K. M. als Empfänger angegeben waren – ich war die Einzige im Haus mit diesen Initialen. Daher betrachtete er seine Aufgabe als erledigt, und so nahm ich den nächsten Urlaubsgruß entgegen, der diesmal einen weißen Strand mit majestätischen Palmen zeigte.
Bei der vierten Postkarte wunderte ich mich schon beinahe nicht mehr, und spätestens bei der fünften freute ich mich auf die Nachrichten aus der Ferne, die mich für ein paar Sekunden an exotische Orte entführten und meinen Liebeskummer weniger einnehmend wirken ließen. Voller Begeisterung las ich Sammys Gedanken über riesige Tempelanlagen, deren mächtige Steinquader von Würgefeigen und Tetrameles-Bäumen überwuchert waren, über belebte Nachtmärkte und atemberaubende Sonnenuntergänge, über endlose Reisfelder und Begegnungen mit frechen Affen.
Neben all den äußeren Eindrücken ihrer Reise sprach sie immer wieder auch von ihrem Innenleben, ihren Kämpfen und Herausforderungen, aber auch von der Freiheit und dem Abenteuer, die sie in diesen fremden Kulturen fand. Jede Karte war ein kleines Fenster in ein Leben, das so anders war als meines, und doch fühlte ich eine seltsame Verbundenheit mit dieser unbekannten Frau.
Als die siebte Karte eintraf, war ich wieder einmal in unserem Hausflur und nahm sie dem Postboten direkt ab. Ich war gerade auf dem Weg zur Arbeit – seit einigen Monaten half ich in einem kleinen Café in Ehrenfeld aus – und wollte mit der Lektüre nicht bis zum Abend warten. Also las ich sie im Gehen. Ich hatte erst wenige Schritte zurückgelegt und war gerade bei der Hälfte des Textes angekommen, als plötzlich jemand aus einem Hauseingang trat und mit mir zusammenstieß. Schnell hob ich die Postkarte auf, die mir vor Schreck heruntergefallen war.
»Oh, Entschuldigung«, setzte ich an, doch der Rest der Worte blieb mir im Hals stecken. Denn vor mir stand Andy – mit einer anderen Frau.
Eine schmerzhafte Begegnung
»Oh, hi«, sagte mein Ex-Freund und kratzte sich verlegen am Kopf. Er sah gut aus, erholt. Anders als ich trug er keine dunklen Ringe unter den Augen – keine Spuren von Schlafmangel oder Weinen. »Das ist ja ein Zufall.«
Ich war sprachlos. Mein Herz hämmerte so heftig, dass ich befürchtete, es könnte jeden Moment aus meiner Brust springen. Mein Blick wanderte unruhig zwischen Andy und seiner Begleitung hin und her.
»Kathy?!«, rief Nathalie überrascht. »Wir haben uns ja ewig nicht mehr gesehen!«
»Ich, ähm, ja, in der Tat …«, stotterte ich und versuchte zu begreifen, was sie hier machte.
Nathalie und ich waren in der Schulzeit viele Jahre lang beste Freundinnen gewesen. Eines Tages, am Ende der elften Klasse, erzählte ich ihr, dass ich in einen Jungen aus der Stufe über uns verknallt sei. Er hieß Benjamin und hatte braune Locken. Beim Lachen bildeten sich Grübchen an seinem Kinn. Eine Woche nach meiner Beichte erwischte ich die beiden knutschend bei den Spinden. Unsere Freundschaft zerbrach und nach dem Abitur sah ich sie nie wieder – bis jetzt.
»Und ihr zwei kennt euch?«, fuhr sie an Andy gewandt fort und schob ihre Finger lässig zwischen seine. »Woher denn?«
»Tja, weißt du, wir waren mal zusammen«, antwortete er zögernd, den Blick auf den Boden gerichtet.
Ich spürte, wie Tränen in mir aufstiegen, doch ich würde nicht vor ihnen weinen. Ich musste mich noch ein paar Sekunden zusammenreißen, koste es, was es wolle.
»So könnte man das sagen«, erwiderte ich hart und mit einer Stimme, die nicht wie meine eigene klang. »Es waren aber nur elf Jahre und unsere Trennung ist schon zwei Monate her. Da kann das Thema schon mal unter den Tisch fallen.«
»Kathy, so war das nicht gemeint.«
Andy warf mir einen entschuldigenden Blick zu und versuchte, seine Hand aus Nathalies Griff zu befreien.
»Oh, ich verstehe«, erwiderte sie und schenkte mir einen übertrieben mitleidigen Blick. »Trennungen sind schwer, aber du findest bestimmt bald jemanden, der besser zu dir passt.«
Ein bitteres Lachen entfuhr mir, dann schüttelte ich den Kopf und sagte: »Ja, sicher, so wie ihr zwei, schätze ich.«
Andy und Nathalie tauschten einen Blick aus, den ich nicht deuten konnte.
»Also, ihr seid jetzt zusammen?«, fragte ich geradewegs heraus. Mein Herz schmerzte ohnehin so sehr, dass ich dachte, die volle Wahrheit könnte es kaum noch schlimmer machen.
»Hm, ja, das sind wir«, sagte Nathalie gespielt verlegen. »Heute ist unser Einmonatiges.«
Andy wurde bei jedem Wort kleiner und sein Gesicht nahm die Farbe des Asphalts zu seinen Füßen an. Meines hingegen wurde so rot wie eine Chilischote, und ich wusste nicht, wem von beiden ich als Erstes an die Kehle springen wollte. In mir herrschte ein so wildes Chaos an Traurigkeit, Schmerz und Wut, dass ich mich am liebsten auf der Stelle übergeben hätte.
Stattdessen kratzte ich das letzte bisschen Selbstbeherrschung, das noch in mir war, zusammen und antwortete: »Na dann: Herzlichen Glückwunsch.«
Ich drehte mich abrupt um und stolperte fast über meine eigenen Füße, als ich so schnell wie möglich Abstand zwischen uns bringen wollte. Ich hörte Nathalie noch etwas rufen, irgendeine Verabschiedung, aber ihre Worte gingen in dem lauten Rauschen unter, das in meinen Ohren hallte.
Zu Hause angekommen, knallte ich die Tür hinter mir zu und sackte zusammen wie ein Häufchen Elend. Tränen liefen mir die Wangen hinunter, und ich ließ sie einfach fließen, während ich versuchte, die schmerzhaften Bilder aus meinem Kopf zu verbannen. Ich schälte mich aus meiner Jacke und ließ sie hinter mir auf den Boden fallen.
Dann erinnerte ich mich, dass ich eigentlich auf dem Weg zur Arbeit gewesen war. Panisch kramte ich in meinem Rucksack nach meinem Smartphone, zog es heraus und schaute auf das Display.
»Fuck!«, sagte ich laut und wischte mir mit dem Handrücken die Nase ab. Dann suchte ich in meiner Kontaktliste Julias Nummer raus.
»Hallo? Kathy, wo bleibst du?«, erklang die Stimme meiner Chefin.
»Julia, hi! Ich weiß, dass das gerade ziemlich kurzfristig ist, aber wäre es okay, wenn ich heute etwas später komme und dafür länger bleibe? Mir ist etwas … etwas Ungeplantes dazwischengekommen.«
Ich spürte Julias Zögern, das Schweigen zog sich und der Kloß in meinem Hals wurde größer.
»Also, wenn es nicht geht …«, begann ich, wurde jedoch von meiner Chefin unterbrochen.
»Weißt du, Kathy, ich verstehe ja, dass es bei dir gerade nicht ganz so toll läuft«, sagte sie. »Aber ich habe hier ein Geschäft zu führen und ich muss mich auf meine Mitarbeitenden verlassen können.«
»Ich weiß«, nuschelte ich kleinlaut. »Das verstehe ich, aber …«
»Und für mich gibt es da kein ›Aber‹. Ich habe in den vergangenen Wochen unzählige Male beide Augen zugedrückt. Jetzt reicht es. Entweder du bist in einer Viertelstunde hier oder ich werde deinen Arbeitsvertrag zum Ende des Monats auflösen.«
»Okay«, erwiderte ich und zog geräuschvoll die Nase hoch. »Ich bin gleich da.«
Weise Worte
»Entschuldigung, ist hier noch frei?«, fragte mich jemand auf Deutsch und riss mich aus meinen Gedanken.
Eine Frau – ich schätzte sie ein paar Jahre jünger, als ich es war – lächelte mich freundlich an und deutete auf den Platz neben mir. Irritiert schaute ich sie an und wurde mir meines Umfelds wieder bewusst. Ich war nicht mehr in Köln, sondern in Südostasien, und Andy und Nathalie waren fast zehntausend Kilometer entfernt.
»Was? Äh, woher weißt du, dass ich Deutsch spreche?«, fragte ich verdutzt.
»Ach, ich glaube, das sieht man den Menschen einfach irgendwann an, wenn man viel auf Reisen ist«, erwiderte sie mit einem strahlenden Lächeln. Die perfekten weißen Zähne in ihrem sommerlich gebräunten Gesicht und ihre nicht enden wollenden Beine ließen sie wie ein Model erscheinen.
Ich wusste nicht, ob ich beleidigt oder beeindruckt sein sollte. Schließlich fand ich es ziemlich anmaßend und oberflächlich, Menschen anhand ihres äußeren Erscheinungsbildes einfach so eine Nationalität zuzuschreiben. Andererseits hatte die Fremde mit ihrer Einschätzung ja recht gehabt.
»Okay«, antwortete ich nüchtern, »nein, ich meine, ja. Ich bin fertig. Du kannst den Tisch haben.«
»Ich wollte dich nicht aufscheuchen. Wir können gern gemeinsam hier sitzen.« Wieder dieses Lächeln, das vermutlich jedem Mann den Kopf verdreht.
»Nein, danke. Ich wollte sowieso gerade los.«
Mein Essen hatte ich schon bezahlt und so erhob ich mich, nickte der Brünetten noch einmal zu und verließ das kleine Lokal. Sobald ich auf der belebten Straße stand, prasselten wieder unzählige Sinneseindrücke auf mich ein. Motorroller hupten, Straßenverkäufer priesen ihre Waren an und überall duftete es nach exotischen Gewürzen.
Ich schlenderte durch die engen Gassen, vorbei an hübschen Läden und Ständen, die von frischem Obst und Gemüse bis hin zu handgefertigten Souvenirs alles anboten, aber auch vorbei an schmutzigen Pfützen und kleinen Müllbergen, die sich an den Straßenecken auftürmten. Die Sonne brannte auf meiner Haut, und ich fragte mich, warum ich nicht noch einen Moment länger in dem Lokal geblieben bin, eine weitere Kokosnuss bestellt und mich mit der anderen Reisenden unterhalten habe. Immerhin verging seit dem Beginn meiner Reise vor einer Woche kaum ein Augenblick, in dem ich mich nicht einsam fühlte, in dem ich mich trotz der Menschenmassen, die mich ständig und überall umgaben, nicht nach »echter« Gesellschaft und einem ehrlichen Gespräch sehnte.
Lag es daran, dass sie mich im falschen Moment angesprochen hatte? War ich emotional noch bei meiner Begegnung mit Andy und Nathalie gewesen und übertrug meine negativen Gefühle auf die Unbekannte, die überhaupt nichts für meine Emotionen konnte? Oder gab es einen anderen Grund dafür, dass ich die Flucht ergriffen hatte?
Ich wusste es nicht und ließ mich treiben, ohne ein bestimmtes Ziel vor Augen. Das kam mir gerade recht, weil es nicht unbedingt zu meinen Stärken gehörte, mich durch Städte zu navigieren. Nach einer Weile fand ich mich in einem kleinen Park wieder, der von hohen Bäumen umgeben war und zu Wat Phnom gehörte. Es war ein seltsamer Zufall, dass mein Weg mich gerade hierhin geführt hatte, wo es sich doch genau um den Ort handelte, der auf Sammys erster Postkarte zu sehen war.
Ich setzte mich auf eine Bank und sah den Einheimischen und Touristen zu, die ihrer Wege gingen. In solchen Momenten wurde mir deutlich, dass diese Menschen nicht nur Randfiguren in meinem Leben waren. Sie waren keine Statisten, traten nicht nur auf, weil ich gerade hier war, und würden nicht verschwinden, wenn ich weiterzog. Jeder von ihnen hatte seinen eigenen Weg, seine eigene Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, Träume und Wünsche, Ängste und Zweifel. Sie alle waren die Hauptfiguren in ihrem eigenen Leben, und darin war ich bestenfalls eine Nebenfigur. Natürlich war mir das auf einer kognitiven Ebene immer bewusst. Aber in letzter Zeit war ich so oft in meinen Sorgen verloren, dass ich mein Umfeld kaum noch wahrnahm. Dadurch erschienen mir meine Probleme vielleicht größer, als sie eigentlich waren.
Wenn man das große Ganze betrachtete, war es gar nicht so dramatisch, dass Andy mich verlassen hatte. Niemand starb, weil er nun mit Nathalie zusammen war und ich allein. Und die Welt drehte sich weiter. Warum fühlte sich mein Liebeskummer dennoch so überwältigend groß an? Wieso kam es mir so vor, als wäre mein ganzes Universum eingestürzt, nur weil eine Beziehung geendet hatte? War der Schmerz so intensiv, weil Andy und unsere Beziehung einen großen Teil meines Lebens und meiner Identität ausgemacht hatten? Fühlte ich mich so verloren, weil ich nicht nur den Verlust meines Partners, sondern auch den unserer gemeinsamen Träume und Pläne betrauerte?
Mein Hals fühlte sich plötzlich an, als hätte ihn jemand mit Stacheldraht zugeschnürt. Ich musste mich ablenken von diesen finsteren Gedanken, stand hastig auf und lief die steinernen Treppen zum Tempel empor. Der Weg war von prächtigen Bäumen und bunten Blumenbeeten gesäumt, doch dafür hatte ich in diesem Moment keine Augen. Er endete vor einem großen Tor, das von steinernen Löwen und Schlangen flankiert wurde. Ich atmete tief durch, dann betrat ich Wat Phnom.