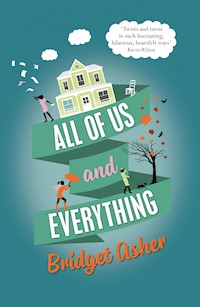4,99 €
1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wird sie sich trauen, nach dem Glück zu greifen? Der bewegende Roman »Die Liebe ist lavendelblau« von Bridget Asher jetzt als eBook bei dotbooks. Kann der Zauber der Provence ein gebrochenes Herz heilen? Die Konditorin Heidi hat anderen stets das Leben versüßt – bis zu dem dunklen Tag vor zwei Jahren, als sie ihren geliebten Mann bei einem tragischen Unfall verlor. In der Hoffnung, sie von ihrer Trauer abzulenken, bittet ihre Mutter sie, das Sommerhaus der Familie in Frankreich wieder auf Vordermann zu bringen. Gemeinsam mit ihrem Sohn reist Heidi in den sonnigen Süden – und fühlt sich abermals wie verzaubert von dem malerischen Häuschen aus ihrer Jugend zwischen wogenden Lavendelfeldern. Wird es ihr gelingen, hier wieder ins Leben zu finden ... und sich für neues Glück zu öffnen? Eine Frau mit gebrochenem Herzen, ein traumhaftes Haus in der Provence und ein Jugendfreund, der möglicherweise zur falschen Zeit am richtigen Ort ist: »Unfassbar romantisch!« People Magazine Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der einfühlsame Familien-Roman »Die Liebe ist lavendelblau« von Bridget Asher wird Fans von Julia Holbe und Cecilia Ahern begeistern. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Über dieses Buch:
Kann der Zauber der Provence ein gebrochenes Herz heilen? Die Konditorin Heidi hat anderen stets das Leben versüßt – bis zu dem dunklen Tag vor zwei Jahren, als sie ihren geliebten Mann bei einem tragischen Unfall verlor. In der Hoffnung, sie von ihrer Trauer abzulenken, bittet ihre Mutter sie, das Sommerhaus der Familie in Frankreich wieder auf Vordermann zu bringen. Gemeinsam mit ihrem Sohn reist Heidi in den sonnigen Süden – und fühlt sich abermals wie verzaubert von dem malerischen Häuschen aus ihrer Jugend zwischen wogenden Lavendelfeldern. Wird es ihr gelingen, hier wieder ins Leben zu finden ... und sich für neues Glück zu öffnen?
Eine Frau mit gebrochenem Herzen, ein traumhaftes Haus in der Provence und ein Jugendfreund, der möglicherweise zur falschen Zeit am richtigen Ort ist: »Unfassbar romantisch!« People Magazine
Über die Autorin:
Bridget Asher lebt mit ihrem Ehemann und ihren vier Kindern in Florida.
Bridget Asher veröffentlichte bei dotbooks bereits »Verlieben war nicht abgemacht«, »All die Frauen meines Mannes«.
Die Website der Autorin: https://juliannabaggott.com/books/bridget-asher/
***
eBook-Neuausgabe August 2023
Die amerikanische Originalausgabe erschien erstmals 2011 unter dem Originaltitel »The Provence-Cure for the Brokenhearted« bei Bantam Books, an imprint of The Random House Publishing Group, a division of Random House, Inc. Die deutsche Erstausgabe erschien 2012 unter dem Titel »Die Provence-Kur für gebrochene Herzen« bei Goldmann.
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 2011 by Bridget Asher
Copyright © der deutschen Erstausgabe 2012 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Copyright © der Neuausgabe 2023 dotbooks GmbH, München
This translation is published by arrangement with Bantam Books, an imprint of Random House, a division of Penguin Random House LLC
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ae)
ISBN 978-3-98690-766-2
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Die Liebe ist lavendelblau« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Bridget Asher
Die Liebe ist lavendelblau
Roman
Aus dem Amerikanischen von Antje Althans
dotbooks.
Die Liebe ist lavendelblau ist ein Roman.
Personen und Handlungen sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind rein zufällig.
Dieser Roman ist der Leserin gewidmet.
In diesem einzigartigen Moment gibt es nur uns zwei.
Prolog
Man kann es auch so ausdrücken: Schmerz ist eine Liebesgeschichte, die rückwärts erzählt wird.
Aber vielleicht stimmt das gar nicht. Vielleicht sollte ich es wissenschaftlicher formulieren. Die Liebe und der Verlust dieser Liebe existieren in gleichem Maße. Ist nicht schon einmal eine ähnliche Gleichung von einem romantischen Physiker aufgestellt worden?
Vielleicht sollte ich es lieber so erklären: Stellen Sie sich eine Schneekugel mit einem eingeschneiten Häuschen darin vor. In dem winzigen Haus sitzt eine Frau auf der Bettkante und schüttelt eine Schneekugel, in der wiederum ein eingeschneites Häuschen mit einer Frau zu sehen ist, die in der Küche steht und eine weitere Schneekugel schüttelt, in der sich …
In jeder guten Liebesgeschichte verbirgt sich eine andere.
Teil 1
Kapitel 1
Seit Henrys Tod hatte ich ständig irgendetwas verloren.
Ich verlor Schlüssel, Sonnenbrillen und Scheckbücher. Einmal verlegte ich einen Bratenheber und fand ihn mit einer Tüte geriebenem Käse im Gefrierschrank wieder.
Ich verschusselte eine Entschuldigung an Abbots Grundschullehrerin, in der ich ihr schilderte, wie mir die Hausaufgaben meines Sohnes abhandengekommen waren.
Ich verlor die Kappen von Zahnpastatuben und die Deckel von Marmeladengläsern und räumte die Sachen offen, unverschlossen weg, sodass sie austrockneten. Ich verlor Haarbürsten und Schuhe ‒ und zwar nicht nur einen, sondern gleich beide.
Ich vergaß Jacken in Restaurants, meine Handtasche unter dem Kinositz und meine Schlüssel im Drugstore an der Kasse. Danach saß ich orientierungslos im Auto, versuchte mir darüber klar zu werden, was genau nicht stimmte, und trottete zurück in den Laden, wo die Kassiererin den Schlüsselbund schon klimpernd hochhielt.
Ich bekam Anrufe von Menschen, die so liebenswürdig waren, mir die Sachen zurückzugeben. Und wenn sie nicht mehr auftauchten, verfolgte ich meine Schritte zurück und war völlig verwirrt. Was suche ich in diesem Mini Mart? Warum stehe ich schon wieder hier im Feinkostladen am Ladentisch?
Ich verlor den Überblick über die Aktivitäten meiner Freunde. Sie bekamen Babys, verteidigten Doktorarbeiten, veranstalteten Kunstausstellungen, Dinnerpartys und Grillfeste im Garten …
Vor allem bekam ich über lange Zeitspannen nichts mit. Die Kinder an Abbots Bushaltestelle, in unserem Viertel, in seiner Klasse und in seiner Little-League-Mannschaft hörten nicht auf zu wachsen. Auch Abbot wuchs. Das war am schwersten zu ertragen.
Auch über kurze Zeitspannen bekam ich nichts mit. Manchmal blickte ich auf, und es war plötzlich dunkel, als hätte jemand einen Schalter ausgeknipst. Das Leben ging auch ohne mich unaufhaltsam weiter. Diese Erkenntnis überraschte mich sogar noch zwei Jahre später, obwohl diese schlichte, unausweichliche Tatsache zu dem Zeitpunkt schon zur Gewohnheit geworden war: Das Leben ging unaufhörlich weiter, nur ich blieb stehen.
Deshalb hätte es mich nicht verwundern sollen, dass Abbot und ich es am Morgen der Hochzeit meiner Schwester nicht rechtzeitig zum Brautjungfern-Treffen schafften. Wir hatten den ganzen Morgen Apples to Apples gespielt. Mehrfach mussten wir das Spiel unterbrechen, weil Jude vom Cake Shop anrief.
»Jude … Nun mal langsam, Jude. Fünfhundert Zitronentörtchen?« Ich erhob mich von der Couch, wo Abbot neben mir saß und schon sein drittes Wassereis schleckte ‒ eins von diesen knallbunten, die in Plastikschläuchen abgepackt sind und die man oben mit der Schere aufschneiden muss und von denen man manchmal einen Hustenreiz kriegt. Selbst dieses Detail erfüllt mich mit Schmerz: Abbot und ich waren so tief gesunken, dass wir uns von gefrorenem Saft aus Plastikverpackungen ernährten. »Nein, nein, ganz bestimmt«, fuhr ich fort. »Ich hätte mir die Bestellung doch notiert. Wenigstens … Scheiße. Das ist wahrscheinlich meine Schuld. Soll ich vorbeikommen?«
Henry war nicht nur mein Mann gewesen, sondern auch mein Geschäftspartner. Ich hatte von Kindesbeinen an erlesenes Gebäck hergestellt und Essen für Kunst gehalten, doch Henry hatte mich überzeugt, dass Essen Liebe ist. Wir hatten uns auf der Kochschule kennen gelernt und kurz nach Abbots Geburt eine weitere Liebesmüh auf uns genommen: den Cake Shop.
Jude war von Anfang an dabei gewesen. Sie war eine alleinerziehende Mutter, zierlich, mit einer großen Klappe, kurzen, gebleichten Haaren und einem herzförmigen Gesicht ‒ eine merkwürdige Kombination aus Schönheit und Härte. Sie war unsere erste Angestellte und verfügte über natürliches Talent, einen großartigen Sinn für Formgebung und Know-how in Marketing. Nach Henrys Tod übernahm sie das Ruder. Bis dahin hatte Henry die geschäftlichen Dinge geregelt, und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den Laden hätte abschreiben können, wenn Jude nicht gewesen wäre. Jude wurde zur treibenden Kraft, zu meinem Steuermann. Sie hielt alles am Laufen.
Ich wollte Jude gerade versichern, dass ich in einer halben Stunde bei ihr im Laden sein würde, als Abbot mich schüchtern am Ärmel zupfte. Er deutete auf seine Armbanduhr, deren Ziffernblatt die Form eines Baseballs hatte. Vielleicht bestand er wegen meiner leichten geistigen Abwesenheit darauf, die Uhrzeit selbst im Blick zu haben.
Als mir klar wurde, dass es schon nach zwölf war, rief ich entsetzt: »Die Hochzeit! Es tut mir schrecklich leid! Ich muss weg!«, und legte auf.
»Tante Elysius ist bestimmt echt sauer!«, prophezeite Abbot und riss dabei die Augen weit auf. Er beugte sich vor und kratzte sich am Fußknöchel, wo ihn eine Mücke gestochen hatte. Er trug seine kurzen weißen Sportsocken, und was an seinem Knöchel wie Golferbräune aussah, war in Wahrheit Schmutz.
»Nicht, wenn wir uns sputen!«, widersprach ich. »Und nimm dir Galmeilotion mit, damit es dich während der Zeremonie nicht juckt.«
Wir rannten wie die Wahnsinnigen durch unseren kleinen Drei-Zimmer-Bungalow. Einen Stöckelschuh fand ich im Wandschrank wieder und den anderen in Abbots Zimmer in dem großen Eimer mit Legosteinen. Derweil rang Abbot mit seinem geliehenen Smoking. Er kämpfte mit den winzigen Manschettenknöpfen und suchte nach der Clip-Fliege und dem Kummerbund. Er hatte sich für Rot entschieden, weil es die Farbe war, die Henry auf unserer Hochzeit getragen hatte. Ich war mir nicht sicher, ob das gesund war, wollte aber die Aufmerksamkeit nicht unnötig darauf lenken.
Ich schminkte mich hastig und zog mir das Brautjungfernkleid über den Kopf, voller Dankbarkeit, dass das Kleid nicht der sonst übliche Alptraum war. Meine Schwester hatte einen erlesenen Geschmack, und es war das teuerste Kleid, das ich je getragen hatte, mein eigenes Hochzeitskleid inbegriffen.
Als ich mich geweigert hatte, den Part von Elysius’ verheirateter Trauzeugin zu übernehmen ‒ oder, wenn man es mit brutaler Präzision ausdrücken wollte ‒ den der verwitweten Trauzeugin? ‒, war meine Schwester sichtlich erleichtert gewesen. Sie wusste, dass ich sowieso nur alles vermasselt hätte. Im Nu hatte sie eine alte Studienfreundin mit einem Abschluss in Marketing angerufen, und ich wurde freudig zur Brautjungfer degradiert. Abbot war als Ringträger verpflichtet worden, und um ehrlich zu sein, fühlte ich mich nicht einmal der Rolle als Mutter des Ringträgers gewachsen. Ich hatte mir in letzter Minute noch eine Ausrede einfallen lassen, um dem Probeessen am Abend zuvor und der Wellness-Behandlung samt Gruppenfrisörtermin am heutigen Tag zu entgehen. Wenn einem der Mann gestorben ist, darf man einfach sagen: »Ich schaff das nicht. Es tut mir schrecklich leid.« Und wenn er bei einem Autounfall umgekommen ist, so wie meiner, darf man sogar sagen: »Ich kann heute einfach nicht fahren.« Man darf einfach den Kopf schütteln und »Verzeihung!« flüstern, und die Leute verzeihen einem sofort, als sei es das Mindeste, was sie für einen tun können. Und vielleicht stimmt das ja auch.
Aber meine Schwester fand das sehr zermürbend, weshalb sie mir das Versprechen abgenommen hatte, zwei Stunden vor der Hochzeit bei ihr zu Hause zu erscheinen. Es gab einen strengen Zeitplan, den wir einhalten mussten; auch ein Mimosas-Umtrunk für alle Brautjungfern gehörte dazu, bei dem jede von uns einen kleinen persönlichen Trinkspruch auf die Braut ausbringen sollte. Elysius gefällt es, wenn sich alles um sie dreht. Ich konnte sie deshalb nicht verurteilen; mir war nur allzu schmerzhaft bewusst, wie egoistisch mein eigener Schmerz war. Mein achtjähriger Sohn hatte seinen Vater verloren. Henrys Eltern ihren Sohn. Und Henry sein Leben. Welches Recht hatte ich also, Henrys Tod ‒ ein ums andere Mal ‒ als Vorwand zu benutzen, um mich auszuklinken?
»Darf ich meine Schnorchelsachen mitnehmen?«, rief Abbot mir über den Flur zu.
»Pack deine Reisetasche, und nimm die Ausrüstung mit«, rief ich zurück, während ich ein paar Sachen in meinen kleinen Koffer stopfte. Meine Schwester wohnte zwar nur zwanzig Minuten von uns entfernt ‒ eine kurze Autofahrt von Tallahassee in die ländliche Gegend von Capps ‒, hatte sich aber gewünscht, dass ihre Familie über Nacht blieb. Das war eine gute Gelegenheit, sowohl die Aufmerksamkeit meiner Mutter als auch meine auf sich zu ziehen und sie so lange wie möglich auszukosten ‒ und um die starke Bindung, die früher zwischen uns dreien existiert hatte, wieder zu festigen. »Du kannst morgen früh mit Opa schnorcheln.«
Immer noch in Sportsocken, kam Abbot aus seinem Zimmer gerannt und schlitterte, in einer Hand den Kummerbund, in der anderen die Clip-Fliege, über den Flur bis zu meiner Tür.
»Ich krieg die nicht fest!«, jammerte er. Der gestärkte Hemdkragen reichte bis an seine Wangen, wie einmal an Halloween, als er sich als Graf Dracula verkleidet hatte.
»Mach dir deshalb keinen Kopf. Pack einfach alles ein.« Ich nestelte hektisch am Verschluss der Perlenkette herum, die meine Mutter mir extra für diesen Anlass geliehen hatte. »Da gibt es bestimmt genug aufgekratzte Frauen, die nichts Besseres zu tun haben. Die helfen dir beim Zurechtmachen.«
»Und wo bist du dann?«, fragte er mit ängstlichem Unterton. Seit Henrys Tod machte sich Abbot ständig Sorgen. Er hatte angefangen, sich die Hände zu reiben, ein neuer Spleen ‒ eine leichte Zwangsneurose, die Pantomime intensiven Händewaschens. Er war zum Bakterienphobiker geworden. Wir hatten deshalb schon einen Therapeuten konsultiert, aber das hatte nicht geholfen. Er machte das, wenn er nervös war und wenn er spürte, dass ich grübelte. Ich bemühte mich zwar, in seiner Gegenwart nicht zu grübeln, doch ich war nicht gut darin, die Fröhliche zu mimen, und meine gespielte Fröhlichkeit machte ihn noch nervöser als meine Grübelei ‒ ein echter Teufelskreis. Fühlte er sich nach dem Tod seines Vaters schutzloser auf dieser Welt? Ich mich schon.
»Ich bin bei den anderen Brautjungfern und erfülle brautjüngferliche Pflichten«, beruhigte ich ihn. In dem Moment fiel mir siedend heiß ein, dass ich meinen Trinkspruch bereithalten sollte. Ich hatte ihn mir in der Küche auf einer Serviette notiert und seither natürlich vergessen, und jetzt konnte ich mich an nichts mehr erinnern. »Was soll ich denn Nettes über Tante Elysius sagen? Ich muss mir für den Trinkspruch etwas einfallen lassen.«
»Sie hat strahlend weiße Zähne und kauft super Geschenke«, meinte Abbot.
»Schönheit und Großzügigkeit«, überlegte ich. »Daraus kann ich was machen. Alles wird gut. Wir haben bestimmt viel Spaß!«
Er sah mich prüfend an, um festzustellen, ob ich es ehrlich meinte, so wie ein Anwalt vielleicht seinen Mandanten anschaut, weil er herausfinden will, worauf er sich wirklich einlässt. Diese prüfenden Blicke war ich gewohnt. Meine Mutter, meine Schwester, meine Freunde, sogar die Kunden im Cake Shop erkundigten sich nach meinem Befinden und bemühten sich, die Aufrichtigkeit meiner Worte einzuschätzen. Ich wusste ja, dass ich nach vorne hätte blicken sollen. Ich hätte mehr arbeiten, mich gesünder ernähren, Sport treiben und mich mit Männern verabreden sollen. Immer wenn ich aus dem Haus ging, musste ich mich auf einen Überfall irgendeines wohlmeinenden Bekannten gefasst machen, der mich mit Mitleid, aufmunternden Worten, Fragen und Ratschlägen überhäufte. Ich übte schon vorher: »Nein, wirklich, mir gehts gut. Abbot und mir geht es großartig!«
Ich verabscheute es auch, dass ich mich dieses Mitleids stets vor Abbot erwehren musste. Ich wollte ehrlich zu ihm sein und ihn zugleich beschützen. Doch natürlich war ich nicht ehrlich. Es war seit Henrys Tod die erste Hochzeit, zu der ich ging. Ich hatte schon immer auf Hochzeiten geweint, selbst bei Leuten, die ich nicht gut kannte, sogar bei Trauungen im Fernsehen. Deshalb fürchtete ich mich jetzt vor mir selbst. Wenn ich schon bei einer Werbespot-Hochzeit heulte, wie würde ich dann erst auf eine echte reagieren?
Ich konnte Abbot nicht ansehen. Wenn ich es täte, wüsste er, dass ich ihm was vormachte. Wir haben bestimmt viel Spaß? Ich hoffte, dass ich das Ganze einfach nur überlebte.
Ich stellte mich vor den bodenlangen Spiegel, den Henry auf der Innenseite meiner Wandschranktür angebracht hatte. Henry war überall, doch wenn mich eine Erinnerung übermannte ‒ der Spiegel war umgekippt, als er ihn montieren wollte, und wäre fast zerbrochen ‒, versuchte ich, nicht bei ihr zu verweilen. Verweilen war eine Schwäche. Ich wusste, wie man sich auf kleine, überschaubare Dinge konzentrierte. Und nun versuchte ich ‒ ein letzter verzweifelter Versuch ‒ mir mit Hilfe meines Spiegelbilds die Perlenkette anzulegen.
»Ungeschminkt gefällst du mir besser«, meinte Abbot.
Mir flutschte die Kette weg, die sich in meiner hohlen Hand zusammenrollte. War es möglich, dass er sich an eine ganz ähnliche Bemerkung seines Vaters erinnerte? Henry hatte immer gesagt, er liebe es, wenn mein Gesicht nackt sei; manchmal flüsterte er mir zu: »So wie der Rest von dir«. Ich sah so viel älter aus als vor zwei Jahren. Das Wort gramerfüllt kam mir in den Sinn ‒ als könnte Gram einen Menschen buchstäblich erfüllen und ihn unwiderruflich verändern. Ich wandte mich an Abbot.
»Komm mal her«, bat ich ihn. »Lass dich mal anschauen.«
Ich legte die Perlenkette auf den Nachttisch, klappte Abbots Kragen herunter, strich ihm die Haare glatt und legte die Hände auf seine knöchrigen Schultern. Dann betrachtete ich in Ruhe meinen Sohn ‒ seine blauen Augen mit den dunklen Wimpern, er sah seinem Vater so ähnlich. Obwohl er noch ein kleiner Junge war, hatte er Henrys gebräunte Haut und seine roten Wangen. Ich liebte sein knubbeliges Kinn und die zwei überdimensionalen oberen Schneidezähne, die in seinem immer noch so kleinen Mund äußerst seltsam wirkten. »Du siehst sehr gut aus«, sagte ich. »Sensationell.«
»Wie ein sensationeller Ringträger?«
»Genau«, sagte ich.
Bevor Abbot und ich am Ende der kurvenreichen Kiesauffahrt einen Parkplatz fanden, mussten wir unser Auto um eine Vielzahl von Lieferwagen herummanövrieren: den Lieferwagen vom Caterer, vom Floristen und vom Toningenieur. Die Auffahrt lief am Pool und am Sandtennisplatz vorbei und ging zwischen dem neu erbauten Atelier und der alten Scheune in Rasen über. Elysius heiratete einen landesweit bekannten, sehr netten und zurückhaltenden Künstler namens Daniel Welding, und obwohl die beiden hier jetzt schon seit acht Jahren gemeinsam lebten, machte mich die Erhabenheit des Anwesens, das sie ihr Zuhause nannte, stets sprachlos ‒ und heute war es sogar noch atemberaubender. Die Trauung selbst sollte auf dem abschüssigen Rasen abgehalten werden, den Abbot und ich jetzt, so rasch wir konnten, hinaufmarschierten. Er war von langen Stuhlreihen gesäumt, die mit Tüllstoff dekoriert waren, und der Austausch der Ehegelübde sollte an dem Springbrunnen im japanischen Stil stattfinden. Ein Spalier war als Überdachung aufgestellt worden, in das Blumen eingeflochten waren. Unter einem riesigen dreieckigen weißen Zelt hatte man ein provisorisches Tanzparkett errichtet.
Abbot hatte seine Sachen in einem Stoffbeutel verstaut, den er gratis in der Stadtbibliothek bekommen hatte. Ich konnte sehen, dass er den Kummerbund und die Clip-Fliege achtlos zwischen seine Schnorchelausrüstung gestopft hatte ‒ das Schnorchelrohr, die Tauchermaske und die Tauchflossen, alles Geschenke meines Vaters. Ich hingegen mühte mich ab, meinen kleinen Rollkoffer hinter mir herzuziehen. Er holperte hinter mir her wie ein alter, halsstarriger Hund.
Wir eilten zum Atelier, um dort unser Gepäck abzuladen, doch es war zugesperrt. Abbot legte die Hände trichterförmig an die Glasscheibe und spähte hinein. Daniel malte auf gewaltigen Leinwänden, und sein freistehendes Atelier verfügte über hohe Decken und einen Leinwandständer, den man im Fußboden versenken konnte. Auf diese Art und Weise musste er nicht auf schwankende Leitern steigen, um an die höheren Stellen zu gelangen. Im Loft stand ein Sofa, das sich zu einem Doppelbett ausziehen ließ, auf dem Daniel sich manchmal mittags ausruhte und auf dem Abbot und ich heute Nacht schlafen sollten. Daniels Arbeiten verkauften sich unglaublich gut, weshalb er sich auch das Haus, die zwei Auffahrten, den abschüssigen Rasen und den versenkbaren Leinwandständer leisten konnte.
»Er ist da drin!«, sagte Abbot.
»Das kann nicht sein. Heute ist sein Hochzeitstag.«
Doch als Abbot klopfte, erschien Daniel hinter der Glastür und öffnete sie weit. Er war breitschultrig, immer braun gebrannt, und seine Haare hatten einen Anflug von Silbergrau. Er hatte eine majestätische Nase, leicht gekrümmt und unförmig ‒ ein elegantes Gesicht. Er nahm seine Brille ab, presste das Kinn auf die Brust, sodass es sich zusammenfaltete wie ein kleines Akkordeon, und musterte mich in meinem unordentlichen, aber schönen Kleid und Abbot in seinem noch unfertig ausstaffierten Smoking. Er lächelte breit. »Ich freue mich sehr, dass ihr hier seid! Abbot, wie gehts?« Er zog den Jungen an sich und umarmte ihn ungestüm. Genau das brauchte Abbot, ungestüme Umarmungen und Zuneigung von väterlichen Typen. Ich war gut darin, ihm Küsse auf die Stirn zu drücken, merkte ihm aber an, wie glücklich es ihn machte, wenn Daniel ihn hochhob. Abbot strahlte übers ganze Gesicht. Mich umarmte Daniel auch. Er roch nach teuren Pflegeprodukten, -Haargels und importierten Seifen.
»Darfst du überhaupt hier sein?«, fragte ich. »Du bist angezogen, als wärst du von einer Hochzeitsparty abgehauen.«
Abbot lief um Daniel herum und betrat das Atelier, wie er es immer tat ‒ mit ehrfurchtsvoller Miene. Er liebte die schmale Treppe zum Loft, die Espressomaschine, die freiliegenden Balken, und natürlich die riesigen Leinwände in verschiedenen Entwicklungsstadien, die an den Wänden lehnten.
»Ich hatte einen Einfall, deshalb hab ich kurz mal reingeschaut«, erklärte Daniel. »Es beruhigt mich, wenn ich mir meine Arbeiten ansehe.«
»Solltest du nicht Schuhe anhaben?«, fragte Abbot.
»Ähm, ja.« Er deutete auf ein Paar nur wenige Meter entfernt. »Wenn mein Anzug Farbe abkriegt, ist das eine Sache, aber die Schuhe sind handgefertigt. Ein Schuster in der Wüste hat mich dafür barfuß in Mehl treten lassen und mit Hilfe des Abdrucks Schuhe speziell für meine Füße angefertigt.« Solche Abenteuer erlebten er und Elysius immer ‒ ein Schuster in der Wüste, der nackte Füße in Mehl maß.
Abbot rannte neugierig zu den Schuhen, fasste sie aber nicht an. Ich wusste, dass er sie gern anfassen wollte, aber mit Schuhen stapft man auf der Erde herum, und der Boden ist mit Bakterien übersät. Er hätte sich prompt im Bad die Hände schrubben müssen. Das simulierte Händewaschen hätte da nicht ausgereicht.
»Wo ist Charlotte?«, erkundigte sich Abbot, als er sich wieder den Gemälden zuwandte. Charlotte war Daniels Tochter aus erster Ehe. Daniel hatte eine schlimme Scheidung und einen hässlichen Sorgerechtsstreit um Charlotte durchgemacht und sich eigentlich geschworen, nie wieder zu heiraten ‒ nicht aus Zynismus, sondern weil er ein gebranntes Kind war. Doch wenige Monate nach Henrys Tod hatte er einen Sinneswandel erlebt. Natürlich bestand da eine Wechselwirkung: Was war geeigneter, in jemandem den Wunsch nach Festigung seiner Liebe auszulösen, als eine Mahnung daran, wie zerbrechlich das Leben ist?
»Sie ist oben im Haus«, antwortete er. An mich gewandt, fügte er hinzu: »Und versucht, nicht aufzufallen.«
»Wie geht es ihr?«, fragte ich. Charlotte war sechzehn und machte gerade eine Punk-Phase durch, die Elysius beunruhigte, auch wenn der Begriff Punk längst veraltet war. Heutzutage gab es für alles neue Bezeichnungen.
»Sie büffelt für den Uni-Zulassungstest, aber, ich weiß nicht, sie kommt mir ein bisschen … verdrießlich vor. Nun, ich sorge mich um sie. Ich bin ihr Vater. Ich sorge mich eben. Du weißt, was ich meine.« Er sah mich an wie eine Mitverschwörerin. Damit signalisierte er mir, dass ich ‒ anders als Elysius ‒ das Elterndasein in- und auswendig kannte. Und das konnte er nur auf indirekte Art zugeben.
»Und was soll das hier sein?«, fragte Abbot. Die Gemälde waren ausnahmslos abstrakt, auf sehr chaotische Weise, doch Abbot verharrte vor einem besonders wirren, mit groben, schweren Linien. Es wirkte hoffnungslos und schwermütig, als wäre in dem Gemälde ein Vogel gefangen ‒ ein Vogel, der sich befreien wollte.
Daniel warf einen Blick darauf.
»Ein Boot, weit draußen, mit vollen Segeln«, sagte er. »Und Verlust.«
»Du musst positiver denken!«, sagte ich leise zu Daniel.
Er legte mir die Hand auf die Schulter.
»Das musst du gerade sagen«, flüsterte er. »Entwirfst du neue Kreationen?« Ich fühlte mich stets geehrt, dass Daniel meine Arbeit als Konditorin als Kunst betrachtete. Sein Kunstverständnis war nicht elitär. Er glaubte, dass Kunst für alle Menschen da ist, und schwärmte stets von meiner Arbeit. Und in diesem Moment sprach er als Künstler zu mir. »Du musst wieder anfangen, etwas zu kreieren. Es gibt keine bessere Methode, um zu trauern.«
Ich war überrascht, wie freiheraus er das sagte, aber auch erleichtert. Ich hatte das ewige Mitgefühl satt.
»Ich habe noch nicht wieder angefangen«, murmelte ich.
Er nickte ernst.
»Abbot«, rief ich. »Wir müssen los.«
Enttäuscht kam Abbot zu mir. Zu Daniel sagte er:
»Deine Gemälde machen einen traurig, ohne dass man weiß, warum.«
»Eine großartige Definition von moderner Kunst«, sagte Daniel.
Abbot lächelte erfreut und rieb sich die Hände; dann, als wäre es ihm selbst aufgefallen, steckte er sie rasch in die Hosentaschen. Daniel hatte nichts bemerkt. Abbot lernte, sein Problem zu kaschieren. War das nun ein Rück- oder ein Fortschritt?
»Ich verpasse noch die Mimosas«, sagte ich.
Daniel betrachtete ein unvollendetes Gemälde. Dann wandte er sich an mich.
»Heidi«, er zögerte, »ich musste die Hochzeitsreise ein paar Tage verschieben, um Arbeiten für eine Ausstellung fertigzustellen. Elysius ist deshalb in Aufruhr. Erinnerst du sie daran, dass ich ein netter Mensch bin, wenn du sie siehst?«
»Mach ich«, versprach ich. »Können wir das hierlassen?«, fragte ich und warf einen Blick auf meinen Koffer und Abbots Tasche.
»Natürlich«, sagte er.
»Komm mit, Abbot«, sagte ich und entwirrte seine Fliege und seinen Kummerbund aus der Schnorchelausrüstung.
Abbot rannte zur Tür.
»Es ist wirklich schön, euch zwei zu sehen«, sagte Daniel.
»Freu mich auch, dich zu sehen«, erwiderte ich. »Und Glückwunsch zur Fast-Hochzeit!«
Da Elysius und Daniel hier schon seit acht Jahren zusammen lebten, kam mir die Hochzeit wie eine merkwürdige Nachlese vor. Für mich waren die beiden nicht nur verheiratet, sondern sie führten eine dauerhafte Ehe. Für meine Schwester hingegen war die Hochzeit von großer Bedeutung, und als ich an der saftig grünen Rasenfläche mit den Streifen entlanglief, die der Aufsitzmäher hinterlassen hatte, hatte ich Schuldgefühle, weil ich emotional so distanziert war.
Ich hätte zumindest einwilligen können, ihre Hochzeitstorte zu backen. Schließlich hatte ich einmal wachsendes Ansehen als Spitzen-Tortendesignerin genossen. Noch heute rufen Menschen aus ganz Florida wegen einer Bestellung mehr als ein Jahr im Voraus im Cake Shop an. Hochzeiten waren meine Spezialität. Doch nach Henrys Tod hatte ich mich nur noch darauf beschränkt, in den frühen Morgenstunden die Cupcakes und Lemon Squares zu backen und ansonsten hinter dem Ladentisch zu stehen. Den Bräuten hatte ich abgeschworen ‒ sie waren mir zu überheblich, gingen zu sehr in dem Ereignis auf. Sie erschienen mir undankbar, weil sie die Liebe für selbstverständlich hielten. Doch jetzt war es mir peinlich, dass ich Elysius und Daniel nicht angeboten hatte, ihre Hochzeitstorte zu backen. Das war mein Talent, das Einzige, was ich zu geben hatte.
Ich blickte zur Fensterfront hinauf, zur Küche und zum Esszimmer, beides hell und golden erleuchtet, und blieb stehen.
»Was ist?«, fragte Abbot.
Am liebsten hätte ich auf dem Absatz kehrtgemacht und wäre nach Hause gegangen. War ich für eine Hochzeit überhaupt bereit? Mir schoss der Gedanke durch den Kopf, dass ich mich momentan in meinem Leben genauso wie jemand fühlte, der auf einer Rasenfläche vor einem riesigen Haus steht und in die wunderschönen Fenster blickt, hinter denen andere Menschen ihr Leben leben, Blumen in Vasen stellen, sich vor dem Spiegel die Haare kämmen und unbeschwert lachen. Und dies hier war das Leben meiner Schwester, übersprudelnd und randvoll.
»Nichts«, beruhigte ich Abbot. Ich schnappte mir seine Hand und drückte sie. Er drückte auch meine Hand, ging weiter und zog mich zum Haus ‒ das so voller Leben war.
In dem Moment wurde die Hintertür weit aufgerissen, und meine Mutter trat heraus. Ihre Haare waren ein honigsüßes Konfekt und zu ihrem Markenzeichen, einem Chignon, gedreht, ihr Gesicht auf eine Art glasiert, die sie »taufrisch und jung« aussehen ließ, was sie teuren Lotionen zuschrieb. Meine Mutter alterte wunderschön. Sie hatte einen langen, eleganten Hals, volle Lippen und bogenförmige Augenbrauen. Es ist merkwürdig, von jemandem großgezogen zu werden, der so viel schöner ist, als man es je sein wird. Sie war von königlicher Schönheit, doch im Kontrast zu dieser königlichen Haltung erschien ihre Verletzlichkeit ausgeprägter ‒ man nahm eine gewisse sanfte Müdigkeit in ihrer Mimik wahr.
Ihr Blick fiel auf mich und Abbot.
»Man hat mich losgeschickt, um euch zu suchen.«
Meine Schwester schickte meine Mutter los, um mich zu suchen? Das verhieß nichts Gutes.
»Wie spät sind wir dran?«, fragte ich.
»Du meinst, wie wütend ist deine Schwester?«
»Hab ich die Mini-Trinksprüche verpasst?«, fragte ich hoffnungsvoll.
Meine Mutter antwortete nicht. Sie kam über die Veranda und die kleine Treppe herab zu uns geeilt, wobei ihr toffeefarbenes Kleid raschelte. Es hatte einen eleganten Schnitt, der ihr Schlüsselbein zur Geltung brachte. Meine Mutter ist zur Hälfte Französin und schwört auf Eleganz.
»Ich musste raus aus diesem Haus!«, sagte sie. »Und du warst mein Vorwand. Direkter Befehl, dich zu suchen und dir Beine zu machen.« Sie wirkte aufgewühlt, vielleicht sogar leicht weinerlich. Hatte sie wirklich geweint? Meine Mutter ist eine Frau, die zu tiefen Gefühlen fähig ist, aber sie weint nicht so leicht. Sie ist die Verkörperung des Begriffs aktive Seniorin ‒ sie gibt sich den Anschein, stets beschäftigt zu sein, um erfüllt zu wirken, hat mir jedoch stets den Eindruck einer Frau vermittelt, die kurz vorm Explodieren ist. Einmal ist sie dann ja auch explodiert und einen Sommer lang verschwunden, kam jedoch zu uns zurück. Trotzdem, wenn eine Mutter sich einmal ohne dich verdrückt hat ‒ selbst wenn sie damit recht hatte ‒, fragt man sich den Rest seines Lebens, ob sie es vielleicht wieder tut. Jetzt richtete sie ihre Aufmerksamkeit auf Abbot. »Du bist so ein hübscher Junge!«
Er errötete. Meine Mutter hatte diese Wirkung auf alle ‒ Briefträger, die kurz vor den Feiertagen gestresst waren, Piloten, die am Ende des Fluges aus dem Cockpit heraustraten, um sich zu verabschieden, sogar auf schnöselige Oberkellner.
»Und du?«, sagte sie und strich mir die Haare über die Schulter zurück. »Wo sind die Perlen?«
»Mir fehlt noch der letzte Schliff«, gab ich zu. »Wie geht es Elysius?«
»Sie wird dir verzeihen«, sagte meine Mutter leise. Meine Mutter wusste, dass es schwer für mich war ‒ die eine Tochter bekam einen Ehemann, die andere hatte ihren verloren ‒, und war deshalb bemüht, mich mit Samthandschuhen anzufassen.
»Es tut mir sehr leid, dass wir zu spät sind«, sagte ich schuldbewusst. »Ich habe das Zeitgefühl verloren. Abbot und ich waren …«
»Mit der Rede für Tante Elysius beschäftigt«, fiel mir Abbot ins Wort. »Ich hab ihr geholfen!« Auch er wirkte schuldbewusst ‒ mein Mitverschwörer.
Meine Mutter schüttelte den Kopf. Ihr stiegen Tränen in die Augen.
»Ich bin so durcheinander!«, sagte sie und versuchte, die Falten an ihrem Kleid glattzustreichen. Dann lachte sie eigenartig. »Keine Ahnung, warum ich so reagiere!« Sie kniff sich in die Nase, als wollte sie sich vom Weinen abhalten.
»Worauf denn?«, fragte ich, von ihrem plötzlichen Gefühlsausbruch überrascht. »Auf die Hochzeit? Hochzeiten sind irre. Sie wühlen viele …«
»Es ist nicht wegen der Hochzeit«, widersprach meine Mutter. »Sondern wegen dem Haus. Unserem Haus … in der Provence. Es gab dort einen Brand.«
Kapitel 2
Als wir noch Kinder waren, fuhren meine Schwester und ich jedes Jahr mit meiner Mutter in unser Haus in der Provence ‒ kurze Sommeraufenthalte, an denen mein Vater, ein Workaholic, aus Zeitgründen nicht teilnahm. Dann fuhr meine Mutter für einen Sommer allein hin, und seither waren wir nie mehr dort gewesen. Als meine Mutter im Garten meiner Schwester zu weinen anfing, umarmte sie mich, und ich drückte sie kurz an mich. Ich erinnerte mich an das Haus, wie ein Kind sich an ein Haus erinnert, aus eigenartigen Blickwinkeln, ein Sammelsurium seltsamer Details: dass an den Fenstern die Fliegengitter fehlten, dass die kleinen Innentüren launische Drehknäufe hatten, die scheinbar ein- und ausrasteten, wie es ihnen passte. An den Gartenwegen um das Haus herum sammelten sich auf den hohen wilden Gräsern offenbar weiße Blüten, doch als ich mich hinabbeugte, erkannte ich, dass es winzige Schnecken waren, ihre weißen Häuser hatten aufgeprägte zarte Spiralen.
Das Haus und alles darin schienen praktisch zeitlos zu sein, doch vielleicht wäre es präziser zu sagen, dass es voller Zeit war ‒ eine Zeitschicht über der anderen. Ich erinnerte mich an die Küche, die den langen, schmalen Esszimmertisch beherbergte, umgeben von bunt zusammengewürfelten Stühlen ‒ jeder ein Überlebender aus einer anderen Epoche. Die kleine, niedrige Küchenspüle war aus einer massiven Marmorplatte gefertigt, braun und gesprenkelt wie ein Ei. Sie gehörte noch zur ursprünglichen Ausstattung des Hauses, das im 18. Jahrhundert am Rand eines kleinen Weinbergs erbaut worden war. In den 1920er-Jahren war im Garten ein Springbrunnen errichtet worden, voll mit knallorangen, riesigen Koi-Karpfen, an dem schmiedeeiserne Gartenstühle und ein Tischchen mit einer weißen, vom Wind geblähten Decke standen. Das Haus lag fünfzehn Autominuten von Aix-en-Provence entfernt und schmiegte sich in den Schatten der langen gezackten Rückseite des Mont Sainte-Victoire. Seit dem Tod ihrer Eltern, als sie Mitte zwanzig gewesen war, gehörte es meiner Mutter.
Wenn wir dort waren, erzählte uns meine Mutter Geschichten über das Haus, vor allem Liebesgeschichten, die sehr unglaubwürdig klangen. Obwohl ich sie immer glauben wollte, erschienen sie mir schon als Kind suspekt. Und trotzdem klammerte ich mich an sie. Nachdem sie uns abends Geschichten erzählt hatte, erzählte ich sie mir stets noch einmal. Ich flüsterte sie in meine hohlen Hände und spürte die Wärme meines Atems, als könnte ich die Geschichten dort festhalten und bewahren.
Ich konnte mir uns drei immer noch in einem der Schlafzimmer im Obergeschoss vorstellen, meine Mutter, wie sie auf der Bettkante saß oder zum Fenster schlenderte, wo sie sich in die kühle Nacht hinauslehnte. Elysius und ich breiteten unsere Haare, noch feucht vom Baden, auf unseren weißen Kissen aus, sodass sie wirkten wie nasse Heiligenscheine. Die Zikaden lärmten, wurden abwechselnd lauter und leiser.
»Am Anfang«, begann meine Mutter immer ‒ denn die erste Geschichte betraf die Geburt des Hauses, als hätte ihre Familie erst existiert, als das Haus aus Steinen erbaut wurde ‒ und erzählte die Anekdote eines unserer Vorfahren, eines jungen Mannes, der einer Frau einen Heiratsantrag gemacht hatte. Er war verliebt, es war die große Liebe. Doch die Frau gab ihm einen Korb. Ihre Angehörigen waren dagegen; sie fanden ihn ihrer nicht würdig. Also baute der junge Mann das Haus, Stein um Stein, ganz auf sich gestellt, Tag und Nacht, ein Jahr lang schlief er nicht. Er fieberte vor Liebe. Er konnte nicht aufhören. Er schenkte ihr das Haus ‒ und sie verliebte sich so heftig in das Haus und in den Mann, dass sie sich ihrer Familie widersetzte und ihn heiratete. Doch da er das Haus in einem solchen Liebeswahn gebaut hatte, war er krank und schwach, und so päppelte sie ihn im ersten Jahr ihrer jungen Ehe wieder auf und brachte ihn mit Pistou, Brot und Wein zurück ins Leben. Sie wurden hundert Jahre alt. Als der Mann starb, war die Frau so untröstlich, dass sie ihm innerhalb einer Woche folgte.
Wir sollten begreifen, dass der Hausbau ein Akt der Liebe gewesen war. Eine erstaunliche Geschichte, nicht wahr? Ein wenig zu gewichtig für zwei kleine Mädchen. Doch es gab noch andere.
Meine Urgroßeltern besaßen in Paris ein kleines Schuhgeschäft und konnten keine Kinder bekommen. Eines Tages, es war Winter, wurde meine Urgroßmutter zurück ins Haus beordert, um eine altjüngferliche Tante zu pflegen. Aber sie waren so verliebt, dass mein Urgroßvater es nicht ertragen konnte, von ihr getrennt zu sein. Eines Abends stand er vor der Tür und blieb eine Woche. Jede Nacht hörten sie das gespenstische Zirpen der Zikaden ‒ die im Winter eigentlich keinen Mucks machen. Und sie zeugten ein Kind ‒ und danach noch sechs weitere.
Und so machte man uns weis, dass das Haus die Liebe offenbaren konnte. Dass es Wunder bewirken konnte.
Die älteste Tochter des Paares, meine Großmutter, hielt sich als junge Frau zur Zeit der Feiern zu Kriegsende in Paris auf. Sie war eigensinnig und ungestüm. In den Menschenmassen um den Place de l’Opera herum traf sie einen jungen amerikanischen GI. Er küsste sie leidenschaftlich, doch dann verschoben sich die Massen wie Gezeiten, und sie wurden getrennt. Sie versuchten, sich zu finden, waren jedoch in dem wahnsinnigen Strudel verloren. Nach dem Krieg schlug er sich zurück nach Frankreich durch, wo er sie aufgrund einer Reihe weiterer kleiner Wunder in diesem Haus fand, weit weg von dem Ort, an dem sie sich kennen gelernt hatten. Und sie gelobten, sich nie wieder zu trennen.
Das Haus hatte die Macht, zwei verliebte Seelen für immer zu vereinen. Wir liebten diese Geschichten, sogar noch, als wir eigentlich zu alt für sie wurden. Wir reichten sie zwischen uns hin und her wie zwei Mädchen, die das Abnehmspiel spielten, übergaben die verzwickten Muster und nahmen sie wieder in Empfang. Wenn Elysius’ Interesse nachließ, zwang ich sie, über die Beweggründe der Beteiligten nachzusinnen oder sich vorzustellen, wie die einzelnen Personen ausgesehen haben mussten. Wir erfanden Details dazu, schmückten die Geschichten aus, machten sie länger und komplexer.
Doch vor unserem letzten Besuch dort, in dem Sommer, als ich dreizehn war, begannen Elysius und ich, die Geschichten anzuzweifeln.
»Was sind denn das für kleine Wunder?« Meine Mutter wusste es nicht. »Es gibt doch bestimmt medizinische Gründe, warum eine Frau erst kein Baby bekommen kann und dann plötzlich doch, oder?« Die Antwort lautete Ja, und dennoch … Und natürlich war es völlig unmöglich, dass ein Mann auf sich gestellt und von Hand ein Steinhaus baute und dabei auf Schlaf und angemessene Ernährung verzichtete.
»Ja«, sagte meine Mutter. »Aber genau das macht es ja zu einem Akt reiner Liebe!«
Meine Schwester sollte Jahre später bekehrt werden. Nach acht gemeinsamen Jahren und trotz seines feierlichen Schwurs, nie mehr zu heiraten, machte Daniel ihr in dem Haus endlich einen Antrag, während sie gemütlich in der Badewanne lag.
Und auch ich wäre einmal fast bekehrt worden. Während unseres letzten Aufenthaltes dort waren wir drei eines Tages in einem Schlafzimmer im Obergeschoss und falteten und sortierten Wäsche, die wir auf dem Holzständer getrocknet hatten. Es war das Zimmer meiner Schwester, dessen Fenster zu dem Berg hinausgingen. Ich weiß nicht, wer es zuerst sah, doch schon bald hatten wir drei uns am Fenster versammelt und beobachteten eine Hochzeit, die auf dem Berg stattfand. Die Braut trug ein langes weißes Kleid, und ihr Schleier wehte im Wind. Wir besaßen ein Fernglas, um Vögel zu beobachten. Meine Schwester schnappte es sich vom Regal, und wir schauten abwechselnd hindurch.
Schließlich sagte meine Mutter:
»Kommt, wir versuchen, näher ranzukommen.«
Und so rannten wir die schmale Steintreppe hinab, durch die Küche und zur Hintertür hinaus. Da sich die Hochzeitsgesellschaft ziemlich weit oben auf dem Berg befand, liefen wir im Weinberg durch die Rebenreihen nach unten, während wir das Fernglas zwischen uns hin und her reichten. Ich musste es jedes Mal neu einstellen, um es meinem schmalen Gesicht anzupassen, und erinnerte mich an den Anblick durch die verschmierten Gläser, verschwommen, surreal und gleichzeitig wunderschön. Die Braut brach in Tränen aus. Sie schlug die Hände vors Gesicht, doch als sie sie wieder wegzog, lachte sie.
Plötzlich fanden meine Mutter, meine Schwester und ich uns in einem Schmetterlingsschwarm wieder ‒ Resedafalter, um genau zu sein, weiß mit schwarzen Flecken. Sie flatterten wie verrückt um uns herum, wie eine schwindelerregende weiße Wolke.
Den knallrosa Rock meiner Mutter und ihre dunkles Haar sah ich nur noch bruchstückhaft, während ihre weiße Bluse in den weißen Schmetterlingen völlig verschwunden war, sodass ihre Stimme fast losgelöst von ihrem Körper schien.
»Schwärmen Schmetterlinge immer so?«, fragte ich.
»Nein«, behauptete meine Mutter, und sie sagte uns, dass dies ein weiterer Zauber sei.
Wir diskutierten mit ihr, weil wir das Gefühl hatten, dass sie das von uns erwartete, doch ich glaubte an die Resedafalter, und ich weiß, dass Elysius es insgeheim auch tat.
An diesen Sommer erinnerte ich mich lebhaft. Damals war ich von Sehnsucht erfüllt, wie es für dreizehnjährige Mädchen typisch ist, die sich scheinbar endlos nach etwas sehnen können, weil sie nicht wissen, wonach. Ich wollte verzaubert werden und sehnte mich nach den Brüdern, die in dem großen Haus nebenan lebten. Der ältere konnte auf der Stirn Gegenstände balancieren ‒ ziemlich große Gegenstände wie Holzstühle und Rechen ‒, und der jüngere schmollte, wenn sein Bruder alle Aufmerksamkeit auf sich zog, und spritzte mich im Pool, der eher grün als blau war, gnadenlos nass. Ihre Haare und Augen waren dunkel, ihr Lächeln schüchtern. Für uns waren sie Exoten: die Jungs, mit denen ich ausgegangen wäre, wenn meine Großmutter meinen Großvater in Frankreich festgehalten und sich geweigert hätte, ihm zuliebe ihr Zuhause, ihr Land und ihre Sprache aufzugeben. Ich stellte mir vor, dass sie mich besser verstünden als amerikanische Jungs.
Ich klaute damals ein Foto von den beiden. Darauf balanciert der ältere Junge, Pascal, groß und gut aussehend, bereits muskulös, einen Springstock auf der Stirn, während der jüngere Bruder, Julien, ihm von einem Gartenstuhl aus verächtlich zuschaut. Ich hatte mich in den älteren Jungen verliebt, der eigentlich versucht hatte, Elysius auf sich aufmerksam zu machen. Den im Gartenstuhl hasste ich irgendwie ‒ den schmollenden Nassspritzer. Ich faltete das Foto zusammen und steckte es in mein Federmäppchen, das in meiner Schreibtischschublade lag.
Doch in den darauffolgenden Jahren erinnerte ich mich hauptsächlich daran, dass meine Mutter während dieses Aufenthalts seltsam distanziert gewesen war ‒ nachdenklich, still ‒, als wüsste sie, was kommen würde. Vielleicht war ihre Beziehung zu meinem Vater bereits zerbrochen ‒ mir kam es so vor, dabei wusste ich nichts über die Ehe.
Im Sommer darauf, als ich vierzehn war und Elysius siebzehn, fuhr meine Mutter ohne uns hin. Sie verschwand nicht nur für kurze Zeit, sondern den ganzen Sommer lang ‒ nachdem sie die Affäre meines Vaters aufgedeckt hatte, worüber meine Mutter auf typisch französische Art ganz offen sprach. Sie schickte meiner Schwester und mir Briefe auf hauchdünnem Luftpost-Briefpapier. Ich schrieb ihr jedes Mal zurück und verwendete das rosafarbene, mit meinem Monogramm versehene Briefpapier, das sie mir zu Weihnachten geschenkt hatte. Allerdings schickte ich die Briefe nie ab, sondern versteckte sie in meinem Schreibtisch. Das war im Sommer 1989. Am letzten Tag im August rief sie an, um uns zu sagen, dass sie nach Hause käme.
Zu Hause bereitete sie dann die leckeren Süßspeisen zu, in die sie sich in Frankreich verliebt hatte: Tarte au Citron, Flan, Tiramisu, Creme brûlée und Pear Pinwheels. Dazu schlug sie nie auch nur ein Kochbuch auf. Sie schien die Rezepte im Kopf zu haben. Bis dahin war sie nie groß im Backen gewesen, doch nach ihrer Auszeit widmete sie sich mit Leib und Seele den kleinen, leckeren Süßspeisen. Ich wollte bei ihr sein, deshalb wich ich ihr nicht von der Seite und lungerte bei ihr in der Küche herum. Vielleicht lernte ich damals zum ersten Mal, die kurzlebige Kunst des Backens mit abstrakten Begriffen wie Sehnsucht gleichzusetzen ‒ obwohl ich es jahrelang vorzog, das Backen als Kunst zu betrachten, und es erst, nachdem ich Henry kennen gelernt hatte, als Akt der Liebe begreifen sollte. Meine Mutter und ich saßen am Tisch in der Essecke und kosteten die Leckereien ‒ kritisierten sie leise, mit gedämpften, andächtigen Stimmen. Nach einer Weile verkündete sie, dass wir das nie richtig hinbekommen würden. Ein oder zwei Tage lang behauptete sie, ganz mit dem Backen aufzuhören, doch dann stand sie wieder in der Küche, und wir machten mit der nächsten Süßspeise weiter.
Meine Mutter war still und nachdenklich, und etwa eine Woche nach ihrer Rückkehr kam der letzte Brief von ihr an. Darin stand, wie der Berg Feuer gefangen hatte. Die Flammen bahnten sich ihren Weg bis zur Steintreppe hinter dem Haus, aber nicht weiter. Ein Wunder nannte sie es. So gerne sie stets Wunder verkündete, diesmal schien es wirklich eins zu sein. Doch als wir sie baten, uns das Feuer zu beschreiben, wollte sie nicht darüber sprechen. »Ich habe es euch aufgeschrieben, damit ihr die Geschichte aufheben könnt«, sagte sie uns. Es war seltsam, dass sie uns nicht davon erzählen wollte, doch ich bedrängte sie nicht. Wir waren heilfroh, dass sie zu Hause war. Sie war zerbrechlich, und zudem hatte sie unter Beweis gestellt, dass sie imstande war, wegzulaufen.
Eines Tages hörte sie mit dem Backen auf. Sie sagte, wir hätten alle Süßspeisen ausprobiert und keine sei uns gelungen. Es bestehe keine Veranlassung mehr weiterzumachen. Nach dieser Ankündigung wirkte sie weniger rastlos, friedlicher, und so hielt ich es für ein gutes Zeichen.
Doch ich machte alleine weiter, zuerst in dem unbeholfenen Versuch, sie zurück in die Küche zu locken, damit wir zusammen sein konnten, und dann, um mich schlicht in der Welt zu verlieren, die ich dort gefunden hatte.
Noch viele Jahre später ertappte ich mich dabei, wie ich einen Teig auf eine spezielle Art knetete oder einen Duft roch, und ich wurde wieder zu der jungen Frau, die allein in unserer Küche stand, und dann fragte ich mich, wo das Foto von den Brüdern geblieben war. Wo waren die Briefe meiner Mutter jetzt? Wo waren die Briefe, die ich ihr auf rosa Briefpapier zurückgeschrieben und nie abgeschickt hatte? Hatte sie jemand weggeworfen oder vergraben? Auf jeden Fall hatte ich sie verloren wie alles andere auch.
Kapitel 3
Meine Mutter hatte uns ins Haus geführt, wo wir jetzt in der Küche standen. Elysius’ Küche war ausgestattet wie die eines Restaurants, mit Edelstahl und Marmor, geschmackvoll beleuchtet und makellos, weil sie sie kaum nutzte. Im Kühlschrank fand sich stets ein Vorrat an Babykarotten und Joghurt und gesunder Bio-Sprossensalat in Schachteln zum Mitnehmen nebst exotischen Dingen wie Fischsorten, die von abgelegenen Inseln eingeflogen wurden, essbaren Blumen und Knollenwurzeln, die, ich schwör’s, vom Schwarzmarkt stammten und tendenziell illegal waren. Aber generell wirkte der Inhalt ihres geräumigen Kühlschranks farblos, und wirklich voll war er auch nicht. Es hallte ein wenig, wenn man ihn öffnete, und das viele Weiß blendete einen fast.
In der Küche tummelten sich die Caterer. Eine Frau im blauen Cocktailkleid erteilte Befehle. Nach einem kurzen Blick auf ihren BlackBerry flitzte sie auf die Veranda, um einen Anruf entgegenzunehmen. Suppenterrinen standen herum, und lange Tabletts, vollgepackt mit schaumig geschlagenen Vorspeisen, Türmen aus Garnelen, Mies- und Venusmuscheln, Kisten mit Wein und reihenweise Stielgläser.
Meine Mutter bemühte sich, Abbot noch einmal zu versichern, dass bei dem Feuer niemand verletzt worden war, dass der Brand sehr weit weg in Frankreich ausgebrochen war.
»Es hat nur in der Küche gebrannt. Wir wissen nicht, wie groß der Schaden ist, aber es geht allen gut!«
Doch Abbot rieb sich in unablässiger Sorge die Hände.
»Wie weit von hier weg ist das? Wo liegt Frankreich?«, fragte er, woraufhin sie ihm alles noch einmal von vorne erklärte.
Aber ich hörte nicht zu. Ich fühlte mich, als hätte jemand einen Schalter umgelegt. Die Nachricht, dass es im Haus gebrannt hatte, schien etwas in mir ausgelöst zu haben. Die Erinnerungen an das Haus aus meiner Kindheit stiegen in mir auf, und mein Gehirn fing an zu rotieren. Ich hatte zwar geübt, nicht bei Erinnerungen an Henry zu verweilen, doch nun war Henry wieder da, und ich konnte nicht widerstehen. Sein Bild erschien leibhaftig und unaufhaltsam vor meinem geistigen Auge. Es war, als würde ich von einer starken Strömung unter Wasser gezogen. Schließlich waren Henry und ich uns in einer Küche vorgestellt worden, in der es von Caterern nur so wimmelte.
Henry Bartolozzi war damals vierundzwanzig. Er trug eine Hose mit hübschen Bügelfalten, dazu ein Sakko und Nikes. Er hatte schwarze Haare, ordentlich gekämmt, aber sie lockten sich trotzdem, und hellblaue Augen. Wir besuchten zur selben Zeit die Kochschule und waren beide über verschiedene Ecken in das Haus eines stadtbekannten Chefkochs eingeladen worden. Meine Mutter hatte mich davor gewarnt, mich in einen kreativen Typen zu verlieben. Zu diesem Zeitpunkt hatte Elysius sich schon ein paar Jahre als Malerin in New York durchgeschlagen und war schon mit zu vielen am Hungertuch nagenden Künstlern ausgegangen. Meine Mutter hatte diese Typen satt. »Was ist verkehrt an einem Medizinstudenten?«, fragte sie regelmäßig bei Familienessen. »Und wenn nun jemand erstickt? Ich hätte gern wenigstens einen Menschen hier am Tisch, der in der Lage ist, einen soliden Heimlich-Hand-griff durchzuführen; jemanden, der im Notfall aus einem Kugelschreiber einen Tubus fertigen kann. Oder wollt ihr, dass einer von uns in ein Messer fällt und verblutet?«
Ich hielt diesen Rat für sehr gut. Auch ich konnte die Freunde meiner Schwester nicht mehr sehen. Aber ich besuchte die Kochschule nicht, um dort Männer kennen zu lernen. Ich hatte Männer satt. Ich war überzeugt, dass ich schon genug von ihnen ins Unglück gestürzt hatte. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich gerade einem die Karriere bei der NASA versaut, indem ich ihn zum Kiffen überredet hatte; bei einem anderen war ich schuld daran, dass die Verlobung in die Brüche ging. Außerdem wurde ich bezichtigt, einen schlimmen Jetski-Unfall verursacht zu haben ‒ bei dem es zum Glück keine Toten gab. Vor Männern hatte ich aus demselben Grund Angst wie vor Fröschen: Ich konnte nicht vorhersagen, in welche Richtung sie hüpften.
Grundsätzlich sah ich die Liebe als eine Vereinbarung an, die von der Bereitschaft abhing, Kompromisse zu schließen. Die Ursache dafür lag natürlich in der komplizierten Ehe meiner Eltern. In unserer Familie erzählt man sich, dass mein Vater, der früher als Anwalt für das US-Patentamt arbeitete, meine Mutter aus der Schreibzentrale gerettet hat.
Das war nicht nur aus feministischer Sicht problematisch, sondern erschwerend kam hinzu, dass meine Mutter hochintelligent war, was in unserer Familie totgeschwiegen wurde. Als ihr Vater aus dem Krieg zurückkam, eröffnete er ein Billigwarenhaus, das die Familie jahrelang ernährte, das jedoch zu der Zeit, als meine Mutter alt genug war, um zum College zu gehen, in finanziellen Schwierigkeiten war. Zudem verschlechterte sich die Gesundheit ihres Vaters, sodass ein Studium für sie nicht in Frage kam. Als Hausfrau sah sich meine Mutter stets die aktuellsten Filme an, sogar die ausländischen, in die sie allein gehen musste, weil mein Vater sich weigerte, Untertitel zu lesen. Wenn sie über einen Film sprach, erwähnte sie grundsätzlich nur den Namen des Regisseurs, ein ausgesprochen französischer Charakterzug. Sie gärtnerte nach wissenschaftlichen Methoden und las Bücher über Physik, Geschichte, Philosophie und Religion, sprach aber nur selten darüber. Ihr intellektuelles Leben führte sie still und heimlich. Einmal bekamen wir zu Weihnachten das Spiel Trivial Pursuit geschenkt. Meine Mutter wusste alle Antworten. Wir waren perplex. »Woher weißt du das alles?«, fragten wir sie. Nachdem sie das Spiel gewonnen hatte, packte sie alles zusammen und spielte es nie mehr. Hatte meine Mutter gerettet werden müssen? Sie akzeptierte die Geschichte. Da war es kein Wunder, dass ich, als ich Henry auf dieser Party in der Küche traf, Liebe als Kompromiss ansah, sogar als Schwäche.
Henry war der Erste, den ich auf der Party kennen lernte. Er unterhielt sich mit der Tochter des Chefkochs, einer flachsblonden Drittklässlerin. Wenn er lächelte, zog er einen Mundwinkel nach oben ‒ ein Lächeln, das mir sofort gefiel.
Er stellte sich vor. Henry Bartolozzi. Die zwei Namen passten nicht zusammen, und ich ließ eine Bemerkung darüber fallen. Daraufhin erklärte er mir, dass den Namen Henry seine Mutter ausgesucht hatte, weil ihr Großvater, ein alter Südstaatler, so hieß, während sein Nachname von der italienischen Seite seines Vaters stammte.
Ich beichtete ihm meinen Nachnamen.
»Buckley. Ein schwieriger Name in der Mittelstufe. Ich war ein wandelnder Limerick.«
Er tippte sich nachdenklich ans Kinn.
»Reimt sich Buckley denn auf irgendwas? Komisch. Mir fällt nichts ein.« Dann gestand er mir, dass Fartolozzi seinen Ruf an der Schule auch nicht gerade verbessert hatte. Er war im italienischen Teil von Boston groß geworden ‒ im North End.
Nachdem sich die Party nach draußen auf den Rasen verlagert hatte, zündeten das flachsblonde Mädchen und ihr älterer Bruder Knallkörper, die übers Pflaster hüpften. Es war dunkel. Es war schwer zu sagen, ob Henry zu mir herübersah.
Später drängten sich einige Leute in seinen alten, rostigen Honda, und als das Radio zufällig bei einem Easy-Listening-Sender landete, sang ich lauthals bei Brandy mit. Ich gestand, dass ich im betrunkenen Zustand leider immer so war, eine Easy-Listening-Diva. Trotzdem, oder vielleicht gerade deshalb, bat mich Henry um meine Telefonnummer.
Gleich am nächsten Abend lud mich Quinn, eine meiner neuen Freundinnen aus der Schule, zum Abendessen ein. Ich schützte vor, zu viel zu tun zu haben. Daraufhin sagte Quinn:
»Na schön, dann essen Henry und ich eben allein.« Und ich fragte:
»Henry Fartolozzi?« Ich sagte ihr, ich könnte meine Pläne ändern.
Henry brachte mehrere Flaschen italienischen Spitzenwein mit ‒ ein echter Luxus, denn keiner von uns hatte Geld. Da ich nicht an den niedrigen Futon gewöhnt war, der auch als Couch diente, bekleckerte ich mich jedes Mal mit Wein, wenn ich mich hinsetzte. Gegen Ende des Abends roch ich wie eine Weinkellerei.
Mein Haupttransportmittel damals war ein riesengroßes Fahrrad aus den fünfziger Jahren, das ich im Gebrauchtwarenladen gekauft hatte. Henry bot mir an, mich nach Hause zu fahren ‒ es war kalt geworden. Ich lehnte ab, doch er bestand darauf. Er stopfte das Ungetüm in den Kofferraum seines uralten, nicht versicherten Honda, der dann prompt nicht ansprang. Ich war erleichtert. Wenn er mich schon retten wollte, war es für mich nur von Vorteil, wenn er scheiterte.
Ich sagte:
»Ich weiß, was mit deinem Auto nicht stimmt.«
Seine blauen Augen leuchteten auf.
»Du kennst dich mit Motoren aus?«
Ich nickte.
»Ein ganz simples Problem. Wenn du den Schlüssel umdrehst, macht er keinen Mucks.«
Henry fand das charmant. Ich fand es charmant, dass er es charmant fand.
»Du hast recht«, meinte er. »Es liegt wahrscheinlich am Sound-Effect-Generator.«
Also brachte Henry mich zu Fuß nach Hause. Als wir bei mir ankamen, stellte ich fest, dass ich meine Schlüssel auf der Dinnerparty vergessen hatte. Er ging mit mir zurück und brachte mich wieder nach Hause. Inzwischen war es drei Uhr morgens, und wir hatten den größten Teil der Nacht mit Spazieren und Reden verbracht. Jetzt standen wir wieder vor meinem Haus.
»Und, magst du mich?«, fragte er und legte dabei den Kopf schief, die dunklen Wimpern umrahmten seine blauen Augen. Er hatte volle Lippen, und er lächelte wieder auf diese bestimmte Art, indem er einen Mundwinkel verzog.
»Was genau meinst du?«, fragte ich. »Natürlich mag ich dich. Du bist sehr nett.«
»Ja, aber nach der Sechstklässler-Definition: Magst du mich echt, oder magst du mich nur so?«
»Vielleicht mag ich dich echt«, sagte ich, senkte den Blick auf meine Schuhspitzen und sah wieder zu ihm auf. »Vielleicht. Ich habe kein Glück mit Männern. Ich habe ihnen sogar abgeschworen.«
»Wirklich?« Besonders an diese Situation kann ich mich überdeutlich erinnern ‒ wie nahe er mir war, so nahe, dass ich die Wärme seines Atems spürte. »Darf ich fragen, warum?«
»Männer machen Arbeit. Sie glauben, sie können einfach so hereinschneien und uns retten, doch dann werden sie anstrengend. Sie wollen umschmeichelt werden. Im Großen und Ganzen sind sie wie sprechende Sofas.«
»Ich finde, für ein sprechendes Sofa habe ich einen wirklich umfassenden Wortschatz.« Er flüsterte, als lege er ein Geständnis ab. »Bei den standardisierten Tests habe ich glänzend abgeschnitten ‒ im Vergleich zu den anderen sprechenden Sofas.« Er starrte mich durchdringend an. Ich verliebte mich in seine Schultern. Ich konnte sein Schlüsselbein sehen, die verletzliche Vertiefung dazwischen, seine schöne, markante Kieferpartie. »Ich finde, Männern abzuschwören ist altmodisch.«
»Vielleicht ist es eine antiquierte Vorstellung. Kann sein, dass ich betrunken war.«
»Vielleicht warst du ja auf einer Sauftour«, er lächelte sein spezielles Lächeln, »und hast ausnahmsweise mal nicht lauthals bei Brandy mitgesungen?«
»Wahrscheinlich. Und jetzt, nüchtern bei Tageslicht betrachtet, erkenne ich, was für eine Schnapsidee das war ‒ als hätte ich probiert, im 7-Eleven um die Ecke eine Produktion von West Side Story im großen Stil auf die Beine zu stellen.«
Er stand jetzt dicht vor mir.
»Hast du denn je versucht, eine Produktion von West Side Story im großen Stil in einem 7-Eleven auf die Beine zu stellen?«
»Zwei Mal. Es hat nicht funktioniert«, antwortete ich. »Aber ich bin jetzt drüber weg, über das mit Den-Männer-Abschwören, meine ich.«
»Du hast offiziell dem Männer-Abschwören abgeschworen?«, fragte er.
»Ja«, sagte ich.
»Sicher?«
Ich nickte, obwohl ich mir nicht so sicher war.