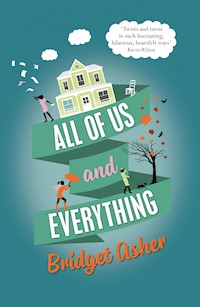Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wenn das Herz plötzlich Purzelbäume schlägt: Der gefühlvolle Liebesroman »Verlieben war nicht abgemacht« von Bridget Asher als eBook bei dotbooks. Manchmal kann es ein Vergnügen sein, den Ex zu treffen – denn als Gwen nun unerwartet vor Elliot steht, könnte ihr Leben nicht besser laufen: Zugegeben, ihr Ehemann ist eher von der zuverlässigen als der aufregenden Sorte, aber sie gilt in ihrem Freundeskreis nicht zu Unrecht als perfekte Ehefrau. Doch nun schüttet Elliot ihr sein Herz aus: Seine Mutter ist nie darüber hinweggekommen, dass er nicht verheiratet ist, träumt immer noch von einer Schwiegertochter wie Gwen … und ist schwerkrank. Was liegt da näher, als ihr mit einer kleinen Flunkerei einen großen Wunsch zu erfüllen? Und so erklärt Gwen sich schließlich bereit, ein Wochenende lang im alten Familienhaus am See die Zukünftige von Elliot zu spielen – nicht ahnend, in welches Gefühlschaos sie sich dabei stürzt … »Ein berührender Liebesroman!« Freizeit Illustrierte Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der romantische Liebesroman »Verlieben war nicht abgemacht« von Bridget Asher. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 352
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Manchmal kann es ein Vergnügen sein, den Ex zu treffen – denn als Gwen nun unerwartet vor Elliot steht, könnte ihr Leben nicht besser laufen: Zugegeben, ihr Ehemann ist eher von der zuverlässigen als der aufregenden Sorte, aber sie gilt in ihrem Freundeskreis nicht zu Unrecht als perfekte Ehefrau. Doch nun schüttet Elliot ihr sein Herz aus: Seine Mutter ist nie darüber hinweggekommen, dass er nicht verheiratet ist, träumt immer noch von einer Schwiegertochter wie Gwen … und ist schwerkrank. Was liegt da näher, als ihr mit einer kleinen Flunkerei einen großen Wunsch zu erfüllen? Und so erklärt Gwen sich schließlich bereit, ein Wochenende lang im alten Familienhaus am See die Zukünftige von Elliot zu spielen – nicht ahnend, in welches Gefühlschaos sie sich dabei stürzt …
Über die Autorin:
Bridget Asher lebt mit ihrem Ehemann und ihren vier Kindern in Florida.
Bei dotbooks veröffentlichte die Autorin auch ihre Romane »All die Frauen meines Mannes« und »Die Liebe ist lavendelblau«.
***
eBook-Neuausgabe November 2022
Die amerikanische Originalausgabe erschien erstmals 2009 unter dem Originaltitel »The Pretend Wife« bei Bantam Books (Random House), New York.
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 2009 by Bridget Asher
Copyright © der deutschen Erstausgabe 2012 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Copyright © der Neuausgabe 2022 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ah)
ISBN 978-3-98690-406-7
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Verlieben war nicht abgemacht« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Bridget Asher
Verlieben war nicht abgemacht
Roman
Aus dem Amerikanischen von Georgia Sommerfeld
dotbooks.
Für Dave,
so real, wie real sein kann
Teil 1
Kapitel 1
In dem Sommer, in dem ich Elliot Hulls erfundene Ehefrau wurde, ahnte ich nicht, dass komplizierte Dinge sich anfangs gern in der Verkleidung einfacher Dinge präsentieren. Deshalb ist es so schwer, ihnen aus dem Weg zu gehen oder sich zumindest für sie zu wappnen. Dabei hätte ich es wissen müssen – schließlich war dieses Phänomen ein Bestandteil meiner Kindheit gewesen. Aber ich sah die Komplikationen, die Elliot Hulls Auftauchen mit sich brachte, nicht kommen. Vielleicht, weil ich es nicht wollte. Also ging ich ihnen nicht aus dem Weg und wappnete mich nicht einmal für sie, was dazu führte, dass ich im Winter zwei erwachsene Männer – meinen angeblichen Ehemann und meinen tatsächlichen Ehemann – in einem verschneiten Vorgarten zwischen verstreuten Golfschlägern im trüben Schein der Lampe über dem Hauseingang so verbissen miteinander ringen sah, dass ich nicht sagen konnte, wer wer war. Das sollte zu einem der groteskesten und gleichzeitig bewegendsten Augenblicke meines Lebens werden, in dem die Dinge die dramatischste Wendung in einer langen und wechselvollen Reihe kleinerer, scheinbar einfacher Wendungen nahmen.
Schauplatz des – simplen – Anfangs dieser Geschichte war eine Eisdiele: Ich stand in der Schlange vor der beschlagenen Glasvitrine, ein Rührwerk schnarrte, und mit jedem Bimmeln der Ladenglocke drang ein Schwall feuchter Luft herein. Es war einer der letzten heißen Spätsommertage. Die Klimaanlage blies kalte Luft von der Decke, und ich blieb unter einer der Düsen stehen, womit ich einen Stau in der Schlange verursachte. Peter unterhielt sich abseits mit Gary, einem Kollegen aus der Anästhesie in einem rosa gestreiften Polohemd, den seine Sprösslinge mit in durchweichende Servietten gewickelten Eistüten umringten. Die Kinder waren noch so klein, dass sie sich nicht daran störten, zusammen mit ihrem Eis auch Serviettenfetzchen zu essen, und Gary war abgelenkt und bemerkte es nicht. Er schlug Peter freundschaftlich auf den Rücken. Das erlebt Peter häufig – die Leute mögen ihn einfach. Er ist entwaffnend, freundlich. Es ist, als wäre er der Präsident eines Clubs, in dem man durch bloße Unterhaltung mit ihm zum Mitglied wird. Aber meine Aufmerksamkeit galt in diesem Moment den Kids. Sie taten mir leid, und ich beschloss, eines Tages eine Mutter zu sein, die ihre Kinder keine durchweichten Serviettenfetzchen essen ließ. Ich weiß nicht, was für eine Mutter meine Mutter war, unaufmerksam oder überfürsorglich oder gar beides? Sie starb, als ich fünf Jahre alt war. Auf manchen Fotos wirkt sie liebevoll, schneidet zum Beispiel mit im Wind wehenden Haaren im Garten einen Geburtstagskuchen für mich an. Auf Gruppenbildern aber schaut sie immer zur Seite oder auf ihren Schoß oder fixiert – wie eine begeisterte Vogelbeobachterin – einen Punkt hinter dem Fotografen. Mein Vater war keine zuverlässige Informationsquelle. Über sie zu sprechen schmerzte ihn, und so tat er es so gut wie nie.
Ich beobachtete die Szene aufmerksam, insbesondere Peter, denn anstatt mich daran zu gewöhnen, einen Ehemann zu haben, verwunderte es mich nach drei Jahren zusehends. Vielleicht verwunderte mich auch weniger die Tatsache, seine Ehefrau zu sein, als die, überhaupt Ehefrau zu sein. Das Wort »Ehefrau« hatte etwas grässlich Spießiges für mich – es weckte die Assoziation mit Schürzen und Hackbraten und Haushaltsreinigern. Man sollte meinen, das Wort hätte inzwischen eine Evolution für mich erfahren – so wie es sich für die meisten Menschen zu Handys und Nachsorge und Therapie weiterentwickelt hatte –, aber ich steckte fest wie eine Kiemenspezies, die unfähig war, im Watt zu atmen.
Obwohl Peter und ich seit insgesamt fünf Jahren ein Paar waren, hatte ich manchmal das Gefühl, ihn überhaupt nicht zu kennen. Wie in diesem Augenblick, als ihm der Kollege in dem rosa gestreiften Polohemd auf den Rücken schlug. Es war, als hätte ich den Vertreter einer seltenen Vogelart namens Ehemann in seinem natürlichen Lebensraum entdeckt und stellte Überlegungen bezüglich Ernährung, Stimme, Flügelspannweite, Balzverhalten und Lebenserwartung an. Es ist schwer zu erklären, doch ich nahm immer öfter diese Position ein, betrachtete mein Leben wie jemand vom National Geographic, ein Reporter mit englischem Akzent, der mein Leben weniger aufregend als seltsam fand.
Die Eisdiele war brechend voll, und die beiden Highschool-Schülerinnen hinter der geschwungenen Glasvitrine hatten vor Stress verkniffene, schweißglänzende Gesichter. Die Ponyfransen klebten ihnen an der Stirn, das Augen-Make-up zerfloss. Endlich war ich an der Reihe und gab meine Bestellung auf. Gleich darauf hatte ich eine Waffeltüte mit einer Kugel Pistazieneis für Peter in der Hand und wartete auf meinen Becher Joghurt-Vanille.
In diesem Moment rief die flinkere der beiden Bedienungen, die eben einem anderen Kunden seine Bestellung über die Theke reichte, an mir vorbei: »Was darf es für Sie sein?«
Eine Männerstimme antwortete: »Zwei Kugeln Gwen Merchant, bitte.«
Überzeugt, dass ich mich verhört hatte, fuhr ich herum, denn ich bin Gwen Merchant – zumindest war ich es bis zu meiner Heirat –, und entdeckte hinter mir in der Schlange einen Geist aus meiner Vergangenheit: Elliot Hull. Ich erkannte ihn sofort. Elliot Hull mit der dichten, dunklen Mähne und den wunderschönen Brauen stand mit den Händen in den Taschen vor mir und sah hinreißend jungenhaft aus. Ich habe keine Ahnung, warum, doch ich hatte das Gefühl, ohne es zu wissen auf ihn gewartet zu haben. Und ich war eher erleichtert als glücklich, dass er endlich aufgetaucht war. Ein befremdlicher, aber ungemein starker Teil von mir wollte ihm um den Hals fallen, als wäre er gekommen, um mich zu retten, und zu ihm sagen: Gott sei Dank bist du endlich da! Was hat dich so lange aufgehalten? Lass uns von hier verschwinden!
Doch das kann ich unmöglich gedacht haben. Nicht damals. Es muss eine Rückwärtsprojektion sein. Bestimmt gibt es einen Fachausdruck dafür, den ich nicht kenne. Ich kann nicht gedacht haben, dass Elliot Hull gekommen war, um mich zu retten, denn seinerzeit wusste ich noch gar nicht, dass ich gerettet werden wollte. (Und natürlich würde ich mich am Ende selbst retten müssen.) Meine einzige Erklärung ist, dass er vielleicht einen verlorenen Teil von mir selbst repräsentierte und ich auf irgendeiner Bewusstseinsebene erkannte, dass ich nicht nur Elliot Hull vermisst hatte. Ich muss den Menschen vermisst haben, der ich gewesen war, als wir uns kannten – die Gwen Merchant von damals, naiv, respektlos und absolut nicht ehefraulich.
Außerdem – kannte ich Elliot überhaupt so gut? Wir hatten uns beim »Eisbrecher«, der (echt armseligen) Orientierungsveranstaltung für Studienanfänger am Loyola College in Baltimore, kennengelernt und dann, im Frühling unseres Senior-Jahres, eine intensive, chaotische, kurze Beziehung gehabt – drei Wochen Unzertrennlichkeit, die damit endeten, dass ich ihn in einer Bar tätlich angriff. Ich hatte Elliot Hull seit dem Keks-und-Punsch-Empfang der Englischen Fakultät anlässlich des Studienabschlusses vor zehn Jahren nicht mehr gesehen.
Dennoch wirkte diese Begegnung auf mich emotional überwältigend. Meine Kehle wurde eng, und in den Augen kündigte ein Stechen das Aufsteigen von Tränen an. Der Luftstrom von oben drückte meine Haare platt. Ich trat einen Schritt zur Seite und gab vor, nicht ganz sicher zu sein, wen ich da vor mir hatte. »Elliot Hull?«, fragte ich. Ich glaube, ich tat das, weil mich die Intensität meiner Wiedersehensfreude erschreckte. Außerdem erinnerte ich mich noch deutlich genug an unsere Beziehung, um ihm nicht die Genugtuung eines sofortigen Erkennens zu gönnen. Er zählte zu den Typen, die so etwas registrierten und deswegen triumphierten.
Elliot sah älter aus, aber nicht wesentlich. Er hatte den schlanken Körper eines Mannes, der ästhetisch altern würde und den man in seinen Siebzigern vielleicht als drahtig beschriebe. Seine unrasierte Kinnpartie war prägnanter geworden. Er trug ein ausgebleichtes hellblaues, am Hals ausgefranstes T-Shirt, eine Red-Sox-Baseball-Kappe und unförmige Shorts. »Gwen«, sagte er mit einem traurigen Unterton. »Es ist lange her.«
»Was machst du hier?«, fragte ich. Es ist nur Elliot Hull, hielt ich mir vor Augen. Ich wusste nicht mehr, weshalb ich damals auf ihn losgegangen war, aber ich wusste noch, dass er es verdient hatte. Es war in einer Bar in Towson gewesen – nur ein paar Meilen von dieser Eisdiele entfernt!
»Das klang ja wie eine Anklage!«, sagte er. »Ich bin ein unbescholtener Mann, der sich ein Eis bestellt hat.«
»Äh, die Sorte haben wir nicht, Sir«, bemerkte das Mädchen hinter der Theke. »Möchten Sie vielleicht eine andere?«
»Zweimal Schokolade mit Marshmallows, Erdnüssen und Karamell.« Er beugte sich zu der Wandtafel vor und las mit zusammengekniffenen Augen das Angebot. »Und mit Schlagsahne und drei Kirschen«, vervollständigte er seine Bestellung.
»Drei?«, wiederholte das Mädchen hörbar entrüstet über die Unersättlichkeit der Menschheit – ein unprofessioneller Ausrutscher.
»Ja, drei«, bestätigte er und wandte sich wieder mir zu.
»Also wirklich«, sagte ich. »Drei Kirschen.«
»Ich mag Kirschen.«
Ich deutete auf seine Shorts. »Bist du unter die Rapper gegangen?« Es war eine gehässige Frage, aber mir war plötzlich nach Gehässigkeit. Eigentlich war ich heutzutage zu charmant für solche Bemerkungen, doch Elliot veranlasste mich zu einer Rückentwicklung, zur Rückkehr zu einem elementaren Teil meiner selbst.
»Soll ich einen Reim aus dem Ärmel schütteln?«
»Nein, nein«, lehnte ich hastig ab. »Bitte nicht.«
Es entstand eine Pause, die sich dehnte. Ich rief mich zur Vernunft. Warum sollte ich mich weiter mit Elliot Hull befassen? Ich war jetzt verheiratet. Wollte ich Freundschaft mit ihm schließen? Eine verheiratete Frau freundete sich nicht plötzlich mit einem Ex an, nachdem sie die Beziehung mit einem tätlichen Angriff in einer Bar beendet hatte. Schließlich setzte er das Gespräch fort. »In Wahrheit bin ich Philosoph«, sagte er. »Ich philosophiere. Und ich lehre an der Universität.«
»Ja, das passt«, sagte ich. »Du bist Der Grübler. So nannten dich meine Freundinnen auf dem College. Jetzt grübelst du also von Berufs wegen. Das tun Philosophen doch, stimmt’s?« Mein Vater war Universitätsprofessor – Meeresbiologe –, daher kannte ich die Grübelneigung von Professoren aus eigener Erfahrung. Als Kind wurde ich zu zahlreichen Potluck-Dinners der Fakultät mitgeschleppt, und jedes Mal war die Luft zum Schneiden vor lauter Gegrübel.
»Ich war kein Grübler. Oder doch?«
»Am Ende des Studiums hattest du die Grübelei zur Kunst stilisiert.«
»Grübeln hat sich aber nicht wirklich als nationaler Trend durchgesetzt, wie ich gehofft hatte.«
»Heute ist Zufriedenheit angesagt«, teilte ich ihm mit. »Blinde Zufriedenheit.«
»Nun, es findet demnächst eine Grübler-Tagung statt, bei der ich als Hauptredner fungiere. Und – was machst du so?«
»Ich? Also, ich habe gerade was Neues angefangen. Eine Kombination aus Verkauf und Innenausstattung.« Meine berufliche Vergangenheit bestand aus ständig wechselnden Jobs, worauf ich nicht stolz war. Mein Lebenslauf war so weit gestreut wie eine Salve aus einem Schrotgewehr. Vor Kurzem hatte ich einen Posten in der Aufnahmestelle eines Internats hingeschmissen, angeblich, weil ich das Elitedenken nicht länger ertrug, doch dann nahm ich einen Teilzeitjob als Assistentin einer Innenarchitektin an, die eine noch elitärere Klientel bediente. Meine Aufgabe bestand darin, potentielle Kunden unter Zuhilfenahme von Statistiken davon zu überzeugen, dass es sich lohnte, ein Haus vor dem Verkauf aufzumotzen, während meine Chefin, ein ätherisches Wesen, in flatternden Gewändern durch die Räume schwebte und die künstlerisch Inspirierte mimte. Ihr Name war Eila, doch sie verriet mir schon nach ein paar Tagen, dass sie ursprünglich Sheila geheißen hatte. »Aber wer hat Vertrauen in die künstlerischen Fähigkeiten einer Sheila? Man muss tun, was man tun muss.« Dann schnupperte sie an ihrem Flatterschal. »Hat es in dem letzten Haus etwa nach Dobermann gerochen?«
»Innenausstattung?«, hakte Elliot interessiert nach. »Ich kann mich nicht erinnern, dass deine Bude im Wohnheim übermäßig nach Feng-Shui eingerichtet gewesen wäre. Hattest du nicht eine Hängematte in der Miniküche angedübelt?«
»Ich hatte eben schon immer Sinn für das Außergewöhnliche.«
Hinter mir hörte ich wie in weiter Ferne eine der Bedienungen »Ma’am? Ma’am?« sagen, bezog es jedoch nicht auf mich, denn ich war nicht alt genug für eine »Ma’am«. Aber dann sagte Elliot: »Äh, Ma’am – dein Eis.«
Ich drehte mich um und bekam meinen Becher Joghurt-Vanille in die Hand gedrückt.
»Danke«, sagte ich. »Vielen Dank.« Ich schob mich auf die Kasse zu und machte mich bereit zur Flucht. »Es war nett, dich wiederzusehen, Elliot«, verabschiedete ich mich.
»Warte«, bat er. »Wir sollten uns treffen. Ich bin gerade wieder hergezogen. Du könntest mir zeigen, was sich alles verändert hat.«
»Ich glaube, das findest du auch allein heraus.« Ich war an der Kasse angelangt und bezahlte mein Eis. »Du bist doch ein kluges Kerlchen.«
Er lächelte mich verschmitzt an. Dieses Lächeln gehörte so sehr zu ihm, dass er vermutlich schon damit zur Welt gekommen war. »Wie wär’s heute Abend?« Er ließ nicht locker. »Ich lade dich zum Essen ein, und danach könntest du eine Stadtführung für mich machen.«
»Tut mir leid, ich habe schon andere Pläne.«
»Nämlich?«
Ich zögerte. »Eine Party.«
»Dann nimm mich doch einfach mit. Stell mich Leuten vor, preis mich an, tu ein gutes Werk. Du hattest es doch schon immer mit guten Taten. Hast du nicht mal einen Keksverkauf für einen guten Zweck veranstaltet? Ich erinnere mich, dir welche abgekauft zu haben – und dass irgendein Plakat etwas damit zu tun hatte.«
Er sah mich so hoffnungsvoll an, dass ich mich genötigt sah, ihm den Wind aus den Segeln zu nehmen. »Ich bin verheiratet«, erklärte ich lapidar.
Er lachte. »Sehr komisch.«
»Was ist daran komisch?«
»Gar nichts … es ist nur …«
»Nur was? Hast du geglaubt, mich würde keiner nehmen?«
»Du bist nie und nimmer verheiratet.«
»Doch, das bin ich.«
»Bist du nicht.«
»Bin ich wohl. Ich heiße jetzt Stevens.« Zum Beweis hob ich die linke Hand mit dem Ring.
Elliot riss die Augen auf. »Du bist tatsächlich … verheiratet?«
»Das klang wie eine Anklage«, sagte ich. »Ich bin eine unbescholtene Frau, die sich ein Eis bestellt hat. Eine unbescholtene Ehefrau.«
»Ich dachte bloß, dass heute niemand mehr heiratet. Heiraten ist so barbarisch. Wie Hahnenkämpfe und Hetzjagden und so was.«
»Siehst du – das ist genau die Art von Beleidigung, die den Wunsch in einem weckt, dich zu ohrfeigen.«
Er reckte das Kinn vor und zog die Brauen hoch. »Du hast mich damals nicht geohrfeigt. Du hast mich nur bei den Wangen gepackt. Das tat allerdings auch ganz schön weh.«
»Warst du nicht verlobt?«, wechselte ich das Thema. »Mit dieser Ellen sowieso?« Sie hieß Ellen Maddox, und ich sah sie noch genau vor mir.
»Sie hat mich gleich nach dem College verlassen – wegen eines Flugbegleiters«, sagte er abfällig. »Wie auch immer – ich stehe zu meiner Aussage, die dich damals dazu getrieben hat, mich bei den Wangen zu packen. Ich stehe dazu, weil sie der Wahrheit entsprach.«
Ich konnte mich nicht erinnern, was er damals gesagt hatte, aber ich kam nicht mehr dazu, ihn danach zu fragen. Eine der Bedienungen reichte ihm seine Riesenportion Eis über die Theke, und in diesem Moment tauchte Peter auf. »Hallo«, begrüßte er Elliot freundlich-wohlerzogen. Mit dieser Tour wirkt er, als sei er in den Fünfzigerjahren auf dem Internat gewesen und versuche nun den Mangel an elterlicher Liebe mit dem Bemühen zu kompensieren, bei allen Menschen in seiner Umgebung Sympathie zu wecken. Doch das war der reine Schwindel. Peter war dazu erzogen worden, auf alles zu vertrauen – hauptsächlich auf die Liebe.
Ich gab ihm seine Eistüte. »Das ist Elliot Hull. Er hat mir auf dem College mal ein paar von den Keksen abgekauft, die ich gebacken hatte, um Geld für die Seeotter zusammenzukriegen.«
»Ach, die armen Seeotter!« Peter streckte die Hand aus. »Ich bin Peter.«
Elliot nahm sie und warf mir einen Blick zu, der zu besagen schien: Nun sieh mal einer an! Du bist wirklich verheiratet! Noch dazu mit einem so großen Mann!, dann sagte er: »Gwen hat mich gerade zu der Party heute Abend eingeladen. Ich bin neu in der Stadt.«
»Gute Idee«, fand Peter, und ehe ich die Chance zu einem klärenden Wort hatte, gab er Elliot schon eine Wegbeschreibung. Ich konnte es immer noch nicht fassen, dass Elliot Hull in mein Leben zurückgekehrt war – und wie schnell es gegangen war. Und wie einfach. Ich hatte absolut nichts dazu getan. Im einen Moment stand ich wartend in der Schlange vor der Eisvitrine, im nächsten sah ich Peter Gesten vollführen, die offenbar besagten, dass Elliot aus einem Kreisverkehr würde ausscheren müssen. Jetzt zeigte er mit ausgestrecktem Arm nach links, und mir fiel wieder das Wort »Flügelspannweite« ein. Peter ist groß. Er hat eine beeindruckende Flügelspannweite.
Neben ihm stand Elliot, und der war nicht groß und nicht wohlerzogen – und er hörte kaum zu. Offenbar grübelte er wieder einmal, wie es für Elliot Hull eben typisch war. Hatten wir damals vor zehn Jahren geglaubt, ineinander verliebt zu sein?
Als Peter seine Ausführungen beendet hatte, fragte er: »Alles klar?«
»Ja, alles klar«, erwiderte Elliot und schaute wieder zu mir. Ich wollte gerade die Hand zu einem lässigen Abschiedsgruß heben, als er sagte: »Gwen Merchant – nach all den Jahren.« Und plötzlich war es, als wäre ich der seltene Vogel. Ich wurde verlegen, spürte sogar, wie ich errötete. Ich konnte mich nicht erinnern, wann mir das zum letzten Mal passiert war. »Bis heute Abend«, verabschiedete er sich, nahm einen Mundvoll von seinem Rieseneis und verließ, eine Hand in der Tasche seiner unförmigen Shorts, die Eisdiele.
Kapitel 2
Es gibt eine Theorie darüber, warum Menschen sich nicht an ihre Säuglingszeit und frühe Kindheit erinnern: Erinnerung benötigt einen Bezugspunkt. Man erinnert sich an etwas, weil es mit einem früheren Erlebnis zusammenhängt. Erinnerungen erwachen nicht, weil sich dieser Teil des Gehirns schließlich entwickelt hat, sondern weil unser Leben aus Schichten besteht, wobei die Erinnerungen nicht so sehr gleich einer Eisschicht auf unseren Erlebnissen liegen, sondern vielmehr darunter wie unterirdische Flüsse.
Genauso ist es bei meiner Beziehung mit Elliot Hull. Um die überschwängliche Freude bei unserem Wiedersehen in der Eisdiele und alles, was sich daraus ergab, wahrhaft zu begreifen, brauche ich Peter. Elliot existiert nicht ohne Peter – nicht wirklich. Und Peter hätte in meinem Leben nicht wirklich existiert ohne meinen Vater, einen durch Verlust geprägten Mann. Und sein Verlust wiederum würde nicht existieren ohne den frühen Tod meiner Mutter.
Lassen Sie mich eine Schicht nach der anderen freilegen.
Ich lernte Peter in einer Tierarztpraxis kennen. Er war mit dem bejahrten, inkontinenten Cockapoo (eine Kreuzung zwischen Cockerspaniel und Pudel) seiner Mutter gekommen, und ich las blutbesudelt einen Artikel über das menschliche Gehirn. Ein Hütehund von einer Farm war mir am Morgen ins Auto gelaufen, als ich auf dem Weg zu einem Psychologiekurs gewesen war, in den ich mich allerdings nicht eingeschrieben hatte. Ich war fünfundzwanzig und hatte kürzlich einen Job im Marketing-Bereich hingeschmissen, der mich geschafft hatte. Jetzt arbeitete ich als Bedienung, was mir wirklich Spaß machte, und spielte mit dem Gedanken, Psychologie zu studieren.
Zu der Zeit hatte ich ein Faible für Gesprächstherapie, hauptsächlich, weil ich selbst gerade eine Therapie bei einer freundlichen älteren Dame begonnen hatte, die eine Brille trug, deren dicke Gläser ihre Augen derart vergrößerten, dass es schien, als schaue sie mich aufmerksam an. Ich war diese Art der Aufmerksamkeit nicht gewohnt, und obwohl sie mir Unbehagen bereitete, tat mir die Frau gut. Sie gab mir jede Woche eine Stunde lang Gelegenheit, über meine Kindheit zu reden, über meine Mutter zu phantasieren und darüber, wie meine Kindheit hätte sein können, wäre sie am Leben geblieben. Wir arbeiteten diese Phantasien in der Hoffnung durch, auf eine elementare Wahrheit zu stoßen. Und was war diese Wahrheit? Es war Herbst, und ich war fünf Jahre alt, als meine Mutter starb – bei einem Unfall, der mit einer Brücke und Wasser zu tun hatte, bei einem einfachen Unfall, der mein Leben aufs Komplizierteste beeinflusste. Er machte einen anderen Menschen aus meinem Vater – einen in sich gekehrten Witwer, der Segelschuhe und Pullover mit Zopfmuster trug und sein Leben den Lauten spezieller Fischarten widmete, einen Mann, der den größten Teil seiner Zeit unter Wasser verbrachte. Es war, als seien meine Eltern beide ertrunken – meine Mutter tatsächlich und mein Vater im übertragenen Sinn.
Was ich der Therapeutin nicht erzählte, war, dass ich auf der fraglichen Fahrt mit im Auto gesessen hatte – ein wohl gehütetes Familiengeheimnis, von dem ich zufällig erfahren hatte. Es war einer meiner Tanten herausgerutscht, während sie mir die Haare bürstete. Wir hatten sie auf dem Weg nach Cape Cod im Pflegeheim besucht. Als wir weiterfuhren, erklärte mir mein Vater, dass Tante Irene nicht mehr ganz richtig im Kopf sei. »Sie bringt alles durcheinander.« Wenn die Therapeutin mir aufmerksam zugehört hatte, musste ihr klar geworden sein, dass ich mit im Auto gesessen hatte, aber ich hätte noch Jahre zu ihr gehen können, ohne es ihr zu erzählen. Sie ließ mich über die Dinge sprechen, über die ich sprechen wollte. Sie hörte zu. War das nicht alles, was man brauchte? Könnte nicht auch ich Menschen auf diese Weise helfen?
An dem besagten Morgen fuhr ich immer wieder durch dichten Nebel. Ich hatte gerade den alten Volvo meines Vaters »geerbt« und hörte Musik, die ich seit meiner Highschool-Zeit kaum gespielt hatte – in diesem Fall die Smiths. Der Volvo hatte ein Problem mit dem Auspuff, weshalb es im Wageninneren stark nach Abgasen roch. Der Nebel, die Smiths und die Dämpfe verliehen dem Morgen einen surrealen Traumcharakter.
Der Hund war ein blonder Labrador, die Sorte, die einen an einen alten Sportlehrer erinnert – stämmig, aber trotzdem athletisch. Er tauchte aus dem Nichts auf. Ich stieg voll in die Eisen, doch es war zu spät. Der Hund prallte vom Kühlergrill ab und rollte den Abhang am Fahrbahnrand hinunter.
Außer mir war niemand unterwegs. Ich hielt an und schaute nach dem Tier. Seine Augen waren glasig, der Atem ging stoßweise. Das ausgefranste rote Halsband war mit silbernen Plättchen verziert. Ich hatte Hunde nie besonders gemocht, hatte auch als Kind nie einen Hund besessen, obwohl es mir vielleicht geholfen hätte, meine Einsamkeit besser zu ertragen. Doch die Vorstellung, ein Tier im Haus zu haben, das jederzeit im Wohnzimmer erscheinen konnte, war mir unsympathisch.
Da ich Angst hatte, dass er mich beißen würde, stellte ich mich ihm vor, ehe ich ihn im Nacken kraulte. Dann schob ich die Arme unter ihn. Er war schwerer als erwartet, aber ich hob ihn hoch, wobei die Plättchen wie Glöckchen klingelten, und schleppte ihn den Hang hinauf. Schweißgebadet und zittrig vor Anstrengung legte ich ihn auf den Rücksitz und breitete meinen Mantel über ihn. Dann wendete ich den Wagen und fuhr in die Richtung, aus der ich gekommen war.
Insgeheim hatte ich mir oft gewünscht, bei einem Notfall helfen zu können, eine Zeugin zu sein, die einem Opfer das Leben rettete. Ich hatte mich immer gefragt, ob damals jemand gesehen hatte, wie der Wagen meiner Mutter ins Schleudern geriet und von der Brücke in den Fluss stürzte. Vielleicht jemand, der von einer Dinnerparty nach Hause fuhr. Oder jemand, der von der Spätschicht kam. Und noch eine Frage beschäftigte mich: Warum war meine Mutter so spät mit mir unterwegs gewesen?
Die Rezeptionistin der Tierarztpraxis hatte auf einem der Plättchen am Halsband eine Telefonnummer entdeckt und eine Nachricht auf dem AB hinterlassen. Der Hund hieß Ripken – wie der Star der Orioles. Ich stellte mir Ripkens Besitzer vor – zwei alte Baseball-Fans, die irgendwann mit forschem Schritt und Baseball-Kappen auf dem Kopf hereinkommen würden. Zu meinem Kurs käme ich bereits jetzt zu spät, und so beschloss ich zu bleiben, um zu sehen, ob der Hund die Operation überstehen würde. Ich glaube, da liebte ich ihn schon. Als ich ihn auf den Rücksitz legte, hatte er mich angesehen, als wüsste er, dass ich ihm helfen wollte.
Die Operation zog sich hin, also versuchte ich, mich mit der Lektüre einer der ausliegenden Fachzeitschriften abzulenken. In die Beschreibung der synaptischen Vorgänge im menschlichen Gehirn vertieft hörte und sah ich Peter nicht kommen, bemerkte ihn erst, als ich irgendwann hochschaute – einen langbeinigen Mann in einem makellosen Hemd und gebügelter Hose, auf dessen Schoß ein Cockapoo saß.
Ich ertappte ihn dabei, wie er mich musterte, und er schaute sofort weg. Mein Blick glitt zum Empfang. Wenn ich die Rezeptionistin auf mich aufmerksam machen könnte, würde sie mir vielleicht den aktuellen Stand der Dinge mitteilen – aber die Frau telefonierte.
Plötzlich fragte Peter: »Kann ich irgendetwas für Sie tun?«
»Wie bitte?«
»Ich möchte nicht aufdringlich sein, aber Sie sehen aus, als hätten Sie heute schon viel durchgemacht.«
Zum ersten Mal wurde ich mir meiner äußeren Erscheinung bewusst – windzerzaust, völlig derangiert und blutverschmiert. »O ja, allerhand.«
»Wird Ihr Tier operiert?«
»Ja, der Hund wird operiert, aber er gehört mir nicht.«
»Oh.«
»Er ist mir ins Auto gelaufen. Ich warte nur noch auf die Besitzer. Theoretisch bin ich wohl die Böse.«
»Aber Sie haben den Hund hergebracht. Das ist anständig. Und Sie sind geblieben.« Es war wirklich nett von ihm, das zu sagen. Er lächelte mich an, und plötzlich hatte er ein Grübchen im Kinn.
»Zumindest habe ich in der Therapie etwas zu erzählen.« Das war mir rausgerutscht. Offenbar war ich noch immer umnebelt. Ich wusste bereits, dass der Hund irgendwie meine tote Mutter repräsentierte, was umfangreiche Gespräche nach sich ziehen würde.
»Sind Sie immer auf der Suche nach neuem Material für Ihre Therapie?«, fragte er.
»Ich versuche, die Frau zu unterhalten. Das ist das Mindeste, was ich tun kann.«
»Ich ziehe es vor, meine Probleme unter den Teppich zu kehren«, scherzte er. »Mein Magengeschwür zu hätscheln.«
»Oh, ein Held.«
»Wie ein Großwildjäger.«
»Wie Hemmingway.«
»Oder wie die Leute, die in Pamplona mit den Stieren laufen.«
In diesem Augenblick rief die Rezeptionistin: »Lillipoo Stevens?«
»Ich komme!«, rief Peter zurück, dann sagte er entschuldigend zu mir: »Es ist der Hund meiner Mutter.«
»Aha.«
Als Nächstes lud er mich auf einen Drink ein.
»Wollen Sie Ihrem Magengeschwür was Gutes tun?«, fragte ich. »Sie sollten vorsichtig sein mit Einladungen an blutverschmierte Frauen. Vielleicht bin ich ja eine Mörderin …«
»Wie aufregend – ich hatte noch nie eine Verabredung mit einer Mörderin ...«
Eine Verabredung. Herrlich altmodisch. »Ich sage nur zu, wenn Sie Lillipoo mitbringen.«
Ich kramte in meiner Handtasche nach einem Kassenzettel, auf dem keine peinlichen Artikel wie Tampons aufgelistet waren, und schrieb meine Telefonnummer auf die Rückseite. Er steckte sie ein und sagte aufrichtig besorgt: »Ich hoffe, es geht alles gut da drin.«
»Danke.«
Dann marschierte er mit Lillipoo unter dem Arm los.
Peter und ich gingen ein Jahr miteinander, bevor wir zusammenzogen. Ripken zog ebenfalls mit ein. Die Operation war kostspielig gewesen. Die Besitzer, die ich nie kennengelernt hatte, im Geist aber noch immer mit Baseball-Kappen vor mir sah, hatten den Hund von einer alten Tante übernommen, die in eine Anlage für betreutes Wohnen gezogen war. Wegen seiner starken Blähungen hatten sie ihn im Freien gehalten. Sie wollten nicht für die Operation aufkommen, und sie wollten ihn auch nicht wirklich wiederhaben. Also blieb Ripken bei mir – mein ganz persönlicher alter, pupsender Sportlehrer; mein erster Hund – mit drei Beinen.
Ein Jahr danach verlobten Peter und ich uns und heirateten kurz darauf. Alles war so perfekt durchorganisiert wie ein automatischer Katzenfutterspender. Statt mit glühenden Blicken schaute er mich liebevoll an. Unsere Beziehung war von einer trägen Zufriedenheit gekennzeichnet, die wir uns aufgrund von Peters unerschütterlicher Zuversicht erlauben konnten. Er war von zwei außerordentlich zuversichtlichen Menschen aufgezogen worden, der Art Menschen, denen die statistische Wahrscheinlichkeit für gewöhnlich den Dämpfer versetzt, dass man nicht ewig leben kann, ohne eine Tragödie zu erfahren. Aber seine Eltern – Gail und Hal Stevens – stellten die Ausnahme von dieser Regel dar: Sie blieben von allem verschont, hatten eine Art Schlupfloch, eine Nische für sich gefunden. Ihre eigenen Eltern waren nach einer dezenten Ankündigung gestorben – ihnen war gerade genug Zeit geblieben, um Abschied zu nehmen, aber nicht so viel, dass sie wirklich gelitten hätten. Metaphorisch gesprochen stürzten immer wieder Bäume auf die Häuser ihrer Nachbarn, doch ihr Haus wurde verschont. Wenn auch nicht tiefreligiös, so waren die Stevens doch regelmäßige Kirchgänger, und sie waren davon überzeugt, dass Gott sie bevorzugte, indem er ihnen geistige Behinderungen, Autounfälle, Krebs, Selbstmord, Drogensucht und dergleichen ersparte. Sie gingen davon aus, nicht einfach nur Glück zu haben, sondern auserwählt zu sein, und diesen festen Glauben gaben sie an Peter weiter. Und ich liebte diese feste Burg, die Nische, in die ich durch die Heirat aufgenommen wurde, liebte den Airbag des Auserwähltseins, denn er versprach uns lebenslangen Schutz. Das Leben mit Peter war so sicher wie ein fabrikneuer Volvo.
Die gemeinsame Zeit vor unserer Heirat und das erste Jahr danach waren gut. Wir aßen Bagels und tranken Gourmet-Kaffee aus Seattle. Ich nahm wieder einen Job im Marketing-Bereich an, weil ich fand, dass ich erwachsen werden musste. Warum sollte ich einen Abschluss in Psychologie machen – die ganze Schwafelei hatte mir doch letztendlich überhaupt nichts gebracht, oder? Nein. Aber Peter – Peter und seine Nische. Meine Therapeutin mit den unnatürlich großen Augen ging in den Ruhestand, und ich suchte mir keine neue. Ich war froh, ihrem Blick entkommen zu sein. Menschen, die in einer Nische leben, brauchen keine Therapie. Außerdem war Peter Anästhesist, ich lernte die Vorzüge einer kleinen Glückspille kennen, und meine restliche Traurigkeit wurde durch ausufernden Konsum betäubt. Wir schufen uns ein hübsches Nest mit Travertin- und Marmor-Akzenten, mit Sofas und Beistelltischen und niedrigen Kommoden und Espressomaschinen. Wir waren regelrecht süchtig nach Stielgläsern. Ich lernte, Bananas Foster zuzubereiten, dieses wundervolle Dessert, bei dem die Bananen zuerst karamellisiert und dann flambiert werden, und wenn wir Gäste zum Dinner hatten, war ich für das Flambieren zuständig. Was für eine wunderschöne blaue Flamme.
Dachte ich während dieser Zeit irgendwann an Elliot Hull – daran, wie er mich im Schein der Neonröhren in der Bibliothek angesehen hatte, wie er, auf einen Ellbogen gestützt, neben mir auf dem Rasen des Campus gelegen oder mich im Schummerlicht jener schmuddeligen Bar betrachtet hatte? Ja, das tat ich. Ich schwelgte in diesen Erinnerungen, wenn ein bestimmter Song im Radio lief, wenn meine Gedanken zu den ungeordneten Verhältnissen in meiner Vergangenheit schweiften. Elliot Hull war keine nebulöse Erinnerung, nicht irgendein verschwommenes Gesicht. Er war präsent. Greifbar. Und ich erinnerte mich, dass er mir nicht die liebevollen Blicke geschenkt hatte, die ich von Peter kannte. Nicht einmal die intensiven meiner Therapeutin mit den unnatürlich großen Augen. Nein. Elliot schaute mich mit seinem ganzen Körper an, wobei er mich weniger ansah als in mich hinein. Er war zu intensiv – unhöflich intensiv. Er hätte niemals lernen können, Liebe einzuteilen und in angemessenen Dosen zu verabreichen. Er hätte sie in einem Schwall über mich ausgegossen, wenn ich ihn gelassen hätte – zu viel, zu viel, zu viel.
Kapitel 3
Am Abend der Party stand ich im Bad vor dem Spiegel und tuschte mir die Wimpern. Ich trug nichts als ein lavendelfarbenes Set aus BH und Slip, das meine blasse Haut noch blasser wirken ließ. Sonne ist nichts für mich. Nach einem Tag am Strand bin ich zuerst rot wie ein gekochter Hummer und anschließend sommersprossig wie eine Regenbogenforelle. Dann lieber blass. Das Neonlicht im Bad war nicht gerade schmeichelhaft. Peter und ich lebten in Canton, einem Yuppie-Viertel im südöstlichen Teil von Baltimore, in einem älteren, zu Luxuseigentumswohnungen umfunktionierten ehemaligen Mietshaus. Die Renovierungsmaßnahmen sollten den altmodischen Charme – Holzböden und schwere Türen – eigentlich nicht verdrängen, doch sie taten es. Ein Beispiel war die Beleuchtung. Viel zu hell. Ich vermisste die schummrige Behaglichkeit schwacher Glühbirnen. Ripken lag auf der Duschvorlage. Er spürte, wenn ich nervös war, und blieb dann in meiner Nähe. Ich schaute zu ihm hinunter, und er schaute zu mir auf. Schließlich legte er den Kopf schief und versuchte, sich mit seinem Beinstumpf am Ohr zu kratzen. Ich bückte mich und tat es für ihn. Mir war nicht wohl bei der Aussicht, Elliot wiederzusehen. Würde ich in Peters Gegenwart schamlos mit ihm flirten? Würde ich wieder wie früher werden, würde mein jetziges Ich von mir abfallen wie eine Mumienbandage und sich in einem wirren Haufen auf dem Boden türmen? Ich wollte nicht Elliot Hulls persönliche Betreuerin sein müssen oder mich in eine endlose nervige Unterhaltung verwickeln lassen. Würde Peter mich retten? »Wir brauchen eine Art Code«, rief ich ins Schlafzimmer hinüber.
»Einen Code? Wofür?«, rief Peter zurück, der sich dort anzog. Ich hörte seine Gürtelschnalle klimpern.
»Dafür, dass du nicht wieder etwas Unbedachtes tust, wie einem Fremden den Weg zu uns zu beschreiben.«
»Er ist kein Fremder. Ihr wart doch auf dem College befreundet, oder?«
»Nicht wirklich.« Womit ich meinte, dass wir gleichzeitig weniger als Freunde und gleichzeitig mehr als Freunde gewesen waren. Es sollte ein Wort dafür geben.
»Dafür kann ich aber nichts, Gwen.« Peter seufzte theatralisch.
Ich streckte meinen Kopf zur Schlafzimmertür hinein. »Ich danke dir, heiliger Peter von den wandlungsfähigen Seufzern.« Peter verstand es auf unnachahmliche Weise, Enttäuschung durch einen Seufzer auszudrücken. Aber nicht nur das. Er konnte mittels Seufzern ganze Abhandlungen darüber formulieren, wie anstrengend ich manchmal war. Er konnte die Geschichte unserer Beziehung seufzen und somit schildern, wie wir es bis zu diesem Moment meiner überwältigenden Nervigkeit geschafft hatten. Er konnte dreistimmige Harmonien seufzen oder eine ganze italienische Oper. Manchmal nannte ich ihn nach so einem grandiosen Seufzer den »großen seufzenden Tenor« oder schlicht Pavarotti.
»Immerhin hast du ihn eingeladen.«
Ein Blick in den Spiegel. Mein Gesicht sah zugekleistert aus. Ich hatte zu viel Make-up aufgetragen. Das mache ich hin und wieder. Es entspringt dem Wunsch zu verschwinden, der übermächtig wird, wenn ich nervös bin. Da ich ein nervöser Mensch bin, sehe ich oft zugekleistert aus. »Ich habe ihn nicht eingeladen. Das hat er nur behauptet.«
»Warum hast du ihm nicht einfach gesagt, dass du ihn nicht auf der Party sehen willst?«
Ich hatte es nicht gesagt, weil ich ihn ebenso sehr sehen wollte wie nicht. Es erschreckte mich, wie unser Wiedersehen in der Eisdiele mich umwarf. Ich dachte an Elliot Hull mit den unförmigen Rapper-Shorts, der Baseball-Kappe und dem charakteristischen verschmitzten Lächeln. Ich stellte mir vor, wie er so in einem Hörsaal eines fünftklassigen Community College stand und ein riesiges Eis in einer Waffeltüte schleckte, während er mit einer Hand in der Tasche Heidegger zitierte. »Er ist bestimmt kein übler Kerl. Er ist Philosoph. Ich meine – in der Philosophie findet man doch keine üblen Kerle, oder?«
»Ich denke, üble Kerle findet man überall«, erwiderte Peter. Er war fest davon überzeugt, dass die Menschen von Grund auf schlecht waren und dagegen ankämpfen mussten. Im Allgemeinen sprach er nicht darüber, also war diese Bemerkung ein Vertrauensbeweis.
»Da hast du wahrscheinlich recht«, erwiderte ich.
»Geh ihm einfach aus dem Weg.«
Ripken pupste, fuhr herum und schnappte nach seinem Furz. Ich tat mein Bestes, um seine Flatulenzen durch entsprechende Ernährung zu minimieren, aber manchmal durchwühlte er den Mülleimer oder klaute einen Schokoriegel aus meiner Handtasche, und schon ging es wieder los.
Ich bedachte ihn mit einem strafenden Blick und verließ das Bad. Peter trug ein kurzärmeliges, blau-weiß kariertes Altmännerhemd mit Button-down-Kragen und Brusttasche. »Das Hemd erinnert mich an Dr. Fogelman«, sagte ich.
»Den Nachbarn deines Vaters?«
»Ja.« Mein Vater wohnt seit mehr als dreißig Jahren neben den Fogelmans. Fogelman ist sein Zahnarzt. Leider ist er kein guter Zahnarzt. Ständig muss mein Vater sich neue Kronen einsetzen und Wurzelkanäle nachbehandeln lassen, weil es beim ersten Anlauf nicht richtig geklappt hat. Er leidet seit Jahrzehnten Schmerzen, nur weil er Dr. Fogelman nicht kränken will. Dr. Fogelman hortete in Vorbereitung für das Jahr-2000-Problem, den weltweiten Katastrophenfall zum Millennium, in seinem Keller vom Boden bis zur Decke Konserven, Wasserflaschen und Medikamente, und nachdem die Jahrtausendwende störungsfrei über die Bühne gegangen war, ernährten er und seine Frau sich ein geschlagenes Jahr ausschließlich aus Dosen. »Manchmal muss man sich durch schlechte Investitionen eben durchbeißen«, sagte er einmal zu mir. Dr. Fogelman ist ein Pessimist mit ungepflegten Zähnen und einem Überbiss, und Mrs. Fogelman steht unverbrüchlich zu ihm, auch wenn sie ihn hinter seinem Rücken »alter Scheißer« nennt.
»Bitte zieh das Fogelman-Hemd aus«, sagte ich zu Peter. »Es deprimiert mich.« Noch immer nur in Unterwäsche setzte ich mich auf die Bettkante. »Es gibt mir das Gefühl, dass wir ein altes Ehepaar sind …«
»Wie die Fogelmans?«
Ich nickte und zupfte nachdenklich an der Tagesdecke. War das die Tagesdecke eines alten Ehepaars?
»Ich mag das Hemd. Es ist retro.«
Es war nicht retro. Es war langweilig. Ein feiner Unterschied, der sich ihm nicht erschließen würde. »Vielleicht findet Elliot Gefallen an Helen. Helen ist hübsch«, sagte ich.
»Nur auf Fotos«, widersprach Peter.
»Das gibt es nicht. Hübsch ist hübsch.«
»Ich habe sie auf Fotos gesehen, als wir gerade zusammengekommen waren, und dann hab ich sie kennengelernt und gesehen, wie sie sich bewegt und wie sie lacht. Sie lacht zu laut, und sie klappt dabei jedes Mal buchstäblich zusammen – wie diese kleinen Holzperlen-Knickfiguren.«
»Oh.« Ich fragte mich, warum er mir nie erzählt hatte, wie er über Helen dachte, und wie viele kleine Betrachtungen er noch für sich behalten hatte – vielleicht auch über mich. Ich wusste, dass Peter meine Freundinnen nicht mochte, aber schließlich wusste ich selbst nicht, ob ich das tat. Es fällt mir schwer, mit Frauen befreundet zu sein. Ich konnte nie gut mit den plötzlichen Unterströmungen von Gesprächen umgehen, damit, wie gewichtig eine Unterhaltung zwischen Frauen werden konnte, und das in ganz ruhigem Ton. Frauen besitzen Superfähigkeiten in geschliffenem Dialog, und ich war grundsätzlich die Dumme. Manchmal erkannte ich erst Stunden später, dass ich wieder einmal die Zielscheibe gewesen war – Hey, Moment mal… –, aber dann war es immer schon viel zu spät für eine Reaktion. Helen war besonders tückisch. Sie war noch immer Single und ließ das neuerdings an uns aus. Noch vor ein paar Jahren hatte sie uns, ihre verheirateten Freundinnen, mit Sympathie überschüttet, einen Freund nach dem anderen zu unseren Hochzeiten angeschleppt und ausgelassen getanzt. Doch dann fing sie an, ihren Männergeschmack infrage zu stellen. Und jetzt stellte sie den Geschmack der Männer infrage. Sie schien unsere Ehen als Provokationen zu verstehen und war offensichtlich auf Krawall aus. Mit mir hatte sie ein leichtes Spiel. Sie erwischte mich jedes Mal mit offener Deckung, weil ich gar nicht daran dachte, mich zu schützen. Das schrieb ich dem Fehlen einer Mutterfigur in meinem Leben zu. Ich gehe davon aus, dass Mütter ihren Töchtern beibringen auszuweichen und Angriffe zu parieren, und diese Lektion hatte ich nicht gelernt.
»Vielleicht mag Elliot diese Knickfiguren«, sagte ich. Peter antwortete nicht.
»Wie wär’s mit Nasereiben?«, bohrte ich weiter.
»Statt Küssen – wie die Eskimos? Warum sollten wir das tun?«, fragte er.
»Ich meine nicht aneinander – ich meine unsere eigene Nase. So, siehst du?« Ich machte es ihm vor. »Als Code! Dann wüsstest du, dass du mich retten musst, falls Elliot Hull mich auf der Party bedrängt.«
»Und was ist, wenn du dir die Nase reiben musst, weil sie juckt? Bei deinen vielen Allergien …« Peter dachte immer praktisch.
»Wir könnten uns auch das Kinn reiben«, schlug ich vor. »Mein Kinn juckt so gut wie nie.«
»Wie wär’s stattdessen, wenn wir uns wie Erwachsene benähmen und nicht wie kleine Kinder, die sich eine geheime Gebärdensprache ausdenken?«
Ich möchte Peter mit meiner Schilderung nicht als gut oder böse darstellen. Wortwechsel wie diesen gibt es in jeder Ehe – sie erscheinen nur in geschriebener Form kleinkariert und aggressiv. Wir waren von Zeit zu Zeit beide kleinkariert und aggressiv, ansonsten aber durchaus liebevoll.
Liebte er mich in diesem Moment? Ich glaube ja. Ich denke, seine Liebe zu mir überraschte ihn manchmal, weshalb er das Gefühl hatte, sie im Zaum halten zu müssen. Und ich unternahm nichts dagegen. Vielleicht bestärkte ich ihn sogar darin. Peters Eltern mochten zwar die zuversichtlichen Nischen-Stevens sein, doch all ihrem Glück zum Trotz glaube ich nicht, dass viele Leute sich an ihre Stelle wünschten. Sie hatten etwas Liebloses. Peter war anders, freundlicher, liebevoller, großzügiger, aber er war trotzdem ihr Produkt. Doch war das etwa seine Schuld?