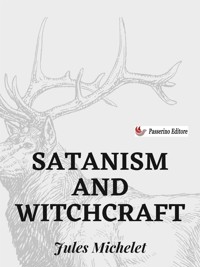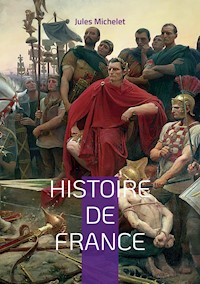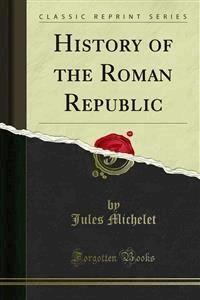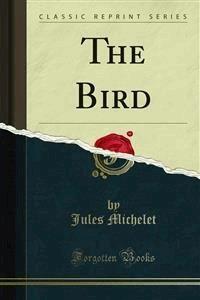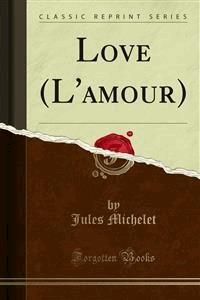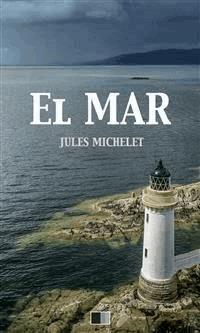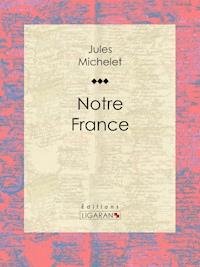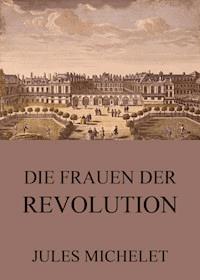Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Michelets philosophisches Buch über Liebe, Ehe und die Frau gehört nach wie vor zu den besten Werken dieser Art. Inhalt: Erstes Buch I. Von der Frau II. Die Frau ist eine Kranke. III. Die Frau darf nur wenig arbeiten. IV. Der Mann muß für Zwei verdienen. V. Wie soll die Braut sein - reich oder arm? VI. Soll man eine Französin heiraten? VII. Die Frau will die Festigkeit und Vertiefung der Liebe. VIII. Du mußt deine Frau schaffen; es ist ihr eigener Wunsch. IX. Wer bin ich, daß ich eine Frau schaffen könnte? Zweites Buch. I. Die Schäferhütte. II. Die Heirat III. Die Hochzeit. IV. Das Erwachen. - Die junge Herrin vom Hause. V. Je enger der häusliche Kreis, desto besser. VI. Die Tafel. VII. Sie müssen sich selbst bedienen. VIII. Diätetik. IX. Von der geistigen Befruchtung. X. Von der moralischen Zeitigung. Drittes Buch. I. Empfängnis. II. Die Schwangerschaft und der Stand der Gnade. III. Die Schwangerschaft. - Der Nebenbuhler. IV. Die Niederkunft. V. Wochenbett und erster Ausgang. Viertes Buch. I. Der Säugling. Trennung. II. Die Liebe zur Veränderung. III. Die junge Mutter wird von ihrem Sohn getrennt. IV. Die Welt. Ist der Wert des Mannes gesunken? V. Die Fliege und die Spinne. VI. Die Versuchung. VII. Eine Rose als Ratgeberin. VIII. Heilung des Herzens. IX. Heilung des Körpers. Fünftes Buch. I. Zweite Jugend der Frau. II. Das Walten der züchtigen Hausfrau. III. Sie verfeinert den Geist und giebt uns die Begeisterung wieder. IV. Es giebt keine alte Frau. VI. Ist die Einigkeit erreicht? VII. Tod und Trauer. VIII. Die Liebe über das Grab hinaus. Noten und Erläuterungen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 434
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Liebe
Jules Michelet
Inhalt:
Jules Michelet - Biografie und Bibliografie
Die Liebe
Einleitung.
Erstes Buch
I. Von der Frau
II. Die Frau ist eine Kranke.
III. Die Frau darf nur wenig arbeiten.
IV. Der Mann muß für Zwei verdienen.
V. Wie soll die Braut sein – reich oder arm?
VI. Soll man eine Französin heiraten?
VII. Die Frau will die Festigkeit und Vertiefung der Liebe.
VIII. Du mußt deine Frau schaffen; es ist ihr eigener Wunsch.
IX. Wer bin ich, daß ich eine Frau schaffen könnte?
Zweites Buch.
I. Die Schäferhütte.
II. Die Heirat
III. Die Hochzeit.
IV. Das Erwachen. – Die junge Herrin vom Hause.
V. Je enger der häusliche Kreis, desto besser.
VI. Die Tafel.
VII. Sie müssen sich selbst bedienen.
VIII. Diätetik.
IX. Von der geistigen Befruchtung.
X. Von der moralischen Zeitigung.
Drittes Buch.
I. Empfängnis.
II. Die Schwangerschaft und der Stand der Gnade.
III. Die Schwangerschaft. – Der Nebenbuhler.
IV. Die Niederkunft.
V. Wochenbett und erster Ausgang.
Viertes Buch.
I. Der Säugling. Trennung.
II. Die Liebe zur Veränderung.
III. Die junge Mutter wird von ihrem Sohn getrennt.
IV. Die Welt. Ist der Wert des Mannes gesunken?
V. Die Fliege und die Spinne.
VI. Die Versuchung.
VII. Eine Rose als Ratgeberin.
VIII. Heilung des Herzens.
IX. Heilung des Körpers.
Fünftes Buch.
I. Zweite Jugend der Frau.
II. Das Walten der züchtigen Hausfrau.
III. Sie verfeinert den Geist und giebt uns die Begeisterung wieder.
IV. Es giebt keine alte Frau.
VI. Ist die Einigkeit erreicht?
VII. Tod und Trauer.
VIII. Die Liebe über das Grab hinaus.
Noten und Erläuterungen.
Die Liebe, Jules Michelet
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849631765
www.jazzybee-verlag.de
Jules Michelet - Biografie und Bibliografie
Franz. Geschichtschreiber und Philosoph, geb. 21. Aug. 1798 in Paris, gest. 9. Febr. 1874 in Hyères, ward schon 1821 Professor der Geschichte am Collège Rollin. 1826 erschien seine erste schriftstellerische Arbeit, das »Tableau chronologique de l'histoire moderne«. Die Julirevolution verschaffte ihm die Stelle eines Vorstehers der historischen Sektion im Reichsarchiv. Gleichzeitig berief ihn Guizot als seinen Substituten an die Sorbonne, und Ludwig Philipp ernannte ihn zum Geschichtslehrer der Prinzessin Klementine. Es folgte nun eine Reihe historischer Arbeiten: »Histoire romaine: République« (Par. 1831, 2 Bde.; 5. Aufl. 1876); »Précis de l'histoire de France, jusqu'à la Révolution française« (das. 1833, 4. Aufl. 1841); »Précis de l'histoire moderne« (das. 1828 u. öfter); »Histoire de France« (jusqu'an XVI. siècle, 6 Bde.; au XVI. siècle, 4 Bde.; an XVII. siècle, 4 Bde.; an XVIII. siècle. 3 Bde.; zusammen, das. 1833 bis 1866, 18 Bde.; neue Aufl. 1879, 19 Bde.); »Mémoires de Luther« (1845, 2 Bde., mit vielen schiefen Urteilen); »Origines du droit français cherchées dans les symboles et formules du droit universel« (1837); »Des Jésuites« (mit E. Quinet, 1843; deutsch, Basel 1843); »Le prêtre, la femme et la famille« (1815) und »Le peuple« (1846), beide auch deutsch. 1838 ward M. in die Akademie aufgenommen und gleichzeitig zum Professor der Geschichte am Collège de France ernannt. Wegen seiner fortgesetzten demokratischen Propaganda vom Lehrstuhl aus wurde er 1850 seiner Professur und, da er die Ablegung des Eides auf die Verfassung vom 14. Jan. 1852 verweigerte, im Juni d. J. auch seiner Stelle als Chef der historischen Sektion in den Archiven enthoben. Er lebte darauf in der Bretagne, mit der Ausarbeitung seiner größeren Werke, namentlich seiner »Histoire de France« und der berühmten »Histoire de la Révolution française« (Par. 1847–53, 7 Bde.; 1879, 9 Bde.), beschäftigt. Auch einige oft ausgelegte poetisch naturgeschichtliche Arbeiten lieferte er noch: »L'oiseau« (1856; deutsch, 4. Aufl., Berl. 1869); »L'insecte« (1857; deutsch, Braunschw. 1858); »L'amour« (1858; deutsch von Spielhagen, 5. Aufl., Leipz. 1889); »La femme« (1859; deutsch von demselben, 2. Aufl., das. 1875), eine Philosophie der Liebe und Ehe; »La mer« (1861; deutsch von demselben, das. 1861); »La sorcière« (1862; deutsch, das. 1863). Unter dem Eindruck der Ereignisse von 1870/71 schrieb er »La France devant l'Europe« (Flor. 1871). Seine »Histoire du XIX. siécle« blieb unvollendet (Bd. 1–3, bis 1815 reichend, Par. 1872–75). Im Gegensatz zu dem pragmatischen Standpunkt, auf dem die Geschichtschreibung Guizots und Mignets steht, hat M. eine halb philosophische, halb poetische, aber immer tendenziöse und effekthaschende Darstellungsweise. Wenige Schriftsteller sind soviel gelesen worden wie M. Sein Leichenbegängnis gestaltete sich daher auch zu einer Demonstration des republikanischen Frankreich gegen alle Reaktionsgelüste. Am 12. und 13. Aug. 1898 wurde ihm eine große Hundertjahrfeier in Paris veranstaltet. Seine »Œuvres complètes« erschienen 1893–99 in 40 Bänden, dann 1897–1903 in 47 Bänden. Nach seinem Tod erschienen von ihm, herausgegeben von seiner zweiten Frau, seiner treuen Mitarbeiterin: »Ma jeunesse« (1884) mit der Fortsetzung »Mon journal 1820–1823« (1888, neue Ausg. 1904). Vgl. die Schriften von Gabriel Monod. Jules M. (Par. 1876), Les maîtres de l'histoire. Renan, Taine, M. (1894) und Jules M., études sur sa vie et ses œuvres (1905); Noël, Jules M. et ses enfants (1878); Corréard, M., sa vie, etc. (1886); J. Simon, Mignet, M., Henri Martin (1889); Madame Quinet, Cinquante aus d'amitié, Michelet, Quinet, 1825–1875 (Par. 1899).
Die Liebe
Vorwort des Übersetzers zur zweiten Auflage
Die Übersetzung eines Werkes, welches schon zur Zeit, als es nur erst im Original zu lesen war, von fast sämtlichen Organen unserer Kritik mehr oder weniger ausführlich besprochen wurde, mit einem Vorwort zu begleiten (noch dazu die zweite Auflage derselben – die erste war nach wenigen Wochen vergriffen), dürfte vielen genau so verdienstlich erscheinen, als: Wasser in den vollen Brunnen schöpfen. Dennoch bin ich der Aufforderung des Herrn Verlegers, dieser zweiten Auflage einige Worte der Verständigung vorauszuschicken, gern nachgekommen, einmal aus uneigennütziger Teilnahme an dem Schicksale eines Buches, dessen edle Tendenz vielfach verkannt, dessen praktischer Nutzen allgemein angezweifelt ist, und sodann auch in meinem eigenen Interesse, der ich die seit dem Erscheinen der ersten Auflage häufig an mich gestellte Frage: aber wie haben Sie nur dies Buch übersetzen können? ein- für allemal zu beantworten wünsche.
Der Übersetzer befindet sich seinen Landsleuten gegenüber immer in der Lage jemandes, der eine ihm bekannte und liebe Person in eine geschlossene Gesellschaft einführt, zu der er selbst gehört. Wird sein Freund gefallen? wird er mißfallen? so fragt er sich nicht ohne einiges Herzklopfen, und er weiß, daß, wenn das erstere geschieht, wenn der Eingeführte durch seinen Geist, seinen Witz, seine Unterhaltungsgabe, seine weltmännischen Manieren sich schnell aller Herzen gewinnt, ihm selbst kein Wort des Lobes, kein Lächeln des Beifalls zu teil wird, daß aber im anderen Falle, wenn der Fremde durch seine ungewohnte Erscheinung, durch die Weise, wie er seine Ansichten äußert, durch diese Ansichten selbst mißfällt und anstößt – er die ganze Verantwortlichkeit seines gut gemeinten Schrittes wird tragen und zehnmal an einem Tage wird hören müssen: Wie konnten Sie nur diesen seltsamen Menschen bei uns einführen? Dieser letztere Fall ist nun, wie schon gesagt, gewissermaßen der meinige.
Man hat sich von einer gewissen Seite nicht gescheut, Michelets Buch geradezu für ein unmoralisches Buch zu erklären; andere, die mit Lessing einen Unterschied machen zwischen unmoralisch und unsittlich, sprechen das Werk von dem ersteren Vorwurf frei, räumen aber ein, daß es vielfach gegen die Sitte verstoße; wieder andere, die noch feiner distinguieren, wollen die Moralität oder die Sittlichkeit nicht in Zweifel ziehen und beschränken sich darauf, es in hohem Grade indecent zu nennen.
Auf diese Vorwürfe läßt sich in aller Kürze folgendes erwidern: Wenn: den Menschen die Binde von den Augen und die Gängelbänder von den Schultern streifen, gegen die Moralität verstößt, so ist Michelets Buch sehr unmoralisch; wenn: die Dinge da, wo es nötig ist, bei ihrem rechten Namen nennen, sich mit der Sittlichkeit nicht verträgt, so ist es bedenklich unsittlich; wenn an ein Werk, das selbstredend nur für Erwachsene geschrieben ist, derselbe Maßstab gelegt werden muß, mit welchem Schriften, die für junge Damen in Pensionen oder für unreife Knaben bestimmt sind, gemessen werden – so ist es entsetzlich indecent.
Als die guten Leute und schlechten Musikanten Goethen wegen der sogenannten Indecenzen und Unsittlichkeiten in seinem Wilhelm Meister zur Rede stellten, schrieb Schiller an den Ersteren: "Sobald mir einer merken läßt, daß ihm in (poetischen) Darstellungen irgend etwas näher anliegt als die innere Notwendigkeit und Wahrheit, so gebe ich ihn auf. Könnte er (Jacobi) Ihnen zeigen, daß die Unsittlichkeit der Gemälde nicht aus der Natur des Objekts fließt, und daß die Art, wie Sie dasselbe behandeln, nur von Ihrem Subjekt sich herschreibt, so würden Sie allerdings dafür verantwortlich sein." Dasselbe gilt auch hier. Ich gebe zu, daß die Sinnlichkeit in diesem Buche eine große Rolle spielt – aber thut sie das etwa in der Liebe nicht? gebe zu, daß gewisse Dinge besprochen werden, die wohl sonst nur in einem tête à tête der Gatten, oder in einer Konferenz mit dem Arzte zur Sprache kommen, daß Situationen angedeutet werden, die man allerdings sonst nur in lasciven Romanen findet – aber wenn jemand den Beweis führen kann, daß die so beschaffenen Dinge mutwillig von Michelet herbeigezogen wurden, daß er die so beschaffenen Situationen schildert, nicht um eine moralische Wahrheit damit zu veranschaulichen, sondern um die Sinne der Leser zu kitzeln – so will ich alle Vorwürfe über mich und meinen Autor ohne Murren ergehen lassen; denn wir haben sie reichlich verdient – der Ritter so gut wie der Knappe. Hören wir, was Michelet selbst über diesen häkligen Punkt sagt: "Wir sind auf der Schwelle dieses wichtigen Themas (die Kunst, das Leben durch die Liebe zu verlängern) stehen geblieben, obgleich wir sehr wohl wissen, daß die heuchlerische Decenz, mit der man einen Schleier darüber gedeckt und so alles der Laune preisgegeben hat, nichts zu reinigen, nichts zur Versittlichung beizutragen vermag. Indem man darauf verzichtete, die geheimen Beziehungen der Ehe aufzuklären, hat man daraus eine dunkle Welt, in welcher die grobe Natur alles ist, und die man deshalb verachten zu können glaubte, geschaffen. Man hat dann fälschlich behauptet, daß die Liebe entnervend wirke, während sie doch im Gegenteil eine unversiegliche Quelle der Kraft ist."
In Abrede stellen zu wollen, daß das sinnliche Element ein mächtiger Faktor in der Liebe ist, kann nur den Thoren oder den Heuchlern einfallen. Daß Michelet es also in Rechnung brachte, und bringen mußte, versteht sich von selbst, und nur dem Vorwurf dürfte er nicht entgehen, den physiologischen Teil seiner Aufgabe mit allzu großer Vorliebe bearbeitet zu haben. Dazu kommt noch der Übelstand, daß er nach Art der Laien, die mit den Resultaten einer fremden Wissenschaft experimentieren, bald zu viel, bald zu wenig sagt: zu viel für den Eingeweihten, zu wenig für die anderen; daß er ferner (auch nach Laienart) oft einen übermäßigen Wert auf Einzelheiten legt, die ihm riesengroß erscheinen, da er sie nicht aus dem Mittelpunkte des Ganzen herausbetrachtet; und daß es ihm dabei nicht selten begegnet, bloße Hypothesen für festgestellte Thatsachen anzusehen. Aus diesem Grunde habe ich geglaubt, einiges rein Physiologische, das diesen Stempel der Halbheit zu deutlich trug, auslassen zu müssen, so die Noten 3 und 4, zumal in denselben nicht viel vorkommt, was im Texte nicht wenigstens angedeutet wäre. Sodann aber habe ich auch, eingedenk des Goetheschen Wortes, daß eines sich nicht für alle schickt, durch das ganze Buch hindurch, wo es irgend thunlich war, gewisse Ausdrücke vermieden, von denen ich sehr wohl weiß, daß sie den in dieser Beziehung wenig verwöhnten Franzosen vollkommen harmlos erscheinen, aber die keuschen Ohren der Deutschen beleidigen würden.
Hier muß ich gleich noch einige andere Punkte erwählten, die manchem, der mit französischem Wesen und französischer Sitte weniger vertraut ist, bei der Lektüre dieses Buches von der Liebe auffallen möchten. So dürfte es gleich von vornherein befremden, daß die französische Liebe mit der Ehe anfängt, oder, um es genauer auszudrücken, sich erst in der Ehe einstellt. Von jener bitter-süßen Empfindung, die das deutsche Volkslied schildert:
Kein Feuer, keine Kohle Kann brennen so heiß, Als heimliche Liebe, Von der niemand nichts weiß; –
von dem Luxus poetischer Sentimentalitäten, die der Deutsche, sofern er wirklich ein Deutscher ist, während der Zeit von dem Tage der Verlobung bis zu dem Hochzeitstage konsumiert, von all der Mondscheinspoesie auf Wasserfahrten und Landpartien, diesem liebeheißen Sehnen und entsagungsreichen Schmachten, dieser wunderlichen, echt-deutschen Mischung sinnlicher Glut und reinster platonischer Schwärmerei – von dem allen hat der praktische Franzose kaum eine Ahnung, das alles geht weit über seine Begriffe von dem, was man der Dame seines Herzens schuldig ist. Sich für sie im bois de Boulogne schlagen, vielleicht auch totschießen lassen – warum nicht? Aber wie der Ritter Toggenburg lange Jahre nach einem gewissen Fenster hinaufschauen, so lange, bis die (möglicherweise bereits verblühte) Liebliche unser eheliches Weib wird; die einmal Erkorene sich erkämpfen durch tausend Entbehrungen, tausend Hindernisse – wie seltsam! Hangen und Bangen in schwebender Pein, da doch wahrlich an galanten Abenteuern vom aristokratischen Salon im Faubourg St. Germain bis zum Garten Mabille hinab kein Mangel ist – wie wunderlich! Sich für Marie zu Tode grämen, während Amande, Heloise und Jeanneton ihre Reize (an denen sich vielleicht nur aussetzen läßt, daß sie käuflich sind) an ihn verschwenden – wie albern!
Bekanntlich sind die meisten französischen Heiraten, was man Konvenienz-Heiraten nennt. Die französische Erziehung, sowohl der Knaben als der Mädchen, ist der dürre Boden, auf dem diese hohlen Nüsse vortrefflich gedeihen. Bei uns bleiben die Kinder, Knaben und Mädchen, so lange es irgend geht, in dem elterlichen Hause. Der Jüngling verläßt es selten früher, als bis der von ihm gewählte Beruf es dringend notwendig macht; das Mädchen bleibt bis zur Verheiratung. So wachsen Brüder und Schwestern, so wachsen die Nachbarskinder, die Kinder der bekannten Familien nebeneinander, miteinander auf. Aus der kindischen Neigung wird eine ernste, aus der Tanzstundenbekanntschaft eine heimliche Liebschaft – schließlich öffentliche Verlobung – Hochzeit. Da bringe nun einmal jemand eine Konvenienz-Ehe zustande! Ganz anders bei den Franzosen. Der Knabe wird, wenn er zwölf Jahre alt ist, in das College geschickt, das Mädchen ebenso in die Pension; und von da ab sehen sich die Nachbarskinder eigentlich erst wieder, wenn er ein Mann, und sie, die mit fünfzehn Jahren ins elterliche Haus zurückkehrte und ein oder zwei Jahre hinter dem Stuhle ihrer Mutter im Salon eine sehr bescheidene Rolle spielte, vielleicht eben mit einem Manne, der dem Alter nach ihr Vater sein könnte, verheiratet ist. Die junge Frau, der junge Mann finden sich ganz zufällig in einer Gesellschaft. Sie erinnern sich der gemeinsam verlebten Kinderjahre. "Wissen Sie noch, damals? ..." – "Ja, und als Sie nun hernach ..." Sie kommen tief ins Gespräch. Nur mit Bedauern brechen sie es ab, als jetzt der ältliche Herr mit der schon etwas kahlen Stirn (hoher Beamter, Bankier oder dergleichen) auf die junge Dame zutritt und ihr in kühlem Tone mitteilt: "Meine Liebe, der Wagen ist da!" "Besuchen Sie uns doch ja recht bald!" sagt die Dame beim Abschiede zu dem wiedergefundenen Gespielen ihrer Jugend. Natürlich verabsäumt er nicht, einer so freundlichen Einladung Folge zu leisten ... Der junge Mann kann der Konvenienz-Ehe sehr gefährlich werden.
Diese Fundamentalverschiedenheiten französischen und deutschen socialen Lebens muß der Leser im Auge behalten, wenn ihn nicht manches in Michelets Buche befremden soll. So aber wird er die etwas frostige Sentimentalität des Kapitels "die Schäferhütte", wo der Liebende zum erstenmal die Geliebte (?) spazieren führt (die Eltern folgen in einiger Entfernung!), erklärlich finden; wird es verstehen, warum die französische Braut an ihrem Hochzeitstage so namenlos verwirrt und aufgeregt ist; wird es begreifen, weshalb Michelet sagen kann: "Manche, die schon seit Monaten verheiratet ist, blieb in ihrem Herzen ein Mädchen", einen Satz, den wir Deutsche füglich umkehren können: Manche, die sich erst in Monaten verheiraten wird, ist schon im Herzen eine Frau; wird es schließlich verstehen, warum in den ersten Jahren der französischen Ehe so vieles zur Sprache kommt, worüber deutsche Verlobte sich lange vor der Hochzeit verständigen konnten, und warum der Franzose der Liebhaber seiner Frau nicht ist, sondern wird.
Und wenn sich so die gemütliche Seite des Verhältnisses bei den Franzosen erst in der Ehe entwickeln kann, so beginnt auch die geistige erst jetzt, kultiviert zu werden. "Das französische Mädchen", sagt Michelet, "tritt eben vollständig unwissend in die Ehe", und ein anderes Mal: "aber ach! die Ärmste ist Finsternis selbst". Dies ist die Folge jener obenerwähnten Pensionserziehung, die meistens von Ordensschwestern, welche sich im besten Falle mehr durch Frömmigkeit als Gelehrsamkeit auszeichnen, geleitet wird; sodann der sklavischen Abhängigkeit, in welcher die französische Mutter (die französischen Mütter sind terribles M.) ihre Tochter hält, und des gänzlichen oder fast gänzlichen Mangels an Umgang mit jungen Leuten des andern Geschlechts. Ein deutsches Mädchen, das einen guten Schulunterricht genossen hat, im Hause ihrer Eltern, im Umgange mit Freundinnen, Brüdern, Freunden der Brüder u. s. w. tausendfache Gelegenheit gehabt hat, sich zu unterrichten, muß natürlich mit einem ganz anderen Fond von Kenntnissen ausgestattet, geistig ganz anders vorbereitet in die Ehe treten, so daß bei ihr von den "sieben Festungswerken der Seele", die Michelet bei seiner jungen Französin zu überwinden findet, etwa nur eines, und vielleicht nicht einmal das vorhanden ist.
Versucht nun aber der Franzose die Lacunen der Pensionserziehung bei seiner jungen Frau auszufüllen, welche Hindernisse treten ihm da entgegen! Will er selbst sie durch Überredung leiten, durch das lebendige Wort auf sie wirken, so steht ihm seine eigne trockne, scholastische College-Bildung im Wege; will er von Herzen zu Herzen sprechen, so findet er keine Worte für Empfindungen, die ihm selbst so neu sind; und will er die Dichter und Denker seiner Nation für sich sprechen lassen, so entdeckt er zu seinem Erstaunen, daß "das erste Buch, das wirklich für eine Frau geschrieben wäre, noch erst geschrieben werden muß". So hart dieser Ausspruch klingt, er ist kaum übertrieben. Was, im ganzen Umfange der französischen Litteratur, soll denn der Gatte seiner jungen Gattin vorlesen oder zur Lektüre empfehlen, von Corneille und Racine an (bei denen sie einschlafen dürfte) bis zur Fanny von Feydeau oder den Memoiren der Phryne Mogador! Wohl haben wir Deutsche diesem französischen testimonium pauperitatis gegenüber Ursache, stolz zu sein auf eine Litteratur, in der Erscheinungen wie Heinses Ardinghello, dessen nackte Sinnlichkeit noch dazu in Vergleich mit der faunischen, kokett verschleierten Lüsternheit in den liaisons dangereuses, im Faux-Blas und in unzähligen anderen französischen Romanen sehr gesund und unschuldig ist, denn doch zu den Seltenheiten gehören.
Und hier sind wir auch wohl an dem Punkte angekommen, der für Michelets Buch der Ausgangspunkt geworden ist. Angesichts dieser traurigen Versumpfung der neueren französischen Litteratur, dieser Litteratur des demi-monde mit ihren Cameliendamen, fils naturels etc. ruft er aus: "O, ein der Frau würdiges Buch, wo es finden? ein heiliges Buch, das zart und doch nicht entnervend wäre! das sie kräftigte, ohne sie hart zu machen, das sie nicht durch eitle Träume verwirrte! ein Buch, das sie nicht in die prosaische, drückende Wirklichkeit, nicht in die Dornen der Widersprüche schleuderte! ein Buch voll von dem Frieden Gottes". Daß Michelet, als er sich niedersetzte, sein Buch über die Liebe zu schreiben, im Herzen seines Herzens darnach trachtete, darnach strebte, diese Lücke auszufüllen, das wird selber der nicht in Abrede stellen können, welcher behauptet, daß diese Absicht nur zum kleinsten Teile erreicht sei.
Dennoch hat man sich von einer gewissen Seite nicht entblödet, die Reinheit dieser Absicht in Zweifel zu ziehen. "Liebt Herr Michelet das Geld? liebt Herr Michelet den Skandal?" so fragt eine (zufälligerweise diesmal französische) Stimme der großen und mächtigen Partei, deren praktische Moral sich in den Satz zusammendrängt: daß der Zweck die Mittel heilige. Es giebt keine schnödere Verleumdung. Wenn ein Mann in Frankreich über die Sittenlosigkeit, die seit den Tagen Ludwigs XIV., wie ein schleichendes Gift, die oberen Schichten der Gesellschaft zerfressen hat, und dort tiefer und tiefer in den socialen Körper sickert, empört ist; wenn ein Mann die Schmach einer Despotie, die auf der geistreichen, aber frivolen und charakterlosen Minorität, und auf der von den Pfaffen in trostloser Unwissenheit gehaltenen Majorität seiner Nation gleicherweise lastet, tief und bitter empfindet – so ist es Michelet; wenn ein Mann in Frankreich die schnöde Trias: Lüge, Dummheit und Tyrannei gründlich verabscheut und begriffen hat, daß in demselben Augenblick, in welchem die Binde des Aberglaubens von dem Auge seiner Brüder fällt, sie auch das Band, an welchem despotische Willkür sie gängelt, von den Schultern streifen können – so ist es wiederum Michelet. Er hat erkannt, daß "die Freiheit ein leerer Schall ist, so lange der Bürger nicht der Sitte des Sklaven entsagt", daß "an dem Tage, an welchem die jungen Leute sich zu ernsten Sitten bekennen, die Freiheit gerettet ist." Michelets Buch ist der mit Rosen bekränzte Dolch eines Republikaners, gezückt gegen die Brust des Despoten, und auf seinem Titelblatte könnte, wie auf Schillers Räubern, ein Leu, der die Pranken drohend erhebt, gezeichnet sein, mit der Unterschrift: in tyrannos!
Michelet spricht mit einer unter den jetzigen Verhältnissen staunenswerten Kühnheit von der Zeit der Freiheit, "die ja doch einmal auch für uns kommen wird"; von dem herrlichen Frühlingsmorgen, wo "die Witwe, die so lange in Dunkelheit lebte, die heiligen Farben, denen ihr Gatte im Leben folgte, schauen wird: strahlend im Glanze des neuen Tages wieder erscheinen am Friese der Tempel".
Um aber diesen Tag des Lichts herbeizuführen, dazu sieht Michelet nur ein Mittel. Nicht Tyrannenmord, nicht das blutige Werk einer Nacht, wenn uns der nächste Morgen moralisch nicht gebessert findet – "Es ist die Reform der Liebe und Familie, welche den anderen Reformen vorangehen muß und sie überhaupt erst möglich macht. Die Gesellschaft stützt sich auf die Familie und die Familie auf die Liebe. So ist die Liebe vor allem anderen". Das ist Michelets Plan, ein im schönsten Sinne demokratischer und vielleicht praktischerer Plan, als der von Schiller in seinen Briefen über ästhetische Erziehung entwickelte: die Menschen durch die Schönheit zur Freiheit zu führen. Nein, nur wer die eigne freche Willkür bändigt und sich freudig dem moralischen Gesetz beugt, darf auch die Willkür im Staatsleben verdammen und das für alle gleiche Gesetz proklamieren – denn er begreift dessen Heiligkeit; nur wer die eignen blinden Begierden machtvoll beherrscht, ist es wert, der Bürger eines freien Staates zu sein – denn er allein ist dazu fähig. Der Wollüstling mag den Druck der Ketten fühlen, mag sie mit einer plötzlichen gewaltsamen Anstrengung zerbrechen – aber bewahren kann er die Freiheit nicht. Mit Männern wie Fiesko kann man wohl Tyrannen stürzen, aber sie sind die ersten, die der jungen Republik durch ihre Unfähigkeit, dem Gemeinwohl ihre phantastischen Wünsche zu opfern, gefährlich werden.
So hat Michelet, indem er nur die moralische Freiheit zu wollen scheint, ein viel weiter hinaus liegendes Ziel im Auge, das er nicht erst zu nennen braucht, da der Weg, auf den er seine Mitbürger weist, direkt zu diesem Ziele führt. "Konzentriert eure Kraft oder geht unter!" Werdet moralische Menschen oder gebt die Hoffnung auf, jemals freie Menschen zu sein – das ist die Alternative, die er ihnen stellt. Er zeigt ihnen das gelobte Land der politischen Freiheit von fern; aber er verkündet ihnen prophetisch, daß dies frivole, kraftlose, verblendete Geschlecht nicht imstande ist, es zu erobern oder das eroberte zu bewahren, und daß dies Geschlecht in der Wüste der Sklaverei irren und immer umherirren wird, bis es einem besseren Platz gemacht hat, oder selbst ein besseres geworden ist. Michelets Buch ist der Aufschrei eines edlen Herzens, das die Schande seiner Nation bluten macht, ein feierlicher Protest gegen die Beglückungstheorien des Napoleonismus, und wenn die weltliche Tyrannei konsequent wäre, oder es wagte, konsequent zu sein, so müßte sie dieses Buch verbieten, wie die stets konsequente geistliche Tyrannei zu Rom es ganz kürzlich erst in die Totenlisten des index congregatione eingetragen hat. (S. Augsb. Ztg. v. 21. Apr.)
Ein geistvoller Kritiker dieses Werkes in der Revue des deux Mondes hat die Bemerkung gemacht, daß Michelets Buch von dem nichtkatholischen Leser wohl kaum verstanden werden dürfte. Der Satz ist nicht ganz richtig formuliert. Es muß heißen: der zum Teil offene, zum Teil versteckte Angriff gegen den Katholizismus, der sich durch das ganze Buch zieht, wird von dem Nichtkatholiken kaum bemerkt, also auch kaum empfunden werden. Natürlich! Was für den einen eine bloße Wahrheit ist, enthält für den anderen eine schwere Anklage; was für diesen eine harmlose Bemerkung, ist für jenen bittere Satire, denn, wie Hamlet sagt:
Der Gesunde hüpft und lacht, Dem Kranken ist's vergällt.
Um es mit einem Worte zu sagen: Michelets Buch ist durch und durch protestantisch, ja, in gewissem Sinne hyperprotestantisch. Dieser Punkt bedarf einer genaueren Erörterung.
Wir sahen oben, daß Michelet folgerichtig durch die moralische Freiheit zur politischen gelangen will, daß er den Staat auf die Familie, die Familie auf die Ehe, die Ehe auf die Liebe basiert. Wie denkt er sich nun diese Ehe? wie will er, daß diese Liebe sei? Die Liebe ist ihm kein Drama, sondern ein Epos; ein Fluß, nicht in dem Augenblicke seiner Überschwemmung, sondern in der Ausdehnung seines ganzen Laufs von der winzigen Quelle droben im Gebirge hinab ins ebene Land durch Saatgefilde und öde Strecken bis ins ewige Meer; eine Progression in infinitum, keine endliche, sondern eine unendliche Größe; eine Flamme, die jetzt heller, jetzt trüber brennt, aber immer brennt, immer weiter greift, bis sie allen Stoff verzehrt, bis sie den ganzen Menschen ergriffen hat, jede Faser des Leibes, jede Regung des Herzens, jeden Gedanken des Geistes; eine mächtige Alchymie, die aus den zweien eines macht, und zuletzt, um ihr Ziel ganz sicher zu erreichen, um den peinlichen Erdenrest, den das Leben unaufgelöst ließ, vollends zu vernichten, den Tod zu Hilfe ruft. Diese unendliche und in ihrem letzten Grunde mystische Liebe ist der genaue Gegensatz jener endlichen, gemeinen "Raupenliebe, die sich von Blume zu Blume schleppt, überall nur den Rand benagt und nie bis zur eigentlichen Süßigkeit dringt". Sie ist der Polygamie des Orients und der noch viel schmachvolleren und verderblicheren Polygamie des Occidents unmöglich; sie kann nur gedeihen in der Monogamie, in der Vereinigung, dem Bunde zweier Liebenden, wo der Mann mit der Wahl seiner Gattin feierlich auf alle übrigen Frauen, die Frau mit der Wahl ihres Gatten feierlich auf alle übrigen Männer verzichtet; jedes in dem anderen den ausschließlichen Repräsentanten des Geschlechts sucht und findet. Soll das aber geschehen können, so müssen sie sich auch eben alles in allem sein, und so wird die Gattin nach und nach die Genossin, die Vertraute, die Freundin, die Mitarbeiterin ihres Gatten; der Gatte ebenso folgerichtig der Freund, der Lehrer, der Arzt, der Priester seiner Gattin. Der Priester! Ja! Er soll ihre engherzige, egoistische Liebe zur großherzigen, allgemeinen Menschenliebe steigern; er soll sie das große Wort, das heilige Wort der Neuzeit: Brüderlichkeit, an dem sie nur erst buchstabiert, lesen lehren; soll ihr lehren, daß: nicht der Glaube an die persönliche Fortdauer, oder an die unbefleckte Empfängnis Mariä, oder irgend ein anderes katholisches oder protestantisches, jüdisches oder mohammedanisches Dogma, sondern daß "das Recht und die Gerechtigkeit das oberste Prinzip des modernen Lebens ist. Ein höheres, umfassenderes Prinzip, als selbst die Liebe; denn die unparteiische, wohlwollende Gerechtigkeit hat alle Wirkungen der Liebe und ist die höhere Liebe, denn sie hat das Individuum zum Objekt und umfaßt doch zugleich das Gemeinwesen". So tritt denn nicht über die Schwelle dieses Hauses, Mann im Talare! die Heilige, die drinnen stirbt, stirbt in den Armen ihres Gatten, ihres Priesters, ihre reine Seele aushauchend in einem letzten Kusse. Steh' auf aus deinem Beichtstuhl! du wartest vergeblich! Nicht zu dir, dem fremden Manne, wird sie flüchten, die junge Frau, in deine profanen Ohren ein Geheimnis zu stammeln, vor dem sie selbst errötet; schon birgt sie das brennende Antlitz an dem Busen ihres edlen Gemahls, und in der Unendlichkeit seiner Liebe hat sie bereits die Absolution gefunden. –
Will aber so der Gatte (und er muß es wollen) seiner Gattin alles in allem sein; will aber so die Gattin (und sie muß es wollen) sich einer so heroischen Liebe würdig zeigen – so müssen sie auch ihr bestes Leben an die Erreichung des hohen Zieles setzen. Der ungeheure Gewinn erfordert eine ungeheure Anstrengung; der endliche Sieg kann nur durch einen fortgesetzten Kampf errungen werden – einen Kampf gegen eine Welt in Waffen: gegen die eigne Schlaffheit, den eignen Egoismus, die eigne Willkür, gegen die Neider und Feinde draußen, gegen das betäubende, verwirrende moderne Leben; ein Sieg, den zu behaupten nicht weniger Kraft erfordert als ihn zu erkämpfen. Dieser Appell an die eigne Kraft, dieses begeisterte Ringen nach einem wunderherrlichen Ziele, das uns kein Priester und kein Heiliger und keine Gnade vermitteln kann; dieser Gedanke, der sich durch das ganze Buch zieht, daß wir uns selbst helfen müssen, da sonst kein Gott uns helfen wird – ist es, weshalb ich es oben ein durch und durch protestantisches genannt habe.
Viele Recensenten (und ich darunter) haben Michelet vorgeworfen, daß er zu wenig Gewicht auf das moralische Element lege, daß er vergessen zu haben scheine, wie die Ehe auf der Idee der Pflicht begründet ist. Ich gestehe, von dieser Ansicht, je länger ich mich mit dem Werke beschäftigte, immer mehr zurückgekommen zu sein. Ich glaube nicht, daß Michelet um eines Haares Breite weniger tief als wir durchdrungen ist von der Heiligkeit der Pflicht, daß er sich nicht ebenso willig wie wir anderen beugt vor dem kategorischen Imperativ. Aber er meint, wenn ich ihn anders recht verstehe: damit das Wort: Du sollst! nicht ein Wort bleibe, muß unser Sinnen und Trachten darauf gerichtet sein, zu bewirken, daß wir auch können, was wir sollen, d. h. wir müssen zur Einsicht gelangen, daß, wenn die Anfechtung einmal da ist, es meistens mit dem besten Willen von der Welt zu spät, und daß: wachen und beten, auf daß wir nicht in Anfechtung fallen, der Lebensweisheit A und O ist.
Ich gebe zu, daß Michelet hier über das Ziel hinausgeschossen hat (ich nannte deshalb die Tendenz hyperprotestantisch); räume ein, daß er in seiner Antipathie gegen jedes starre Dogma, in seinem Unglauben an die Macht des Staates und der Kirche, eine Ehe zu schützen, in welcher die Gatten nicht in der stets regen, stets wachsenden Liebe das Heil suchen und finden – zu weit gegangen ist. Aber wir wollen auch in diesem Punkte nicht vorschnell richten. Viele Kritiker (und ich unter ihnen) haben Michelet wegen der vielen Regeln und Regelchen, deren strikte Beobachtung er seinen Gatten zur heiligsten Pflicht macht, verspottet, und behauptet, daß er auf diese Weise die Junggesellen nicht für die Ehe gewinnen, die Zahl der Ehen in Frankreich nicht vermehren werde. Wie aber, wenn ich einem Knaben, der etwa die lateinische Sprache lernen will, eine voluminöse Grammatik, von der ersten bis zur letzten Seite voll von Regeln und Ausnahmen, in die Hand gebe und ihm sage: alle diese Regeln und Ausnahmen mußt du im Kopf haben, bevor du hoffen kannst, ein fehlerfreies Exercitium zu liefern – habe ich recht oder nicht? Und, wenn jemand eine Reise unternehmen will und muß (wenn er anders die verlorene Gesundheit wiederzuerlangen wünscht), ist es nicht ehrlicher und verständiger, ihn auf die Schwierigkeiten und Gefahren des Weges aufmerksam zu machen, als ihn unvorbereitet ziehen zu lassen? Ist es nicht verständiger, den jungen Männern die Ehe zu schildern als das, was sie ist, die Ausführung der kompliziertesten Aufgabe, die dem Menschen gestellt werden kann, eine Aufgabe, die zu lösen er in jedem Augenblick Kopf und Herz auf dem rechten Fleck haben muß? als sie ihnen vorzuspiegeln als das was sie nicht ist, ein Eldorado, ein Elysium, voll Freuden und Wonnen ohne Ende? Doch was sage ich, auch das soll ja Michelet gethan, er soll ja diese Wonnen nur zu verlockend, zu verführerisch geschildert und überhaupt von der ersten bis zur letzten Seite den widerlichsten, cynischsten Materialismus gepredigt haben. Wenigstens behauptet dies (und noch ein gut Teil andere Lügen dazu) ein kürzlich in Paris erschienenes, über 400 Seiten starkes Buch, betitelt! L'amour. Renversement des propositions de M. Michelt par un libre penseur, welches wir nur deshalb hier nennen, um den Leser zu ersuchen, es nicht in die Hand zu nehmen, er müßte denn ein besonderes Verlangen haben, einen Tartüfe zu beobachten, in dem Augenblick, wo der Edle fühlt, daß ihm die scheinheilige Maske von dem Armensündergesicht gerissen wird.
Leipzig, im Mai 1859. F. Spielhagen.
Einleitung.
I.
Der vollständige Titel dieses Buches, der den Zweck, den Sinn und die Bedeutung desselben ausführlich angäbe, wäre: Die geistige Befreiung durch die wahre Liebe.
Diese Frage, die Frage der Liebe, liegt, dunkel und unendlich, unter den Tiefen des menschlichen Lebens; ja, sie trägt die Grundvesten, auf denen das Leben ruht. Die Familie stützt sich auf die Liebe und die Gesellschaft auf die Familie. So ist die Liebe vor allem andern.
Wie die Sitten, so der Staat. Die Freiheit wäre ein leerer Schall, wenn der Bürger Sklavensitten bewahrte.
Wir suchen hier ein Ideal, aber ein Ideal, welches heute verwirklicht werden kann, nicht eins, das man für eine bessere Gesellschaft aufheben müßte. Es ist die Reform der Liebe und der Familie, die den anderen Reformen vorangehen muß und sie überhaupt erst möglich macht.
*
Eine Thatsache ist unbestreitbar. Inmitten so vieler intellektueller und materieller Fortschritte hat der moralische Sinn abgenommen; alles schreitet vorwärts, entwickelt sich; nur eins wird kleiner: der Geist.
In diesem wahrhaft feierlichen Augenblicke, wo das über die ganze Erde ausgebreitete Netz der elektrischen Drähte im Begriff steht, ihre Gedanken zu zentralisieren und ihr es möglich machen wird, endlich einmal zum Bewußtsein ihrer selbst zu kommen – welchen Geist wollen wir ihr geben? Und was soll daraus werden, wenn das alte Europa, von dem sie alles erwartet, ihr nur einen geschwächten Geist darbietet? Europa ist jung und alt, in dem Sinne, daß es gegen seine Verderbnis die verjüngende Kraft aufrufen kann, die im Genie liegt. An Europa ist es, die Welt neu zu gestalten, indem es sich selbst neu gestaltet. Europa allein weiß und sieht und sieht voraus. Bewahre es sich nur die Willenskraft, und es ist noch nichts verloren.
*
Man kann sich nicht verhehlen, daß die Willenskraft in den letzten Zeiten gewaltige Veränderungen erlitten hat. Der Ursachen dafür giebt es viele. Ich will nur zwei derselben nennen, die moralisch und physisch zu gleicher Zeit sind, und die, indem sie direkt das Gehirn treffen und es abstumpfen, darauf ausgehen, alle unsere moralischen Kräfte zu paralisieren.
Seit einem Jahrhundert ist die Herrschaft der Spirituosen und Narkotiken in fortwährendem und unaufhaltsamem Wachsen begriffen. Sie hat, je nach dem Charakter des Volkes, verschiedene Resultate gehabt. Hier hat sie den Geist verdüstert und ihn unheilbar barbarisiert; dort hat sie noch tiefer die physische Existenz unterwühlt und die Rasse selbst verschlechtert; – aber überall hat sie den Mann isoliert und ihm selbst an dem häuslichen Herde eine beklagenswerte Vorliebe für ungesellige Genüsse eingeflößt.
Kein Bedürfnis mehr nach Geselligkeit, Liebe und Familie. Dafür die trübseligen Freuden eines polygamen Lebens, welches, da es dem Manne keine Lasten auferlegt und die Frau nicht schützt (wie die Polygamie des Orients), nur um so zerrüttender, willkürlicher, schrankenloser und durch den fortwährenden Wechsel aufreizender und entnervender ist.
Man verheiratet sich immer seltener (die offiziellen Angaben beweisen es). Und, was kaum weniger ins Gewicht fällt, tritt die Frau in die Ehe, so ist es sehr spät. In Paris, wo sie früh reif und früh mannbar ist, verheiratet sie sich erst im fünfundzwanzigsten Jahre, verlebt also acht bis zehn Jahre des Wartens, sehr häufig des Elends, ja unvermeidlicher Unordnungen. Die Ehe hat wenig Festigkeit und schützt nicht vor Treubruch.
Barbarischer Zustand, wo die Liebe nur ein Krieg gegen die Frau ist, in welchem man sich ihr Elend zu Nutze macht, sie erniedrigt und dann, zerrüttet, dem Hunger preisgiebt.
*
Jedes Jahrhundert ist durch eine Hauptkrankheit charakterisiert. Das dreizehnte war das des Aussatzes, das vierzehnte das der schwarzen Pest, das sechzehnte das der Syphilis, das neunzehnte ist an den beiden Polen des Nervenleidens angegriffen, in dem Gedanken und in der Liebe; beim Manne an dem entnervten, haltlosen, paralytischen Gehirn; bei der Frau an der mit schmerzhaften Geschwüren behafteten Gebärmutter. Dies Jahrhundert wird das Jahrhundert der Gebärmutterkrankheiten genannt werden – man kann es auch das des Elends, der Verlassenheit der Frau nennen – und ihrer Verzweiflung.
Die Strafe ist diese: Die leidende Frau wird aus ihrem kranken Schoße nur einen Kranken gebären, der, wenn er leben bleibt, gegen die natürliche Stumpfheit ein verderbliches Mittel in der Abstumpfung durch Alkohol und Narkotiken suchen wird. Nehmen wir an, daß ein solcher Mensch unglücklicherweise sich fortpflanzt, so wird er von einer noch hinfälligeren Frau ein noch entnervteres Kind haben. Solchem Elend ist der Tod als Gegenmittel und gründliche Heilung vorzuziehen.
*
Man hat von Anfang des Jahrhunderts an vollkommen gefühlt, daß die Frage der Liebe die entscheidende Frage ist, welche unter den Grundvesten der Gesellschaft selbst abgehandelt wird. Wo die Liebe stetig und mächtig ist, da ist alles stark, solid und fruchtbar.
Die gefeierten Utopisten, die über so viele andere Gegenstände (über die Erziehung z. B.) helles Licht verbreiteten, haben das Kapitel der Liebe nicht mit demselben Glück behandelt. Ich wage zu behaupten, daß sie hier nur eine geringe Unabhängigkeit des Geistes gezeigt haben. Ihre Theorien sind, obgleich der Form nach kühn, im Grunde darum nicht weniger sklavisch gegen die Wirklichkeit und ängstlich auf die Sitten der Zeit berechnet. Jene Männer fanden die Polygamie vor, und sie haben sich ihr unterworfen und für die Zukunft polygamische Utopien phantasiert.
Um das wahre Gesetz in dieser Sache zu finden, hätten sie, ohne große moralische Untersuchungen anzustellen, einfach die Geschichte und die Natur befragen sollen.
In der Geschichte sind die Menschenrassen genau auf Grund ihres monogamen Lebens physisch und moralisch stark.
In der Naturgeschichte haben die höheren Tiergattungen eine Neigung zum Leben in der Ehe und verwirklichen es zum wenigsten für einige Zeit; und es ist gerade dies der vorzüglichste Grund ihres höheren Ranges.
Man sagt, daß bei den Tieren die Liebe unstet und launisch, daß, andere Objekte der Lust zu suchen, für sie Naturzustand sei. Ich finde jedoch, daß, sobald nur eine gewisse Stabilität möglich ist und die Lebensmittel regelmäßig herbeigeschafft werden können, Ehen unter ihnen entstehen, zum mindesten zeitweilige, die nicht bloß durch die Liebe zu ihrer Brut, sondern ganz eigentlich durch die Liebe zustande kommen. Ich habe hundertmal diese Beobachtung gemacht, besonders in der Schweiz an einer Finkenfamilie. Als das Weibchen gestorben war, versank das Männchen in Verzweiflung und ließ die Jungen umkommen. Augenscheinlich war es Liebe und nicht väterliche Liebe, was es auf dem Neste festgehalten hatte. Sie war tot, und alles war vorbei.
Die Nahrung ist in der späteren Jahreszeit weniger reichlich, und es nötigt viele Gattungen, ihre zeitweiligen Ehen aufzugeben. Die Gatten sind gezwungen, sich dann zu trennen, ihren Bereich der Beute und der Jagd auszudehnen, und sie können des Abends nicht mehr zu demselben Neste zurückkehren. So scheidet sie der Hunger, nicht ihr Wille. Die kleinen Fortschritte in der Industrie, welche eine feste Ehe stets herbeiführt, werden gehemmt, vereitelt.
Wäre dem nicht so, sie würden bleiben. Es ist nicht die Wollust allein, welche sie hält; denn das befruchtete Weibchen gewährt solche nicht. Es ist der ganz eigentliche Instinkt der Geselligkeit, des gemeinsamen Lebens; die Lust, den ganzen Tag eine kleine Seele sich nahe zu fühlen, die auf euch rechnet, euch ruft, euer bedarf, euch (dich Fink, dich Nachtigall) durchaus nicht verwechselt mit einem andern derselben Gattung, nur euren Gesang hört und ihn oft durch ihre sanften, klagenden Rufe beantwortet, die gleichsam mit leiser Stimme gegeben werden (damit sie nur einer hört!), und die von ihrem Herzen zu deinem gehen.
*
In unseren Tagen ist man mit Nachdruck auf die Fragen der Liebe zurückgekommen. Geniale Schriftsteller haben sie teils in unsterblichen Romanen, teils in theoretischer, beredter, scharfer und strenger Form mächtig angeregt. Aus Gründen, die man erklärlich finden wird, enthalte ich mich eines weiteren Eingehens auf ihre Bücher. Ich erlaube mir nur trotz meiner Bewunderung und auf Sympathie ruhenden Achtung zu bemerken, daß man weder von der einen noch von der andern Seite tief genug in den Gegenstand eingedrungen ist.
Seine beiden Seiten, die physiologische so gut wie die der praktischen Moral, sind noch nicht aufgehellt.
Die Diskussion dauert fort, ohne daß man weiß oder zu bemerken sich herabläßt, daß sie sich um mehr als einen Punkt dreht, den die höchste Autorität, die der Thatsachen, für immer abgemacht und entschieden hat.
Das in seinem wesentlichen Mysterium lange Zeit unbegriffene, verkannte Objekt der Liebe, die Frau, ist durch eine Reihe von Entdeckungen in den Jahren von 1827–1847 enthüllt worden. Wir kennen dieses heilige Wesen, das gerade darin, wo das Mittelalter es der Unreinheit beschuldigte, sich in Wahrheit als die Reinste der Reinen in der Natur zeigt.
Die berechtigte Veränderlichkeit der Frau ist begriffen worden, und ebenso ihre Unveränderlichkeit, das, was den endgültig dauerhaften Charakter der Verbindung und der Ehe ausmacht.
Wie ist es möglich, von der Frau zu sprechen, ohne etwas von alledem zu sagen?
*
Ein anderer wesentlicher Punkt ist der, daß die Liebe nicht, wie sie sagen oder zu verstehen geben, eine Krisis, ein Drama in einem Akte ist. Wäre sie nur das, so verlohnte sich ein so flüchtiges Ereignis kaum der Aufmerksamkeit. Sie wäre dann eine der ephemeren, oberflächlichen Krankheiten, die man sobald wie möglich loszuwerden sucht.
Aber glücklicherweise ist die Liebe, und ich meine die treue, auf einen Gegenstand gerichtete, eine oft lange Reihenfolge sehr verschiedener Leidenschaften, welche das Dasein beleben und fort und fort erneuern. Wenn man die blasierten Klassen, welche der Tragödien, der plötzlichen, handgreiflichen Veränderungen bedürfen, beiseite läßt, so sehe ich, daß die Liebe manchmal ein ganzes Leben hindurch dieselbe bleibt, mit verschiedenen Graden der Intensität und äußeren Variationen, die ihr Wesen nicht berühren. Ohne Zweifel kann eine Flamme nicht brennen, ohne zu wechseln, sich zu heben, zu senken, wieder aufzusteigen, sich in Form und Farbe zu verändern. Aber die Natur hat dem vorgesehen. Die Frau verwandelt sich unaufhörlich in ihrer Erscheinung; eine Frau hat deren tausend. Dazu kommt, daß die Phantasie des Mannes leicht den Gesichtspunkt verrückt. Auf den für gewöhnlich dauerhaften und festen Grund der Gewohnheit zeichnet der Augenblick Veränderungen, welche die Neigung modifizieren und verjüngen.
Nehmt nicht die Ausnahme, die vornehme, romantische Welt, sondern die Regel, die Mehrzahl, die Wirtschaften der Arbeiter. Ihr findet hier, daß der Mann, der um sieben, vielleicht um zehn Jahre älter ist als die Frau, und sich überdies mehr im Leben umgesehen hat, im Anfang seine junge Gefährtin bedeutend durch seine Erfahrung beherrscht, und sie ein wenig wie seine Tochter liebt. – Sehr schnell holt sie ihn ein oder eilt ihm voraus: die Mutterschaft, die häusliche Erfahrung vermehren ihre Wichtigkeit; sie gilt so viel wie er und sie wird wie eine Schwester geliebt. Aber wenn das Handwerk, die Arbeit den Mann abgenutzt haben, so wird die nüchterne, ernste Frau, der eigentliche gute Geist des Hauses, von ihm wie eine Mutter geliebt. Sie sorgt für ihn, sie pflegt ihn; er stützt sich auf sie und erlaubt sich oft, ein wenig das Kind zu spielen, wohl wissend, daß er in ihr eine so gute Pflegerin und eine sichtbare Vorsehung besitzt.
Und das ist es nun, worauf sich bei den kleinen Leuten jene große und schreckliche Frage wegen der Superiorität des einen Geschlechts über das andere, eine so heikle Frage, so lange es sich um die Leute von gutem Ton handelt, reduziert. Es ist vor allem eine Altersfrage. Ihr seht sie am Tage nach der Hochzeit, wenn die Frau wie ein Kind erscheint, zu Gunsten des Mannes gelöst; später zu Gunsten der Frau. Wenn am Sonnabend-Abend der Mann seinen Wochenlohn bringt, so zieht sie ihr Wirtschaftsgeld ab (die Pflege der Kinder); sie läßt ihrem Manne das Geld für seine kleinen Vergnügungen. Sie denkt an alles; an sich denkt sie nicht.
*
Wenn man die Liebe eine Krisis nennt, so kann man die Loire auch eine Überschwemmung nennen.
Aber bedenkt doch auch, daß dieser Fluß in seinem zweihundert Meilen langen Laufe, in seiner so vielfältigen, so verschiedenartigen Thätigkeit als Straße, als Bewässerer der Felder, als Reiniger der Luft u. s. w. auf tausenderlei Weise seine Wirkung äußert. Es heißt ihm Unrecht thun, wenn man ihn einzig von seiner leidenschaftlichen Seite auffaßt, wo man ihn am dramatischsten findet. Lassen wir sein zufälliges Drama, das wirklich nur untergeordnet ist, beiseite und nehmen wir ihn lieber in dem regelrechten Epos seines großen Lebens als Fluß, in seinen heilsamen und befruchtenden Einwirkungen, die nicht minder poetisch sind.
In der Liebe ist der Augenblick des Dramas ohne Zweifel interessant; aber er ist zugleich der der Leidenschaft, wo wir eben nur zugegen sind und unsere Selbsttätigkeit sehr gering ist. Es ist wie der schäumende, wilde Bach im Gebirge, da wo sein Bett am schmalsten. Aber man muß ihn als Ganzes, in der ganzen Ausdehnung seines Laufes nehmen. Weiter oben ist er ein friedliches Bächlein; weiter unten wird er ein breiter, aber gelehriger Strom.
Die Liebe ist keine Macht, welche der Bildung gänzlich unzugänglich wäre. Sie ist, wie jede andere Naturgewalt, ein Stoff für den Willen, für die Kunst, welche, sage man was man will, sie sehr leicht schafft und leicht durch die Situation, die äußeren Umstände und die Gewohnheiten modifiziert.
*
Wie soll der ältere, weiter vorgeschrittene, aufgeklärtere Mann die junge Frau einweihen?
Wie soll die entwickelte und auf dem Höhepunkte der Anmut und Macht angelangte Frau es anfangen, das Herz des Mannes sich zu erhalten, wieder zu erobern? wie soll sie den Ermüdeten erquicken, verjüngen? ihm die Flügel geben, die ihn emportragen über das Elend des Lebens und des Handwerks?
Welches ist die Macht des Mannes über die Frau und die der Frau über den Mann?
Dies ist eine Wissenschaft und eine Kunst. Wir wollen das erste Wort sagen; andere mögen es ausführen.
*
Um das Vorhergehende zusammenzufassen:
Man hat bis jetzt die Liebe nur in ihrem am wenigsten lehrreichen Momente genommen.
Sie hat eine Seite, wo sie notwendig und tief erscheint, die naturgeschichtliche Seite, welche von unglaublicher Einwirkung auf ihre moralische Entwickelung ist. Dies ist übersehen worden.
Sie hat eine Seite, wo sie frei und willkürlich ist, wo die praktische Moral auf sie einwirkt. Diese Seite hat man vernachlässigt.
Dieses Buch ist ein erster Versuch, jene beiden Lücken auszufüllen.
II.
So lange die notwendige, unveränderliche Seite der Liebe nicht aufgehellt war, wußte man nicht genau, wo ihre Freiheit anfing, ihre spontane, persönliche und veränderliche Thätigkeit. Die Frau war ein Rätsel. Man konnte ohne Ende darüber schwatzen und das Für und Wider erörtern.
Da trat unter diese Schwätzer einer und schnitt die Debatte ab: einer, der viel davon weiß, der Bruder der Liebe: der Tod.
Diese beiden, scheinbar sich entgegengesetzten Mächte gehen immerdar zusammen. Sie streiten, aber mit gleichen Kräften. Die Liebe tötet den Tod nicht, der Tod tötet die Liebe nicht. Im Grunde verstehen sie sich vortrefflich. Sie erklären sich gegenseitig.
Bedenkt, daß hier, wo es galt, das noch warme Leben zu, erfassen, nur der plötzliche, grausame Tod helfen konnte, der gewaltsame Tod. Er ist es vor allem, der uns belehrt. Die Hingerichteten haben das Geheimnis der Verdauung enthüllt, und die Frauen, die sich den Tod gaben, das der physischen Liebe und der Zeugung.
Man mußte einen Ort haben, wo der gewaltsame Tod alltäglich war, wo der Selbstmord unaufhörlich der Beobachtung eine ungeheure Menge von Frauen lieferte, Frauen von jedem Alter, und die meisten in den Stadien ihrer Leiden: diese in dem Moment des Monats, wo die Natur sie exaltiert; jene, schwanger, die mit ihrem Kinde sterben wollten; Jungfrauen endlich, arme Blumen, die an der Liebe verzweifelten.
Ich weiß nicht die ganze Zahl für Paris. Aber der Ort in Paris, wo man die Leichname derer ausstellt, welche nicht in ihrer Wohnung sterben, die Morgue, nimmt jährlich fünfzig auf. Das giebt fünfhundert in zehn Jahren! – eine ungeheure Zahl, wenn man ihre natürliche Zaghaftigkeit bedenkt und die außerordentliche Furcht, die sie vor dem Tode haben.
Und in welchen Monaten ist dieser gewaltsame Tod der Frauen am häufigsten? In den schönen Monaten, wo sie bitterer ihre Verlassenheit empfinden, in den sonnigen Monaten, wo die Frau liebt. Denn es ist ein wesentlicher Punkt, daß die Liebe, die Zeugung von dem Manne mehr in den Festen des Winters und nach den fröhlichen Gelagen gesucht wird; von der Frau in der Zeit der Blumen, unter den reineren Einflüssen der verjüngten Natur, der Sonne und des Frühlings. Dann ertragen sie weniger leicht den Schmerz der Vereinsamung, ihr trostloses Elend, und sie wollen lieber sterben.
Die statistischen Tabellen lassen das nicht erkennen. Sie rangieren ohne weiteres die Mehrzahl derer, die so in der Exaltation der Liebe sterben, unter die Rubrik: temporärer Wahnsinn.
*
Seit dem Anfang des Jahrhunderts war die Wissenschaft der großen Entdeckung auf der Spur. Geoffroy Saint-Hilaire und Serres begründeten die Lehre vom Embryo. Baër (1827) begann die Lehre vom Ei, ihm folgten Négrier und Coste. Im Jahre 1842 gab Pouchet von Rouen der Wissenschaft eine Form und stellte sie für die Zukunft in kühner Größe hin.
Er hatte seine Beobachtungen fast nur an Tierweibchen angestellt, und nur beiläufig an der Frau selbst. Der geistreiche und gelehrte Coste und sein geschickter Mitarbeiter Gerbes (ein ausgezeichneter Anatom) hatten den Ruhm und das Glück, die ganze Wahrheit zu erkennen. Während eines Zeitraums von zehn Jahren ungefähr (seit der Errichtung des Lehrstuhls für die Ovologie bis zur Herausgabe des unvergleichlichen Atlas, der diese Entdeckungen vervollständigt), haben sie in dem Tode lesen können, und Hunderte von Frauen haben ihnen das tiefste Geheimnis der Liebe und des Schmerzes enthüllt.
*
Welches ist nun das Resultat dieser ernsten Betrachtung? Was gewinnen wir aus diesem ungeheuern und entsetzlichen Schiffbruch von Frauen, aus diesen Leichen, welche uns jedes Jahr die Vereinsamung, die Verlassenheit, die betrogene Liebe an den Strand spülen?
Was aus diesem Schiffbruch bleibt, ist eine große Wahrheit, welche die Vorstellung, die man sich von der Frau machte, unberechenbar verändert.
Gerade das, was das Mittelalter verhöhnte und schmähte und ihre Unreinheit nannte, ist ihre heilige Krisis; ist, was sie zu einem Gegenstande der Verehrung, was sie unendlich poetisch macht. Die Liebe hatte es immer geglaubt, und die Liebe hatte Recht. Die alberne Wissenschaft von früher hatte Unrecht.
Aber die Frau schmachtet unter der Wucht einer ungeheuern Notwendigkeit. Die Natur begünstigt den Mann. Sie übergiebt sie ihm schwach, liebend, abhängig von einem fortwährenden Bedürfnis, geliebt und beschützt zu werden. Sie liebt von vornherein den, welchem Gott sie zuzuführen scheint. Um sich nicht vertrauensvoll hinzugeben, sich zu verteidigen, sich zu halten auf dieser abschüssigen Ebene, dazu bedarf sie weit mehr Seelenstärke, als wir jemals nötig haben, und zehnmal mehr Tugend. Welche Verpflichtung für uns! Die Natur verläßt sich bei der Hilflosigkeit ihrer unschuldigen Tochter auf den Adel des Mannes.
*
Aber dies ist noch mehr. Thatsachen, die aus einer anderen Quelle stammen (Lucas 2, 60), fangen an, es festzustellen, daß die Vereinigung in Liebe, der sich der Mann so leichtsinnig überläßt, für die Frau sehr viel tiefer und entscheidender ist, als man jemals glauben konnte. Sie giebt sich ganz und ohne Rückhalt. Das bei den Tierweibchen beobachtete Phänomen findet sich weniger regelmäßig, aber es findet sich doch bei der Frau. Die Befruchtung verändert sie nicht bloß vorübergehend. Die Witwe giebt ihrem zweiten Gatten häufig Kinder, die dem ersten ähneln.
Das ist groß und furchtbar. – Das Resultat ist von ungeheuerm Gewicht für das Herz des Mannes. Wie! Die Natur hat so viel für ihn gethan, ihn bis zu diesem Grade begünstigt! Und er, der die Gesetze macht, er hat sich selbst begünstigt, er hat sich auf diese Weise gegen ein schwaches Wesen bewaffnet, das sich ihm hingeben muß! Wie groß müßte bei diesem doppelten Vorteil seine Milde gegen die Frau sein, wie zärtlich sein Schutz!
Diese Ebbe und Flut ihrer Lebenskraft, diese gründliche Wiedererneuerung, die sie mit so viel Schmerzen erkauft, macht aus ihr das sanfteste, das bestimmbarste der Wesens sobald man sie liebt und schirmt und vor schlechten Einflüssen bewahrt. Jede Thorheit der Frau ist eine Dummheit des Mannes.
Welche tiefe Harmonie, welche bewunderungswürdige Regelmäßigkeit beherrscht doch die große Bewegung des Lebens und der Ideen! Verwirrt, so scheint es, und ganz zufällig, drängen sich die Einzelheiten. Tretet weiter weg, seht das Ganze, und ihr seid mehr als überrascht, ergriffen von der wunderbaren Zweckmäßigkeit, mit welcher ganz verschiedene, scheinbar in gar keinem Zusammenhange stehende Dinge, von denen das eine das andere nicht kennt, aufeinander wirken und miteinander schaffen und bauen an dem ewigen Kunstwerk.
In dieser Periode von zwanzig Jahren, wo durch die Wissenschaft die physische Abhängigkeit der Frau so schlagend