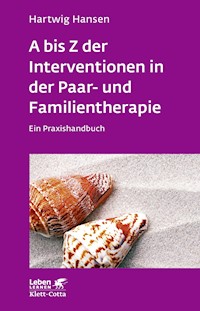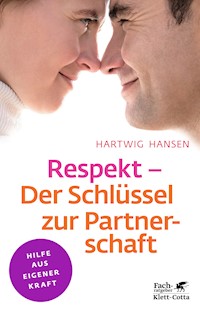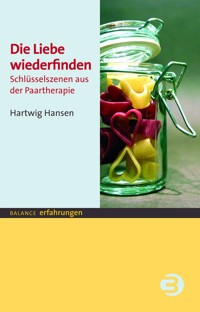
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BALANCE Buch + Medien Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: BALANCE erfahrungen
- Sprache: Deutsch
Gehen oder bleiben? Aufgeben oder kämpfen? Rückzug oder Wachstum? Heute ist es nicht mehr so schwierig, kompetenten Rat in Beziehungskrisen zu bekommen. Aber was passiert eigentlich genau in der Paartherapie? Dieses Buch öffnet die Praxistür. Paartherapeut Hartwig Hansen Setzt in seiner »Beziehungs-Werkstatt« fort, was der Psychoanalytiker Irvin D. Yalom mit seinen »Geschichten aus der Psychotherapie« vorgemacht hat: Mit Respekt und Humor erzählt Hansen von den entscheidenden Wendepunkten in seiner Arbeit mit ratsuchenden Paaren. Das Buch vereint beispielhafte Momente der Beziehungsklärung und Verständigung durch überraschende Interventionen. Und das alles in einem unmittelbaren, so noch nicht gekannten Erzählstil. Es ist ein großes Glück, die schon verloren geglaubte Liebe wiederzufinden, ein hartes Stück Arbeit, das einigen Mut erfordert. Dieses Buch lässt Sie an all dem teilhaben. Empfehlenswert für Paare, die eine Beratung suchen, und für alle, die schon immer mal wissen wollten, was in einer Paartherapie geschieht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 179
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hartwig Hansen
Die Liebe wiederfinden
Schlüsselszenen aus der Paartherapie
Hartwig Hansen: Die Liebe wiederfinden
1. Auflage 2009
© BALANCE buch + medien verlag GmbH & Co. KG, Köln 2013
Der BALANCE buch + medien verlag ist ein Imprint der Psychiatrie Verlag GmbH, Köln
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf ohne Zustimmung des Verlags vervielfältigt, digitalisiert oder verbreitet werden.
ISBN-ePub 978-3-86739-829-9
ISBN-PDF 978-3-86739-729-2
ISBN-Print 978-3-86739-046-0
Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Wenn Sie Erfahrungsberichte und fundierte Ratgeber zur Gesundheit suchen, besuchen Sie unsere Homepage: www.balance-verlag.de
Lektorat: BALANCE buch + medien, Köln
Umschlagkonzeption: p.o.l. kommunikation design, Köln, unter Verwendung eines Fotos von MMchen / photocase.com
Typografiekonzept: Iga Bielejec, Nierstein
Satz: BALANCE buch + medien verlag, Köln
www.balance-verlag.de
Menü
Buch lesen
Innentitel
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Impressum
Herzlich willkommen
Das Mausoleum
Erbfolgen
Das Pümpel-Theorem
Zehn »verlorene« Jahre
Das Wiedersehen
Familien-Patina
Rote Tücher
Das Bild im Mülleimer
Der Gepäckschein
Die Entscheidung
Der dritte Mann
Die Kaninchenfalle
Der Glibber
Das Monster
Ein Herz darf sprechen
Zeugnisse
Herzlich willkommen
»Wer in einer Ehe nur glücklich sein will, sollte nicht heiraten. Glücklich machen, das ist es, worauf es in einer Partnerschaft ankommt.« Dieser Satz stammt aus meinem »Praxis-Zettelkasten« für das Zitieren in besonderen Beratungssituationen.
»Nicht nur glücklich sein … glücklich machen …« Klingt gut, ist aber auch leicht gesagt. Wie geht das? Was ist dafür notwendig? Was muss ich, was müssen wir dafür lernen? Solche und ähnliche Fragen stehen in den Gesichtern vieler, die mir, beziehungsweise uns, in der Paarberatung gegenübersitzen.
Wenn ich in diesem Buch von »wir« oder »uns« spreche, meine ich gleichzeitig meine Kolleginnen, mit denen ich in den letzten Jahren – in guter Balance der Geschlechter – mit Paaren und Familien zusammengearbeitet habe. Diese Kooperation als Beratungspaar hat sich sehr bewährt und ich habe sie – trotz erhöhten Abspracheaufwands – sehr zu schätzen gelernt. Darüber hinaus arbeite ich auch allein.
In diesem Buch habe ich nun ein paar beispielhafte Erlebnisse in Form von »Schlüsselszenen« zusammengestellt, um nachvollziehbar zu machen, was Paarberatung will, macht und kann. Nicht mehr und nicht weniger.
Es ist in heutiger Zeit nach unseren Erfahrungen zwar schon leichter geworden, sich in festgefahrenen Beziehungen Unterstützung in einer Beratung zu holen, es hat aber immer noch den Beigeschmack des »Na, die haben’s ja nötig …« und des »Nur, wenn’s gar nicht mehr anders geht …«.
So beginnen viele Erstgespräche und somit auch einige »Geschichten« in diesem Buch mit einem sich langsam aufgebauten »Überdruck« auf Seiten der Ratsuchenden: »Bitte, retten Sie uns!« Meist verbirgt sich dahinter das belastende Gefühl: »Wenn Sie uns nicht helfen können, wissen wir auch nicht mehr weiter.«
Durch diese Phase des Leidensdrucks und der Verzweiflung zu den Themen zu kommen, die gemeinsam angeschaut werden können, um eventuell wieder Bewegung und Weiterentwicklung in die Beziehung zu bringen, ist die erste Herausforderung in der Beratung. Oft klappt es mit Ruhe und Geduld, manchmal ist es allerdings auch zu spät.
Was für Themen finden sich dann am Grund des »Überdruckkessels« und damit auch in den aufgeschriebenen Geschichten? Ich denke, an erster Stelle stehen die »Nebenbeziehungen«, egal auf welcher Seite, und die Verletzung und Verunsicherung, die sie auslösen.
So hören wir zum Beispiel häufiger in modernen Zeiten: »Ich habe die E-Mails meines Mannes gelesen. Er hat offenbar eine andere Frau beim Chatten kennengelernt.«
Daneben gibt es natürlich eine Vielzahl anderer Gründe für den ersten Anruf: »Ich habe das Gefühl, wir haben uns auseinandergelebt. Aber ich möchte meinen Traum von einer glücklichen Partnerschaft nicht schleichend beerdigen.«
»Mein Sohn zieht sich immer mehr zurück, und ich glaube, es hat etwas mit der Sprachlosigkeit in unserer Familie zu tun.«
»Ich komme einfach nicht damit klar, dass mich meine Schwiegermutter zu hassen scheint.«
»Wir stehen vor einer großen Entscheidung. Mein Mann soll versetzt werden, aber er spricht nicht mit mir.«
Die grundlegende Erschütterung, die in all diesen An- und Hilferufen zum Ausdruck kommt, steht oft am Ende einer langen Entwicklung, die dann mit den Sätzen beschrieben wird: »Wir haben irgendwie unsere Beziehung verloren.« oder »Wir reden kaum noch miteinander.« oder »Zeigen Sie uns bitte, wie wir unsere Liebe wiederfinden!«
Was diesen Sätzen vorausgeht, sind nicht wahrgenommene oder bewusst verdrängte Warnsignale. Der amerikanische Paartherapeut John Gottman beschreibt diese anschaulich als »apokalyptische Reiter«, die eine Beziehung nachhaltig gefährden. Mitunter fragen wir die Paare, die zu uns kommen, wie viele dieser Reiter sie schon kennen. Das dann folgende Gespräch ist meist sehr aufschlussreich und fruchtbar.
Die vier apokalyptischen Reiter sind:
Verletzung durch Vorwürfe und Kritik;
Verachtung;
Verleugnung und Rechtfertigung;
Rückzug und Kontaktabbruch.
Diese Reiter kündigen, wenn sie häufiger im Alltagserleben auftauchen, eine schleichende Krise, wenn nicht die Trennung, an:
1. Reiter: verletzende Kritik, Beschwerden als persönlicher Vorwurf, die Schuld und Versagen einschließen. (»Das ist so typisch für dich!«)
2. Reiter: Verachtung, oft ausgedrückt durch Sarkasmus und Zynismus. Oder durch Verfluchen, Augenrollen, Verhöhnen und respektlosen, abschätzigen Humor. In welcher Form die Verachtung – der gefährlichste der vier Reiter – auch auftritt, sie vergiftet eine Beziehung. Es ist so gut wie unmöglich, ein gemeinsames Problem zu lösen, wenn sich die Partner abgelehnt fühlen. Verachtung nährt den Konflikt und löst nichts.
3. Reiter: Verleugnung durch Rechtfertigung und Gegenangriff: »Wieso, was hab ich damit zu tun? Das Problem liegt doch wohl bei dir.« Solche Worte wirken wie eine dosierte Aufkündigung der Beziehung: »Mach, was du willst, ich hab damit nichts zu tun.«
4. Reiter: Rückzug und Abbruch des Kontakts sind eigentlich schon die letzte Windung der sich abwärts drehenden Spirale: Kein Blickkontakt, kein Nicken mehr auf die Worte des anderen, keine Erwiderung, stummes Hoffen, das »irgendetwas passiert«.
Und meist gibt es noch einen »fünften Reiter«. Er steht für Machtausübung und Machtdemonstration: »Du kannst mir gar nichts, ich bin dir sowieso überlegen …«. Gerade auch als Abwehr der eigenen Ohnmachtsgefühle spielt das »Gerangel um Macht« auf allen Stufen des Isolations- und Trennungsprozesses eine wichtige Rolle.
Sie werden in vielen Sequenzen der folgenden Geschichten auch die apokalyptischen Reiter durchs Bild galoppieren sehen. Sie werden nicht explizit benannt, der Hinweis mag aber hilfreich sein, um beim Lesen auf sie zu achten.
Es ist kaum zu beantworten, wann es in einer Partnerschaft so viele dieser Reiter gibt, dass einer der beiden die Trennung fordert bzw. ausspricht. Das hängt von vielen individuellen Faktoren ab und natürlich nicht zuletzt von einer guten Beratung, die darauf hinweist und die Reiter ins Bild bringt.
Beratungen verlaufen sehr unterschiedlich und individuell, sie variieren in der Dauer (von einmaliger »Krisenintervention« bis zu Begleitungsepisoden über einige Jahre), im Sitzungsrhythmus (mal wöchentlich, mal vierzehntägig, mal vierteljährlich, je nach Bedarf und Wunsch der Paare) sowie im »Tiefgang« (einige Paare blicken nach der Verabredung von mehr »Paarzeit« wieder optimistisch in die Zukunft, andere profitieren sehr von der Bearbeitung individuell-persönlicher Themen im Beisein des Partners). Gemeinsam scheint mir Folgendes: Paarberatung ist eine Mischung aus einfühlsamer Moderation, Vermittlung von Informationen zu Kommunikation und Beziehungspflege sowie der Begleitung in neue Erlebnis- und Wachstumsräume.
Nicht selten werden die Beratungen zu Expeditionen in den Dschungel der Familiengeschichten. Das »Früher« ist im »Heute« immer lebendig. Es gilt also, sich vorsichtig dem »Eingemachten«, wie auf dem Buchtitel angedeutet, zuzuwenden. Wenn es gelingt, den Zusammenhang zwischen der Werte- und Kommunikationsstruktur in den Herkunftsfamilien und derjenigen in der aktuellen Partnerschaft deutlich und nachvollziehbar zu machen, sind beeindruckende »Aha-Erlebnisse« der Lohn für couragierte Arbeit.
Dazu ist die gemeinsame Erstellung von sogenannten Genogrammen, den nachgezeichneten Familienstammbäumen, besonders geeignet und hilfreich. Anhand dieser Genogramme werden Informationen zu den Familienmitgliedern über mindestens drei Generationen gesammelt und das Gespräch über Familientraditionen oder -tragödien, über Familienwerte und -wünsche vertieft. Um Bewegung in festgefahrene Partnerschaftsmuster zu bringen, sind Rat suchende Paare für solche »Ausflüge in die Vergangenheit« meist sehr dankbar, da sie frühe »Prägungen« nachvollziehbar und auch für beide verstehbar machen.
Mir persönlich imponiert der Mut vieler Paare. Viele kommen nicht nur ohne recht zu wissen, was sie erwartet, sie probieren auch mit uns – anfangs zögernd, am Ende froh – so »verrückte« Sachen aus, dass sie Stühle für Menschen im Raum platzieren, Gegenstände Gefühlen zuordnen oder zunächst befremdlich scheinende Übungen machen und »Hausaufgaben« erledigen. Von diesen besonderen Sequenzen in der Beratung, in denen »nicht nur geredet« wird, handeln viele der folgenden Geschichten. Dass ich sie so genau aufgeschrieben habe, soll nicht zuletzt auch die Angst nehmen, sich in einer Beratung Hilfe zu holen.
Andere Therapiekolleginnen und Beratungskollegen arbeiten sicher mit anderen Methoden, mir scheinen diese Angebote aus der Gestalttherapie und des Psychodramas besonders hilfreich in der Paarberatung zu sein. Ansonsten stütze ich mich nach der Ausbildung am Hamburger Institut für systemisch-integrative Paar- und Familientherapie von Prof. Martin Kirschenbaum auf die Grundideen der systemischen Beratungskultur und der lösungsorientierten Kurzzeittherapie von Steve de Shazer und Insoo Kim Berg. Zusätzlich fließen wichtige Elemente der Kommunikationspsychologie nach Schulz von Thun sowie der Gesprächs-, Verhaltens- und Tiefenpsychologischen Therapie in meinen »Beratungsstil« mit ein.
Natürlich passiert in einer Beratung – vom »Alarm-Anruf« über den ersten Händedruck bis zur Verabschiedung – eine ganze Menge mehr, als in den »Schlüsselszenen« lebendig wird. Und natürlich habe ich beim Aufschreiben gekürzt, zusammengefasst und bin mittendrin »eingestiegen« und auch wieder »ausgestiegen«. Das bitte ich zu entschuldigen und zu berücksichtigen. Es kam mir darauf an, beispielhafte Entwicklungen von Paaren und damit die Möglichkeiten von Paarberatung nachvollziehbar zu machen. Dass die Mehrzahl der Geschichten in diesem Buch »optimistisch« enden, sagt nichts über die immer wieder gerne erfragte »Erfolgsquote« von Paartherapie oder gar über die Qualität von uns Beratenden aus. Es liegt einerseits einfach daran, dass mir diese bewegenden Momente in besonderer Erinnerung geblieben sind, und andererseits daran, dass Trennungen offenbar eher außerhalb von Sitzungen vollzogen werden und wir – wenn überhaupt – oft nur nachträglich davon erfahren. Dann scheinen wir als Paarberater den Staffelstab entweder an Rechtsanwältinnen und -anwälte oder – besser – an Mediatorinnen und Mediatoren zu übergeben.
Meinen Kolleginnen – besonders Anne Eckerfeld und Elke Dietz – danke ich herzlich für die lange vertrauens- und auch immer wieder humorvolle Zusammenarbeit in ihren Praxen.
Ich danke Ute Hüper und der Crew des Balance Verlages, die immer an die Idee dieses Buches geglaubt haben, sowie Karin Koch für ihr einfühlsames und hilfreiches Lektorat.
Um die Anonymität der Protagonisten in den Geschichten zu wahren, habe ich mich bemüht, all die Fakten und Umstände unkenntlich zu machen, die ein Wiedererkennen für Außenstehende ermöglichen könnten. Der Einfachheit halber sind auch alle Paare »verheiratet«, also Frau und Herr A., was in der Wirklichkeit nicht immer so ist. Hier meint es: Frau und Herr A. kommen als Paar in die Beratung, sie gehören zusammen.
Ich danke ausdrücklich all den Paaren und Familien, die sich mir und uns so couragiert und engagiert anvertraut haben. Ohne sie gäbe es dieses Buch als lebendige »Einführung in die Paarberatung« nicht. Vielleicht hilft es, die Hemmschwelle zu verringern, bei Bedarf den ersten Schritt zu einer Paarberatung zu tun. Vielleicht bekommt die verloren geglaubte Liebe dort mit ein bisschen Unterstützung die Chance, wiederentdeckt zu werden.
Das Mausoleum
Als Frau A, selbstständige Redakteurin in der hart umkämpften Fernsehbranche, heute zur zweiten Sitzung in die Praxis kommt – ihr Mann parkt noch den Wagen –, fragt sie: »Muss eigentlich immer dieser Tisch zwischen unseren Stühlen stehen?«
Sie meint den kleinen Beistelltisch, auf dem ein frischer Blumenstrauß prangt und die Wassergläser – beim vielen Reden mitunter hilfreich – abgestellt werden können.
»Sie können ihn gerne zur Seite stellen«, sagt meine Kollegin, was Frau A. daraufhin forsch tut.
Nachdem auch Herr A., ebenfalls selbstständig im TV-Business tätig, uns begrüßt hat, stellt Frau A. ihren Stuhl demonstrativ dichter an seinen heran und berichtet aufgeräumt, was nach der ersten gemeinsamen Sitzung passiert ist. »Die zwei, drei Tage danach waren sehr schwer, fand ich. Ich glaube, weil nach so langer Zeit, in der wir nicht miteinander sprechen konnten, endlich alle Themen auf den Tisch gekommen sind. Aber danach hatten wir eine Superzeit. Es hat wieder Spaß gemacht mit meinem Mann. Ich habe mich besser von ihm verstanden gefühlt, weil er wieder mehr von sich gezeigt hat. Da ist mir das Herz wieder aufgegangen …«
»Wie hört sich das an, Herr A.?«, frage ich in ein bewegungsloses Gesicht.
Plötzlich ändert sich die Mimik von Herrn A. und es platzt aus ihm heraus: »Ich finde, wir streiten einfach zu oft. Die letzten Monate waren, trotz unserer ersten Sitzung, total anstrengend. Jedes Mal, wenn wir aneinandergeraten, geht ein Stück von unserer Beziehung verloren.«
»Ihre Frau hat gerade von einer sehr schönen Zeit mit Ihnen gesprochen …« Weiter komme ich gar nicht.
»Ja, das mag ja sein, aber wir streiten einfach viel zu viel. Das unterhöhlt unsere Ehe. Erzähl doch mal von gestern Abend, Andrea. Das mache ich in Zukunft einfach nicht mehr mit. Ich bin doch nicht deine Aufziehpuppe.«
»Oweia, was geht denn hier ab?« bedeutet wohl der Blick, den sich meine Kollegin und ich zuwerfen. Das Ehepaar A. macht allerdings prompt weiter.
»Was soll das, Stefan, warum ziehst du das gleich wieder in den Dreck, was ich gerade gesagt habe?«
»Ich zieh nichts in den Dreck, ich sag nur, wie es ist. Ja, wir haben zwischendurch auch immer mal wieder gute Phasen, okay. Das ist auch das Ergebnis von gutem Willen auf beiden Seiten. Aber ich kann es einfach nicht ertragen, dass du mir vorschreibst, wann wir etwas besprechen sollen. Ich habe dir gestern Abend ausdrücklich und mehrmals gesagt, dass ich nicht mehr weiter streiten will, und du hast wortwörtlich gesagt: ›Das müssen wir jetzt aber zu Ende klären!‹ Das lasse ich mir nicht mehr gefallen, Andrea!«
Frau A. schaut mit versteinerter Miene ihren Mann an und schüttelt resigniert den Kopf.
»Darf ich mal ein bisschen zu sortieren versuchen?«, frage ich, um die Tirade von Herrn A. zu stoppen. »Wir haben bisher gehört, dass Sie, Frau A., die Zeit seit unserem ersten Zusammenkommen zuerst schwer und dann als sehr schön empfunden haben, weil Sie sich von Ihrem Mann besser verstanden fühlten. Und Sie haben gesagt, dass Sie sich besser verstanden fühlen, wenn Ihr Mann mehr von sich zeigt.
Nun sagt Ihr Mann ›Schöne Zeit, ja, aufgrund von gutem Willen auf beiden Seiten. Mir geht es aber darum, dass wir nicht mehr so oft streiten und vor allem, dass du mir nicht vorschreibst, wann wir streiten.‹ So weit in Ordnung?«
»Ja, so weit in Ordnung und auch wieder nicht …«, sagt Herr A., der jetzt sichtlich den Deckel vom inneren Dampfkochtopf gehoben hat und uns mit auf die Zielscheibe nimmt.
»Was ich in der letzten Stunde vermisst habe, ist, dass wir doch der Sache auf den Grund gehen müssen. Darum sind wir doch hier, so ein bisschen Kommunikationskosmetik bringt uns da nicht weiter.«
»Was meinen Sie mit ›der Sache auf den Grund gehen‹?«, frage ich.
»Also, wir reden doch immer noch um den heißen Brei herum. Der zentrale Punkt bei uns ist doch, dass meine Frau es nicht erträgt, wenn ich beruflich verreisen muss, wenn ich also außerhalb ihrer Kontrolle bin. Und ich bin es mittlerweile so was von leid, mich immer wieder rechtfertigen zu müssen!«
»Vielleicht stand der Tisch diesmal doch am richtigen Platz«, sagt meine Kollegin. »Die Zeichen stehen im Moment offenbar nicht unbedingt auf Annäherung. Vielleicht stellen Sie ihn einfach wieder hin.«
»Ich begreif nicht, was in dich gefahren ist, Stefan«, sagt Frau A. und rückt das Tischchen wieder dahin, wo es vor Beginn der Sitzung stand.
»Das kann ich dir sagen, Andrea. Du vertraust mir einfach nicht mehr. Ich bin jetzt fünfunddreißig Jahre, ich bin kein Kind mehr. Ich will nicht mehr kontrolliert werden.«
»Ein neuer Versuch …«, sage ich betont ruhig. »Ich will einfach mal nachfragen. Vermute ich richtig, dass Ihr Streit mit der Affäre zu tun hat, von der Sie uns letztes Mal erzählt haben, Frau A.?«
»Ja, darum geht es«, sagt Frau A., wendet sich aber gleich wieder an ihren Mann: »Verstehst du nicht, Stefan, dass ich dir erst wieder vertrauen kann, wenn wir das mit deiner Affäre besprechen können.«
»Aber wir haben doch schon tausendmal darüber gesprochen, Andrea …« Jetzt wirkt Herr A. verzweifelt.
»Aber nicht so, dass es für mich in Ordnung ist. Ich will dich ja nicht kontrollieren. Verstehst du nicht, dass ich nach der Erfahrung von Nürnberg gerne wissen möchte, wo du bist, wenn du auf Dienstreise fährst?«
»Nein, das verstehe ich nicht, und das ist mir auch einfach zu eng. Das war doch vorher auch nicht so. Da haben wir doch auch nicht alles zusammen gemacht …«
»Und noch ein Versuch …« Pause. »Es ist nicht einfach, dazwischen zu kommen bei Ihnen. Im Moment scheint es mir so, als würden Sie sich in Streitschleifen bewegen, die Sie schon gut kennen. Es war aufschlussreich, dass Sie sie uns gezeigt haben, aber vielleicht finden wir gemeinsam etwas Neues, was Sie ausprobieren können … Ich will noch mal zusammenfassen: Sie, Herr A., sagen: ›Mir ist es zu eng‹. Da sind Sie übrigens nicht alleine mit diesem Gefühl, das sagen auch andere Männer, die zu uns in die Beratung kommen. Und Sie, Frau A., sagen: ›Ich will dich nicht kontrollieren, verstehst du denn nicht, dass ich noch verletzt bin durch deine Affäre.‹ Wann war die eigentlich genau?«
»Vor einem Jahr«, sagt Frau A. »Und wenn ich daran denke, fühle ich immer noch diesen Stich. Es tut einfach verdammt weh, wenn man belogen und betrogen wird. Und darum bin ich unsicher, ob es nicht wieder passieren kann, Stefan. Wir können nicht einfach zur Tagesordnung übergehen, als sei nichts geschehen.«
»Ich bin doch hier, Andrea, ich bin doch mitgekommen. Aber wie sollen wir denn darüber sprechen – und vor allem, wie lange noch?«
»Das scheint mir eine wichtige Frage zu sein …«, wende ich mich an Herrn A. »Wie wollen Sie, wie wollen wir darüber sprechen? Wie können Sie mit Verletzung, mit Schmerzlichem auch in Zukunft umgehen? Wie wollen Sie mit dieser Frau, die sagt, sie sei sehr verletzt, in Zukunft umgehen? Sicher scheint mir eins zu sein: Gefühle können sich nur verändern, wenn sie ›sein dürfen‹ und ernst genommen werden. Solange Ihre Frau, Herr A., nicht das Gefühl hat, dass ihre Verletzung wirklich sein darf und von Ihnen nicht abgewehrt oder abgewertet wird, werden Sie weiter gemeinsam in den bekannten Streitschleifen landen. Ihre Frau möchte sich durch das, was Sie als Kontrolle empfinden, vor weiterer tiefer Verletzung schützen. Wie klingt das?«
»Ja, das verstehe ich ja auch. Bei mir kommt nur was anderes an, nämlich Kontrolle und Einengung. Wenn ich einmal spüren würde, dass sie mir vertraut, würde ich auch ihre Verletzung eher akzeptieren können.«
»Wirkt irgendwie wie ein Dilemma, wer anfangen soll: ›Geh du mit deiner Verletzung anders um und vertraue mir, dann übernehme ich auch die Verantwortung dafür, dass ich dir wehgetan habe.‹ Und Ihre Frau sagt: ›Solange ich nicht spüre, dass du weißt, wie weh du mir getan hast, so lange muss ich mich auch absichern, dass ich nicht neu verletzt werde.«
»Ja, so ist das wohl bei uns«, sagt Frau A.
»Das klingt so, als könnten wir uns gemeinsam die verschiedenen ›Knöpfe‹ genauer anschauen, die dann im Wechsel bei Ihnen gedrückt werden. Vielleicht können Sie sich vorerst bis zu unserem nächsten Treffen darüber verständigen, wie Sie über den Punkt Affäre miteinander sprechen wollen. Wann sehen wir uns wieder?«
In der folgenden Sitzung nach drei Wochen wirken Herr und Frau A. angespannt. Frau A. kramt in ihrer Handtasche und holt einen beschriebenen Zettel heraus. »Mich beschäftigt und verunsichert diese Affäre von meinem Mann immer noch sehr stark. Es fühlt sich für mich so an wie der Super-GAU, den man in einer Beziehung erleben kann. Und als mir das nach der letzten Sitzung alles wieder so hochkam, habe ich auch noch mal sehr viel weinen müssen. Erstaunlicherweise war mein Mann dann auf einmal sehr fürsorglich zu mir und hat mich in den Arm genommen.«
»Und wie war das für Sie?«, fragt meine Kollegin.
»Gut.«
»Das hast du gar nicht gesagt«, meldet sich Herr A. zu Wort. »Doch«, nuschelt Frau A.
»Einen kleinen Moment mal, nur fürs Protokoll«, sage ich. »In den Arm nehmen, tut gut. Und das sagen, tut auch gut.«
»Ja, okay«, setzt Frau A. wieder an, »ich möchte heute diesen Punkt klären. Das ist mir in den letzten Tagen klar geworden. Ich möchte dieses Mausoleum, diese Totenstille nicht mehr!«
»Gut, geht es also heute um das Mausoleum … Was meinen Sie, Herr A.?«
»Wenn’s hilft …«, sagt der in einem Ton von »Bringen wir es endlich hinter uns.«
Meine Kollegin nimmt das als Einverständnis, dass es losgehen kann, und fragt: »Was ist denn eigentlich in diesem Mausoleum, wie Sie es nennen, begraben?«
Frau A. reagiert umgehend: »Das Mausoleum steht für: Mein Mann hatte eine Affäre. Aber das ist begraben und vergessen. Und wir sprechen nicht mehr darüber. Basta! Aber so geht das für mich nicht. Ich komm damit nicht klar. Mir kommt das immer wieder hoch und dann will ich das auch sagen dürfen!«
»Okay, und ich habe Sie, Herr A., eben so verstanden, dass es in Ordnung ist, heute über das Mausoleum, wie es ihre Frau nennt, zu sprechen«, rückversichert sich meine Kollegin.
»Ja. Ich bin gespannt, was du aufgeschrieben hast.«
Frau A. schaut auf die Stichworte auf ihrem Schoß und spricht – durch ein Nicken von uns ermuntert – ihren Mann direkt an: »Stefan, ich möchte mich bei dir entschuldigen, dass ich damals nicht so viel Zeit für dich hatte, wie ich gerne gehabt hätte.« Die Stimme von Frau A. klingt weich und gleichzeitig entschlossen. »Ich war mit dem neuen Serien-Auftrag voll absorbiert und ich weiß, dass du mich damals mehr gebraucht hättest, weil du auch eine schwere Zeit hattest. Das tut mir leid. Trotzdem hat es mir