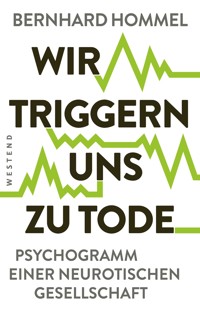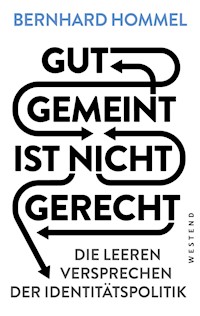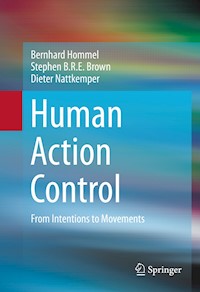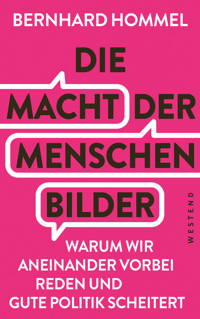
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Westend Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Sicher haben Sie sich auch schon einmal eine Talkshow oder ein politisches Magazin angesehen, bei dem Politiker von verschiedenen Parteien oder Strömungen eingeladen waren. Und dabei sind Ihnen mindestens zwei Dinge aufgefallen: Erstens ist es erschreckend leicht, vorherzusagen, welche Meinungen und Argumente die jeweiligen Politiker zu einem Thema vorbringen werden. Zweitens tragen Gesprächsrunden in den Medien bestenfalls zur Sammlung der verfügbaren Meinungen bei, jedoch nie zu irgendeiner Art von Annäherung oder Konsens. Warum das so ist, erklärt Bestsellerautor Bernhard Hommel in seinem neuen Buch und zeigt, wie wir uns wieder besser verstehen können.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 163
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Ebook Edition
Prof. Dr. Bernhard Hommel
Die Macht der Menschenbilder
Warum wir aneinander vorbeireden und gute Politik scheitert
Impressum
Mehr über unsere Autor:innen und Bücher:
www.westendverlag.de
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
ISBN 978-3-98791-112-5
1. Auflage 2025
© Westend Verlag GmbH, Waldstraße 12A, 63263 Neu-Isenburg 2024
Umschlaggestaltung: Buchgut, Berlin
Satz: Publikations Atelier, Weiterstadt
Inhalt
Titelbild
Fahrplan
Einleitung
Zwei Menschenbilder
Anlage und Umwelt
Freiheit und Gleichheit
Intention und Wirkung
Selbstermächtigung und Minderheitenschutz
Eigenverantwortung und Bürgerpflicht
Woher kommen Menschenbilder?
Vom Menschenbild zum Weltbild
Menschenbild und Wirklichkeit
Politik für alle
Probleme
Lösungen
Literatur
Navigationspunkte
Titelbild
Inhaltsverzeichnis
Fahrplan
Dieses Buch ist ein weiterer Versuch, als wissenschaftlicher Psychologe aus meinem Elfenbeinturm heraus die aktuellen politischen Entwicklungen zu kommentieren. Um diejenigen Leser nicht zu verlieren, die zwar wissenschaftlich fundiertes Wissen schätzen, aber nicht durch endlose Fußnoten am Lesefluss gehindert werden wollen, habe ich mich wie bei meinen vorigen Büchern dazu entschieden, konkrete Verweise und allgemeine Leseempfehlungen nicht in den Text einzubauen, sondern in einer separaten Literaturliste am Ende des Buches zu präsentieren. Auch in diesem Buch habe ich mich nicht überwinden können, mittlerweile übliche Gender-Gepflogenheiten zu übernehmen. Weil, wie ich in meinem Buch Gut gemeint ist nicht gerecht erläutert habe, diese Gepflogenheiten nicht zielführend sind, sondern der sozialen Gerechtigkeit sogar im Weg stehen können. Meine persönliche Variante besteht darin, dass ich das herkömmliche männliche Generikum verwende, in dem ich zum Beispiel von »dem Anderen« schreibe, aber bei konkreten Beispielen weibliche Verweise bevorzuge. Welches Geschlecht auch immer Sie aber haben mögen, ich wünsche Ihnen in jedem Fall eine unterhaltsame, inspirierende Lektüre.
Einleitung
Sicher haben Sie sich auch schon einmal eine Talkshow oder ein politisches Magazin im Fernsehen oder im Internet angesehen, bei dem Politiker verschiedener Parteien oder Strömungen eingeladen waren. Ich wette, dass Ihnen bei dieser Gelegenheit mindestens zwei Dinge aufgefallen sind – die beiden Dinge nämlich, die ich in diesem Buch beleuchten möchte: Erstens ist es erschreckend leicht vorherzusagen, welche Meinungen und Argumente die jeweiligen Politiker zu einem beliebigen Thema vorbringen werden. Politiker linker Parteien tendieren zum Beispiel dazu, Probleme mithilfe von Verboten, Einschränkungen und Regeln zu lösen. Politiker rechter Parteien setzen dagegen öfter auf Einsicht, Vernunft und die freie Marktwirtschaft. Ja, natürlich werden Politiker in der Öffentlichkeit ihre Parteilinie vertreten und diese Parteilinie ist gewiss nicht vollkommen beliebig. Aber der Grad der Vorhersagbarkeit ihrer Beiträge lässt sich damit nicht hinreichend erklären. Zweitens tragen Gesprächsrunden in den Medien bestenfalls zur Sammlung der verfügbaren Meinungen und Argumente bei, nie jedoch zu irgendeiner Art von Annäherung oder gar Konsens. Politiker verschiedener Hintergründe verstehen sich einfach grundsätzlich nicht, sie reden vielmehr fast immer bei auch noch so gutem Willen aneinander vorbei. Gregor Gysi hat das einmal öffentlich zugegeben, ohne es wirklich zu realisieren. Als es um politische Debatten ging, die er stark befürwortet, wurde er gefragt, ob er denn jemals als Ergebnis solcher Debatten seine Meinung geändert habe. Nach kurzem Nachdenken musste er das verneinen. Tatsächlich haben Sie wahrscheinlich noch nie bei einer Talkrunde oder einer Bundestagsdebatte erlebt, dass die Teilnehmer unter dem Eindruck der Argumente anderer Teilnehmer ihre Meinung änderten. Warum also reden sie eigentlich miteinander? Warum sollten wir überhaupt debattieren?
Genau dieser Frage will ich in diesem Buch nachgehen und meine Antwort wird überraschend negativ sein: Wir brauchen das eigentlich nicht zu tun. Denn wir werden uns so oder so nicht verstehen. Warum das so ist, woher das kommt und was wir vielleicht daran tun könnten, möchte ich in diesem Buch behandeln. Ich möchte fragen, woher die von Politikern unterschiedlicher Couleur vorgebrachten abweichenden Ansichten über gesellschaftliche Probleme und die verschiedenen Lösungsansätze, aber auch unsere eigenen, persönlichen politischen Auffassungen eigentlich kommen. Und meine Antwort wird mich zu zwei steilen Thesen ermutigen. Die erste wird sein, dass die eigentliche Basis der unterschiedlichen politischen Positionen aus unterschiedlichen Menschenbildern besteht. Aus Menschenbildern, denen sich handelnde Akteure oft nicht bewusst sind und die in der Regel gar keinen bewussten Teil unseres politischen Denkens darstellen. Dennoch funktionieren sie als gedankliche Axiome. Als Setzungen, die zwar eine Menge gedanklicher Folgen hervorbringen – wie ich in diesem Buch erläutern möchte – die aber selbst weder erkannt und begriffen noch intellektuell gerechtfertigt und diskutiert werden. Die zweite These wird sein, dass sich die Menschenbilder, von denen ich hier zwei – sicherlich relativ holzschnittartig – gegenüberstellen möchte, derart wenig überschneiden, dass ein Austausch über die weiteren Überlegungen und politischen Implikationen dieser Menschenbilder fruchtlos bleiben wird. Politische Debatten können sicherlich Machtverhältnisse verändern, aber sie bringen uns keinen Erkenntnisgewinn.
Das Konzept der Menschenbilder, die ich in diesem Buch entwickeln möchte, bezieht sich auf grundsätzliche Ideen darüber, wie Menschen funktionieren und wie man deren Funktionieren im Zuge politischen Handelns gesellschaftlich regulieren, beeinflussen und steuern kann. Es geht mir dabei keineswegs um Manipulation, sondern um ganz normale Politik. Also um den Versuch, unsere verschiedenen Interessen, Neigungen und Ziele irgendwie zu integrieren und dafür zu sorgen, dass wir als Gesellschaft in eine positive, vielleicht sogar bessere Zukunft blicken können. Diese Menschenbilder sind nicht Gegenstand der politischen Diskussion. Wir streiten uns also nicht konkret darüber, wie wir Menschen sehen und wie wir sie sehen wollen. Auch Politiker sind sich in den meisten Fällen wahrscheinlich nicht im Klaren darüber, dass sie von einem bestimmten Menschenbild ausgehen und dass dieses Menschenbild auch anders sein könnte. Die Funktion dieses Menschenbildes besteht also darin, als Grundlage unseres politischen Denkens zu dienen, ohne dass wir das Menschenbild selbst infrage stellen. Es ist eine Setzung, eine Art naive Basistheorie. Es ist das, was man in der Wissenschaft ein Axiom nennt: ein Grundsatz, der keines Beweises bedarf.
Weil Menschenbilder bei der politischen Diskussion als Axiome wirken, werden sie weder thematisiert noch hinterfragt. Ohne aber die Voraussetzungen von angestellten Überlegungen zu verstehen und aktiv mitzudenken, sind diese Überlegungen nicht wirklich zu begreifen und sinnvoll zu bewerten. Nur wenn ich begreife, dass mein Gegenüber die Erde für eine Scheibe hält, kann ich wirklich verstehen, was sie damit meint, bis ans Ende der Welt zu reisen. Und nur wenn ich begreife, dass mein Gesprächspartner davon ausgeht, dass die Erde eine Kugel ist, kann ich erkennen, was er mit einer Weltumsegelung meint. Aber auch für mein Gegenüber wäre es wichtig, die eigenen Axiome, die eigenen Unterstellungen aktiv mitzudenken. Denn sie bestimmen schließlich maßgeblich, ob all das, was ich weiterhin annehme und entscheide, überhaupt sinnvoll ist.
Ein Ziel dieses Buches besteht darin, die unbewussten Menschenbilder, auf denen meiner Ansicht nach alle politischen Überlegungen basieren, ins Bewusstsein zu rücken. Vor allem möchte ich zeigen, dass und inwiefern sich bestimmte politische Annahmen, Positionen und Forderungen direkt aus den zugrunde liegenden Menschenbildern ergeben oder doch zumindest von ihnen nahegelegt werden. Bestimmte Menschenbilder, so werde ich argumentieren, werden zu kohärenten Weltbildern, die in vielen Fällen mit anderen Weltbildern unvereinbar sind. Es macht daher wenig Sinn, sich über diese Annahmen, Positionen und Forderungen zu streiten, ohne das zugrunde liegende Menschenbild in Rechnung zu stellen. Wenn Ihr Gegenüber davon ausgeht, dass die Erde eine Scheibe ist, dann können Sie nicht vernünftig mit ihr über den Ankunftsort und die Windverhältnisse einer Seereise diskutieren. Viele Diskussionen und Debatten sind demnach überflüssig, weil sie gar nicht zu einer vernünftigen Lösung führen können. Einsicht in diesen Umstand würde uns Dissens, Unbehagen und zahlreiche öffentliche Auseinandersetzungen ersparen.
Des Weiteren möchte ich aufzeigen, dass und inwiefern beide der von mir besprochenen Menschenbilder in erheblicher Weise unzureichend sind. Nun sind Menschenbilder notwendigerweise Stereotypen. Also Annahmen über Menschen, die nicht jedem Individuum in gleichem Umfang gerecht werden. Insofern sind Menschenbilder natürlich immer falsch, wenn man nur genau genug hinschaut. Das muss nicht unbedingt ein Problem sein. So ist meine stereotype Erwartung, dass die Menschen, die ich auf meiner Italienreise treffen werde, Italienisch sprechen, genau genommen übertrieben allgemein. Denn ich werde andere Reisende treffen, die kein Italienisch sprechen können: Einwanderer, die es noch nicht gut genug beherrschen und ihre Muttersprache bevorzugen, und Einwohner von Landesteilen, in denen man sich zum Beispiel auf Deutsch oder Ladinisch verständigt. Aber wenn ich mit meiner stereotypen Erwartung und möglichen Ausnahmen nur hinreichend flexibel umgehe und wenn ich sie hinreichend häufig an der Realität schärfe, wird sie sich doch in sehr vielen Fällen als nützlich erweisen. Bei den Menschenbildern verhält es sich jedoch anders, denn sie werden kaum irgendjemandem gerecht. In Wirklichkeit sind wir Menschen viel diverser strukturiert. Kaum jemand handelt im Alltag in einer Art und Weise, die mit den in der Politik gehandhabten Menschenbildern viel zu tun hat. Keines der beiden Menschenbilder spiegelt also in Wahrheit die Komplexität unserer gesellschaftlichen Wirklichkeit in irgendeiner vernünftigen Weise wider. Deswegen erübrigt sich auch der Streit darüber, welches von beiden besser und angemessener ist.
Um all dies deutlich zu machen, möchte ich folgendermaßen vorgehen: Zunächst möchte ich die beiden Menschenbilder holzschnittartig charakterisieren – wenn Sie sich noch andere ausdenken können, dann ist das gut und spricht nicht gegen meine These. Im Anschluss möchte ich an verschiedenen Beispielen herausarbeiten, wie sie ganz unterschiedliche Haltungen gegenüber wichtigen Fragen unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens nahelegen und motivieren. Tatsächlich sind viele politische Positionen weder originell noch individuell, sondern relativ direkt durch das zugrunde liegende Menschenbild getrieben. Dieses Menschenbild ist in der Regel nicht das Ergebnis ausgiebiger vernünftiger Erwägungen, sondern das unterbewusste Produkt einer komplexen Mixtur genetischer Prädispositionen und frühkindlicher Prägungen. Diese vorrationale Entstehungsgeschichte gibt uns das Gefühl der Alternativlosigkeit, denn wir haben andere Menschenbilder weder kennengelernt noch aus guten Gründen zurückgewiesen. Wir kennen es halt nicht anders und wissen es eben nicht besser.
Das sind schon mal ungünstige Voraussetzungen für ein tieferes Verständnis von Überlegungen, die auf anderen Menschenbildern basieren. Zudem haben Menschenbilder die Neigung, sich zu Weltbildern zu verdichten. Diese wiederum neigen zur Kohärenz, zur Geschlossenheit und damit zur Abwertung möglicher Widersprüche und Gegenargumente. Es ist diese Kohärenz, die wirklich vernünftigen Diskussionen einem wirklich fruchtbaren Austausch von Meinungen im Wege steht und zur Bildung von Meinungsblasen führt. Im Anschluss werde ich erläutern, warum und inwiefern beide Menschenbilder unzulänglich sind und wie ein breiteres, offenes realistischeres Menschenbild eine fruchtbarere gesellschaftliche Diskussion und vor allem bessere politische Entscheidungen erlauben könnte. Dazu brauchen wir allerdings ein besseres Verständnis dafür, wie Menschen wirklich funktionieren und vor allem, wie verschieden sie wirklich sind. Wir müssen also zumindest einen Teil unserer scheinbar selbstverständlichen Vorannahmen gegen wissenschaftliche Plausibilität eintauschen. Aber wenden wir uns zunächst einmal den zwei beispielhaften Menschenbildern zu.
Zwei Menschenbilder
Die sich seit dem Beginn des Jahres 2020 ausbreitende Corona-Pandemie hatte viele politische Kräfte an deren Grenzen gebracht. So konnte man sehr unterschiedliche politische Strategien unmittelbar hinsichtlich ihrer Wirkmächtigkeit verfolgen und vergleichen. Besonders interessant für meine Fragestellung sind die Strategien der deutschen Regierung seit der ersten Verfügbarkeit von Impfstoffen. Ungefähr ein halbes Jahr lang waren sämtliche offizielle Stellungnahmen völlig klar in dem Ausschluss jeglicher Impfpflichten und die verantwortlichen Stellen setzten, wie sie wiederholt betonten, auf den »mündigen Bürger«. Der nur mäßigen Impfbereitschaft wurde mit der Darreichung von mehr, besserer und wissenschaftlich fundierterer Information begegnet. Offensichtlich in der Hoffnung, dass sich die Bürger irgendwann überzeugen und sich dementsprechend impfen lassen werden. Gegen Ende des Jahres 2021 wurde jedoch zunehmend deutlich, dass sich ein beträchtlicher Teil der deutschen Bevölkerung unabhängig von der verfügbaren Information auf jeden Fall nicht impfen lassen werde. Dies hatte einen Strategiewechsel zur Folge, bei manchen Parteien langsamer, bei anderen schneller. Sodass die Einrichtung einer möglichen Impfpflicht mehr oder weniger plötzlich in aller Munde war. Nun ließe sich vieles über diese Entwicklungen sagen: Wie etwa, dass der rigorose Ausschluss einer Impfpflicht zu Beginn recht naiv war und der plötzliche Umschwung der politischen Strategie der Glaubwürdigkeit der Regierung nicht besonders nutzte. Oder dass es vielleicht eine gute Idee gewesen wäre, die verfügbaren wissenschaftlichen Informationen zunächst einmal intern zu ordnen, zu bewerten und in eine einheitliche, abgewogene politische Schlussfolgerung zu gießen, statt einer verwirrenden Kakofonie von vielen Stimmen mit unklaren wissenschaftlichen und politischen Mandaten Raum zu geben. Mir geht es hier aber um etwas anderes, nämlich um die jeweiligen Menschenbilder, die den verschiedenen Perioden der genannten politischen Strategien zugrunde lagen.
Der Beginn der politischen Kampagne für das Impfen war durch die Idee gekennzeichnet, dass Bürger als rationale Entscheidungsagenten gesehen werden können. Agenten also, die zunächst einmal Informationen sammeln, sie gegebenenfalls nach ihrer Glaubwürdigkeit bewerten, dann versuchen zu integrieren und Widersprüche aufzulösen. Um dann plausible Reaktionsmöglichkeiten vernünftig abzuwägen und schließlich zu einer durchdachten Entscheidung zu gelangen. Diese Idee von Menschen als mehr oder weniger rationalen Entscheidern hat eine mehr als tausendjährige Geschichte. Ursprünglich ging man davon aus, dass die Rationalität des menschlichen Entscheidens vom Bildungsniveau der betreffenden Person abhängt. So unterschied Plato zwischen drei Triebfedern des menschlichen Handelns: der Vernunft, der Tatkraft und der Begierde. Wobei es der Vernunft als lenkendes Organ oblag, die zwei anderen Triebfedern zu bändigen und gewissermaßen vor den eigenen Karren zu spannen. Diese Fähigkeit wurde allerdings nur den politischen Führern der griechischen Republiken zugebilligt, während die Tatkraft vor allem bei Soldaten und die Begierde bei Bauern, Händlern und Handwerkern als entscheidende Antriebe verortet wurden.
Maßgebliche Theorien des menschlichen Entscheidens und Handelns gestehen mittlerweile allen Bürgern alle drei Triebfedern (also Vernunft, Tatkraft und Begierde) zu, gewichten aber deren Wertigkeiten genauso wie Plato. So unterscheidet der Nobelpreisträger Daniel Kahneman zwischen einem rationalen und einem maßgeblich irrationalen System und geht davon aus, dass sich beide Systeme in einem kontinuierlichen Wettstreit miteinander befinden. Das rationale System ordnet für die Entscheidung wesentliche Informationen nach vernünftigen, logischen Gesichtspunkten, gewichtet und integriert sie und kommt schließlich zu einer abgewogenen Handlungsentscheidung. Das damit in Konkurrenz stehende irrationale System spiegelt unsere weniger vernünftigen Beweggründe wider, unter anderem auch Platos Tatkraft und Begierde. Je stärker dieses irrationale System zu unseren Entscheidungen beiträgt, desto impulsiver und unvernünftiger sind sie. Genau wie bei Plato entscheidet die Vernunft, der mentale Wagenlenker, über das Ausmaß der Beiträge des rationalen und des irrationalen Systems. Dies erfordert aber Energie und Anstrengung, sodass spontane Entscheidungen tendenziell als irrational, lange und gut überlegte Entscheidungen hingegen als vernünftig angesehen werden.
Staatliches Handeln, das von diesem agentiven, also vom Menschen als aktivem Agenten ausgehendenMenschenbild geleitet wird, kann sich jedes dieser zwei Systeme zunutze machen. Populistische politische Botschaften, wie sie etwa schon in der ersten Amtszeit von Donald Trump an der Tagesordnung waren und nun wieder sind, zielen vornehmlich auf das irrationale System. Längere Entscheidungsfindung muss verhindert werden, um das rationale System aus dem Spiel zu halten. Stattdessen gehören die motivationalen und emotionalen Triebfedern menschlichen Handelns in den Vordergrund, um das irrationale System zu füttern. Diese Strategie fand sich auch in der politischen Auseinandersetzung um die deutsche Corona-Politik wieder, wie etwa in der auf irrationale Ängste abzielende Anti-Impf-Kampagne der AfD. Im Gegensatz dazu zielte die Impfkampagne der Regierungsparteien zu Beginn der Verfügbarkeit von Impfstoffen auf das rationale System. Die Grundidee bestand offensichtlich darin, möglichst viele Informationen über die Wirkung der Impfstoffe öffentlich zu machen, wie etwa durch die Arbeit der Ständigen Impfkommission und des Robert Koch-Instituts. Den Bürgern erlaubte man damit, die Wahrscheinlichkeit, an Covid zu erkranken und gegebenenfalls zu sterben, mit der Wahrscheinlichkeit zu vergleichen, mögliche Nebenwirkungen der Impfung zu erleiden. Freiwilligkeit statt staatlicher Zwang war die Devise und für viele Repräsentanten der FDP und der AfD blieb sie das auch unter der zunehmenden Einsicht, dass diese Strategie nicht zur angestrebten Herdenimmunität führen wird.
Das agentive Menschenbild legt nahe, Personen in ihrer Individualität zu betrachten, dies aber von außen zu tun. Wenn sich also zwei Individuen zu unterschiedlichen Handlungsweisen veranlasst sehen, dann geht das agentive Menschenbild davon aus, dass die zugrunde liegenden Entscheidungsprozesse unterschiedlich gelaufen sein müssen. Entweder weil den beiden Personen unterschiedliche oder unterschiedlich viele Informationen zur Verfügung standen, was man durch die Bereitstellung weiterer Informationen reparieren kann. Oder weil sie sich in ihrem Hintergrundwissen oder ihren Neigungen und Erfahrungen unterscheiden. Die Freiheit, dies zu tun, wird für ein demokratisches Zusammenleben als wesentlich betrachtet und Versuche, das Innenleben der entscheidenden Personen stärker zu durchdringen, bleiben in der Regel aus. Bürgern wird daher ein relativ großes Maß an Autonomie unterstellt und zugebilligt.
Während dieses agentive Menschenbild, oder doch zumindest die sich daraus ergebenden Schlussfolgerungen, zu Beginn der Pandemie von vielen politischen Kräften breit geteilt wurde, nahm seine Attraktivität jedoch im Laufe der Zeit und im Angesicht der offensichtlichen Impfunwilligkeit überraschend großer Teile der Bevölkerung zunehmend ab. Tatsächlich ist die Einführung eines Impfzwangs gleichbedeutend mit der Kapitulation hinsichtlich der Annahme, dass das bessere Argument letztendlich siegen könne. Zunehmendes Unverständnis in weiten Teilen der Bevölkerung machte sich breit und gab einem alternativen Menschenbild aufseiten der Politiker zunehmend mehr Raum. Während das agentive Menschenbild von den drei Grundbegriffen westlicher Demokratien seit der französischen Revolution (Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit) vor allem dem Begriff der Freiheit Rechnung trägt, betont das alternative Menschenbild den Begriff der Gleichheit. Vor allem Ideologien links von der politischen Mitte sehen Bürger in der Regel nicht als autonome Individuen, sondern als Mitglieder und Repräsentanten bestimmter gesellschaftlicher Gruppen. Gesellschaftspolitische Auseinandersetzungen werden vornehmlich als Streit oder Kampf derartiger Gruppen um Macht oder ökonomische Ressourcen wahrgenommen. Die individuellen Eigenschaften von Bürgern werden vor allem aus deren Zugehörigkeit solcher Gruppen hergeleitet. Das Grundmuster dieser Überlegungen folgt vornehmlich der marxistischen Auffassung von Bürgern als Abbilder der gesellschaftlichen Bedingungen, in denen sie leben, und nicht so sehr als Individuen, die sich innerhalb dieser Bedingungen um Selbstverwirklichung bemühen. Um diese abbildende, also reflektorische Eigenart dieses zweiten Menschenbildes zu betonen, werde ich es von nun an das reflektorische Menschenbild nennen.
Ein Beispiel dieses reflektorischen Menschenbildes lässt sich an der jüngsten gesellschaftlichen Diskussion um die sogenannte Identitätspolitik ablesen. Jene habe ich in meinem Buch Gut gemeint ist nicht gerecht ausführlich besprochen. Identitätspolitiker leiten die Eigenschaften und möglichen Interessen von Individuen ausschließlich von deren Zugehörigkeit zu bestimmten gesellschaftlichen Gruppen ab. Diese Gruppen werden meist nach zwei Kriterien definiert. Das erste Kriterium ist Macht: entweder politische Macht im Allgemeinen, das Ausmaß der Kontrolle über die persönlichen Lebensverhältnisse oder die Kontrolle der Sichtbarkeit von Repräsentanten einer Gruppe in der Öffentlichkeit. Das zweite Kriterium ist Binarität, also Zweigliedrigkeit. Die Bevölkerung wird dadurch in der Regel in zwei Gruppen geteilt: eine Gruppe, die weniger Macht hat, und eine andere, die mehr Macht hat. Ein populäres Beispiel ist die Hautfarbe, die dazu benutzt wird, um Schwarze und Weiße gegenüberzustellen. Die Hautfarbe von Menschen variiert kontinuierlich und bietet eine binäre Einteilung in zwei Gruppen eigentlich nicht an. Die Variabilität von Hautfarbe widerspricht daher der Idee einer Zweiteilung, denn oft ist die Variabilität innerhalb einer Gruppe sehr viel größer als die Unterschiede an den Übergängen: Durchschnittliche Finnen und Sizilianer unterscheiden sich viel stärker in ihrer Hautfarbe als durchschnittliche Deutsche und Türken. Dennoch beharren Identitätspolitiker auf der Bedeutung von Hautfarbe und auf den unterschiedlichen Zugängen zu gesellschaftlicher Macht, die mit der entsprechenden Zweiteilung einhergeht.
Wie ich im Weiteren wiederholt erläutern möchte, legen das agentive und das reflektorische Menschenbild sehr unterschiedliche Herangehensweisen an gesellschaftliche Probleme nahe. Das agentive Menschenbild impliziert, dass politische Maßnahmen zur Erreichung gesellschaftspolitischer Ideale zunächst am Individuum ansetzen müssen. Das Individuum wird im Normalfall als autonom und selbst organisiert verstanden, sodass politisches Handeln danach trachten muss, den natürlichen Entscheidungsprozess von Bürgern so wenig wie möglich durch staatliche Regulation zu beeinträchtigen und stattdessen möglichste viele nützliche Informationen für die nötigen Entscheidungen bereitzustellen. Diese Grundüberlegung findet sich in einem Großteil der politischen Entscheidungen zu Beginn der Pandemie wieder und ist konstitutiv für das Selbstverständnis der US-amerikanischen Republikaner.