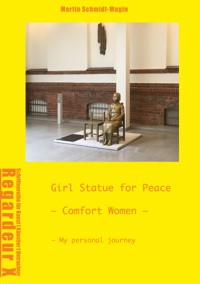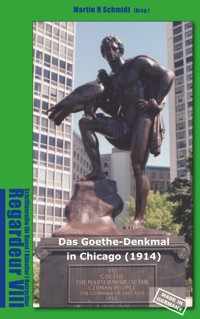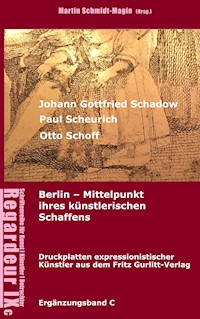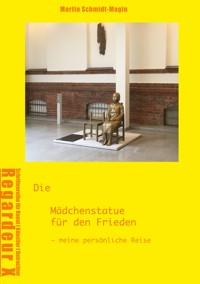
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Regardeur
- Sprache: Deutsch
Für die einen ist es die Mädchenstatue für den Frieden für die anderen das Kriegsmädchen. Es ist traurig erleben zu müssen, wie sich an ein und demselben Kunstwerk die Gemüter so eklatant scheiden. Und, es sind nicht nur japanische Bür- ger, die sich gegen die Skulptur und deren Plat- zierung aussprechen. Mit der vorliegenden Beschreibung meines Weges mit der Bronzeskulptur möchte ich einen Text lie- fern, der es den Lesern und Betrachtern ermög- licht ein tieferes Verständnis für die Umstände zu erhalten, die zu der Herstellung und den bis- herigen Aufstellungen der Statue im öffentlichen Raum in Süd-Korea und in der Bundesrepublik Deutschland führten. Es waren von 2016 bis 2019 nur drei Jahre während derer ich die Mädchenstatue für den Frieden begleiten durfte, diese jedoch waren sehr intensiv. Und obwohl ich nicht mehr in das Projekt eingebunden bin, eines kann ich versprechen: Es wird weitergehen! Die Trostfrauen werden nicht vergessen!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 129
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mein Stuhl
„... mein Stuhl ist immer auf seinem Platz Mein Stuhl ist die Achse der Welt, ist mein ewiger Fels. Auf der Welt gibt es allzuviel leere Dinge. doch mein Stuhl ist auch unbesetzt nicht leer.“
Kim Chong-mun (1919 - 1981)
Sechs Tage nach den US-amerikanischen Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki am 6. August und 9. August 1945 gab Kaiser Hirohito mit der Rede vom 15. August die Beendigung des „Großostasiatischen Krieges“ bekannt. Das war der Anfang vom Ende des Leides hunderttausender junger Frauen und Mädchen, die vom japanischen Militär als Sexsklavinnen, euphemistisch als „Trostfrauen“ bezeichnet, während des Zweiten Weltkrieges missbraucht wurden. Am 14. August 1991 bekannte sich Großmutter Kim Kah-soon zum ersten Mal öffentlich dazu, eine Sexsklavin des japanischen Militärs gewesen zu sein; seit 2012 ist der 14. August der „Internationale Gedenktag für dieTrostfrauen“.
Bisher entstanden weit über 100 Orte der Erinnerung an dieses Verbrechen weltweit. 2011 wurde die Bronzeskulptur „Mädchenstatue für den Frieden“ des Künstlerehepaares Kim Seo-kyeong und Kim Un-seong in Seoul vor den Toren der japanischen Botschaft, enthüllt.
Mehrere Wiederholungen der „Mädchenstatue“ stehen geduldet nicht erwünscht an verschiedenen Orten dieser unserer Erde. Eine davon konnte im August und September 2018 in Hamburg-Altona im Foyer des Dorothee-Sölle-Hauses gezeigt werden.
Dr. Martin Schmidt-Magin gibt seine ganz persönliche Sicht auf die „Mädchenstatue für den Frieden“ in Form tagebuchartiger Beschreibungen der Begegnungen mit Aktivistinnen und Aktivisten.
Für Nuna
Inhalt
1.
Vorwort
2.
Teil1
3.
Teil 2 Bonn
4.
Hamburg
5.
Korea
6.
Rückkehr und Ausblick
7.
Anhang
8.
Nachwort
9.
Abbildungen
Impressum
Kintsukuroi bezeichnet die traditionelle japanische Methode zur Reparatur von Steingut, Seladon oder Porzellan. Dabei werden die vorhandenen Bruchstücke eines Gefässes oder Objektes mit Lack geklebt und Fehlstücke ergänzt. Diese Klebestellen werden nicht mit Farbe kaschiert sondern mit feinstem Goldstaub überstreut. Das zerbrochene Gefäß erhält seine ursprüngliche Form zurück, die Narben sind deutlich sichtbar, durch die Transformation der Reparatur jedoch bleibt die Würde des Gefäßes gewahrt.
Für mich ein treffendes Synonym für die „Trostfrauen“.
Oben: Beispielfoto für Kintsukuroi
Rechts: “Mädchenstatue für den Frieden”, Bronze, Stein, 2011, im Foyer des Dorothee-Sölle-Hauses, 2018
Vorwort
„Herr Doktor! Sie sind der Künstlerische Leiter dieses Projektes?“ „Ja.“ „Dann muss ich Ihnen etwas mitteilen, und zwar meine Eindrücke zu diesem Mahnmal. Sie sehen ja, ich bin, wie Sie, ein Mann. Und ich muss Ihnen sagen ... ich kann mich dieser Statue nicht nähern. Zu stark schwingen meine eigenen schlimmen Erfahrungen in mir, beim Anblick dieses jungen Mädchens. In meiner Kindheit war auch ich Opfer von Übergriffen und offensichtlich habe ich dieses alte Thema noch immer nicht verarbeitet und aufgelöst. Meine Frau machte mich auf diesen heutigen Event aufmerksam und ich bin ganz blauäugig mitgegangen. Und nun, sehen Sie mich an. Ich stehe hier im Foyer des Dorothee-Sölle-Hauses, so weit entfernt von der Statue, wie es nur möglich ist und doch so nah, dass ich sie gerade noch sehen kann. Und innerlich? Innerlich zittere ich.“ „Es ist bemerkenswert und spricht für Sie, dass Sie sich dieser Erfahrung stellen.
Eine andere Dame sagte mir gerade vor wenigen Minuten annähernd das Gleiche. Auch sie musste in ihrer Jugend sexuelle Übergriffe ertragen und kann die Skulptur aus der Ferne anschauen, sich ihr aber nicht wirklich nähern. Und doch, sie sagte: Bei einem zweiten Besuch, wenn sie alleine mit der Skulptur hier im Foyer ist, dann wird sie sich ihr nähern und auch sicher einmal auf dem leeren Stuhl Platz nehmen. Vielleicht ist das auch für Sie ein Ansatz.“
Mit dieser kurzen Gesprächssequenz ist das Thema der „Mädchenstatue für den Frieden“ schon nahezu gänzlich umrissen: Ein Mahnmal gegen sexuelle Übergriffe. Ein Denkmal für die Einhaltung der Menschenrechte. Ein klares Statement für „Ein NEIN ist ein NEIN!“ Ein Hilfeschrei all jener Mädchen und jungen Frauen, die in Kriegsgebieten als leichte Beute marodierender Soldaten misshandelt, vergewaltigt und getötet wurden und auch heute noch werden. Sie, die Statue, „Pyeonghwabi“, ist eine Aufforderung an uns alle: „Macht endlich Schluss mit sexualisierter Kriegsführung! Macht endlich Schluss mit Gewalt gegen Frauen!“ Sexueller Missbrauch Schwächeren gegenüber geschieht seit Menschen gedenken. Es ist endlich an der Zeit, dass sich der männliche Teil unserer Gesellschaft der eigenen Verantwortung bewusst wird und erkennt und verinnerlicht, dass Intoleranz und Demütigung, Erniedrigung, Gewalt und Folter keine Mittel im Umgang mit dem weiblichen Geschlecht sein kann.
Die bronzenen „Mädchenstatue für den Frieden“ gibt uns, den Betrachtern die Möglichkeit, wieder in Kontakt mit dem eigenen Inneren Kind zu kommen, das von Vater und Mutter, von Freunden und Erziehenden geschlagen und verletzt wurde. Und über die Kontaktaufnahme mit dem Inneren Kind kann Heilung geschehen, für uns selbst, über Annahme und Vergebung; ebenso für Andere, denn über die eigene Heilung entsteht Mitgefühl, Respekt und Verständnis.
Ursprünglich entstand die „Mädchenstatue für den Frieden“ in Süd-Korea, explizit als ein Mahnmal gegen die sexualisierte Gewalt des japanischen Militärs im Zweiten Weltkrieg gegen Mädchen und junge Frauen in den besatzten Gebieten im Asia-Pazifik-Raum. Wissenschaftler gehen von einer erschreckend hohen Zahl von Opfern aus und beziffern diese mit zwischen 200.000 und 400.000! Und natürlich gibt es Institute und Forscher, die diese Zahlen bezweifeln. Aber, selbst wenn „nur“ 10.000 Opfer sexueller Gewalt durch japanische Soldaten hätten erleiden müssen, es wären 10.000 Opfer zuviel! Jede Frau, jedes Mädchen, dass sexuelle Übergriffe erleiden muss ist ein Opfer zuviel! So steht die Statue mit ihren Wurzeln fest verwachsen mit dem Konflikt zwischen Japan und Korea.
Dadurch jedoch, dass wir eine Kopie der Statue nach Deutschland transportiert haben und sie hier im Geltungsbereich der Deutschen Verfassung aufstellten, erhält sie eine viel umfassendere, eine generelle Bedeutung. Die Statue wird zum allgemeinverständlichen Symbol, grenz- und kulturübergreifend.
Nach meiner persönlichen Erfahrung verläuft der individuelle und persönliche Kontakt mit der „Mädchenstatue für den Frieden“ in mehreren Etappen ab. Zunächst wird die Skulptur aus der Ferne wahrgenommen, in ihrer naturalistischen Ausformung: Ein Mädchen in traditioneller Kleidung sitzt auf einem Stuhl, daneben befindet sich ein weiterer Stuhl, jedoch unbesetzt. Beim Herantreten werden Einzelheiten der Statue wahrnehmbar: das Mädchen schaut merkwürdig teilnahmslos, mit leeren Augen starrt sie vor sich hin. Die Haare sind kurz geschnitten, kinnlang und unfrisiert, eher zerzaust. Die Hände sind zu Fäusten geballt und vor den Schoß gepresst, die Füße finden keinen festen Halt auf dem Boden, sondern schweben leicht darüber. Auf der Schulter sitzt ein kleiner Vogel. Hinter dem Mädchen auf der Plinthe der Statue bildet ein mit schwarzen Steinen gebildetes Mosaik den Schattenwurf, nicht jedoch des jungen Mädchens, sondern einer alten Frau, deutlich nach vorne gebeugt, sitzend mit einem Haardutt im Nacken.
Der Schatten ist mit gebrochenen schwarzen Steinen mosaiziert; in der Mitte befindet sich ein aus weißem Marmor gefertigter Stein in Form eines Schmetterlings. Der bronzene Stuhl zu des Mädchens rechten Seite ist leer. Wenn die Statue soweit bereits erfasst werden konnte, dann ist auch die der Statue beigegebene Schrifttafel zu lesen, der Text lautet: „Diese Mädchenstatue für den Frieden erinnert an das Leid der sogenannten „Trostfrauen“, die während des 2. Weltkrieges von der japanischem Militärregierung zwangsprostituiert wurden. Ca.
200.000 Frauen aus den besetzten asiatischen Länder wurden in Militärbordelle verschleppt und sexuell missbraucht. Das Mahnmal gedenkt der Leiden der Opfer dieses unmenschlichen Kriegsverbrechens und leistet einen Beitrag, um die Würde und Rechte der betroffenen Frauen wieder herzustellen. Zugleich ist es ein fortwährender Aufruf zum Frieden und dient als Zeichen der Erinnerung an alle Menschen, die auch heute noch weltweit Opfer sexueller Gewalt werden.
In Solidarität mit allen Menschen auf der Welt, die sich für den Frieden einsetzen! 14. August 2018"
Und spätestens jetzt, da der Begleittext gelesen wurde setzt der „V-Effekt“ ein, das von Bert Brecht initiierte Stilmittel des Epischen Theaters: Der Verfremdungseffekt. Eine Handlung wird derart unterbrochen, dass beim Zuschauer jegliche Illusionen zerstört werden. Zerstört wird hier die Illusion, dass die „Mädchenstatue für den Frieden“ eine schön anzusehende aber belanglose Skulptur unter vielen ist. Nein, belanglos ist diese qualitätsvolle Statue keinesfalls, sie beinhaltet Sprengstoff und Heilung zugleich. Sprengstoff für jene, die Gewalt und Auseinandersetzung suchen, Heilung für jene, die sich für ein Gespräch und einen Austausch öffnen, die die eigenen Wunden und Verletzungen anschauen können und aus der Annahme der eigenen Wurzeln und Herkunft, Stabilität im Jetzt und Kraft für die Zukunft entwickeln.
Großmutter Lee Yong-soo ließ mich bei meinem Besuch im November 2018 anläßlich ihres 90sten Geburtstages in Korea erkennen, dass „Anerkennen – Vergeben – Erblühen lassen!“ – die richtige Formel ist für den Umgang mit der eigenen Geschichte, wie schrecklich oder auch wie schön sie auch immer gewesen sei. Nur indem wir uns unserer Vergangenheit stellen, sie als das anerkennen was sie ist und dabei anerkennen, dass sie vorüber ist, dass wir durch Vergebung wieder Kraft für unsere Gegenwart gewinnen, indem wir uns auf uns selbst wieder besinnen können und aus diesen Erkenntnissen heraus Neues und Friedvolles in der Zukunft erblühen lassen, nur dadurch kann Versöhnung geschehen und dabei kann auch ein Werk der Kunst, ein Bild oder eine Skulptur helfen.
Ja, es ist möglich und geschieht immer wieder, dass wir vor der geballten Kraft des Gemäldes eines Leonardo da Vinci, eines Rembrandt, eines Picasso, eines Damian Hirst vor Ehrfurcht regelrecht „ersterben“; ja, das ist möglich.
Aber: vor der Bronzeskulptur „Mädchenstatue für den Frieden“ werden wir als Betrachter auf einer ganz anderen Ebene erreicht. Es ist nicht die oberflächliche Ebene der Verehrung, sondern die Ebene der persönlich-individuellen Betroffenheit. Wir können uns in der Skulptur des bronzenen Mädchens wiedererkennen; wir können uns mit ihr identifizieren, verschmelzen und aus dieser Einheit kann eine neue Sichtweise erwachsen, die dabei hilft zu verstehen, dass es keine Rivalität zwischen Männern und Frauen geben muss, dass Männer Frauen verstehen können und – wie im Taoismus – nur aus der Einheit von Yin und Yang (weiblicher und männlicher Energie) eine einheitliche Stärke resultieren kann und resultieren wird! Die „Mädchenstatue für den Frieden“ macht Mut und gibt die Stärke dazu! Mit anderen Worten: „See it – Say it – Sort it!“
Teil I
„Geboren wurde ich in Lehm aus Erz durch Feuer … meine Schwestern residieren verteilt über den Erdball“
Konzipiert wurde ich im Atelier des koreanischen Künstlerehepaares Kim Seo-kyung und Kim Un-seong in Seoul, Süd-Korea. In einer liebevollen und von Respekt und Toleranz getragenen Atmosphäre entstand meine Urform, das Modell zur Marquette, der Gussform. Nur zu gerne erinnere ich mich an die warmen und weichen Hände von Seo-kyung und Un-seong, die zu anfangs flüssigen Gips und später warmes Wachs über mein inneres Metallskelett gossen, auftrugen und schließlich – wie gesagt mit ihren Händen – glatt strichen.
In der obersten Wachsschicht modellierten beide – ganz zärtlich – meinen Körper, meine Haut und die Kleidung, die ich tragen darf, den Hanbok, das traditionelle Gewand koreanischer Frauen und die feinen Stoffschuhe. Modell sass den beiden, die keine eigenen Kinder haben, ein junges ca.
13 Jahre altes Mädchen aus der Nachbarschaft des Ateliers. Sie ist eines jener vielen Kinder, die, von Neugierde getrieben wieder und wieder ihre Nasenspitze an die großen Fensterscheiben der Atelierhalle pressen, um einen Blick ins Innere zu erhaschen. Da Seo-kyung und Un-seong nur zu gerne Kinder um sich herum spielen sehen, hat sich seit dem Einzug beider Künstler eine kleine Fangemeinde von Nachbarskindern gebildet, die nahezu täglich im Atelier vorbeischauen.
Dabei bringen sie gelegentlich Obst oder Süßigkeiten zu den Künstlern, manchmal treiben sie Schabernack, indem sie die Klingel drücken oder an das riesige Tor klopfen und natürlich gleich danach schnell weglaufen; doch manchmal sitzen sie auch ganz ehrfürchtig auf dem alten Sofa im Atelier und verfolgen mit weit geöffneten Augen, oft auch mit weit geöffnetem Mund den Entstehungsprozess von Zeichnungen und Plastiken.
Eines der Mädchen gefiel Seo-kyung und Un-seong so gut, dass sie bei dessen Eltern anfragten, ob Sumi, so ist ihr Vorname, ob Sumi Modell sitzen könne für die zu entstehende Bronzeskulptur „Mädchenstatue für den Frieden“. Die Eltern zierten sich anfangs. Sie betreiben ein kleines Lebensmittelgeschäft in dem nahegelegenen Einkaufszentrum, gleich an dem Eingang der zur Bowlinghalle führt und dort werden alle Hände der Familie zur Unterstützung benötigt, auf keinen der fünfköpfigen Familie ist zu verzichten, denn jeder und jede ist mit einem festen Part im Geschäftsablauf betraut. Als Seokyung und Un-seong jedoch versicherten, dass Sumi nur wenige Stunden an wenigen Tagen als Modell sitzen werde und die Zeiten natürlich gemeinsam abgesprochen werden können, da willigten die Eltern ein. Zwischenzeitlich hatten sie auch mit vielen ihrer Kunden über dieses „Projekt“, wie sie es nannten gesprochen und dabei erfuhren sie, dass es als eine Ehre zu verstehen ist, wenn ein Künstler danach fragt, ob man für sie Modell sitzen möge.
Was Sumi vor allen anderen Kindern der „Fangemeinde“ auszeichnete, war ihr immer freundliches Wesen. Es gab niemanden, der hätte sagen können, dass er Sumi jemals mit schlechter Laune angetroffen oder dass sie gar einer Anfrage um Hilfe nicht entsprochen habe. Sumi war ein sprichwörtlicher Sonnenschein für ihre Familie und all jene Menschen, die mit ihr in Kontakt kamen. So achtete sie während der vielen Stunden, die sie in der großen Halle des Einkaufszentrums am Stand ihrer Eltern verbrachte peinlich genau darauf, dass wann immer eine hilfsbedürftige Person an der Glastüre auftauchte und nicht unmittelbar selbst die schwere Türflügel öffnete, dass sie oder einer ihrer beiden Brüder diesen Personen zu Hilfe eilte. Dabei war ihr oberstes Gebot an sich selbst und an ihre Geschwister, dass sie immer mit einem Lächeln im Gesicht diesen kleinen Dienst am Nächsten ausübten. Sumi war auch als „Kleine Sonne“ bei den Mitbewerbern im Einkaufszentrum bekannt, alle, wirklich alle schätzen ihre freundliche und wohltuend quirlige Art, die sie manchmal sogar noch mit einem kleinen Scherz oder einem Bonmot zur Belustigung der Umstehenden würzte. Sumi brachte sprichwörtlich Licht in die Tristess des Einkaufszentrums.
Und dennoch wunderte es die Eltern der kleinen Sumi, warum das Künstlerehepaar gerade ihr Kind auswählten. Für Sumis Eltern war die Kleine eher eine vorwitzige Göre, die sich hin und wieder zu viel herausnahm und der es an dem ehrwürdigen und zurückhaltenden Respekt anderen Mitmenschen gegenüber bisweilen fehlte. In alkoholgeschwängerten Gesprächen ließ sich ihr Vater sogar gegenüber seinen Geschäftspartnern dazu verleiten, Sumi als eine Schande der Familie zu bezeichnen. Diejenigen jedoch die Sumis Vater näher kannten wussten, dass er und seine Tochter ein Herz und eine Seele waren und er niemals weder die Hand gegen sie erheben hätte können, noch sie schelten oder ausschimpfen würde.
Die Verwunderung der Eltern war auch erst ab dem Moment aufgetaucht, da sie vom Inhalt, von der Thematik des „Projektes“ erfuhren. In ihrer Vorstellung müsste ein trauriges, ein vom Leben stark gezeichnetes Mädchen, vielleicht sogar eine verunstaltete junge Frau als Vorbild für die „Mädchenstatue für den Frieden“ den Platz einnehmen; doch, sie fügten sich gerne und versprachen, Sumi bei ihrer ersten Model-Rolle zu unterstützen.
So wurde ich nach dem Vorbild der lebensfrohen Sumi geschaffen. Ihr Aussehen ist ebenmäßig, ihre Herkunft aus einer eher arm als reich zu nennenden Familie im Nordosten der Landeshauptstadt und Multimillionenmetropole Seoul ist ihr nicht anzusehen. Die eher harten Gesichtszüge ihrer Urgroßeltern, die zwischen dem Sarak-san-Gebirge und dem Gelben Meer lebten sowie die weiche körperliche Erscheinung ihrer Vorfahren, die von Jeju, der größten Insel Koreas kommend nach dem Großen Bruderkrieg in der neuen Hauptstadt der Republik Korea, in Seoul ihren neuen Lebensmittelpunkt fanden; beide Antipoden vereint sie in sich und Sumi kann wirklich als eine Gegensätze in sich harmonisch vereinende koreanische Schönheit angesehen werden, die auch von Europäern und Amerikanern als koreanisches Mädchen schnell identifiziert werden kann. Und obwohl sie bereits im 14ten Lebensjahr stand, strahlte ihr rundes, volles Gesicht noch viel Kindlichkeit aus, was nicht nur den leicht vorgewölbten Wangen geschuldet war.