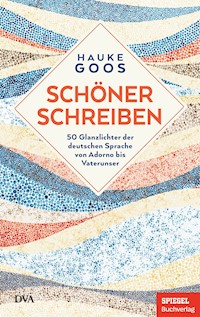17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Deutsche Verlags-Anstalt
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Zum Staunen, Genießen und (Wieder-)Entdecken: 50 neue Glanzlichter der deutschen Sprache – die Fortsetzung der beliebten Kolumne »Schöner schreiben« als Buch
Seit vielen Jahren trägt Hauke Goos in seiner beliebten SPIEGEL-Kolumne »Schöner schreiben« meisterhafte Beispiele der deutschen Sprache zusammen: markante Sätze aus Romanen, berührende Auszüge aus Briefen oder kraftvolle Passagen aus Reden, die zeigen, wie elegant und anschaulich das Deutsche sein kann. Dieser Band versammelt 50 neue, teils unveröffentlichte Texte, darunter: »Die Formel für ein gelungenes Leben«, »Wie man den Weltuntergang zum Klingen bringt«, »Der schönste Satz, den Mozart nicht schrieb« und »Der womöglich kälteste Liebesbrief der Literaturgeschichte«. Jeder einzelne eine Einladung, einen Autor, ein Genre, ein Werk kennenzulernen und zu entdecken, was die deutsche Sprache so faszinierend macht. Mit Beiträgen zu Vicki Baum, Walter Benjamin, Elfriede Jelinek, Erich Kästner, Gotthold Ephraim Lessing, Saša Stanišić und vielen anderen mehr.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 193
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Zum Buch
Seit vielen Jahren trägt Hauke Goos in seiner beliebten SPIEGEL-Kolumne »Schöner schreiben« meisterhafte Beispiele der deutschen Sprache zusammen: markante Sätze aus Romanen, berührende Auszüge aus Briefen oder kraftvolle Passagen aus Reden, die zeigen, wie elegant und anschaulich das Deutsche sein kann. Dieser Band versammelt 50 neue, teils unveröffentlichte Texte, darunter: »Die Formel für ein gelungenes Leben«, »Wie man den Weltuntergang zum Klingen bringt«, »Der schönste Satz, den Mozart nicht schrieb« und »Der womöglich kälteste Liebesbrief der Literaturgeschichte«. Jeder einzelne eine Einladung, einen Autor, ein Genre, ein Werk kennenzulernen und zu entdecken, was die deutsche Sprache so faszinierend macht.
Hauke Goos, Jahrgang 1966, schreibt seit 1999 für den SPIEGEL. 2021 erschien das von ihm und Alexander Smoltczyk herausgegebene SPIEGEL-Buch Ein Sommer wie seither kein anderer. Wie in Deutschland 1945 der Frieden begann – Zeitzeugen berichten, ebenfalls 2021 kam Schöner schreiben. 50 Glanzlichter der deutschen Sprache von Adorno bis Vaterunser heraus. 2024 veröffentlichte er zusammen mit seiner Frau Annette Warum hängt daran dein Herz? Wie Erinnerungsstücke aus der Kriegszeit helfen, unsere Eltern zu verstehen. Hauke Goos lebt mit seiner Familie in Hamburg.
Hauke Goos
Die Magie der deutschen Sprache
50 literarische Glanzlichter von Kafka bis Loriot
Deutsche Verlags-Anstalt
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung des urheberrechtlich geschützten Inhalts dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2025 by Deutsche Verlags-Anstalt, München
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München,
und SPIEGEL-Verlag Rudolf Augstein GmbH & Co. KG, Ericusspitze 1, 20457 Hamburg
(Vorstehende Angaben sind zugleich Pflichtinformationen nach GPSR.)
Umschlaggestaltung: Favoritbuero
Umschlagabbildung: © Richard Laschon / Shutterstock
Satz: satz-bau Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-33446-8V001
www.dva.de
Für Jakob, Laurenz, Matilda und Bruno
Inhalt
V o r w o r t
Frauen hinter Glasbausteinen: ratlos
Roger Willemsen, Deutschlandreise
Das (vielleicht) schönste Romanende der Welt
Otfried Preußler, Krabat
Liebe, Sehnsucht, Einsamkeit: Warum das Hotel der Tempel der Moderne ist
Vicki Baum, Menschen im Hotel
Gute Vorsätze – fröhlicher rauchen
Hans Magnus Enzensberger, Fallobst
Ein unordentliches Genie – und eine Rede für die Ewigkeit
Franz Grillparzer, Rede zu Ludwig van Beethovens Begräbnis am 29. März 1827
»Ich mache fast alles für Geld, und nichts davon interessiert mich«
Sibylle Berg, Ende gut
Auf der Suche nach der verlorenen Zeit
Walter Benjamin, Berliner Kindheit um Neunzehnhundert
Hamburg im Feuersturm – wie man Worte für das Unbeschreibliche findet
Hans Erich Nossack, Der Untergang
Hauke Haien oder die Stürme des Lebens
Theodor Storm, Der Schimmelreiter
Erzählen, was man nicht benennen darf
Christa Wolf, Der geteilte Himmel
Vom Glück, im Auto zu sitzen und nichts zu tun
Moritz von Uslar, Deutschboden: Eine teilnehmende Beobachtung
Weshalb uns die Sehnsucht auf ewig ein Rätsel bleibt
Robert Walser, Brief an seine Schwester Lisa, 30. Juli 1897
Kaltes Silber, verwehte Schreie – Ernst Jünger und die Sprache des Krieges
Ernst Jünger, In Stahlgewittern
Der womöglich kälteste Liebesbrief der Literaturgeschichte
Gretha Jünger an ihren Mann Ernst, 29.12.1942
Ein schreiendes Kind, ein Keller unter Wasser – und dann?
Peter Handke, Kindergeschichte
Das Geheimnis des Lebens, mit einem simplen Kausalsatz erklärt
Heinrich von Kleist, Brief an Wilhelmine von Zenge, 16. November 1800
Der kürzeste (und vielleicht schönste) Vater-Sohn-Dialog der Welt
Alexander Gorkow, Hotel Laguna
Der leere Himmel über der Ukraine
Joseph Roth, Reisen in die Ukraine und nach Russland
»Wie schön zu wissen, dass Du da bist«
Freya von Moltke an Helmuth James von Moltke, 23. Januar 1945
Der überwältigende, bedrohliche Zauber des Orients
Friedrich Hölderlin, Hyperion
Englisch für Angeber – Loriots ultimativer Härtetest
Vicco von Bülow, Englische Ansage
Warum man nur im Kaffeehaus sein Glück findet
Alfred Polgar, Theorie des »Café Central«
Die Freuden des Schmerzes: »Begreifen können wir es nicht!«
Elfriede Jelinek, Die Klavierspielerin
Kann man hoffnungsvoll über die Dummheit schreiben?
Dietrich Bonhoeffer, Von der Dummheit
Wie man die Wüste mit Worten zum Leben erweckt
Johann Gustav Droysen, Geschichte Alexanders des Großen
So lustig schrieb Rilke – und so böse
Rainer Maria Rilke, Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge
Warum wir uns gegen Unrecht wehren müssen
Rudolf von Ihering, Der Kampf um’s Recht
Sehnsucht nach Nähe, Sehnsucht nach Ferne
Brigitte Reimann, Franziska Linkerhand
»Fehlentscheidungen sind das Kostbarste, was der Schiedsrichter dem Fußball geben kann«
Thomas Brussig, Schiedsrichter Fertig
»Ich verlor ihn so ungern, diesen Sohn!«
Gotthold Ephraim Lessing an Johann Joachim Eschenburg, 10. Januar 1778
Wie man den Weltuntergang zum Klingen bringt
Hermann Kesten, Der Scharlatan
»Und dass die Menschen nicht so oft weinen«
Nicole, Ein bißchen Frieden
So schreibt man klar und deutlich über den Hass
Heinrich Mann, Der Haß
Warnung: Die Schilderung von Gewalt kann faszinierend sein
Ferdinand von Schirach, Verbrechen
Wenn die Kindheit ein Gefängnis ist
Karl Philipp Moritz, Anton Reiser
Die Fürstin, die böse über Hitlers Sprache und zart über die Liebe schrieb
Mechtilde Lichnowsky, Werke
Das Grauen des Krieges – in wenigen Zeilen
Walter Kempowski, Das Echolot
Wie man mit einem kleinen Wort das Verhängnis andeutet
Erich Maria Remarque, Im Westen nichts Neues
Was man sagt, wenn man sich für Fußballer schämt
Eberhard Stanjek, Deutschland – Österreich 1:0, 25. Juni 1982
»Alles dunkel und kalt« – Die Skandalgräfin und der Neujahrsblues
Franziska zu Reventlow, Tagebucheintrag von 1. Januar 1897
Die berühmteste Drohung der Weltgeschichte
Karl Marx/Friedrich Engels, Manifest der Kommunistischen Partei
Das Irrenhaus Berlin – und das Abenteuer Zukunft
Erich Kästner, Emil und die Detektive
Fake News: Der schönste Satz, den Mozart nicht schrieb
Wolfgang Amadeus Mozart, Tagebuch vom 13. Juli 1770
Mozart und der vielleicht schönste Satz der Welt
Eduard Mörike, Mozart auf der Reise nach Prag
»Kapitänshauskäufer«: Wie man Touristen beleidigt, ohne dass sie’s merken
Dörte Hansen, Zur See
Wie man den Himmel mit Worten malt
Bruno Schulz, Die Zimtläden
Triggerwarnung: Dieses Märchen könnte Sie beunruhigen
Jacob und Wilhelm Grimm, Hänsel und Gretel
Wie Kafka von der Welt Abschied nahm
Franz Kafka, Brief an seine Eltern, 2. Juni 1924
»Lebensinhalt ist doch ein total schwachsinniger Begriff«
Sven Regener, Herr Lehmann
Die Formel für ein gelungenes Leben? Hier kommt sie!
Golo Mann, Brief an Julio del Val Caturla, August 1989
Nachweise
V o r w o r t
Im Frühjahr 2024 dachte ich einen Moment lang ernsthaft darüber nach, Olaf Scholz in dieses Buch aufzunehmen.
Auf Sylt waren am Pfingstwochenende ein paar junge Menschen zum Feiern zusammengekommen, sie hatten Lieder gesungen, die fremdenfeindlich und rassistisch waren. Auf einem Handy-Video, das jemand ins Netz gestellt hatte, schien einer von ihnen einen Hitlergruß anzudeuten. Ein paar Tage lang war Deutschland empört, so sehr, dass der Bundeskanzler sich genötigt sah, den Vorfall zu kommentieren.
Für einen Politiker eigentlich eine schöne Gelegenheit. Weil unstreitig ist, was man in solchen Fällen sagt, kommt es allein darauf an, wie man es sagt.
Wenn man Glück hat, gelingen Sätze, die ins Zitatgedächtnis einer Gesellschaft eingehen. Weil sie etwas diffus Empfundenes auf den Punkt bringen; weil sie Phänomene, die scheinbar unverbunden nebeneinanderstehen, in eine Klammer fassen. Und weil sie zeigen, dass Rhetorik ohne Haltung wertlos, Haltung ohne Rhetorik aber wirkungslos ist.
Und Scholz? »Ganz klar: Solche Parolen sind ekelig, sie sind nicht akzeptabel«, sagte er. Offenbar wollte er Schärfe mit Eindeutigkeit verbinden und auf keinen Fall missverstanden werden. Darüber, sagte Scholz, dürfe es »kein Vertun« geben. »Und deshalb ist es auch richtig, dass all unsere Aktivitäten darauf gerichtet sind, genau zu verhindern, dass das eine Sache ist, die sich verbreitet.«
Ich finde diese Aussage bemerkenswert. Olaf Scholz, das kann man sagen, ist kein großer Redner, er war es nie. Zwanzig Jahre zuvor hatte er sich als Generalsekretär seiner Partei den Spitznamen »Scholzomat« verdient. Obwohl das als Vorwurf gemeint war, trug er den Titel wie eine Auszeichnung.
Ich weiß nicht, ob Scholz sich zuhörte, wenn er redete. Manchmal während seiner Kanzlerschaft sah es so aus, als würde er sich selbst am meisten langweilen bei seinen Reden, aber das kann natürlich täuschen. Meist wirkte er wie jemand, der sich vorgenommen hatte, die deutsche Sprache auszutrocknen, so lange, bis sie jegliche Anschaulichkeit und Schönheit verloren hatte. Die Kunst, viel zu reden und nichts zu sagen, hat Scholz früh zur Perfektion gebracht.
Vielleicht, dachte ich in jenem Frühjahr, ist dieses Sylt-Zitat eine schöne Gelegenheit, um zu zeigen, worum es in diesem Buch nicht geht. Ich hatte ja »Stellen« aus Romanen, Briefen, Reden zusammengetragen, Absätze, kurze Passagen, die mich begeistern: Weil sie das, was gesagt werden soll, präzise und gleichzeitig elegant ausdrücken, konzise und anschaulich, verständlich und oftmals originell. Weil sie zeigen, was Stil ist; was Stil ausmacht. Und weil sie die Mühe verbergen, die es bereitet, einen Gedanken, eine Beschreibung oder eine Erkenntnis so in Worte zu fassen, dass der Leser das Gefühl hat: Besser geht es nicht. Genau so muss man es machen.
Würden all diese »Stellen« nicht umso heller leuchten, je deutlicher der Kontrast zutage träte? Scholz’ irritierend stumpfes Deutsch hier – und das funkelnde, glänzende, bisweilen magische Deutsch anderswo, bei Karl Marx und Friedrich Hölderlin, bei Vicki Baum und Hans Magnus Enzensberger, bei Heinrich von Kleist, Elfriede Jelinek, Franz Kafka und vielen anderen?
Stil ist nichts anderes als die Übereinstimmung von Inhalt und Form. Wer’s nicht einfach und klar sagen kann, hat der Philosoph Karl Popper mal gefordert, der soll schweigen und weiterarbeiten, bis er’s klar sagen kann. War »ekelig« tatsächlich das Wort gewesen, das Scholz zu den hässlichen Gesängen als Erstes einfiel? Fand er für Rassismus und Fremdenhass keine anderen Worte als »eine Sache, die sich verbreitet«? Wollte er im Ernst das Bemühen um Anstand und Herzensbildung unter der Überschrift »all unsere Aktivitäten« zusammenfassen?
Ich habe Scholz’ Satz damals gegoogelt und dann einen Screenshot gemacht. Nicht, weil mich seine Sprachlosigkeit überrascht hätte. Sondern weil sein Satz zeigt, wie wichtig Sprache ist. Wie wichtig Kommunikation ist, in einer Demokratie und überhaupt. Wie sehr es auffällt, wenn einer für Rhythmus und Farbe, für die Schönheit und die Kraft von Sprache kein Gefühl hat. Wie traurig es ist, wenn einer etwas sagen will und keine Worte findet.
Mittlerweile sind auf meinem iPhone beinahe 7000 »Objekte« gespeichert. Beinahe jeden Tag kommen neue hinzu. Fotos von Orten, Fotos von meinen Kindern – und eben auch Screenshots von Sätzen, die ich irgendwo entdeckt habe. Ich finde diese Sätze in Werbetexten und auf Grabsteinen, auf Kinoplakaten und an Denkmälern, in Briefsammlungen, politischen Reden und natürlich in Romanen. Wer »Stellen« sammelt, wird ständig beglückt.
Mal ist es eine Selbstbeobachtung, die mich berührt, wie in Kafkas Brief an seine Verlobte Felice Bauer:
»Ich erschrecke, wenn ich höre, daß Du mich liebst, und wenn ich es nicht hören sollte, wollte ich sterben.«
Oder ein verblüffender Gedanke, wie bei Paul Valérys unsterblicher Behauptung, Gott habe die Welt aus dem Nichts erschaffen, doch das Nichts »schmecke durch«.
Mal ist es eine schöne Unverschämtheit, wie in dem (erfundenen) Tagebucheintrag Mozarts vom 13. Juli 1770:
»Gar nichts erlebt. Auch schön.«
Oder die Erinnerung an eine große Liebe, die zugleich auch die Erinnerung an eine große Enttäuschung ist, wie in Hannah Arendts Worten an Martin Heidegger, der 1933 in die NSDAP eingetreten war und bis zum Kriegsende Mitglied blieb:
»Die Widmung dieses Buches ist ausgespart. / Wie soll ich es Dir widmen, / dem Vertrauten, / dem ich die Treue gehalten habe / und nicht gehalten habe, / Und beides in Liebe.«
Wobei natürlich jeder seine eigenen Hausgötter hat: Dichter, Schriftsteller, Schreiber aller Art, die er schätzt, deren Stil er mag. Bei mir sind es, unter anderem, Golo Mann und Sebastian Haffner, Sigmund Freud und Egon Friedell, Joseph Roth, Joachim Fest, Rolf Vollmann und Marie-Luise Scherer. Ich bewundere Friedrich Schiller für seine mitreißende Geschichte des Dreißigjährigen Kriegs, Thomas Mann für seinen tiefgedachten Essay über Friedrich den Großen und Wolfgang Herrndorf für sein schonungsloses Krankheitsprotokoll Arbeit und Struktur, das vom Tod handelt und trotzdem eine Feier des Lebens ist.
Am schönsten, hier wie überall, sind die Entdeckungen. Über ein Zitat auf ein bis dahin unbekanntes Buch zu stoßen; über ein Buch auf einen Autor; über einen Autor auf eine Schreibschule: Das ist das Vergnügen, das dieses Suchen nach »Stellen« verspricht. Sehr viele Entdeckungen verdanke ich Ernst Mannheimer, dem ich schon im Vorwort des ersten Bandes, Schöner schreiben, gedankt habe: für seine Begeisterung, und für die Großzügigkeit, mit der er seine Funde teilt. Der Dank sei hier ausdrücklich noch einmal wiederholt.
Die deutsche Sprache, hat der irische Komiker Dylan Moran einmal gesagt, klinge »wie eine Schreibmaschine, die Alufolie frisst und die Kellertreppe hinuntergetreten wird«. Und von Karl V., der im Jahr 1530 zum Kaiser des Heiligen Römischen Reiches gekrönt wurde, ist der Satz überliefert: »Ich spreche Spanisch zu Gott, Italienisch zu Frauen, Französisch zu Männern und Deutsch zu meinem Pferd.«
Beides stimmt nicht, zum Glück. Die deutsche Sprache ist, wenn man’s vermag, so wohlklingend wie die französische. Man kann im Deutschen seine Trauer über einen verlorenen Gefährten ausdrücken (Gretha Jünger an ihren Mann Ernst, einer der kältesten Liebesbriefe aller Zeiten), man kann für Mozarts Musik Worte finden, die Sinneseindrücke in Melodie verwandeln wie Eduard Mörike, man kann seine Gleichgültigkeit, seinen Ennui klarsichtig und berührend zum Gegenstand machen wie Sibylle Berg in Ende gut. Jedes dieser Beispiele bezeugt die Anstrengung eines Autors, oder einer Autorin, sich dem Publikum so gut wie irgend möglich mitzuteilen. An Sätzen, an Absätzen, am Text so lange zu arbeiten, bis für den Inhalt eine Form gefunden ist. Die passende Form. Die perfekte Form. Sich Mühe zu geben, sich zu quälen. Damit der Leser, damit die Leserin sich nicht quälen muss.
Olaf Scholz hat es am Ende dann doch nicht in dieses Buch geschafft. Die Fundstücke, die ich hier versammle, erscheinen mir so überzeugend, dass es, so hoffe ich, keinen Kontrast braucht.
Immerhin: In der Zwischenzeit habe ich Scholz ein zweites Mal in meinem iPhone-Archiv gespeichert. Ende 2024, als in Berlin die Ampel-Koalition auseinanderbrach, gelang ihm ein Satz, der den Tonfall seiner kurzen Kanzlerschaft perfekt trifft. Scholz sagte ihn zu seinem Finanzminister Christian Lindner, der sein Partner war und darüber zum politischen Gegner wurde. Resignation ist darin, Wut, vielleicht Trauer. Vor allem aber, endlich, Emotion.
Der Satz lautet: »Ich möchte nicht mehr, dass du meinem Kabinett angehörst.«
Magisch ist auch das nicht. Aber es ist mehr als nichts.
Frauen hinter Glasbausteinen: ratlos
Deutschland ist irgendwo oder nirgendwo oder überall: Dieselben Glasbausteine in der Fassade, dieselben gestuft angebrachten Hausnummern, dieselben Garagen und vor den Garagen dieselben Ehefrauen, die ratlos in der Einfahrt stehen und zusehen, wie ihr Mann nach Hause kommt, und nebenan kommt der Nachbar in sein Haus, und die Frauen stehen und fragen sich: Warum kommt dieser in mein Haus zu mir und jener in ihr Haus zu ihr? Lauter Andere und Gleiche, alles anders und gleich, die Sorge, die Liebe, die Einzelhaft.
Roger Willemsen, Deutschlandreise
Anfang des Jahrtausends unternahm der Fernsehmoderator Roger Willemsen eine Reise, die exotischer kaum denkbar ist: Er fahre von Deutschland nach Deutschland, erklärte er, um die sogenannten Menschen draußen im Lande zu suchen.
Was ihm sofort auffiel: dass es eine Lücke gibt zwischen den Deutschen, wie sie sind, und den Deutschen, wie sie sich sehen. Und dass die meisten von dieser Lücke nichts wissen. Auf dem Umschlagfoto steht Willemsen im Türbereich eines Zuges, sein Blick geht am Fotografen vorbei nach draußen und gleichzeitig tief nach innen: neugierig und erschöpft, erwartungsfroh und ein wenig bang.
Reisetexte folgen einer Regel: Man muss sich selbst bewegen, damit etwas in Bewegung geraten kann. Mal sucht der Reisende sich selbst, mal weicht er sich aus; mal strebt er einem Ziel zu, häufiger will er einfach nur weg von etwas.
Andererseits treibt alle Reisenden der Wunsch nach Erkenntnis voran, die Suche nach dem Herzen der Finsternis. Eine Deutschlandreise, das ist immer auch: Soziologie, Mentalitätsgeschichte und Archäologie. Überall finden sich die Spuren der Vergangenheit, von der Gegenwart nur nachlässig übermalt: Verbote, Warnhinweise, Reklame, Wörter wie »Lebensmittelgeschäft« oder »Fremdenzimmer« und, unter Türspionen, bunte Fußmatten, auf denen in geschwungener Schrift »Willkommen« steht.
Die Deutschen, das ist die Grundannahme jeder Deutschlandreise, sind sich selbst ein Rätsel. Sie verehren das Praktische und träumen vom Geistigen, sie sind im Kleinen oft laut und im Großen häufig verzagt, unbegabt zum Leichtsinn, zu Sprüngen, überhaupt zur Revolution. Wenn die Deutschen einen Bahnhof stürmten, höhnte Lenin, kauften sie zuvor eine Bahnsteigkarte.
»Am schönsten ist das Land als Versprechen, weit weg«, schreibt Willemsen. Sein Blick auf Deutschland ist ein Blick aus dem warmen Abteil heraus, begrenzt durch den Rahmen, den das Zugfenster setzt. Ein Blick aus der Distanz, aber mehr noch ein Blick von oben: eine Reise durch ein Miniaturwunderland, eine Expedition durch eine Gemütlichkeitskulisse.
Der Zugfahrer ist ein Entdecker im Wartestand: jederzeit bereit, das Wunder zu bestaunen, das er erhofft und das sich vielleicht gerade deshalb nie einstellt – und gleichzeitig darauf gefasst, ständig weiterfahren zu müssen.
Tatsächlich findet Willemsen überall Belege für das, was er erwartet. Überall Gleichförmiges, das so gern individuell wäre, lauter Distinktionsbemühungen aus dem Baumarkt, überall Menschen, die sich gern abheben würden von anderen und trotzdem Teil einer Gemeinschaft sein wollen.
Der Mensch, hat Elias Canetti geschrieben, fürchte nichts so sehr wie die Berührung durch Unbekanntes. Trost finde er in der Gemeinschaft, in der Gleichheit mit anderen. Die Berührungsfurcht lähmt, die Erfahrung der Gleichheit macht glücklich.
Lauter Andere und Gleiche: Das ist gut beobachtet. Willemsen weiß natürlich, dass es dieses Deutschland, zu dem er unterwegs ist, nicht gibt. Es kommt also darauf an, eine Pointe zu finden, die den Ton für das Folgende setzt, die ein Phänomen (»alles anders und gleich«) auf einen Begriff bringt, besser noch: auf drei Begriffe, weil sich dann ein hübscher Erwartungsbruch herstellen lässt.
Aber welche?
Glaube, Liebe, Hoffnung, die Trostformel aus dem Korintherbrief? Einander zu ähnlich.
Etwas wie Bauern, Bonzen und Bomben, so heißt ein Roman von Hans Fallada? Schon besser, wenngleich Alliterationen immer schwierig sind.
Die Sorge, die Liebe: Das ist angenehm grundsätzlich und ohne jeden Hochmut, große, einfache Begriffe, Willemsen hat offenbar verstanden, was die Menschen beschäftigt. Und dann, quer dazu, beinahe schroff: die Einzelhaft.
Deutschland, so scheint es ihm, ist ein Land ohne Mitte, es besteht fast ausnahmslos aus Peripherie. Und Geschmack ist am Ende auch nur das Geschick, aus einem Sortiment industriell hergestellter Massenware eine Kombination zusammenzustellen, die Einzigartigkeit behauptet – bunte Glasbausteine oder eben eine gestuft angebrachte Hausnummer. Einem Reisenden, der sich bewegt, muss alles, was er wahrnimmt, notwendig statisch erscheinen.
Garagen, Einfahrten, Glasbausteine: Je näher man dieses Land anschaut, desto ferner blickt es zurück.
Das (vielleicht) schönste Romanende der Welt
»Wie hast du mich«, fragte er, als sie die Lichter des Dorfes zwischen den Stämmen aufblinken sahen, hier eines, da eins – »wie hast du mich unter den Mitgesellen herausgefunden?«
»Ich habe gespürt, daß du Angst hattest«, sagte sie, »Angst um mich: Daran habe ich dich erkannt.«
Während sie auf die Häuser zuschritten, fing es zu schneien an, leicht und in feinen Flocken, wie Mehl, das aus einem großen Sieb auf sie niederfiel.
Otfried Preußler, Krabat
Die Geschichte einer Probe, ganz am Ende dieses seltsamen Buches, einer Probe auf Leben und Tod. Einer jungen Frau werden die Augen verbunden, unter mehreren Müllerburschen soll sie den einen herausfinden, den sie liebt. Hat sie Erfolg, ist er frei, findet sie ihn nicht, müssen beide sterben. Otfried Preußler, dem wir den Räuber Hotzenplotz, den Kleinen Wassermann und die Kleine Hexe verdanken, wusste, dass gerade das Märchenhafte elementar sein muss, wenn es Eindruck machen soll.
Zehn Jahre lang hat Preußler an seinem Krabat geschrieben. Vermutlich dauerte alles auch deshalb so lange, weil so vieles mit hineinsollte: schwarze Magie und Adoleszenz, Konkretes (die Landschaft der Oberlausitz) und Allegorisches (die Verstrickungen seiner Generation in den Nationalsozialismus). Preußler, 1923 geboren, war in der Jungturnerschaft, in der HJ und irgendwann in der NSDAP gewesen, er kam dann an die Ostfront und später in Kriegsgefangenschaft. Das Buch, hat er kurz vor seinem Tod gesagt, sei die »Geschichte aller jungen Leute, die mit der Macht und ihren Verlockungen in Berührung kommen«.
Zehn Jahre Schreibarbeit also. Zehn Jahre lang Selbstbefragung und Zweifel, zehn lange Jahre die allergrößte Sorgfalt für die allereinfachsten Sätze, weil man am besten einfach schreibt, wenn man über etwas so Komplexes wie das Erwachsenwerden berichten will, über die Liebe, über die Freiheit; auch darüber, wie es ist, sich von etwas freizumachen.
Bei Otfried Preußler kann man lernen, welche Symbolkraft die Natur hat. Dass es beispielsweise nicht schadet, wenn es in einer solchen Geschichte ab und an kräftig schneit. Schnee hat etwas Segensreiches und zugleich Bedrohliches. Bei Preußler hoffen die Bauern auf Schnee, weil die Schneedecke die Wintersaaten vor Frost schützt. Andererseits muss jedes Jahr im Winter einer der Müllerburschen sterben, aus Gründen, die zu erklären hier zu weit führt. Wenn der erste Schnee fällt, werden die Gesellen mürrisch und reizbar.
Dem Schnee, vor allem, ist es zu verdanken, dass Preußlers Romanschluss bis heute jedem Leser ans Herz greift. Über den letzten Sätzen liegt ein dunkles Leuchten, ein magisches Zwielicht.
Gleich zweimal setzt Krabat zur entscheidenden Frage an: »Wie hast du mich…« Dazwischen nimmt Preußler sich Zeit für die Annäherung an das Dorf, die ja auch eine Annäherung an eine gemeinsame Zukunft ist. Großartig, wie er damit dann einfach weitermacht, wie er hinter die Lichter, die er gerade eben hat aufblinken lassen, auch noch »hier eines, da eins« schreibt – weil er weiß, dass eine wirklich große Frage Zeit braucht: Wie hast du mich gefunden?
Die Antwort des Mädchens ist ebenso selbstbewusst wie schlicht. Wenn eine Romanfigur sich ihrer Sache so sicher ist, dann muss sich der Leser keine Sorgen machen.
Natürlich kann man versuchen, das alles knapper zu erzählen, ökonomischer:
»Wie hast du mich herausgefunden?«, fragte er.
»Ich habe gespürt, daß du Angst um mich hattest.«
Aber was wäre damit gewonnen?
Schreiben ist Handwerk: das richtige Wort zu finden, den passenden Rhythmus; aus den Wörtern Sätze, aus den Sätzen Absätze, aus den Absätzen eine Welt zu machen. Alles wegzustreichen, was vom Wesentlichen ablenkt. Und all das stehen zu lassen, was überflüssig erscheint und trotzdem zwingend notwendig ist. Hier eines, da eins.
Und dann, während die beiden noch laufen (aus einem Er und einem Sie ist wie nebenbei ein sie geworden), fängt es zu schneien an, leicht und in feinen Flocken, »wie Mehl«. Der letzte Schneefall dieser Geschichte und ein letzter Hinweis darauf, dass die Vergangenheit in der Mühle, aus der Krabat gerade glücklich entkommen ist, über allem liegt, was noch kommt.
Ob man das herzergreifend oder kitschig findet, das ist in diesem Fall egal, weil genau dies der perfekte Schluss ist, zart und wie hingetupft, das Ergebnis einer zehnjährigen Schreibfron und einer großen Erleichterung.
2023 wäre Otfried Preußler hundert Jahre alt geworden. Was von ihm bleibt, neben dem Hotzenplotz, neben dem Kleinen Wassermann, neben der Kleinen Hexe? Eines der schönsten Romanenden der Weltliteratur.