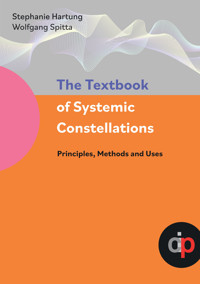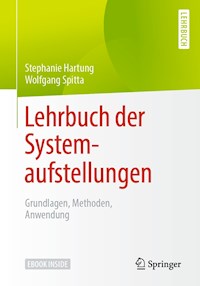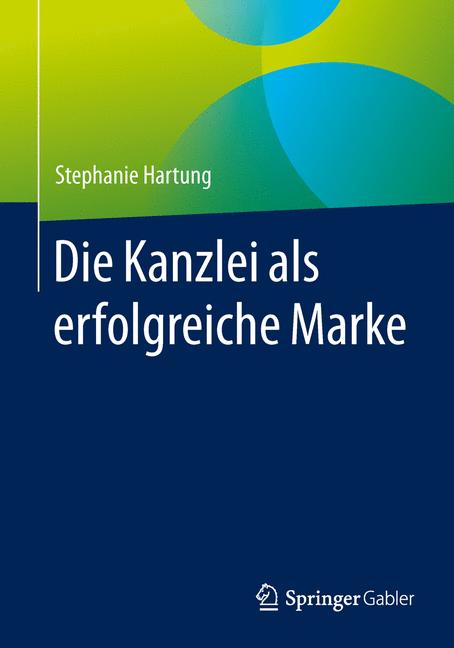29,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Darum geht es im Buch Im ersten Teil widmet sich das Buch einer vertieften Erläuterung der Systemischen Intelligenz und ihrer Bedeutung für ein zeitgemäßes und innovatives Organisationsverständnis. Im zweiten Teil wird dieses Verständnis auf die einzelnen Bereiche der Organisation und ihrer Entwicklung angewendet und dargelegt, welche Verständniskonsequenzen sich daraus für die Führung und Beratung von Organisationen ergeben. Der dritte Teil schließlich führt ein in die Welt der systemischen Methodik für die praktische Gestaltung von Entwicklungs-, Veränderungs- und Innovations-Management und bietet eine große Vielfalt von Ansätzen und Formaten. _________________________________________ What This Book Is About The first part of the book offers an in-depth exploration of Systemic Intelligence and its relevance for a contemporary and innovative understanding of organisations. The second part applies this understanding to the various areas of organisational life and development, outlining the implications it holds for leadership and consultancy. The third part introduces the world of systemic methodology for the practical design of development, change, and innovation management—and presents a wide range of approaches and formats.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 857
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Für Aaron
Jede Organisation entsteht durch Verbindung.
Die Magie der Verbindung
Systemische Intelligenz in der Organisationsentwicklung
STEPHANIE HARTUNG
CI Publisher
ISBN eBook 978-3-911621-04-5
ISBN Print Softcover 978-3-911621-06-9
Verantwortlich im Sinne des § 55 Abs. 2 des Medienstaatsvertrags
Stephanie Hartung, Kamekestraße 12, 50672 Köln, Deutschland
www.feld-institut.de, [email protected]
Coverdesign Katja Anspann
Illustrationen Stephanie Hartung
© 2025 CI Publisher
CI Publisher ist ein Verlagslabel der Constellators International KG
Eingetragen im Handelsregister beim Amtsgericht Köln unter HRA 31237
Anschrift
CI Publisher c/o Constellators International KG
Kamekestraße 12, 50672 Köln, Deutschland
Kontaktadresse nach der EU-Produktsicherheitsverordnung
Urheberrecht
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Für den Inhalt ist der Verlag verantwortlich. Jede Verwertung, die über die gesetzlich zulässigen Grenzen hinausgeht, bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Verlags.
ISBN eBook 978-3-911621-04-5
ISBN Print Softcover 978-3-911621-06-9
Druck und Vertrieb im Auftrag des Verlags:
tredition GmbH, Heinz-Beusen-Stieg 5, 22926 Ahrensburg, Deutschland
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über dnb.dnb.de abrufbar.
Haftungsausschluss
Die in diesem Buch veröffentlichten Hinweise und Übungen wurden von der Autorin und dem Verlag mit größter Sorgfalt erarbeitet und geprüft. Eine Garantie oder Haftung wird jedoch nicht übernommen. Die Anwendung der Übungen erfolgt in eigener Verantwortung.
Inhaltsverzeichnis
Cover
Widmung
Titelblatt
Urheberrechte
Vorwort
Übersicht über die Inhalte
I. DIE WURZEL – SYSTEMISCHE INTELLIGENZ
I.1 Die Wirklichkeit entsteht in Verbindungen
I.1.1 Literaturverzeichnis Kapitel I.1
I.2 Die Organisation als Gestalt
I.2.1 Gestalttheorie und Organisation
I.2.1.1 Die Struktur der Organisation
I.2.1.2 Die Ganzbeschaffenheit der Organisation
1.2.1.3 Das Wesen der Organisation
I.2.2 Wahrnehmungsgesetze und Organisation
I.2.2.1 Gesetz der guten Gestalt und der Prägnanz
I.2.2.2 Gesetz der Nähe
I.2.2.3 Gesetz der Ähnlichkeit
I.2.2.4 Gesetz der Kontinuität
I.2.2.5 Gesetz der fortgesetzt durchgehenden Linie
I.2.2.6 Gesetz der Geschlossenheit
I.2.2.7 Gesetz der gemeinsamen Bewegung
I.2.2.8 Komplexität der Wahrnehmung
I.2.2.9 Erfahrung der Wahrnehmungsgesetze – VTS
I.2.3 Feldtheorie und Organisation
1.2.3.1 Lewins Konzepte für Veränderungsprozesse
I.2.4 Literaturverzeichnis Kapitel I.2
I.3 Die Organisation als System
I.3.1 Systemische Grundfunktionen
I.3.2 Systemordnungen
1.3.2.1 Ordnungen der Liebe
I.3.2.2 Ordnungen der Funktion
I.3.2.2.1 Komplexität
I.3.2.2.2 Gleichgewicht
I.3.2.2.3 Rückkopplung
I.3.2.2.4 Selbstorganisation
I.3.2.3 Ordnungen des Energieflusses
I.3.2.3.1 Sinn
I.3.2.3.2 Zugehörigkeit
I.3.2.3.3 Hierarchie
I.3.2.3.4 Ausgleich
I.3.3 Literaturverzeichnis Kapitel I.3
I.4 Wahrheit und Wahrnehmung
I.4.1 Annehmen, was ist
I.4.2 Drei Ideen zur Wahrheit
I.4.2.1 Die erste Idee über die Wahrheit
I.4.2.1.1 Empirismus
I.4.2.1.2 Rationalismus
I.4.2.2 Die zweite Idee über die Wahrheit
I.4.2.3 Die dritte Idee über die Wahrheit
I.4.3 Wahrnehmung
I.4.3.1 Umfangreiches Wahrnehmungssensorium
I.4.3.2 Sinnliche Wahrnehmung
I.4.3.4 Wahrnehmung mit dem Leib
I.4.3.5 Systemische Wahrnehmung
I.4.4 Phänomenologie und Konstruktivismus
I.4.4.1 Konstruktivismus
I.4.4.2 Phänomenologie
I.4.4.3 Erkenntnis in Organisationen
I.4.4.4 Polare Erkenntnis
I.4.5 Literaturverzeichnis Kapitel I.4
II. DAS WACHSTUM – SYSTEMISCHE BEWEGUNG
II.1 Beschreibungsbereiche in Organisationen
II.1.1 Der Bereich der Identität
II.1.2 Der Bereich der Strategie
II.1.3 Der Bereich der Taktik
II.1.4 Der Bereich der Handlungen
II.1.5 Der Bereich der Angebote
II.1.6 Der Bereich der Organisationsstruktur
II.1.7 Der Bereich der Funktion
II.1.7.1 Person, Rolle, Funktion
II.1.8 Der Bereich der Leistung, Qualifikation und Bildung
II.1.9 Der Bereich der Kultur
II.1.10 Der Bereich des Umfelds und der Stakeholder
II.1.11 Der Bereich der Entwicklungsphasen der Organisation
II.1.12 Literaturverzeichnis Kapitel II.1
II.2 Bilder der Organisation
II.2.1 Die Organisation als Maschine
II.2.2 Die Organisation als Organismus
II.2.3 Die Organisation als Gehirn
II.2.4 Literaturverzeichnis Kapitel II.2
II.3 Paradoxie und Polarität
II.3.1 Paradoxie
II.3.2 Polarität
II.3.2.1 Polarität in der Natur
II.3.2.2 Polarität in der Metaphysik
II.3.2.3 Polaritätsmanagement in Organisationen
II.3.3 Literaturverzeichnis Kapitel II.3
II.4 Organisationsstrukturen und Paradigmen
II.4.1 Die sieben Paradigmen
II.4.2 Das reaktive Paradigma
II.4.3 Das magische Paradigma
II.4.4 Das tribale impulsive Paradigma
II.4.5 Das traditionelle konformistische Paradigma
II.4.6 Das moderne leistungsorientierte Paradigma
II.4.7 Das postmoderne pluralistische Paradigma
II.4.8 Das integrale evolutionäre Paradigma
II.4.9 Entwicklung entlang der Paradigmen
II.4.10 Literaturverzeichnis Kapitel II.4
II.5 Systemische Führung
II.5.1 Führung von und in Organisationen
II.5.1.1 Führung von Organisationen
II.5.1.2 Führung in Organisationen
II.5.2 Klassische Führungsstile
II.5.3 Transaktionale Führung
II.5.4 Transformationale Führung
II.5.5 Agile Führung
II.5.6 Komplexe Systemische Führung
II.5.7 Literaturverzeichnis Kapitel II.5
II.6 Wandel, Transformation und Übergang
II.6.1 Was ist Veränderung?
II.6.1.1 Veränderungen erster und zweiter Ordnung
II.6.1.2 Veränderungen erster, zweiter und dritter Ordnung
II.6.1.3 Vier Arten der Veränderung
II.6.2 Übergang – Wie geschieht Veränderung?
II.6.2.1 Kurt Lewins Change Modell
II.6.2.2 Die psychologische Dimension der Veränderung
II.6.2.3 Von der Zukunft her verändern
II.6.2.4 Das McKinsey 7S Modell
II.6.2.5 Das 8-Stufen Modell von Kotter
II.6.3 Literaturverzeichnis Kapitel II.6
II.7 Systemische Personal- und Teamentwicklung
II.7.1 Die selbstlernende Organisation
II.7.2 Gruppengestalt und Gruppendynamik
II.7.2.1 Das Team als Fraktal der Organisationsgestalt
II.7.2.2 Gruppendynamik und Teamführung
II.7.3 Psychologisches Verständnis
II.7.3.1 Das Bedürfnis, geliebt zu werden
II.7.3.2 Das Bedürfnis, einen guten Platz zu haben
II.7.3.3 Das Bedürfnis, sicher zu sein
II.7.3.4 Drei Machtinstrumente
II.7.3.4.1 Das Machtinstrument der Kontrolle
II.7.3.4.2 Das Machtinstrument des Defizits
II.7.3.4.3 Das Machtinstrument der Zeit
II.7.4 Literaturverzeichnis Kapitel II.7
II.8 Die digitale Organisation
II.8.1 Digitalisierung und KI in der Anwendung
II.8.2 Vertrauen und Miteinander
II.8.2.1 Bildung und KI
II.8.2.2 Kreativität, Originalität und KI
II.8.2.3 Emotionale Intelligenz, soziale Kompetenz und KI
I.8.2.4 Flexibilität, Anpassungsfähigkeit und KI
II.8.2.5 Ethik, moralisches Urteilsvermögen und KI
II.8.2.6 Leibliche Fähigkeiten, sinnliche Wahrnehmung und KI
II.8.3 Literaturverzeichnis Kapitel II.8
II.9 Trauma in der Arbeitswelt
II.9.1 Definition, biologische und soziale Dimensionen
II.9.2 Posttraumatische Belastungsstörungen (PTBS)
II.9.2.1 Posttraumatische Belastungsstörungen beim Einzelnen
II.9.2.1.1 Wiedererleben des Traumas
II.9.2.1.2 Vermeidung und Taubheit
II.9.2.1.3 Negative Gedanken und Stimmungen
II.9.2.1.4 Übererregung und Reizbarkeit (Hyperarousal)
II.9.2.1.5 Erhöhte Aufmerksamkeit (Hypervigilanz)
II.9.2.2 Systemische Dysfunktionen in der Organisation
II.9.2.2.1 Dysfunktionaler Alltag
II.9.2.2.2 Vermeidung und Taubheit
II.9.2.2.3 Negative Stimmungen in der Organisation
II.9.2.2.4 Übererregung, Reizbarkeit, Hypervigilanz, Starre
II.9.2.3 PTSB und Systemische Dysfunktionen
II.9.3 Individuelle Überlebensmuster
II.9.3.1 Muttermangel
II.9.3.2 Mutterbedrohung
II.9.3.3 Mutterbesetzung
II.9.3.4 Muttervergiftung
II.9.3.5 Vaterflucht
II.9.3.6 Vatererror
II.9.3.7 Vatererpressung
II.9.3.8 Vatermissbrauch
II.9.4 Überlebensmuster und systemische Dysfunktion
II.9.5 Literaturverzeichnis Kapitel II.9
III. DIE VIELFALT – SYSTEMISCHE PRAXIS
III.1 Meditation, Achtsamkeit und Bewusstheit
III.2 Systemische Gesprächsführung
III.2.1 Diade und Triade
III.2.2 Papageien
III.2.3 Reframing
III.2.4 Utilisation
III.2.5 Das Ich im Spiegel
III.2.6 Systemische Fragen
III.2.6.1 Zirkuläre Frage
III.2.6.2 Skalierungsfrage
III.2.6.3 Wunderfrage
III.2.6.4 Ressourcen- und Lösungsorientierte Frage
III.2.6.5 Hypothetische Frage
III.2.6.6 Perspektivwechsel
III.2.6.7 Konstruktive Fragen
III.2.7 Absurde Interventionen
III.2.8 Zusammenfassung Systemische Gesprächsführung
III.2.9 Interview Formate
III.3 Präsentische Arbeit
III.3.1 Das Ziel einer Aufstellung
III.3.2 Das ist eine Aufstellung
III.3.3 Aufstellungsarbeit ist praktizierte Meta-Wissenschaft
III.3.4 Dimensionen der Aufstellung
III.3.4.1 Der Fokus der Aufstellung
III.3.4.1.1 Erkundungs- und analysefokussierte Aufstellung
III.3.4.1.2 Lösungsfokussierte Aufstellung
III.3.4.1.3 Zielaufstellung
III.3.4.1.4 Simulierende/Szenario-Aufstellung
III.3.4.2 Aufstellungstypen
III.3.4.2.1 Systemaufstellung, Organisationsaufstellung
III.3.4.2.2 Symptomaufstellung, Phänomen-Aufstellung
III.3.4.2.3 Werte-, Prioritätenaufstellung
III.3.4.2.4 Aufstellung der Überzeugungen
III.3.4.2.5 Problemaufstellung
III.3.4.2.6 Tetralemma Aufstellung
III.3.4.2.7 Polaritäten-Aufstellung
III.3.4.2.8 Besondere Vorgehensweise: Verdeckte Aufstellung
III.3.4.3 Grundmodelle der Aufstellung
III.3.4.3.1 Grundmodell 1 – Ich und Du
III.3.4.3.2 Grundmodell 2 – Wir
III.4 Gruppenformate
III.4.1 World Café
III.4.2 Open Space Technology (OST)
III.4.3 Fishbowl
III.4.4 Appreciative Inquiry (AI), wertschätzende Erkundung
III.4.5 Zukunftswerkstatt
III.4.6 Design Thinking
III.4.7 Peer Coaching
III.5 Die Organisation als autonome Entität
III.5.1 Identität – Essenz, Persönlichkeit, Ausdruck
III.5.1.1. Die Essenz der Organisation
III.5.1.2 Die sozio-kulturelle Identität der Organisation
III.5.1.2.1 Time Line
III.5.1.2.2. Johari Fenster
III.5.1.2.3 Big Five Modell
III.5.1.2.4 Competing Values Framework (CVF)
III.5.1.2.5 Organizational Culture Assessment Instrument
III.5.1.2.6 Cultural Dimensions Theory
III.5.1.2.7 McKinsey 7S Modell
III.5.1.3 Essenz und Identität in Einem
III.5.1.4 Die Organisationsmarke
III.6 Systemische Ordnungsprinzipien in der Praxis
III.6.1 Ordnungen der Funktion
III.6.1.1 Gleichgewicht und seine Aspekte
III.6.1.1.1 Gleichgewicht und Polaritäten
III.6.1.1.2 Gleichgewicht und seine Teilziele
III.6.1.2 Selbstorganisation und ihre Aspekte
III.7 Polaritätsmanagement in der Praxis
III.8 Veränderungsmanagement in der Praxis
III.8.1 Um welche Art der Veränderung handelt es sich?
III.8.1.1 Das SCORE Modell in der präsentischen Arbeit
III.8.2 Wie soll der Veränderungsprozess gestaltet werden?
III.8.3 Der Theory U Prozess
III.9 Führung in der Praxis
III.9.1 Persönliche Wahrnehmung und Selbstkonzepte
III.9.2 Jenseits heroischer Führung
III.9.3 Shared Leadership in selbstlernenden Organisationen
III.10 Teamentwicklung in der Praxis
III.10.1 Rolle und Funktion des Teams
III.10.2 Zusammenarbeit
III.10.3 Teamführung
III.11 Systemische Dysfunktionen in der Praxis
III.11.1 Das Trauma der Organisation
III.11.2 Mit dem Anliegen arbeiten
II.11.2.1 Die Arbeit mit dem Anliegen
II.11.2.2 Arbeit mit den Worten des Anliegens
III.11.3 Das starke Organisations-Selbst
III.12 Literaturverzeichnis Buchteil III
IV. ANHANG
IV.1 Der wissenschaftliche Charakter von Aufstellungsarbeit
IV.2 Epilog
IV.3 Danke
IV.4 Über Stephanie Hartung
Die Magie der Verbindung
Cover
Widmung
Titelblatt
Urheberrechte
Vorwort
IV. ANHANG
Die Magie der Verbindung
Cover
I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
Vorwort
Vom Moment der Entstehung einer Organisation beginnt ihre Entwicklung. Wie entsteht eine Organisation und was genau ist eine Organisation? Sie entsteht durch Verbindung. Jedes gemeinsame Tun erfordert eine spezifische Form von Organisation. Es beginnt in der kleinsten Einheit von Miteinander – kannst Du mir mal tragen helfen? –, und es erstreckt sich über verschiedenste Strukturen, die wir brauchen, um unsere Ziele gemeinsam zu erreichen. Allein könnten wir sie nicht erreichen. Wir müssen uns mit anderen verbinden und gemeinsam auf unser Ziel ausrichten. So gesehen verbringen wir mehr als 99 Prozent unserer wachen Lebenszeit in Organisationen, welcher Art auch immer diese sein mögen.
Die Strukturen für unsere Zusammenarbeit sind nicht gegeben. Sie sind von uns gemacht, und sie werden von uns verändert, verbessert oder angepasst, manchmal auch verschlechtert.
Stimmt es, dass wir die Organisationen machen und entwickeln, oder machen und entwickeln Organisationen sich aus sich selbst heraus, während wir alles dafür tun, damit sie das können – im Rahmen unserer Möglichkeiten und in bester Absicht? Stehen wir im Dienst des Größeren, und wenn ja, was wäre dann dieses Größere? Wir können die Frage vielleicht nicht beantworten. Zugleich lohnt eine nähere Betrachtung, und was das Ergebnis meiner Betrachtungen ist, finden Sie hier im Buch.
Die Emergenz, das automatische Entstehen von Strukturen für die Zusammenarbeit ist jedenfalls ein offensichtliches, ein systemisches Prinzip der Natur. Organismen, die einzeln, für sich, nicht viel oder eigentlich sogar nichts schaffen würden, sind andauernd damit befasst, etwas Größeres entstehen zu lassen. Das gilt für Ameisen wie für Menschen. Es gilt für alle Organismen. Gemeinsam erschaffen sie etwas, was für sie allein undenkbar wäre. Von diesem Gemeinsamen scheinen sie, scheinen wir getrieben. Wir wollen uns verbinden um etwas Größeres zu erschaffen. Und wir sind zugleich untrennbarer Teil dieses Größeren, unser Sein ist ein ewiges Werden in einer ewigen Symbiogenese mit allem Seienden.
Wenn ich hier ein Buch über systemische Intelligenz in Organisationen schreibe, dann schreibe ich also in gewisser Form ein Buch über unsere Verbindungen. Ich schreibe ein Buch über Emergenz und über unser zielorientiertes Miteinander inklusive der Möglichkeiten, die sich uns unter Berücksichtigung systemischer Ordnungen dabei bieten. In der kreativen Gestaltung dieses auf ein Ziel ausgerichteten Miteinanders sind wir als Mensch das Zentrum. Wir sind die, die erschaffen, und wir werden damit zu Dienern dessen, was wir erschaffen – autonome Entitäten, die ihre eigene Gesetzmäßigkeit offenbaren und Entsprechendes von uns einfordern. Dieses Prinzip der Gleichzeitigkeit von uns als Erschaffende und Diener gilt für alle Organisationen. Sie alle unterliegen Grundprinzipien, systemischen Ordnungen, die für ein erfolgreiches Funktionieren gekannt, beachtet und beherrscht sein wollen – Aspekte, die ich in diesem Buch behandeln und ausloten werde.
Die Grundprinzipien, denen Organisationen als Entitäten unterliegen, sind in der systemischen Intelligenz zusammengefasst. Der Terminus der systemischen Intelligenz stammt von meinem niederländischen Kollegen Paul Zonneveld, und ich habe ihn dankbar für meine Arbeit übernommen.
Die systemische Intelligenz konzentriert sich auf die Kunst der organisationalen Verbindung. Ich bin davon überzeugt, dass allein sie ein unverzichtbarer Begleiter für die Organisationsentwicklung ist, um den heutigen Herausforderungen gerecht zu werden. Ohne die systemische Meisterschaft in organisationaler Verbindung und Verbundenheit wird ein Fortbestehen kaum gelingen. Aus meinen eigenen Erfahrungen und den Berichten von Führungskräften wie auch Beraterkolleggen schließe ich, dass die allgemeine und spezifische Dysfunktionalität aufgrund schwacher und gestörter Verbindungen in Organisationen einen Grad erreicht hat, der nach einer grundlegenden Wendung fragt. Die Wendung besteht im Wesentlichen in der Wiederherstellung und Stärkung der Verbindungen.
Verbindung ist die Grundvoraussetzung für Entwicklung.-Leben ist Verbindung und Verbindung ist Leben. Wo immer Verbindungen gestört, verletzt oder gar getrennt werden, drohen systemische Dysfunktionen, die zu Problemen und Krankheiten führen können, letztendlich sogar zum (System-)Tod.
Wenn wir auch als vereinzelte Körper erscheinen (zumindest erleben wir uns als abgetrennt), so sind wir letztendlich doch alle eine vereinzelte Manifestation derselben Energie. Wir alle sind verschiedene Ausdrücke einer gemeinsamen Substanz, die in verschiedenen Konzentrationen oder Zuständen auftritt. Wir alle sind verschiedene Ausdrücke desselben.
Wenn es uns nicht gelingt, die Verbindungen zu uns und zwischen uns – innerhalb unserer Systeme und zu den jeweiligen Umfeldern – zu gestalten und in Verbundenheit zu agieren, dann gelingt unser Leben nicht, und dann gelingen unsere Organisationen nicht, das ist allenthalben bereits überall sichtbar. Ohne ein verbindungszentriertes, systemisches und zugleich spirituelles Verständnis offenbart sich daher jede Idee von Organisationsentwicklung als geist- und herzlos. Es führt zu dysfunktionalen Strukturen beim Einzelnen, in der Gruppe, in Organisationen und auf kollektiver Ebene. Die Interdependenz ist angesichts der Komplexität maximal und vervielfacht dadurch die systemische Dysfunktionalität.
Im Dienst der Verbindungen habe ich bestehende Konzepte, Modelle und Formate einer systemischen Prüfung unterzogen und sie für die ganzheitliche Arbeit neu justiert. Ihre Intelligenz haben meine Arbeit bereichert, ihre Kombination mit systemischer Methodik war für mich ein Abenteuer.
In meinem Buch geleite ich Sie durch die mannigfaltigen Felder dieser Aspekte sowie der systemischen Intelligenz und ihrer Anwendungsvielfalt, für die systemische Experten gefragt sind, seien sie in der Führung in Organisationen oder Berater für Organisationsentwicklung. Gefragt sind Verbindungsmeister, die unbedingt über den Rand des üblichen Alltags hinaus in neue Bereiche aufbrechen möchten. Herausgefordert sind Menschen, die zum Kern des Eigentlichen zurückkehren möchten – in aller Tiefe und Weite, postrational und multidimensional. Für sie habe ich dieses Buch geschrieben.
Stephanie, Frühjahr 2025
Übersicht über die Inhalte
Das Buch ist in drei Themenbereiche gegliedert. Ein schrittweises Lernen beim Lesen verstehe ich wie ein fließendes Hinabsteigen einer Treppe – von der obersten Stufe, der mentalen Quelle, aus der alles sprudelt und sich ergießen will, über grundlegende Haltungen, weiter über die Bewegung bis zur untersten Stufe der blühenden Vielfalt, in ein weites Tal neuer systemischer Denkweisen, Fähigkeiten, Möglichkeiten und Anwendungen. Auf den einzelnen Stufen werden Sie immer wieder auf bereits bekannte Themen treffen, die wiederaufgenommen erweitertet und vertieft werden, um sie auch persönlich erfahrbar zu machen. Daraus ergibt sich ein verwobenes Geflecht aus theoretischem Input, praktischen Übungen und Anleitungen sowie Beispielen aus der Praxis. Das sind meine drei Themenbereiche im Detail
I. Die Quelle – Systemische Intelligenz
• Wirklichkeit entsteht in Verbindungen
• Jenseits der Ratio
• Organisation als Gestalt und offenes System
• Ordnungen der Funktion und des Energieflusses
• Wahrnehmung und Wahrheit
II. Das Wachstum – Systemische Bewegung
• Beschreibungsebenen der Organisation
• Bilder der Organisation
• Polarität in der Organisation
• Organisationsstrukturen und Paradigmen
• Systemische Führung
• Team und Entwicklung
• Veränderung und Transformation
• Digitalisierung und KI
• Trauma in der Arbeitswelt
III. Die Vielfalt – Systemische Praxis
Im dritten Teil des Buches finden Sie neben einer Einführung in die meditative Praxis und die systemische Gesprächsführung eine Übersicht über Grundformen und Formate der präsentischen Arbeit sowie über Formate für die Gruppenarbeit. Für die Entwicklungsarbeit in Organisationen finden Sie außerdem nach einer Einführung in systemische Grundlagen für die Praxis zahlreiche Anregungen für Praxisformate in diesen Bereichen:
• Die Organisation als autonome Einheit
• Systemische Ordnungsprinzipien
• Polaritätsmanagement
• Veränderungsmanagement
• Führung
• Teamentwicklung
• Systemische Dysfunktionen
Abb.1 Die Teile des Buchs
IV. Anhang
Im Anhang finden Sie meine Gedanken zum wissenschaftlichen Charakter der Aufstellungsarbeit, meinen abschließenden Gedanken im Epilog, ein Dankeschön an meine Unterstützer und Begleiter, und schließlich einige Informationen zu meiner Person.
I. DIE WURZEL – SYSTEMISCHE INTELLIGENZ
In diesem ersten Teil stelle ich Ihnen die systemische Intelligenz als Grundlage für die systemische Organisationsentwicklung vor und kombiniere sie mit praktischen Übungsformaten, die es Ihnen erlauben, die Dimensionen der systemischen Intelligenz selbst zu erfahren.
I.1 Die Wirklichkeit entsteht in Verbindungen
Bei der systemischen Arbeit mit Organisationen gibt es zwei zentrale Aspekte, die weitreichende Dimensionen und Auswirkungen haben. Der erste Aspekt besagt: Wo es ein System gibt, ist auch eine Umwelt. Das gilt nicht nur für die Organisation in ihrem lokalen oder Markt-Umfeld. Systemisch betrachtet ist z.B. aus der Sicht der Organisation auch das Personal sein Umfeld. Ich werde auf die System-Umfeld Unterscheidung weiter unten im Themenbereich der Systemischen Organisationsentwicklung vertieft eingehen.
Hier möchte ich zunächst den zweiten Aspekt ansprechen – die Wirklichkeitsentstehung in Organisationen. Für die systemische Betrachtung von Organisationen ist entscheidend zu verstehen, dass in Systemen alles direkt und/oder indirekt miteinander verbunden ist. Dadurch beeinflusst alles einander auf komplexe Weise. Organisationen sind daher multidimensionale Systeme. Die Interdependenz ist maximal.
Verbindungen sind magisch. Alles entsteht aus Verbindungen. Alles entwickelt sich in Verbindungen. Alles entfaltet sich in einer Kultur der Verbundenheit. Eine systemische Sicht betrachtet daher die Magie der Verbindungen einer Organisation. Die zugrundeliegende Haltung bei dieser Betrachtung ist dementsprechend eine systemische Haltung der Verbundenheit. Sie fokussiert einerseits auf die Verbindung mit uns selbst. Andererseits sagt sie mit Blick auf das Umfeld: Wir gehören zusammen. Zusammen bilden wir Eins – wir sind eine Einheit. Aus der Fokussierung auf die Verbindungen und der Haltung der Verbundenheit leiten sich das systemische Denken und Handeln ab.
Was hier zunächst einfach klingen mag, entpuppt sich bei näherem Hinsehen als eine wirkliche Herausforderung, für die unser rationaler Verstand nicht wirklich gewappnet zu sein scheint – in der Regel jedenfalls und auch nach aktuellem Evolutionsstand. Die meisten von uns sind nicht darin geübt, in Verbindungen zu denken. Eine zentrale Aufgabe unseres Denkens ist die Unterscheidung. Unterscheiden bedeutet trennen. Unser Denken trennt gemeinhin das Eine vom Anderen, es unterscheidet: „das ist so, und das ist nicht so. Also ist es anders“. Denken ist Unterscheiden. Denken ist Trennen.
Vielleicht ist das der Grund dafür, dass Konzepte, die sich Aspekten der Verbindung widmen, als spirituell oder sogar esoterisch abgetan werden. Tatsache ist: Verbindungen sind Fakten, unumstößlich. Ohne Symbiogenese wären wir ein Nichts – im biologischen, im sozialen und im kulturellen Sinn. Allerdings denken wir zweidimensional, von wenn nach dann, konsekutiv, analytisch, linear logisch. Das ist tatsächlich eine der ersten Bewegungen des Verstands. Wenn Sie neben dem Ohr eines Babys mit dem Finger schnippen, dreht es sich sofort in dessen Richtung – es will wissen, woher das Geräusch kommt. Wenn ich schnipp höre, muss es eine Quelle für das Geräusch geben, das ist frühe, erste Logik. Das Unterscheiden, das Denken in Folgerichtigkeit, das Analysieren – all das sind Grundtätigkeiten unseres Denkens als Voraussetzung für Analyse, Klassifikation, Erkenntnis und Entscheidung. Es fußt auf unseren Bewertungen (Kategorisierungen) und Beurteilungen und mündet wiederum in diesen. Diese großartige Fähigkeit zu unterscheiden sichert unser Überleben.
Stellen Sie sich vor, Sie sehen im Wald zwei wolfsähnliche Tiere, einen Wolf und einen Hund. Sie erinnern sich daran, dass der Wolf ein wildes Tier und der Hund ein domestiziertes Tier ist. Aufgrund dieser Kategorisierung können Sie erkennen, welches Tier für Sie potenziell gefährlich und welches Tier wahrscheinlich eher ungefährlich ist. Ein Hund ist kein Wolf, und ein Wolf kein Hund. Die Erkenntnis des Unterschieds der beiden Tiere darf natürlich nicht so lange dauern, wie es vermutlich braucht, diesen Abschnitt zu lesen. Andernfalls wäre Ihre Fähigkeit zur Unterscheidung in diesem Fall nutzlos. Das Wolfsbeispiel macht aber sicher verständlich, wie überlebenswichtig unsere Fähigkeit zu unterscheiden sein kann.
Abb. I.1.1 Wolf und Hund (nach NABU, Naturschutzbund
Mit unserer Unterscheidung machen wir die Welt für uns sicherer. Das ist der Sinn der Unterscheidung. Wir versuchen beim Denken, die Komplexität der Wirklichkeit nicht nur zu reduzieren, sondern sie durch Trennung aufzulösen. Wir trennen die komplexen multidimensionalen Verbindungen der Wirklichkeit zugunsten einer schnelleren Entscheidungsfindung. Wie beschrieben, ist das perfekt für „Wolfssituationen“, und auch mit Blick auf Zeitersparnis ist das oft hilfreich. Ob wir mit unserer Entscheidung einen Schritt getan haben, der für unser Handeln in der Organisation förderlich ist, sei dahingestellt. Der israelisch-amerikanische Psychologe Daniel Kahnemann hat uns eindrücklich vor Augen geführt, in wie viele Fallen wir bei unserem schnellen Denken tappen können. Für seine Erkenntnisse über unser Denken wurde ihm 2002 der Nobelpreis verliehen. (Kahnemann).
Unsere vereinfachte Erkenntnis gilt dem abgetrennten Einzelnen. Wir identifizieren einzelne Aspekte und unterscheiden sie voneinander. Wir unterscheiden das Eine und das Andere, bewerten beide separat in ihrem von uns so gedachten Abgetrennt-Sein und treffen eine Entscheidung. Wir schließen eine der beiden Möglichkeiten aus: Das Eine ja, das Andere nein. Das ist hilfreich für unseren Alltag, insbesondere wenn wir unwichtige Entscheidungen ohne weitreichende Folgen treffen müssen – Ich glaube ich nehme lieber das rote Kleid!
Unsere Unterscheidung führt uns möglicherweise zu der irrigen Annahme, wir könnten eine objektiv richtige Aussage über ein Einzelnes, Abgetrenntes machen. Wir vermuten ein Können, das wir besonders in Organisationen pflegen. Wir glauben, wir könnten objektive Aussagen treffen. Lassen Sie uns mal zu den Fakten zurückkommen, damit wir zur Entscheidung finden.
Die Trennung, oder genauer gesagt, das Abgetrennte, das Absolute ohne jedweden Bezug, genau das ist eine Illusion von großer Tragweite. Wenn wir das Einzelne separat betrachten und analysieren, übersehen wir seine alles entscheidenden Verbindungen, in denen es sich jeweils ändert und von denen andauernd beeinflusst wird. Real sind allein die Verbindungen innerhalb des Umfelds, in dem wir das Einzelne betrachten. Allein sie entscheiden über seine jeweilige Qualität. Ändert sich das Umfeld, dann ändern sich die Verbindungen. Dadurch ändert sich wiederum das Einzelne und mit ihm seine Qualität – was wiederum Einfluss auf das Umfeld hat.
Die Komplexität aller Systeme beschreibt eine wechselseitige Abhängigkeit, sie ist interdependent. Ein erst das, dann das gibt es nicht, alles ist gleichzeitig. Jedes und jeder Einzelne stehen in vielerlei System- und Umfeld-Verbindungen und definieren sich durch diese. Nichts existiert für sich allein, alles steht miteinander in Verbindung. Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich spreche hier nicht von dem vermeintlichen Wert eines Menschen. Den gibt es sowieso nicht. Ich spreche hier von der jeweiligen Bedeutung eines Einzelnen in seinen jeweiligen Verbindungen.
Welche Bedeutung die Interdependenz hat, wurde in zahlreichen Experimenten bestätigt. Ein beeindruckendes Beispiel ist das Stanford Prison Experiment von Philip Zimbardo, das er in den 1970er Jahren durchgeführt und 30 Jahre später in seinem Buch Der Luzifer-Effekt eindrücklich beschrieben hat. (Zimbardo)
„Es klingt nach einem Drehbuch für einen Psychothriller: Der junge, ambitionierte Psychologe Philip Zimbardo will wissen, wie Menschen unter Gefängnis-Bedingungen funktionieren. Er lädt 24 Studenten ein – „aus gutem Hause“, wie er sagt –, sich im Keller der Universität Stanford in zwei Gruppen aufzuteilen: Häftlinge und Wärter. Die einen verschwinden, nur mit einer Nummer und einem weißen Kittel versehen, in eigens gebauten Zellen. Die anderen, mit Schlagstock, Sonnenbrille, Trillerpfeife und Schlüssel ausgestattet, spielen die Wärter. Sinnlose Appelle und Erniedrigungen demonstrieren bald die Macht der Wärter über die Häftlinge. Mittendrin im Experiment: Philip Zimbardo als Gefängniswärter. Nach fünf Tagen entgleist die Situation, als Zimbardos Freundin – ebenfalls Psychologe-Dozentin in Stanford – den Zellentrakt besucht und ihren Freund fassungslos anschreit: ‘Was Du mit diesen Jungs machst, ist schrecklich!’ Daraufhin wird das Experiment abgebrochen. Philip Zimbardo erkennt: „Ich bin der autoritäre, herrische Machtmensch geworden, dem ich mich mein ganzes Leben entgegengestellt, den ich sogar verabscheut habe.“(Deutschlandfunk Kultur)
Vor dem Hintergrund dieser und ähnlicher Erkenntnisse können wir das Verhalten eines Menschen in einer Organisation nicht isoliert betrachten und analysieren. Es scheint angesichts dessen beinahe sinnlos, Mitarbeiter auszutauschen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass sich die neuen wieder funktionsgerecht ins System einfügen und als definierte Funktionsteile desselben Resonanzraums ähnliche oder gar gleiche Symptomatiken aufzeigen. Wir sollten daher verstehen, welche spezifischen Erwartungen mit der Position (Rolle) und mit der Funktion (Aufgabendefinition) verbunden sind. Ebenso sollten wir wissen, in welche Prozesse der Mitarbeiter auf dieser Position beim Ausüben seiner Funktion eingebunden ist, welche Abteilungen dabei eine Rolle spielen, usw.
Die systemische Wirklichkeit ist derart komplex, dass zweidimensionale Rückschlüsse keine Relevanz für die multidimensionale Realität haben. Sie können allerdings phantasierte und bisweilen durchaus gefährliche Ideenwelten erschaffen. Eine andere Wirklichkeit als die systemische gibt es nicht. Ohne die Berücksichtigung der Multidimensionalität der Wirklichkeit sind unsere Rückschlüsse wertlos. Wir sollten daher das Verhalten eines Mitarbeiters als Symptom der aktuellen Gegebenheiten seines Systems verstehen. Unser Verstand ist nicht in der Lage, die so vielfachen wie vielfältigen Verbindungen mitzudenken. Wir brauchen deshalb in Situationen, in denen Analysen und Entscheidungen die Organisation oder die Mitarbeiter beeinflussen können, Methoden, die auf eine einfache, zeit- und kostensparende Art Komplexität abbilden können und weitreichende Erkenntnisse ermöglichen. Die präsentische Arbeit mit (Organisations-)Aufstellungen bietet eine effiziente Methode, um diese notwendige Erkenntnisvielfalt zu gewinnen. Tatsächlich ist die systemische Aufstellungsarbeit die bisher einzige multidimensionale Methode für Erkenntnisgewinn und Transformation.
Zum Einstieg biete ich Ihnen ein einfaches Aufstellungsformat an, das Ihnen helfen kann zu verstehen, wovon ich hier spreche – selbst, wenn Sie noch keine Kenntnisse über Aufstellungen haben. In dem Format erfahren Sie in nur 4 Schritten, wie sehr sich ein Einzelner in seinen jeweiligen Bezügen ändern kann. Sie können die Aufstellung mit Menschen durchführen, entweder online oder in einem Präsenzsetting in Ihrem Raum.
Ich schlage Ihnen vor, zwei Ihrer Mitarbeiter aufzustellen. Aufstellen bedeutet, dass Sie zwei Personen aussuchen, die stellvertretend für Ihre Mitarbeiter agieren. Sie führen die beiden intuitiv an deren Platz. Intuitiv meint hier: Denken Sie nicht darüber nach, wo die Personen nach Ihrer Kenntnis stehen müssten, lassen Sie sich vielmehr von einem inneren Impuls leiten. Am einfachsten geschieht das dadurch, dass Sie sich hinter die Person stellen, sie an den Schultern berühren und warten, bis Ihr innerer Impuls Sie – und dadurch die Person – in Bewegung setzt. Am Platz drehen Sie sie intuitiv in die Richtung, in die sie schauen. Sie dürfen den beiden nicht vorschreiben, ob sie stehen, sitzen oder liegen sollen.
Damit es bei diesem hier vorgestellten Format nicht zu Übergriffen oder Bloßstellungen kommt, empfehle ich Ihnen, die Aufstellung im privaten Kreis mit Freunden zu machen und die Identitäten der Protagonisten nicht preiszugeben. Sagen Sie nicht, für welche Mitarbeiter die Stellvertreter aufgestellt wurden, nennen Sie sie der Einfachheit halber A und B. Meine Grafiken zeigen die Figuren der Stellvertreter aus der Vogelperspektive – Kopf, Schulter und die Füße, die zugleich auch die Blickrichtung anzeigen.
Schritt 1
Denken Sie an zwei Mitarbeiter, die momentan wichtig für Sie sind – A und B. Vergegenwärtigen Sie sich diese beiden in ihren spezifischen Funktionen. Suchen Sie nun drei Stellvertreter für A und B sowie für ein Gegenüber aus. Stellvertreter können reale Menschen oder Figuren sein, die A und B repräsentieren. In der ersten Formation stehen A und B nebeneinander (siehe Abb.I.1.2). In dieser Position stehen sie zunächst als Personen, die sie sind, noch ohne ihre Funktionen im Unternehmen einzunehmen bzw. zu repräsentieren.
Ein dritter Stellvertreter steht A und B gegenüber. Er ist ein externer Betrachter, der die Personen A und B nicht kennt. Er betrachtet A und B und beschreibt, welche Unterschiede er zwischen ihnen wahrnimmt. Dabei soll er zunächst seinen Gesamteindruck beschreiben (zoom-out) und dann auf Details bei seinen Gegenübern fokussieren (zoom-in). Danach richtet er die Aufmerksamkeit auf sich selbst und sagt, was er bei sich selbst wahrnimmt, wenn er erst mit A und dann mit B in Kontakt geht.
In diesem, wie in eigentlich allen Aufstellungsformaten wird ein Aufstellungsleiter benannt, der die einzelnen Stellvertreter reihum befragt – daraus ergibt sich eine 3+1 Gruppe. Wenn Sie nicht über genügend Teilnehmer verfügen, können Sie sich in diesem Format auch ohne Aufstellungsleiter untereinander über Ihre Wahrnehmungen austauschen.
Abb. I.1.2 Unterscheiden
Schritt 2
Nach der ausführlichen Beschreibung des Betrachters (was nehme ich bei A wahr, was bei B, wie unterscheiden sie sich?), stellen sich A und B – nun als Mitarbeiter der Organisation – in Beziehung zueinander: sie stellen sich einander gegenüber und verbinden sich in der gegenseitigen Betrachtung, indem sie einander ansehen (siehe Abb.I.1.3). A sagt zu B: Ich sehe Dich, und ich bin mit Dir in unserer Organisation in der Arbeit verbunden. B sagt zu A denselben Satz. Verändern sich die beiden Vertreter jetzt? Kommen durch die Verbindung neue Aspekte zum Vorschein? Verhalten sie sich anders? Was nimmt der Betrachter jetzt wahr? Was nimmt er bei A und B, und was nimmt er jetzt bei sich selbst wahr?
Abb. I.1.3 Verbinden
Schritt 3
Nachdem der Betrachter beschrieben hat, welche Veränderungen er bei A und B durch deren Verbindung wahrgenommen hat, stellen Sie zwei weitere Stellvertreter auf, die jeweils für ein Kind stehen (Abb.I.1.4). Dabei ist unerheblich, ob es sich um die Kinder von A und B, oder ob es sich um irgendwelche Kinder handelt. Wenn Sie nicht genug Personen haben, suchen Sie Objekte aus, die stellvertretend für die Kinder platziert werden.
Abb.I.1.4 Komplexität
Was hat sich durch das Hinzukommen der beiden Kinder-Stellvertreter geändert, was bei A, was bei B, was an ihrer Verbindung? Lassen Sie den Betrachter beschreiben, was er bei A und B wahrnimmt und wie sich möglicherweise auch seine eigenen Bezüge zu A und B geändert haben.
Schritt 4
Im Anschluss an dieses kleine Experiment reflektieren Sie. A und B waren immer dieselben. Haben sie sich in den jeweiligen Bezügen verändert, und wenn ja, wie? Die Erkenntnis aus diesem kleinen Prozess ist vielleicht banal: Alles ändert sich andauernd in seinen jeweiligen Verbindungen. Obwohl wir das eigentlich wissen, verhalten wir uns bei der Analyse in Organisationen oft so, als könnten wir absolute Erkenntnisse gewinnen – z.B. eben über Mitarbeiter, gerne in Assessmentcentern, die uns Erkenntnisse bzgl. der Kompetenzen eines Menschen bieten sollen. Solche Kompetenzen gibt es zwar, für die Organisation aber ist relevant, ob diese Kompetenzen sich in den spezifischen Verbindungen entfalten, oder ob sie in ihrer Entfaltung gehindert werden. Ausschließlich aus der Qualität der jeweiligen Verbindung ergibt sich eine relative und damit einzig richtige Erkenntnis.
Verstehen Sie diesen Umstand wie den Unterschied zwischen unseren Genen und deren Expression. Die Gene stehen für die Persönlichkeit und die Kompetenzen eines Mitarbeiters, die Genexpression steht für die Entfaltung oder Behinderung eben dieser individuellen Kriterien im Rahmen der Systeme, in die der Mensch eingebunden ist, oder der Umstände, in denen er sich befindet.
Erkennen können wir also nur das Dazwischen, die Qualität der Beziehung, bzw. der Verbindung, die Menschen haben. Das gilt auch für alle strukturellen und sachlichen Aspekte, seien es Abteilungen, Produkte, Preise, Strategien usw. Das Dazwischen, die eigentliche Qualität der Verbindung, gibt dem Einen und dem Anderen (Menschen, Sachen, Aspekten) einen Sinn und definiert sie in dieser speziellen Verbindung als untrennbaren Teil eines Beziehungssystems.
Ohne Verbindung gibt es keine Lebenswirklichkeit. Die Magie der Verbindung ist die Wirklichkeit, denn wirklich ist das, was in der Verbindung entsteht und wirkt. Das gilt im individuellen ebenso wie im personalen und im organisationalen Bereich. In der systemischen Praxis konzentrieren wir uns deshalb auf Verbindungen und arbeiten in einer inneren Haltung der Verbundenheit.
Wo alles verbunden ist, gibt es keinen Anfang und kein Ende. Zu Verbindungen können wir daher keine endgültigen Erkenntnisse gewinnen und entsprechende Aussagen formulieren, von denen wir behaupten könnten, dass sie objektiv, also absolut richtig seien. Denn in der Verbindung ist alles relativ zueinander und ändert sich – abhängig von Betrachtungsstandpunkt und Zeitpunkt – andauernd. Daher ist die andauernde Reflexion das zentrale Instrument in der systemischen Führung. Darüber finden Sie im Kapitel über Systemische Führung vertiefte Betrachtungen.
Wie oben erwähnt, denken wir mit Blick auf die zweidimensionale entweder-oder Trennung gemeinhin auch in wenn-dann Sequenzen. Wir nennen das: Logik. Mit ihrer Hilfe verbinden wir eine Ursache über eine Zeitachse mit einer Wirkung. In multidimensionalen Systemen, in denen direkte und indirekte Verbindungen einander beeinflussen, gibt es keinen Zeitbezug, weil alles gleichzeitig aufeinander wirkt. Die Henne-Ei Linie wird zu einem Ei-Henne-Ei-Henne-usw.-Kreis, der naturgemäß keinen Anfang und als solcher auch kein Ende kennt.
Unser ganzes System scheint darauf ausgerichtet zu sein, Warum-Fragen zu stellen und dafür stimmige Weil-Antworten zu finden. Ob bewusst oder unbewusst scheinen wir davon überzeugt zu sein, dass wir unseres Lebens sicher sein können, wenn wir das, was ist, analysieren und bewerten und daraus unser Denken und Handeln ableiten. Wir glauben, wir hätten die Kontrolle.
Angesichts unseres natürlichen Ringens um Überleben und Selbsterhalt auf möglichst hohem Niveau ist das allzu menschlich. Und biologisch gesehen ist es klug, weil unser Organismus primär auf Überleben fokussiert. Wir haben nur das eine Leben, also ist unser Gehirn so konzipiert, dass es ein Gefühl der Sicherheit über Erinnern, Wiedererkennen und Kontrollieren herstellen kann. Daher ist unser Gehirn andauernd damit beschäftigt, Sicherheit für unseren Selbsterhalt zu gewährleisten. In der Regel beschäftigt es sich dabei beinahe ausschließlich mit sich selbst und verliert den Bezug zu dem was Jetzt ist.
Um bei voller Leistung unseres dauerbeschäftigten Gehirns nicht einen Großteil unserer körpereigenen Glukose zu verbrauchen (bis zu 70%), hat die Biologie eine interessante Energiespar-Konstruktion entwickelt: Unser Gehirn gleicht zunächst ab, ob eine neue Situation wirklich so neu oder nicht vielleicht doch schon aus früheren Erfahrungen bekannt ist. Dieser erste Abgleich geschieht im Gedächtnisfeld, dem sogenannten Hippocampus im limbischen System, der mit der Großhirnrinde (Neokortex) verbunden ist. Das Gedächtnisfeld tendiert dabei zur emotionsgeleiteten Ressourcenschonung – es fühlt sich so an wie xy – indem es sich schnell mit einer Ähnlichkeits-Einsicht zufrieden gibt wie: dann wird es wohl so sein wie xy…. Jetzt muss sich unser Gehirn nur noch auf solche Detailaspekte konzentrieren, die wirklich neu sind. Es braucht so die Leistung nicht weiter hochfahren und kann Ressourcen schonen. Es benötigt dadurch nicht so viel Glukose, nun aber die Hilfe des Neokortex, der für Analyse, Logik und Kontrolle zuständig ist.
Leider jedoch ist unser Kortex nur im Wachzustand wirklich effizient und in dem auch nur, wenn es ein mittleres Maß zwischen Unter- und Überforderung gibt – ein Grund, warum ständig feuernde Belastungsstörungen (z.B. durch Stress bei der Arbeit) ebenso wie das Bore-Out Syndrom (Langeweile bei der Arbeit) bei programmatischer Unterforderung bei uns zu einer Art „Verblödung“ führen können.
Jede neu auftretende Situation wird mit einer in unserem Körper gespeicherten Erinnerung abgeglichen. In den meisten Fällen stellt sich dabei ein uns bekanntes Körpergefühl ein, weil wir das meiste durch unsere „Erfahrungsbrille“ einordnen können. Für uns jedenfalls macht die Einordnung Sinn. Es gab schon mal eine ähnliche Situation, ich kann in etwa einschätzen, was jetzt geschehen wird und weiß, was ich tun sollte. Wir lassen uns unbewusst von uns bekannten Gefühlen leiten und entwickeln Reiz-Reaktionsmuster. Im Lauf der Zeit werden wir zu unseren Mustern. Irgendwie ist es immer dasselbe, schießt es uns durch den Kopf, und komisch, wundern wir uns, warum geraten wir bloß immer wieder in dieselben Situationen, lernen dieselben Typen kennen, und sollen verdammt noch mal immer verantwortlich für all das sein?
Die in unserem Hippocampus gespeicherten Erinnerungen dienen dem Abgleich und dem (Wieder-)Erkennen potenziell kritischer Momente. Die Analyse in unserem Großhirn dient der Einordnung der Situation in die Gefahrenskala, während die Verhaltenskontrolle auf die Gefahrenverhinderung abzielt. Diese Leistungen unseres Systems sind wirklich beeindruckend, sie helfen aber in Bezug auf die verbundene Wirklichkeit nur bedingt weiter, weil sie sich hauptsächlich mit der Vergangenheit befassen und nicht mit dem Jetzt.
Zweidimensionales wenn-dann und warum-deshalb Denken reicht also bei weitem nicht aus, wenn wir uns mit der vieldimensionalen, komplexen Wirklichkeit befassen wollen. Denn diese Wirklichkeit beschreibt – wie der Name schon sagt – das, was wirkt, und das ist immer das, was in einer Verbindung entsteht und sich von Moment zu Moment verändert.
„Die bildgebenden Verfahren der Hirnforschung belegen neuronale Feuerungsmuster im limbischen System 200 Millisekunden nach einem Reiz. Die Leistung des Erfahrungsgedächtnisses besteht darin, dass es auf diesen Reiz hin simultan viele Szenarien produziert, die uns helfen, den Gehalt einer Situation zu erfassen. So wie der Cortex in der Lage ist, bestehende Informationen zu völlig neuen zu verbinden (und nicht nur Gespeichertes abruft), so kann auch das Erfahrungsgedächtnis neuartige, noch nicht erfahrene Szenarien produzieren. Immer wenn wir uns in neuen komplexen Situationen befinden, sind wir auf die Unterstützung unseres Erfahrungsgedächtnisses angewiesen.
Im Unterschied zum Cortex, der eher langsam, sequenziell und im analytischen Modus funktioniert, arbeitet das Erfahrungsgedächtnis schnell, simultan, mit verdichteten Bildern, die auf musterhafte Zusammenhänge abstellen. Während der Cortex Erfahrungen nach der Logik von richtig oder falsch verarbeitet, produziert das Erfahrungsgedächtnis nach der Logik von ‚Mag ich‘ oder ‚Mag ich nicht‘ gemischte Affektlagen, die gleichzeitig jeweils Annäherungs- und Vermeidungsverhalten auslösen … Was lässt sich daraus ableiten für die Förderung von Erkenntnis? Wir können unser Erfahrungsgedächtnis produktiv stellen, wenn wir es mit Bildern und Metaphern füttern.“(Krizanits, S. 39)
Meine Erfahrung ist, dass wir unser Erfahrungsgedächtnis besonders gut mit Aufstellungsarbeit produktiv stellen können, da es für unser Hirn keinen Unterschied macht, ob wir die Erfahrung im realen Leben oder während einer Aufstellung gemacht haben. Aus hirnphysiologischer Perspektive ist eine Erfahrung eine Erfahrung. Die damit verbundenen Gefühle, die sich aus dem Botenstoffcocktail ergeben, der jeweils von unserem Gehirn ausgeschüttet, in unserem Körper verteilt und verstoffwechselt wird, sind so real, wie unser Körper eben sein kann. Wahrscheinlich werden Sie diese Erfahrung auch selbst machen, je öfter Sie mit Aufstellungen arbeiten. Im Kontext der Veränderung in systemischer Organisationsentwicklung spielt diese Form der Sinngebung durch Aufstellungen eine entscheidende Rolle, weil Veränderung ohne Sinn nicht greift.
Wirklichkeit entsteht in der Verbindung oder besser gesagt: durch Kommunikation. Ich habe weiter oben schon erwähnt, dass es sich bei der Kommunikation weniger um einen Akt der Information als vielmehr um einen Prozess des Eins-Werdens handelt. Dabei sind nicht unbedingt Worte im Spiel. Kommunikation gelingt auch ohne Worte, wie in den 1970er Jahren in dem Song Radar Love von der niederländischen Band Golden Earring besungen – sie braucht nur eine entsprechende tiefe Qualität der Verbindung, die anders als in dem Song gemutmaßt, nicht immer gleich die Liebe eines Liebespaars sein muss.
Kommunikation fokussiert auf die Verschmelzung, auf das Neue, das bei der Vereinigung entsteht. Kommunikation bringt (System-)Wirklichkeit hervor. Deshalb hat der Systemtheoretiker Niklas Luhmann gesagt, soziale Systeme bestünden nicht aus Menschen, sondern aus (deren) Kommunikationen. Dementsprechend gleicht die Organisationskultur den Kommunikationsmustern, die durch Wiederholungen entstehen. Die Muster spielen auf allen Ebenen der Organisation eine zentrale Rolle, weil sie das Gerüst ihrer selbstreferenziellen Identität bilden. Ihre Bedeutung zeigt sich in der Organisation in Bereichen wie z.B. Führung, Markenbildung oder Veränderung.
„Ein soziales System kommt zustande, wenn immer ein autopoietischer Kommunikationszusammenhang entsteht und sich durch Einschränkung der geeigneten Kommunikation gegen eine Umwelt abgrenzt. Soziale Systeme bestehen demnach nicht aus Menschen, auch nicht aus Handlungen, sondern aus Kommunikationen.“(Luhmann)
Für die Beschreibung der Systeme lehnte Luhmann den Subjektbegriff ab. Praktisch angewendet hat Luhmanns Betrachtung weitreichende Folgen für das Verständnis von Organisationen. Fritz B. Simon liefert uns in seinem Buch Formen eine etwas ausführlichere Darlegung des Zusammenhangs von System (Organisation), Organismus (Individuum) und Kommunikation.
„21.4 Die unterschiedlichen Definitionen sozialer Systeme beruhen auf der Kopplung unterschiedlicher Einheiten: der Kopplung von Kommunikationen (= Elemente von Kommunikationsmustern) vs. der Kopplung von Organismen (= Komponenten / Mitglieder / Teilnehmer an der Kommunikation).
21.4.1 Variante 1: Bei der Kopplung der konkreten Mitglieder / Teilnehmer eines sozialen Systems sind die Komponenten (Organismen) des Systems konstante Größen, während die Muster der Koordination ihres Verhaltens (und damit der Kommunikation) variabel sind und sich im Laufe der Zeit ändern (können).
21.4.2 Variante 2: Bei der Kopplung von Kommunikationen sind die Elemente des sozialen Systems (Kommunikationen) und die Muster ihrer Kopplungen (= Kommunikationsmuster) konstant, während die Mitglieder/Teilnehmer an der Kommunikation variabel sind und wechseln können (austauschbar sind).
21.7 Soziale Systeme können sich nicht ohne Kommunikation bilden und erhalten, sodass die Definition sozialer Systeme als Kommunikationssysteme die größere Reichweite haben dürfte (da Kommunikationssysteme ohne menschliche Mitglieder möglich sind).
21,8 Funktionen, die das soziale System (=Kommunikationssystem) nicht eigenständig erbringen kann (wahrnehmen und agieren), übernehmen seine Mitglieder, bzw. deren Bewusstsein (= psychische Umwelten des Kommunikationssystems).“(Simon)
In diesem Zitat von Simon klingen verschiedene Themen an. Hier erscheinen sie vielleicht noch theoretisch. Ich werde später erklären, welche praktische Relevanz sie für eine erfolgreiche Organisationsentwicklung haben können.
In den folgenden beiden Kapiteln befasse ich mich mit den Erkenntnissen, die Grundlage für die Systemische Intelligenz sind. Ich lege dar, welche Erkenntnisse sich über die Organisation aus den Erkenntnissen der Gestalttheorie und der Systemtheorie ableiten lassen. Ich erläutere die Organisation als Gestalt und als offenes System und beschreibe in diesem Zusammenhang auch systemische Grundfunktionen und deren Prinzipien.
Im Anschluss „übersetze“ ich diese Konzepte der beiden Metatheorien für die systemische Arbeit in Organisationen. Ich zeige Ihnen, wie sich die Systemordnungen als Ordnungen der Funktion und des Funktionsflusses auf das organisationale Geschehen auswirken.
Zum Abschluss des Grundlagenkomplexes öffne ich in Kapitel I.5 noch einmal den Raum für das Phänomen der systemischen Wahrheit und beschreibe verschiedene Wahrheitsverständnisse im Feld der systemischen Arbeit, wie sie sich aus dem phänomenologischen und dem konstruktivistischen Wahrheitsverständnis ergeben.
I.1.1 Literaturverzeichnis Kapitel I.1
Deutschlandfunk Kultur
Wie man der Manipulierbarkeit entkommt
https://www.deutschlandfunkkultur.de/philip-zimbardo-der-luzifer-effekt-wie-man-der-100.html
Kahnemann
Daniel Kahnemann
Schnelles Denken, langsames Denken
Siedler Verlag, München 2012
Krizanits
Joana Krizanits
Einführung in die Methoden der systemischen Organisationsberatung
Carl-Auer Verlag GmbH, Heidelberg 2013, S. 39
Luhmann
Niklas Luhmann
Ökologische Kommunikation. Kann die moderne Gesellschaft sich auf ökologische Gefährdungen einstellen?
Westdeutscher Verlag, Opladen 1986, S. 269
NABU
Naturschutzbund
https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/saeugetiere/wolf/wis-sen/19347.html
Simon
Fritz B. Simon
Formen: Zur Kopplung von Organismus, Psyche und sozialen Systemen
Carl-Auer Verlag GmbH, Heidelberg 2018
Zimbardo
Philip Zimbardo
Der Luzifer-Effekt:
Spektrum Akademischer Verlag; 2008.
I.2 Die Organisation als Gestalt
In diesem Kapitel stelle ich Ihnen die Organisation als Gestalt, bzw. die Erkenntnisse der Gestalttheorie im Kontext ihrer Bedeutung für Organisationen vor. Sie bilden die Grundlage für unser Verständnis der systemischen Organisationsentwicklung.
I.2.1 Gestalttheorie und Organisation
Die zentrale und richtungsweisende Erkenntnis der Gestalttheorie ergibt sich aus der Definition der Gestalt:
Eine Gestalt entsteht durch die Verbindung einzelner Elemente. Sie ist die magische Emergenz einer Verbindung. Magische Emergenz beschreibt das, was entsteht, wenn sich Elemente verbinden. Als verbundenes Ergebnis ist sie viel mehr und zugleich etwas anderes als die Summe ihrer Elemente. Wir bezeichnen dieses mehr und andere als den übersummativen Charakter der Gestalt, ihr So-Sein weist über die Summe der Elemente hinaus.
Sie ist ein eine autonome Einheit, die wir als solche wahrnehmen. Als Wahrnehmungs-Einheit hat sie eine eigene Struktur, eine Ganzbeschaffenheit – d.h. eine sinnlich wahrnehmbare Qualität – und ein eigenes Wesen. Die spezifische Ausprägung und Kombination dieser Aspekte gibt es so kein zweites Mal. Jede Gestalt ist einmalig. Einmal entstanden, entwickelt sich die Gestalt autopoietisch, d.h., aus sich selbst heraus.
Die Gestalt entsteht in dem Moment, in dem Teile sich zu einem Ganzen fügen oder gefügt werden – Noten zu Melodien, Schrauben und andere Metallteile zu einer Maschine, Wolle und Strickmuster zu einem Pullover, Keilrahmen, Leinwand und Farbe zu einem Bild. Als Gestalt werden auch soziale Konstrukte oder auch funktionalsoziale Konstrukte definiert – Gruppen also, die von Menschen mit einem definierten Ziel formiert werden.
Wenn sich Menschen zusammentun, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen, entsteht eine Gestalt, die etwas anderes und viel mehr ist, als die Summe der Menschen, die sie geschaffen haben. Demnach ist eine Organisation als Gestalt zu verstehen.
Als soziales Konstrukt hat eine Gestalt die verschiedensten Funktionen, d.h., Zwecke, die vom Erhalt der Spezies über Weltrettung bis hin zur Gewinnerzielung reichen. Zur Gruppe der sozialen Konstrukte gehören z.B.
• Familien – als soziale Basis für die Nachwuchssicherung;
• Kegel- und andere Freizeitclubs – die sich der Strukturierung des Vergnügens durch Zugehörigkeits-, Umgangsund Spielregeln widmen;
• Organisationen – zur professionellen Befriedigung gesellschaftlicher Bedürfnisse;
• Politische Parteien – die an der Bildung des politischen Willens des Volkes mitwirken und das Personal für die öffentlichen Ämter stellen;
• Staaten – als Garant für das Funktionieren von Wirtschaft und Gesellschaft, indem sie einen rechtlichen Rahmen in einem definierten Gebiet schaffen und durchsetzen.
Jede Organisation ist eine Gestalt, die von innen und von außen als Wahrnehmungsganzes erkannt wird. Gemäß dem Prinzip der Emergenz entstehen in einer Organisation neue Wirklichkeiten durch das spezifische Zusammenspiel ihrer Elemente. Das Prinzip der Entropie beschreibt im Kontext der Verbindungs- und auch Vereinigungs- oder gar Vermischungsprozesse die Unumkehrbarkeit der Zunahme von Unordnung, die in den emergenten Prozessen entsteht. Kurz gesagt bedeutet das, dass durch eine Verbindung etwas Neues entsteht Emergenz) und dass diese Entstehung immer auch einen Faktor der Unordnung in sich birgt (Entropie), die unumkehrbar ist. Alle Systeme wachsen in drei Dimensionen (Abb.I.2.1), und mit dem Wachstum steigt der Grad der Unordnung innerhalb des Systems und auch in der Verbindung des Systems mit seinen Umfeldern.
Abb. I.2.1 Systemwachstum in drei Dimensionen
Quantitatives Systemwachstum und Entropie
Systeme wachsen erstens quantitativ, sie werden größer und mehr. Sie werden größer und mehr z.B. dadurch, dass die Menge ihrer Elemente zunimmt. In Organisationen kommen z.B. neue Menschen dazu, die Produktionskapazität steigt, oder die Organisation eröffnet neue Standorte. Außerdem nimmt im Laufe der Zeit die Menge der Verbindungen einer Organisation zum Umfeld zu, wodurch z.B. Netzwerke entstehen, die wiederum neue Kooperationen und mit diesen potenziell neue Geschäftsfelder ermöglichen, oder auch das Einflusspotenzial der Organisation steigern. Die Entropiezunahme bei quantitativem Wachstum entsteht in Organisationen z.B. bei Expansion, die es schwieriger macht, Informationen effektiv zu verteilen und Entscheidungen zu koordinieren, was Unordnung und Ineffizienz begünstigen kann.
Qualitatives Systemwachstum und Entropie
Systeme wachsen zweitens qualitativ, sie gewinnen an Qualität und Wert. In Organisationen nimmt z.B. der Grad ihres Bewusstseins zu und mit diesem der Grad ihrer Bewusstheit, nicht zuletzt vor dem Hintergrund ihrer gesammelten Erfahrungen. Im Lauf ihrer Aktivitäten gewinnt eine Organisation immer mehr Fähigkeiten und Fertigkeiten, wodurch auch ihr Wert wächst. Durch die Zunahme der Fähig- und Fertigkeiten gewinnt auch die Qualität der Produkte und Dienstleitungen, deren Wert für das Umfeld ebenfalls steigt und dadurch z.B. den Menschen der Organisation einen höheren Identifikationsgrad bietet – sie sind stolz auf ihre Organisation. Wenn die Qualität der Leistung der Organisation wächst, führt das auch zu einer höheren Komplexität, da neue Technologien, Methoden und Wissen integriert werden müssen.
Die Implementierung und Anpassung an diese neuen Qualitäten erfordern zusätzliche Energie und Ressourcen, was ebenfalls zu einer Zunahme der Entropie führen kann. Wenn z.B. eine Organisation eine neue Software einführt, müssen Mitarbeiter geschult werden, Prozesse neugestaltet werden, und es kann zu anfänglichen Störungen kommen, bis sich die neue Qualität etabliert hat. Mit der Qualitätssteigerung steigt insgesamt auch die Reputation einer Organisation und mit dieser steigt ihr Markenwert. Bei Profitorganisationen mit Shareholderstruktur wächst der Wert außerdem nicht selten dadurch, dass sie die Fähigkeit zu vorstellbaren Narrativen einer erfolgreichen Zukunft haben.
Ausdifferenzierung und Entropie
Systeme steigern drittens den Grad ihrer Ausdifferenzierung. Diese bezieht sich auf die Entwicklung neuer, spezialisierter Untereinheiten oder Strukturen innerhalb eines Systems, die verschiedene Funktionen übernehmen. Diese Differenzierung ist eine Reaktion auf die zunehmende Komplexität des Systems und die Notwendigkeit, spezialisierte Aufgaben effektiver zu bewältigen. Organisation differenzieren sich z.B. dadurch aus, dass sie spezialisierte Abteilungen wie Forschung und Entwicklung, Marketing, Produktion und Personalwesen schaffen, die jeweils spezifische Aufgaben erfüllen. Während diese Differenzierung notwendig sein, um mit der steigenden Komplexität umzugehen, kann sie auch zu einer Fragmentierung führen, bei der die verschiedenen Teile der Organisation weniger miteinander verbunden sind. Das erhöht natürlich die Entropie, da es schwieriger wird, ein kohärentes und abgestimmtes Ganzes aufrechtzuerhalten. Insgesamt erhöht die Ausdifferenzierung also die Komplexität des Systems, schafft aber auch die Möglichkeit für mehr Effizienz und Anpassungsfähigkeit.
Ist die Organisation einmal als einzigartiges und autonomes Konstrukt entstanden, zeigt sie ihre eigene Struktur, ihre Textur und ihr eigenes Wesen, die es so kein zweites Mal gibt. Aufgrund ihrer Eigenständigkeit nimmt sie nun die Menschen, von denen sie geschaffen wurde, in ihren Dienst. Diese setzen sich jetzt dafür ein, die Organisation zu erhalten und sie weiter zu entwickeln. Unabhängig davon, wer eine Organisation einmal gegründet oder im Verlauf maßgeblich zu ihrer Entwicklung beigetragen hat, gilt für alle Menschen in der Organisation das Verdikt ihrer funktionalen Austauschbarkeit.
Abb. I.2.2 Menschen als externe Funktions-Ressource für Organisationen
Wie im Beispiel der Transponierbarkeit einer Melodie müssen die Menschen in der Organisation funktional austauschbar sein. Um der Organisation zu dienen, muss jeder von ihnen eine bestimmte Qualität vorweisen (Fach- und Sozialkompetenz, professionelle Erfahrung, persönliche Reife, u.a.) und in einer definierten Beziehung zu den anderen Menschen stehen (Organigramm und Rollendefinition), mit ihnen nach definierten Vorgaben zusammenarbeiten (Prozessgestaltung) und dabei definierte Aufgaben erfüllen (Funktionsund Stellenbeschreibung). Die Austauschbarkeit der Funktionselemente macht die Menschen zu einer externen Ressource für die Organisation, mithin zum Umfeld der Organisation.
Werden die Funktionsträger ausgetauscht, müssen neu Hinzukommende über sämtliche Aspekte ihrer Funktion informiert werden, damit sie dieser optimal nachkommen können. Wie wichtig dieser Umstand ist, wird in Nachfolgeprozessen in Organisationen deutlich. Wenn nicht klar ist, welche Organisation genau übernommen werden soll, und wie die einzelnen Funktionsbereiche ausgestaltet sein müssen, um dieser speziellen Organisation zu dienen, führt dies mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Schwierigkeiten. Mit der funktionalen Austauschbarkeit wird keinesfalls einer ökonomisch motivierten Austauschbarkeit des Menschen das Wort geredet, obwohl dies leider noch immer in vielen Organisationen als Kultur vorherrscht.
Menschen als solche sind nicht austauschbar. Sie sind in ihrer Einmaligkeit niemals ersetzbar. Allein als Handelnde mit einer Funktion sind sie austauschbar, sie müssen als solche sogar austauschbar sein. Dabei gibt es zugleich eine geschlossene Kreisbeziehung zwischen dem Menschen und der Organisation. Ohne die Menschen gibt es keine Organisation, und ohne die Organisation kann der Mensch nicht kooperativ handeln, sich nicht verwirklichen, sich nicht entfalten. Es gilt daher, eine Passung herzustellen zwischen a.) dem Gründungsanliegen des/der Menschen, b.) dem Gestaltcharakter der Organisation, c.) dem Funktionsaspekt des/der Menschen sowie schließlich d.) dem energetischen Einheitsaspekt von Menschen und Organisation. Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass die Organisation als Sozialkonstrukt deutlich längere Halbwertzeiten hat als Menschen. Auch diesem Aspekt dient das Verdikt der Austauschbarkeit der Funktionsträger. Es muss dafür Sorge getragen