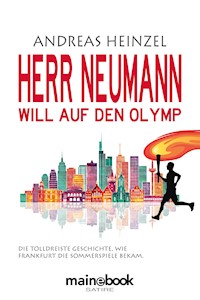Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: mainbook Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Roman, so spannend wie königlich amüsant. Robert ist vom Besuch eines Thronfolgerpaares in Frankfurt so neugierig geworden, dass er im Internet eine Gruppe zur Errichtung einer neuen deutschen Monarchie gründet: die Monarchos. Er ahnt indes nicht, was für eine Welle auf ihn zukommen wird. Eine Welle, die nicht nur ihn und seine Freundin Natalie mit voller Wucht herumwirbelt, sondern in atemberaubendem Tempo gleich das ganze Land. Die Medien machen Jagd auf den Mann hinter den Monarchos, und auch die Regierenden in Berlin kommen an ihm nicht mehr vorbei. Und von ganz rechts erhofft man sich viel mehr als nur einen neuen König ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 361
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Das Buch
Eigentlich war alles Natalies Idee. Hätte sie Robert nicht vom bevorstehenden Staatsbesuch des Thronfolgerpaars erzählt, wäre er nie mit seiner Freundin in die Frankfurter Innenstadt gezogen, hätte nie den triumphalen Empfang der Menge erlebt und nie versucht herauszufinden, ob die Begeisterung der Menschen nicht noch größer gewesen wäre, wenn es sich bei dem jungen Paar um die eigenen Thronfolger gehandelt hätte.
So aber wird Robert neugierig und gründet in einem sozialen Netzwerk die Monarchos: eine Gruppe mit dem Ziel, eine neue deutsche Monarchie zu errichten.
Die Resonanz ist zunächst verhalten. Doch dann wird aus der kleinen Bewegung eine unaufhaltsame Welle: Die Mitgliederzahl der Monarchos wächst mit jedem Tag. Die Medien beginnen sich für Robert zu interessieren, vor allem die Journalistin Sonja Gerber, die hier ihre ganz große Chance wittert. Die Oppositionsparteien versuchen das Thema für sich auszuschlachten. Die Rechten wollen die Monarchiebewegung unterwandern. Bis die Regierung schließlich nicht mehr anders kann, als Nägel mit Köpfen zu machen.
Als dann auch noch Roberts Mutter in das Geschehen eingreift, ändert sich das Leben von Robert und Natalie schlagartig und wird nie mehr, wie es war ...
Der Autor
Andreas Heinzel wurde 1962 in Frankfurt am Main geboren. Er studierte Germanistik, Politikwissenschaften und Geschichte und arbeitet seit Jahrzehnten erfolgreich als Texter und Kreativdirektor für nationale und internationale Werbeagenturen. Daneben ist er immer wieder auch als Sprecher zu hören und veröffentlicht mit „Die Monarchos” nun seinen ersten Roman. Andreas Heinzel hat zwei Kinder und lebt mit seiner Frau in Frankfurt.
Diese Geschichte ist erstunken und erlogen und wurde mit größtmöglicher Nachlässigkeit recherchiert. Sämtliche darin vorkommenden Personen sind frei erfunden, sollten sie dennoch jemandem ähneln, ist das purer Zufall.
Es ist daher vollkommen ausgeschlossen, dass sich diese Geschichte jemals wirklich ereignen wird. Oder vielleicht doch?
ISBN 978-3-946413-28-8Copyright © 2016 mainbook VerlagAlle Rechte vorbehalten
Lektorat: Gerd FischerCovergestaltung: Olaf TischerBildrechte: © Sonya Illustration/ThinkStock
Auf der Verlagshomepage finden Sie weiterespannende Bücher: www.mainbook.de
Andreas Heinzel
Die MONARCHOS
Ein durch und durch royalistischer Roman
Für Sabine, meine Königin.
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Epilog
Dankeschön und Entschuldigung
1
Ganz im Ernst, ich frage mich, worauf ich mich da eingelassen habe. Genauso gut hätte ich heute in aller Ruhe ausschlafen können, stattdessen stehe ich jetzt an einem Absperrgitter in der Taunusanlage und halte ein Fähnchen in die Höhe, das mir vor ein paar Minuten ein freundliches junges Mädchen mit den Worten immer schön schwenken in die Hand gedrückt hat. Neben mir gießt Natalie ihren Freundinnen Betty und Saskia Prosecco in die mitgebrachten Gläser und stößt mit ihnen an. Gestern Abend erst hatte sie mich gefragt, ob ich nicht mit ihnen mitgehen wolle, das sehe man schließlich nicht jeden Tag, so ein Thronfolgerpaar, live, auf unseren Straßen. Eigentlich hatte ich daran kein wirkliches Interesse, doch was soll’s, ich tat ihr den Gefallen, stand in aller Herrgottsfrühe auf und begleitete sie in die Stadt, wo sie sich mit ihren Kolleginnen aus dem Krankenhaus verabredet hat.
Wie es aussieht, warten wir nicht allein. Ums uns herum stehen Tausende gutgelaunter Menschen, die sich bestens amüsieren oder gebannt auf den riesigen Videoscreen starren, der sich an der gleichen Stelle befindet, an der vor gar nicht langer Zeit Globalisierungsgegner kampierten und auf dem nun eine Fahrzeugkolonne zu sehen ist. Eine offene Limousine bewegt sich gemächlich durch die Straßen. In deren Fond ein junges, attraktives Paar, das freundlich lächelnd den Zuschauern am Straßenrand winkt, davor und dahinter geschlossene Limousinen mit offiziellen Vertretern des Staats, des Landes und der Stadt, dazu eine Eskorte Motorräder mit eingeschaltetem Blaulicht.
Über uns schwebt fast bewegungslos ein Hubschrauber in der Luft. Das Dröhnen des Rotors wird von der Musik aus den riesigen Lautsprechern übertönt, die keine hundert Meter von uns an einem Stahlrohrgestänge hängen. Neben mir wippen ein paar junge Mädchen zu den Beats und machen Selfies, zu zweit, zu dritt, alleine oder auch alle zusammen.
Der Tross mit den Fahrzeugen biegt aus der Kennedyallee Richtung Friedensbrücke ein, es dauert also noch ein paar Minuten, bis die jungen Staatsgäste bei uns sind. Auch wenn mir die beiden im Grunde genommen völlig egal sein könnten, hoffe ich, dass der Name der Allee kein böses Omen ist. Diese Menschenmassen, die Begeisterung, das strahlende Wetter – zwangsläufig muss ich an Dallas und an JFK denken. Andererseits, warum sollte etwas passieren? Die beiden sind keine mächtigen Staatschefs, kein POTUS, kein FLOTUS, sondern lediglich das zukünftige Königspaar eines unserer Nachbarländer, beliebt, geliebt, und es gibt wahrhaftig keinen Grund, ein Attentat auf die beiden zu verüben. Andererseits, kein Ort ist frei von Verrückten, auch Frankfurt nicht.
Der aufdringlich fröhliche Moderator eines privaten Radiosenders versucht die Menschenmassen zwischen Mainzer Landstraße und Willy-Brandt-Platz mit flachen Witzen auf die kurzen Augenblicke königlicher Vorbeifahrt einzustimmen. Ein müßiges Unterfangen, bringt sich die Masse doch problemlos selbst in Stimmung, wie bei einem Rockkonzert oder dem Empfang des Fußballweltmeisters.
Bis eben war ich der Überzeugung, dass man weit über siebzig und weiblich sein und samstags die Haare ondulieren lassen muss, um sich für Königshäuser zu begeistern. Tatsächlich stehen um mich herum jedoch die gleichen Hipster, die gestern noch, wie jeden Freitag, auf dem Friedberger Platz gefeiert haben. Dazu Familien mit kleinen Kindern, Geschäftsleute, und ja, natürlich auch die Rentner, mit denen ich gerechnet hatte, doch sind die fast in der Minderheit. Habe ich irgendetwas verpasst? Einen Trend, der an mir vorbei gegangen ist? Würde mich wundern, ich bin Werbetexter, da kriegt man eigentlich alle Zeiterscheinungen mit, ob man will oder nicht.
Je mehr ich mich umsehe, desto mehr erstaunt mich die unfassbare Euphorie der Leute. Schließlich sind es nicht unsere Thronfolger, die da in wenigen Augenblicken um die Ecke biegen werden. Fast könnte man den Eindruck gewinnen, als wolle die Menge sie adoptieren, um ein bisschen an deren Glamour teilzuhaben. Denn mal ehrlich: Diesbezüglich sind uns unsere europäischen Nachbarn ein Stück voraus. Schön, immerhin haben wir einmal ein Kirchenoberhaupt gestellt, aber irgendwie ist das dann doch nicht dasselbe. Ich frage mich, ob Natalie und ihre Freundinnen auch auf den damaligen Papst die Gläser erhoben hätten. Ich hege Zweifel.
Es wird unruhig am Ende der Straße, Jubel brandet auf, Fahnen werden über den Köpfen geschwenkt, dann erscheinen die ersten, in feierlich tiefen Drehzahlen vorbei brummenden Polizeimotorräder. Der Jubel verwandelt sich in Hysterie, als die elegante offene Limousine der Staatsgäste an uns vorbeischwebt, im Heck das junge Paar, das sichtlich beeindruckt ihren frenetisch feiernden Fans auf beiden Seiten der Straße zuwinkt. Seltsamerweise entdecke ich nirgendwo Sicherheitsbeamte an den Absperrungen, in den Fenstern oder auf den Dächern der umliegenden Häuser. Keine humorlosen Agents in Anzügen mit Sonnenbrillen und Ohrstöpseln, die auf alles und jeden achten, nur nicht auf die sie passierende Eskorte. Entweder hat man sie gut getarnt und versteckt, oder die Sicherheitslage ist tatsächlich so entspannt. Der Gedanke, dass jemand dieses friedliche Fest stören könnte, scheint allerdings auch mir mittlerweile recht abwegig. Die Leute in den Wallanlagen sind hemmungslos begeistert, mehr noch, sie sind komplett aus dem Häuschen, schreien und umarmen sich, sobald das Paar vorbeigefahren ist. Ein kollektiver Höhepunkt, der nur wenige Augenblicke anhält, dann ist er auch schon wieder vorbei. Die Welle frenetischen Jubels folgt den Fahrzeugen Richtung Mainufer und hinterlässt eine seltsame, beeindruckend gemeinschaftliche Seligkeit. Kein grimmiger Blick weit und breit, kein Gerempel oder Gemaule, kein ärgerliches Wort, es ist, als habe dieser kurze Moment einen heftigen Ausstoß von Glückshormonen verursacht.
Ich bin noch komplett mitgerissen, als sich Natalie zu mir umdreht und mich darauf hinweist, dass die Show vorüber sei. Die beiden kämen nicht mehr, sagt Natalie lächelnd, und das Fähnchen, das ich nach wie vor schwenke, könne ich getrost wieder runternehmen. Wie es mir denn gefallen habe, will sie wissen. Einzigartig, antworte ich, es sei absolut einzigartig gewesen, und was bloß in die Menschen gefahren sei, diese Begeisterung für zwei Endzwanziger, die weder singen noch schauspielern, noch den Weltfrieden herbeibeten, das sei doch schier unglaublich.
Die zwei sind eben einfach cool, meint Natalie, und darauf wolle sie nochmal anstoßen. Die drei Frauen leeren die Proseccoflasche, trinken, kichern und reden durcheinander. Sie müsse sich nun leider verabschieden, sagt Saskia, kippt ihr Glas in einem Zug und küsst die Wangen ihrer Freundinnen, sie wolle noch etwas in der Stadt besorgen, sonst habe sie nie Zeit dafür, sie wünsche uns anderen aber noch ganz viel Spaß.
Betty und Natalie wollen dagegen das Traumwetter nutzen und sich ans Mainufer legen, um einen Cappuccino zu trinken. Das wird mir allerdings zu spät, da ich noch ein bisschen was arbeiten muss, eine Filmidee, die mein Chef gleich montagmorgens erwartet. Wir stecken unsere Fähnchen in die Rabatten, dann drücke ich Betty, umarme und küsse Natalie und mache mich zu Fuß auf den Weg ins Ostend, in unsere Wohnung.
Im Grunde genommen ist das Wetter viel zu gut, um sich über Werbung Gedanken zu machen, also setze ich mich auf den sonnenbeschienenen Balkon, nehme den Laptop, eine Flasche Wasser sowie ein Salamisandwich mit und lege die Füße auf die Brüstung. Insgeheim ärgert es mich, dass ich jetzt hier sitzen und arbeiten soll, obwohl ich gestern Nachmittag bereits eine Idee hatte, mit der ich eigentlich ganz zufrieden war, die aber an der Chefklippe scheiterte. Genauso gut könnte ich jetzt auch am Main liegen, mich langsam aber sicher betrinken und den Tag genießen, denn das nächste Regengebiet ist sicher bereits im Anzug. Ich könnte aber auch einfach mal schauen, was in der Welt so passiert ist. Also klappe ich den Rechner auf und fahre ihn hoch. Ich habe nicht eine neue Mail, auch irgendwie langweilig, also gehe ich auf die Seite meiner Tageszeitung. Die ganze Welt scheint Pause zu machen, kaum eine der Meldungen, die ich im Schnelldurchlauf von oben nach unten passieren lasse, hätte es an ereignisreicheren Tagen in die Nachrichten geschafft – bis auf eine.
Die Hauptmeldung gleich an oberster Stelle zeigt ein Foto des Prinzen und der Prinzessin, die gut gelaunt aus ihrem Auto winken. Von einem triumphalen Empfang ist in der kurzen Artikelzusammenfassung die Rede, und dass man nicht sicher sei, wer heute mehr Sonne nach Deutschland gebracht habe: Hoch Norbert oder das Lächeln der Prinzessin. Der Artikel selbst beschreibt die Hintergründe des Besuchs und gibt detailliert den bisherigen Ablauf wieder. Die große Begeisterung der Zuschauer an den Straßen erstaunt auch den Verfasser, es sei, als habe das ganze Land unendlich lange auf einen Moment wie diesen gewartet. Offensichtlich bin ich nicht der Einzige, dem das aufgefallen ist.
Da fällt mir ein, dass ich nach der Frankfurter Bürgergruppe schauen wollte, die Natalie gestern erwähnte, als sie mir vom bevorstehenden Staatsbesuch erzählte. Die unzähligen Wimpel an den Straßenlaternen, die kleinen Flaggen, die verteilt wurden, die vielen Helferinnen und Helfer in ihren Prinzenpaar T-Shirts, das alles, erklärte mir Natalie, sei nicht etwa aus öffentlichen Geldern bezahlt worden, sondern durch Hunderte Frankfurter und Frankfurterinnen, die sich in einem sozialen Netzwerk engagiert hätten. Innerhalb weniger Tage hatten sie das Geld für den überschäumenden Empfang eingesammelt und ein ganzes Team an Freiwilligen organisiert. Der Magistrat musste die Vorbereitungen lediglich absegnen.
Ich gebe Frankfurt, Bürger und Prinzenbesuch in die Suchmaschine ein und erziele mehrere tausend Treffer. Einer davon erscheint mir vielversprechend, er verweist auf eine Gruppe namens Frankfurter Adelsfreunde, und ich erinnere mich, dass das genau der Name war, der im Gespräch mit Natalie gefallen war. Ich klicke auf den Link und lande beim sozialen Netzwerk, dessen Mitglied ich seit Jahren bin. Daher brauche ich mich auch nicht einzuloggen, sondern lande direkt auf der Seite der Gruppe.
Die Zahl der Mitglieder ist beeindruckend, es sind über sechstausend. Sie alle fieberten bereits seit Wochen dem Besuch des adligen Paares entgegen und hatten sich zum Ziel gesetzt, den beiden einen unvergesslichen Empfang in Deutschland zu bereiten und zu zeigen, dass unser Land Europas Königshäuser ins Herz geschlossen hat. So jedenfalls steht es in den Informationen zur Gruppe. Die Kommentare der Mitglieder scheinen dies zu bestätigen, jedenfalls lese ich dort Sätze wie Boah, das war so geil eben, oder Die zwei sind ja so süß und Du Schööööööne oder Den Prinz würd ich mir auch klarmachen oder aber Schade, keine richtige Kutsche. Der meistfavorisierte Kommentar jedoch, dem über achtzig Leute den Daumen hoch geben, heißt: Zu schade, dass das nicht unsere sind.
Gute Güte. Das meinen die doch nicht ernst, oder? Die wollen doch nicht tatsächlich wieder? Ich klappe den Laptop zu und beschließe, mich mit Filmideen zu beschäftigen. Ich schließe die Augen, versuche an Orangen, an Süden, Sommer und Sonne zu denken, die elementaren Zutaten, wenn man einen Werbespot für Orangensaft machen will, der die Marktforschung überleben soll. Doch nach ein paar Minuten gebe ich auf, der Kopf ist einfach nicht bei der Sache.
Zu schade, dass das nicht unsere sind. Wäre es nicht ungemein spannend zu erfahren, wer noch alles so denkt? Sicher mehr als achtzig. Das muss sich doch herausfinden lassen. Bestimmt gibt es dazu längst Umfragen, Studien und Untersuchungen, aber das ist mir alles zu umständlich, ich habe keine Lust, den Rest des Tages mit Suchmaschinen zu verbringen. Das geht schließlich viel einfacher, die Adelsfreunde haben es mir gerade vorgemacht: Ich gründe einfach eine Gruppe und lasse mich überraschen, wer sich mir anschließt.
Eine halbe Stunde später ist alles erledigt. In den Informationen zur Gruppe steht zu lesen, dass sie sich für den modernen europäischen Adel begeistere und für die Wiedereinführung der Monarchie auch in Deutschland stark mache. Ich konkretisiere das Ganze noch, indem ich von einer parlamentarischen Monarchie rede, einer Form also, die uns viele unserer europäischen Nachbarn vorleben. Das genügt fürs Erste, finde ich, alles andere wird sich ergeben. Oder auch nicht, vielleicht reagiert ja gar keiner, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Wenn allein ich den Link zu dieser Gruppe empfehle, wissen das schon meine rund dreihundert Kontakte, und natürlich kann sich das potenzieren, sollten auch nur ein paar davon einen Kommentar abgeben oder sonstwie darauf reagieren, wodurch wiederum deren Kontakte von der Existenz der Gruppe erführen.
Ich versuche zu schätzen, mit wie vielen Mitgliedern meine Gruppe rechnen kann. Wenn die Frankfurter Adelsfreunde in wenigen Wochen über sechstausend Mitglieder erreicht haben, sollten mir in einem Monat mindestens genauso viele gelingen. Mir ist klar, dass die Mitgliederzahl schwanken würde, es wird immer wieder auch Austritte von kurzfristig Begeisterten geben. Ich bin dennoch optimistisch und setze mir auf dem Höhepunkt der Popularität eine Zahl von zehntausend Gruppenmitgliedern als Ziel. Wenn ich das erreiche, werde ich Natalie ein königliches Mahl mit allem drum und dran bereiten.
Ich greife zur Wasserflasche und bin stolz auf mich. Das ist mal etwas anderes als Werbung für Fruchtsaft. Und das Beste: Ich bekomme sofort ein Echo, ich kann direkt sehen, ob ich die Leute richtig eingeschätzt habe. Und ich bin mir ganz sicher, dass viele auf die Idee abfahren werden. Eine neue deutsche Monarchie, einfach so, aus einer Laune heraus geboren. Mein Chef würde sagen, das wird ein geiler Case.
Was für ein Oberhaupt hätte ich denn eigentlich gerne? Nur mal angenommen, ich würde das alles ernst meinen. Das mit dem letzten Kaiser lief, wie die Geschichte gezeigt hat, nicht so richtig bombig, außerdem denkt bei Kaiser heute sowieso jeder an Fußball, Kaffee oder Versicherungen, also entscheide ich mich für einen König, von mir aus auch für eine Königin, ich bin da ganz offen. König klingt auch viel bodenständiger, finde ich. Kaiser dagegen hat gleich was von Pomp und Kitsch. König bedeutet Volksnähe und Heimeligkeit. Ja, König ist gut. Ich will einen König haben und basta.
Bleibt der Name der Gruppe. Das sollte kein zu großes Problem darstellen, schließlich ist so etwas Teil meines Jobs. Einerseits muss er gleich deutlich machen, worum es geht, andererseits will ich, dass er weder altbacken noch rückwärtsgewandt klingt, sondern, im Gegenteil, jung, positiv, fortschrittlich, cool, eben genau das, was jeder meiner Kunden für seine Produkte gerne hätte.
Ich schreibe eine Liste möglicher Begriffe herunter. Als letzten Vorschlag füge ich ganz unten Monarchos dazu. Monarchos. Gefällt mir gut. Ich gebe den Namen in die Suchmaschine ein und erfahre, dass ich mir den Namen lediglich mit einem Pferd teilen muss. Das sollte schon passen, also übernehme ich den Begriff für meine Monarchistengruppe und bestätige ihn. Das war’s, meine Gruppe ist im Netz.
Zufrieden beiße ich ins Sandwich. Mehr kann ich für Deutschland im Augenblick nicht tun, also wende ich mich wieder meinen Filmideen zu. Hoffentlich kommt Natalie bald, ich kann kaum erwarten, ihr alles zu erzählen.
Du hast was?, fragt Natalie, als sie spätabends leicht angetrunken und bettschwer nach Hause kommt. Ich habe eine Gruppe zur Wiedereinführung der Monarchie in Deutschland gegründet, antworte ich ihr leicht enttäuscht, da ich mit etwas größerer Begeisterung gerechnet hatte. Ich spinne ja, fährt sie auf dem Weg ins Bad fort, nur weil die Leute auf den Straßen ein bisschen gefeiert hätten? Bis heute Morgen habe mich das Ganze nicht im geringsten interessiert, was ich mir überhaupt davon erwarte, will sie wissen. Das sei ein Versuchsballon, halte ich dagegen, und dass ich es einfach interessant fände, wer sich sowas vorstellen könne, gerade bei der Parteimüdigkeit, von der alle sprechen.
Sie interessiere sich nur noch dafür, ins Bett zu kommen, sie sei hundemüde, schließlich sei sie nachtdienstgeschädigt. Dann drückt sich Natalie im Rahmen der Badezimmertür an mir vorbei und gibt mir einen raschen Kuss. Ich solle ebenfalls ins Bett gehen, sonst sei mit mir morgen früh wieder nichts anzufangen, und die Monarchie könne ich auch morgen noch einführen. Vielleicht hat sie recht, an Arbeit ist heute sowieso nicht mehr zu denken, das muss ich auf morgen verschieben, oder ich gehe Montag einfach früher in die Agentur, unter Zeitdruck arbeite ich erfahrungsgemäß am besten. Ich fahre den Rechner herunter, lasse alles stehen und liegen und schleiche hinter ihr her.
2
Der Sonntag beginnt wie der Samstag mit strahlendem Wetter. Ich setze mich sofort an den Rechner und schaue nach, was aus meiner Gruppe geworden ist. Das Ergebnis ist ernüchternd. Zwar besteht sie neben mir nun aus weiteren fünfzehn Mitgliedern, aber in meinem tiefsten Inneren hatte ich mir nach der Begeisterung des Vortags doch etwas mehr Zulauf erwartet. Auch die Kommentare lassen noch keinen Rückschluss auf die Tragfähigkeit meiner Idee zu, es gibt nämlich noch keine.
Montag sieht es nicht viel besser aus. Nachdem ich in aller Herrgottsfrühe einen abgelehnten Versicherungsfilm für meine Saftzwecke umgemünzt habe, schaue ich auf meine Gruppenstatistik und freue mich verhalten über weitere 42 Mitglieder. Fast komme ich zu der Ansicht, dass ich das Ganze auch hätte lassen können, aber wahrscheinlich muss man den Dingen auch Zeit geben.
Einen Tag später überschreite ich die Hundertermarke, außerdem haben die ersten Besucher Stellung bezogen. Neben ernst gemeinten Zuschriften im Sinne von Finde ich super, hoffentlich habt ihr damit Erfolg gibt es auch einigen Nonsens zu lesen. Ich bin für Elvis als King steht da neben Mega Idee! und Abschaffung aller Steuern! Immerhin, es ist ein Anfang. Und weder wurden Trolle aktiv noch gab es einen Shitstorm, also bin ich erst mal ganz zufrieden.
Natalie interessiert sich nach wie vor nicht für meine Aktivitäten. Sie hält das alles für Quatsch, und wie man dafür überhaupt seine kostbare Zeit opfern könne. Ich solle lieber schauen, wie das bei mir mit Urlaub sei, damit wir endlich ein paar Tage raus kämen. Ich verspreche ihr, mich darum zu kümmern, wahrscheinlich hat sie recht, und in Holland waren wir schon lange nicht mehr. Es ist ja auch so wunderbar unproblematisch, einfach hinfahren und Zelt aufbauen, einen Platz für unser kleines Iglu bekommen wir immer, reservieren muss man nicht einmal in der Hochsaison.
Am nächsten Tag drucke ich als Erstes einen Urlaubsantrag aus, trage die kommenden zwei Wochen darauf ein und rufe Natalie an, damit sie im Bilde ist. Das gehe klar bei ihr, sagt sie, das sei wirklich großartig, und sie freue sich ganz furchtbar. Ich könne ihr noch nichts versprechen, dämpfe ich ihre Begeisterung, aber ich würde jetzt den Antrag einreichen, und wenn er genehmigt werde, könnten wir gleich nächstes Wochenende starten. Sie jubelt am anderen Ende, ich küsse sie durch den Hörer, dann lege ich auf.
Das sei überhaupt kein Problem, sagt mein Kreativdirektor, jeder müsse Urlaub nehmen und passen würde es nie, das sei klar, aber es sei ihm lieber, ich nähme jetzt zwei Wochen am Stück und wäre danach wieder voll einsatzbereit, als dass ich hier und da einen Tag abstottere, mich aber nie richtig erhole, wovon keiner etwas habe, ich nicht und die Agentur auch nicht. Wohin es denn gehe, fragt er, und ich antworte Holland. Ich solle mir aber nicht den Schädel wegkiffen, lacht er und wünscht viel Spaß.
Dass es so leicht werden würde, hätte ich nicht gedacht. Ich verlasse den Raum und schicke Natalie eine Nachricht: Kannst Urlaub einreichen. Kuss, Robert. Wenige Sekunden später erscheinen als Antwort ein fröhlich grinsender Smiley, eine Sonne und eine Palme auf dem Display. Schön, freue ich mich, wäre das auch geklärt.
Der Rest der Woche vergeht wie im Flug. Ich habe viel zu tun und merke gar nicht, wie die Tage verrinnen. Natalie muss noch einmal nachts ran, hat dann aber tagsüber Dienst und ist permanent guter Laune. Was die Vorfreude auf ein paar Tage außerhalb der eigenen vier Wände doch bewirken kann. Wir überlegen kurz, ob wir vielleicht bereits Freitag fahren sollten, entscheiden uns dann aber dagegen, da wir nicht vor dem späten Nachmittag loskämen, und auf den Stau rund um Köln haben wir keine Lust, also verlegen wir unsere Abfahrt auf Samstag.
Kurz nach dem Frühstück ist es soweit, wir werfen jeder eine Reisetasche ins Auto, das Zelt, die Isomatten sowie unsere Schlafsäcke, die sich zu einem verbinden lassen, was mich ganz besonders freut. Es gibt wenig Romantischeres als eine Nacht zu zweit im Zelt. Ich habe allerdings auch keine Probleme mit Ameisen, der Lendenwirbelsäule oder der Bullenhitze kurz nach Sonnenaufgang.
Natalie fährt, ich sitze auf dem Beifahrersitz und presse die Füße auf die Airbagabdeckung. Sollte jetzt ein Crash passieren, würden mir die Kniescheiben vermutlich die Wangenknochen zertrümmern. Als mir das klar wird, ändere ich meine Position und lasse die Beine leicht zur Seite fallen, gerade so, dass Natalie noch schalten kann.
Ob ich mich freue, fragt sie mich von der Seite lächelnd. Sehr, antworte ich und meine es genau, wie ich es sage. Ich kenne mich: Wenn sie mich nicht zu diesem Urlaub gedrängt hätte, hätte ich frühestens im Herbst ein paar Tage Auszeit genommen, aber schon jetzt, kurz vor der holländischen Grenze, merke ich, wie urlaubsreif ich tatsächlich bin.
Willkommen in Holland, begrüße ich uns, als ich das erste Uit Schild sehe. Den Niederlanden, korrigiert mich Natalie, willkommen in den Niederlanden. Das sage doch kein Mensch, behaupte ich. Niemand käme auf die Idee Ohne die Niederlande fahrn wir zur WM zu singen. Oder sich den Fliegenden Niederländer in der Oper anzusehen.
Sie wolle nur korrekt sein, sagt sie, aber von ihr aus dürfe ich gerne weiter Holland sagen. Da könne sie sicher sein, grinse ich und bekomme überdies langsam Hunger. Noch gut zwei Stunden, dann werde ich hoffentlich irgendwo das erste Broodje Frikandel auftreiben. Oder wir gehen zum nächstbesten Chinesen, die sind alle besser als bei uns, erinnere ich mich.
Wir biegen auf den Campingplatz hinter den Dünen ein. Es ist nicht ganz so leer, wie wir es erwartet haben. Eigentlich ist es sogar ziemlich voll, aber da wir keine Lust verspüren, von Platz zu Platz zu fahren, um dann vielleicht doch nichts Besseres vorzufinden, bleiben wir hier. Wir schlendern an Wohnmobilen und Wohnwagen vorbei und stellen fest, dass das klassische Zelt vom Aussterben bedroht ist. Woher haben die Menschen nur das Geld für sechs Meter fahrbares Heim? Ich hätte es nicht und meine Kinderkrankenschwestern-Begleitung schon gar nicht.
An einem unbeparkten Stück Rasen, den uns zwei benachbarte Wohnmobile freundlicherweise übriggelassen haben, bleiben wir stehen. Hier sollte unser Zelt gut hinpassen, und so blockiere ich die kostbare Stelle, während Natalie den Wagen holt.
Wir räumen das Auto leer, und während sie es anschließend umparkt, baue ich das Zelt auf. Meine Eltern hatten nie gezeltet, so gesehen kann ich auf keine diesbezüglichen familiären Erfahrungen zurückgreifen. Dennoch stecke ich die beiden Fiberglas-Stangen ineinander und richte die blaue Kuppel auf, als hätte ich nie etwas anderes getan. Wir legen unsere Schlafsäcke und unsere Taschen hinein, dann kriechen wir ins Innere, um halb im Liegen, halb im Sitzen unser Badezeug anzuziehen. Wenn es nach mir ginge, könnten wir auch gleich hier bleiben, wo wir schon kaum etwas anhaben, aber Natalie will partout noch ins Meer.
Der Weg dorthin ist nicht all zu weit. Wir müssen nur eine Sackgasse Richtung Dünen hinter uns lassen, einen großen Parkplatz queren und die Düne hinauf- und wieder hinunterklettern. Natalie schreit vor Freude, als sie endlich die graublaue Brandung erblickt. Der frischer werdende Wind weht ihr die braunen Strähnen durchs Gesicht, sie lacht und rennt die sandige Piste hinunter zum Strand. Sand spritzt bei jedem ihrer Schritte auf. Während sie bereits ihr Shirt und die kurze Jeans abstreift, schlendere ich gemütlich hinterher und beobachte sie.
Ich bewundere sie, wie sie sich in die garantiert eiskalten Wogen fallen lässt. Ich nehme mir vor, dass ich sie, sobald sich ihre Lippen blau verfärben, aus dem Wasser zitieren werde. Dann ziehe auch ich Hose und Hemd aus und gehe vorsichtig Richtung Meer. Es ist ziemlich windig, sodass die Nachmittagssonne gar nicht mal so warm erscheint, mehr noch, der Wind treibt mir im Handumdrehen eine Gänsehaut auf den Körper. Dennoch will ich nicht als Weichei dastehen und beschleunige mein Tempo. Mit einer mir nicht bekannten Entschlossenheit stürze ich mich in die Fluten, wo ich sofort befürchte, einen Herzstillstand zu bekommen. Ich drehe mich wieder zum Land und rudere mit beiden Armen durchs Wasser, um den rettenden Weg ans wärmende Ufer zu finden, doch habe ich nicht mit Natalie gerechnet, die sich mit ihrem froschnassen Körper an meinen Rücken hängt und mich zur Seite reißt.
Eine Viertelstunde lang schwimmen wir um die Wette, versuchen Kopfstand und tauchen nach Muscheln, bis mich Natalie besorgt ansieht und beschließt, dass ich sofort an Land gehen müsse, da sich meine Lippen bereits blau verfärbt hätten. Solidarisch folgt sie mir, wir kehren zu unseren Klamotten zurück und setzen uns auf ein Handtuch in den Sand.
Ich lege den Arm um sie und will sie wärmen. Dabei beobachten wir erwachsene Männer, die ihre Lenkdrachen am Himmel tanzen und in wilden Umdrehungen über den Köpfen der erschrockenen Strandspaziergänger herabstürzen lassen, um sie in letzter Sekunde nach oben zu reißen, woraufhin sich das Spiel wiederholt. Kitesurfer fegen etwas weiter draußen über die Wellen. Der mittlerweile heftige Wind ist wie für sie gemacht. In halsbrecherischer Geschwindigkeit peitschen sie über das Wasser, lassen sich kurz in die Lüfte tragen, um einen Moment später wieder die Gischt zu berühren und das Rennen fortzusetzen.
Mir ist verdammt kalt, außerdem habe ich nach wie vor Hunger. Ich schlage vor, zum Campingplatz zurückzugehen, zu duschen und dann in der kleinen Stadt ein Schwein zu essen, oder auch zwei. Natalie nickt lächelnd, dann kämpfen wir uns durch den Wind zurück über die Dünen. Selbst die sturmerprobten Einheimischen haben Schwierigkeiten, mit ihren Rädern von der Stelle zu kommen. Mühsam setzen wir einen Schritt vor den anderen und erreichen schließlich das Campingterrain, wo wir gleich in unser Zelt fallen werden, genauer gesagt fallen würden, wenn es denn da wäre, unser Zelt. Aber das ist es nicht. Ungläubig schauen wir auf die Wohnmobile links und rechts von uns. Es besteht kein Zweifel, dass das die Fahrzeuge sind, zwischen denen ich das Zelt errichtet hatte. Mich erfasst eine leichte Panik. Leichtsinnigerweise hatten wir im Innenzelt unsere Papiere, unser Geld und unseren Autoschlüssel gelassen, unsere Handys natürlich auch, also eigentlich alles.
Nachdem wir uns gegenseitig versichert haben, dass dort, wo noch vor einer Dreiviertelstunde unser Zelt stand, tatsächlich kein Zelt steht, bleibt uns nichts anderes übrig, als den Weg zur Rezeption einzuschlagen, wo wir den Diebstahl melden wollen. Als wir schon die Treppe zum Bungalow hinaufsteigen, hält mich Natalie am Arm fest und fragt, ob ich das Zelt eigentlich befestigt hätte. Wie, befestigt, frage ich. Mit Heringen, fährt sie fort, mit Heringen und Leinen. Wenn Natalie so fragt, kennt sie bereits die Antwort, und ich kenne sie auch, nicht erst, als sie auf ein blaues Quadrat in der den Campingplatz umgebenden Hecke zeigt.
Ich sei ein selten großer Held, ein so unglaublich großer Held, das könne wohl nicht wahr sein, schleudert sie mir kopfschüttelnd entgegen, als wir unser Eigentum bergen, das, so rekonstruieren wir, wie ein Heuballen in einem Wildwestfilm quer über den Platz über Stromanschlüsse, Kugelgrills und herumliegendes Spielzeug gepoltert sein musste, bevor es, beim Versuch, in die Stadt zu gelangen, von der Hecke aufgehalten wurde.
Naja, gebe ich zurück, das sei eben passiert, weil sie partout Hals über Kopf zum Meer habe aufbrechen wollen, da sei es doch ganz klar, dass man keinen Gedanken mehr für Heringe und Leinen übrig habe, und überhaupt hätte auch sie daran denken können, hinterher sei man immer schlauer.
Ach, meint sie, jetzt sei wohl sie schuld, das werde ja immer besser, und wenn ich schon so einen Mist bauen würde, solle ich wenigstens meinen Fehler zugeben. Aber Fehler einzugestehen sei eben generell nicht meine Stärke, Schuld hätten immer die anderen.
Darauf erwidere ich nichts mehr, das ist mir zu blöd. Schweigend tragen wir das Zelt an allen vier Ecken über das Gelände und stellen es an den gewohnten Platz, wo ich mich zwecks Beschwerung hineinlege, während Natalie die Stahlheringe und Leinen aus dem Auto holt. Ich bin stocksauer. Auf mich, auf Natalie, auf das alles. So hatte ich mir den ersten Urlaubstag nicht vorgestellt. Und Hunger habe ich immer noch.
Zum Glück beruhigt sich alles schnell wieder, wie immer, wenn wir uns streiten. Das ist das Schöne an Natalie: Sie ist nicht nachtragend, oder zumindest selten. Wenig später gehen wir daher lecker Chinesisch essen, trinken fast zwei Flaschen Wein und weihen spät am Abend unseren gemeinsamen Schlafsack ein. Die nächsten Tage bewegen wir uns nur zwischen Meer, Restaurant und Zelt, und es ist gut, so wie es ist.
Am darauffolgenden Samstag sind wir genau eine Woche auf dem Campingplatz. Eine Woche seit dem Besuch der Thronfolger in Frankfurt, eine Woche seit der Gründung der Monarchos. Natalie hat inzwischen losen Kontakt zu unseren Nachbarn im Wohnmobil geknüpft. Ein freundliches Ehepaar mittleren Alters aus Den Haag, das schon seit Jahren auf diesen Platz kommt und fast fließend Deutsch spricht. Was wir heute vorhätten, wollen die beiden wissen, als wir mit unseren Kaffeetassen vor dem Zelt liegen und frühstücken. Wir antworten, dass wir Amsterdam besuchen wollen, Sightseeing und so. Soso, und so, lachen sie freundlich, aber nicht gleich jeden Coffeeshop aufsuchen. Das hätten wir nicht vor, lachen wir zurück, aber irgendwie scheint Amsterdam ohne Drogenkonsum kaum denkbar, seltsam, das. Nein, nein, sagen wir, vielmehr stehe der Blumenmarkt auf dem Programm, die Grachten natürlich, ansonsten würden wir uns überraschen lassen. Da wünschten sie uns aber ganz viel Spaß, verabschieden sie uns, und wir sollen später berichten.
Die Stadt nimmt uns sofort gefangen. Den ganzen Tag schlendern wir durch die Altstadt und genießen die entspannte Atmosphäre. Oder wir sitzen im Café, lassen das Geschehen um uns herum auf uns wirken und trinken Bier, dessen Schaum mit der Holzkelle abgeschöpft wird. Am Singel erstehen wir einen Sack Blumenzwiebeln, die wir in unsere Balkonkübel einpflanzen wollen, dann biegen wir um die Ecke und erreichen einen riesigen Platz.
Straßenbahnen durchfahren ihn längs und quer. Pantomimen und lebende Statuen versuchen, wie in jeder anderen europäischen Metropole, die Aufmerksamkeit der Passanten zu erregen. Touristen eilen wild gestikulierenden Fremdenführern hinterher, andere sitzen auf der gegenüberliegenden Seite der Straße auf den Stufen eines Obelisken und ruhen sich vom Stadtbummel aus. Wir setzen uns dazu und lassen das Geschehen auf uns wirken.
Es ist der Dam, der zentralste Platz der Stadt, dessen Stirnseite von einem beeindruckenden Gebäude beherrscht wird. Das müsse der Königspalast sein, sagt Natalie, die konzentriert in ihrem Reiseführer blättert. Die königliche Familie halte sich dort aber nur selten auf, eigentlich residiere sie in Den Haag.
Schöne Location, finde ich, ein Platz zum Wohlfühlen. Ich stelle mir gerade lebhaft vor, wie die Amsterdamer ihren Oberhäuptern auf dem Balkon zujubeln, als mir der Besuch der Prinzen in Frankfurt wieder einfällt. Was wohl meine Monarchos-Gruppe macht? Ich könnte mir vorstellen, dass sie langsam auf die tausend Mitglieder zugeht.
Warum sie eigentlich meine Monarchiegruppe so bescheuert fände, frage ich Natalie, die, ohne von ihrem Buch aufzublicken, antwortet, dass das großer Quatsch sei. Das müsse ich doch selbst erkennen. Wieso Quatsch, insistiere ich, es gebe schließlich überall in Europa Demokratien, denen Königsfamilien oder Fürstenhäuser vorstünden, und die seien überaus beliebt.
Ja, deren Adlige hätten aber auch keine Weltkriege angezettelt, und das sei nun mal ein großer Unterschied, das müsse wohl selbst ich zugeben. Und überhaupt ginge das bei uns doch überhaupt nicht, da sei schon das Grundgesetz vor. Das man aber ändern könne, entgegne ich, denn so leicht räume ich nicht das Feld, das sei alles eine Frage der Mehrheiten in den jeweiligen Kammern. Ich solle weiter träumen, beendet Natalie die Diskussion, und ob wir langsam weitergehen wollen, ihr werde etwas frisch.
Als wir wieder auf unserem Campingplatz eintreffen, sitzen unsere neuen Freunde vor ihrem Camper und begrüßen uns schon von weitem, fragen, wie es gewesen sei. Wir berichten von unserem Tag und von unserer Begeisterung für ihre großartige Hauptstadt. Wir erzählen, was wir gesehen haben, wo wir entlanggelaufen und wo wir eingekehrt sind. Der Dam, sagen wir, sei der Knaller, ein toller, ein unglaublich lebendiger Platz. Mit einem großartigen Palast, sage ich. Und ob es nicht ein seltsames Gefühl sei, zu wissen, dass dort oben, nur ein paar Meter entfernt, ihr König lebe.
Er lebe dort doch nicht, lachen die zwei, aber ab und zu sei er anwesend, das stimme schon. Aber nein, sagen sie, daran denke hier niemand, man frage sich ja auch nicht, ob der eigene Nachbar zu Hause sei. Wenn er da sei, sei es gut, wenn nicht, dann auch. Doch wenn die Nachrichten recht behielten, könne man auch bei uns in Deutschland sicher bald wieder schauen, ob der König zu Hause sei, sagt unser Nachbar und schwenkt die Zeitung in seiner Hand. Welche Nachrichten, frage ich und erfahre, dass in Deutschland gerade eine Monarchie-Diskussion geführt werde, die scheinbar durch das Internet ausgelöst worden sei. Haha, sagt er, das sei wohl das, wie sage man bei uns in Deutschland – Sommerloch?
Ob ich mal kurz sehen dürfe, frage ich und bitte um die Zeitung, die er mir gerne reicht. Ich überfliege den Artikel, verstehe aber nur wenig. Das macht allerdings nichts, denn was ich herauslese sind Worte wie Deutschland, Monarchie oder Internet. Und Monarchos. Schlagartig wird mir klar, dass ich da etwas verpasst habe und bin nicht sicher, ob mir das gefällt.
Ich reiche das Blatt an Natalie weiter und deute auf den Artikel. Sie solle das bitte mal lesen und ob ihr etwas auffalle. Ja, antwortet sie, da hätten anscheinend noch mehr Leute so bescheuerte Ideen wie ich. Der Name, hake ich nach, ob ihr der Name etwas sage. Ich deute auf den Artikel. Nein, antwortet sie und was damit sei. Das sei der Name meiner Gruppe, antworte ich und ob wir subito das Campingplatz-Café aufsuchen könnten, ich bräuchte dringend WLAN.
Es ist nicht viel los in dem kleinen, zweckmäßig eingerichteten Café. Ein paar einzelne Gestalten stehen an der Selbstbedienungstheke und zapfen sich einen Kaffee oder sitzen an den Tischen und tippen auf ihren Mobiltelefonen herum. Eine Familie mit zwei kleinen Kindern sitzt vor großen Tellern, darauf Berge fingerdicker Pommes Frites. Der Ketchup hat bereits mächtige Spuren in den Gesichtern der Kleinen hinterlassen. Ich setze mich an einen freien Platz, während sich Natalie vor der Kaffeemaschine für einen Milchkaffee anstellt. Ich suche und finde das offene WLAN des Campingplatzes, dann bin ich eingeloggt und klicke auf meine Gruppe. Ich versuche mich zu erinnern, wie viele Mitglieder die Frankfurter Adelsfreunde hatten, bevor wir losgefahren waren, ich meine, es waren rund sechstausend. Die Mitgliederzahl meiner Gruppe liegt inzwischen höher. Die aktuelle Zahl beträgt, wenn ich das richtig lese: 264.579. Ich gebe zu, dass ich damit nicht gerechnet habe. Ich gebe ferner zu, dass ich froh bin zu sitzen. Und ich rufe Natalie herbei, da ich gerade jetzt, in diesem Augenblick, nicht allein sein möchte.
Sie nimmt neben mir Platz, leckt ihren Kaffeelöffel ab und fragt, was denn los sei, ich sei so ruhig. Ich zeige ihr die Zahl auf dem Bildschirm. Ui, sagt sie, das sei aber eine ganze Menge und gratuliert mir. Wie das denn käme, fragt sie, in so kurzer Zeit, ob das normal sei. Normal nicht, antworte ich und versuche das alles zu verstehen. Dabei durchforste ich die unzähligen Nachrichten, die sich in der Postbox befinden, in der Hoffnung, dass eine Meldung etwas Licht ins Dunkel bringt. Die meisten davon kommen von Menschen, die wissen wollen, wer ich sei, was für ein Programm ich verfolge und wie es nun weitergehe. Ein paar Nachrichten sind von Freunden, die mich in der Mehrheit beglückwünschen oder wenigstens wissen wollen, wie ich denn darauf gekommen sei. Auch von meinem besten Freund Murat ist eine Nachricht dabei, gestern verschickt. Da hätte ich ja ein schönes Ding angerichtet und ganz Deutschland spreche über mich, und ich solle mich doch mal melden, dann könne man bei meiner Rückkehr ein Bier trinken und ein bisschen über die Zukunft quatschen.
Eine große Anzahl Mails aber kommt, stelle ich fest, von Redaktionen, Journalisten und Korrespondenten. Nationale wie internationale Fernsehsender sind darunter, Radiostationen und natürlich jede Menge Zeitschriften und Tageszeitungen. Das kann und will ich jetzt nicht alles lesen, aber die allererste der Nachrichten, die will ich sehen. Sie stammt von einem Redakteur einer Boulevardzeitung, der eine Geschichte über meine Gruppe bringen will und ob ich vielleicht Zeit und Lust für ein Interview hätte. Ich könne ihn auch gerne anrufen. Bei der Gelegenheit fällt mir auf, dass ich nirgendwo meine Handynummer hinterlassen habe, und ich weiß jetzt, dass das eine gute Entscheidung war, das schenkt mir vielleicht noch ein paar Tage.
Dann schaue ich, ob ich von diesem Journalisten eine weitere Nachricht finde, und tatsächlich hat er einen Link gepostet mit dem Kommentar, dass er, da ich mich leider nicht gemeldet habe, den Artikel so hätte schreiben müssen, und dass er hoffe, dass dieser mir gefalle. Ich könne mich nach wie vor jederzeit melden, dann könne man vielleicht ein Interview verabreden oder eine Homestory angehen.
Ich bin sprachlos. Mit allem hatte ich gerechnet, doch nicht damit. Aber sie sehen darin doch einen Scherz, fragt Natalie, das tun sie doch, oder? Ich bin mir nicht sicher, antworte ich, es könne sein, dass sie das für eine lang geplante politische Bewegung halten. Na, dann solle ich sie aber mal zügig aufklären. Natalie sieht mich vorwurfsvoll an. Ob sie es mir nicht gesagt habe, meint sie ruhig und ernst, ob sie mir nicht gesagt habe, dass das eine Schwachsinnsidee sei, aber nein, ich habe wieder mal nicht hören wollen, und jetzt hätte ich den Salat.
Sie solle es doch einmal von der anderen Seite aus betrachten, entgegne ich, langsam die Situation erfassend. Egal, wie das ausgehe, das könne uns doch bestimmt nicht schaden. Doch genau in diesem Punkt sollte ich mich täuschen, wenn es bis dahin auch noch etwas dauern würde. Jedenfalls steht in diesem Moment außer Frage, dass wir unseren Urlaub früher als geplant abbrechen werden, da ich jetzt vor Ort in Frankfurt sein muss. Und auch wenn Natalie richtig sauer deswegen ist, so stimmt sie mir ausnahmsweise zu. Aber die Tage werde man nachholen, mault sie leise, und dass ich einem aber auch alles verderben könne.
3
In Deutschland ist man mittlerweile wenn auch nicht in Aufruhr, dann doch geringfügig nervös. Und selbst wenn sich die Regierenden in Berlin betont gelassen geben, versucht man dem Phänomen der Monarchos doch schnellstmöglich auf die Schliche zu kommen, auch an diesem Morgen im Bundesministerium des Inneren.
Ob er das bereits gelesen habe, fragt Klaus Moeser, der zuständige Beamte des Verfassungsschutzes den ebenfalls mit der Sache befassten Herrn Staatssekretär aus dem Ministerium des Inneren, Thorsten Militzki.
Moeser deutet auf den weißen Schreibtisch vor ihm, auf dem er ein buntes Sammelsurium an Zeitungsartikeln und Ausrissen aus Magazinen ausgebreitet hat. Leitartikel der Tagespresse befinden sich genauso darunter wie die großen Schlagzeilen der Boulevardpresse.
Er sei noch dabei, antwortet der Staatssekretär, aber das sei doch sicherlich ein Scherz. Solche Gruppierungen gebe es im Internet mittlerweile zuhauf. Mal träten sie für den Boykott einer Burgerkette ein, mal für die Befreiung politischer Gefangener. Nun sei es in diesem Fall eben die Wiedereinführung der Monarchie, eine reine Spinnerei, da solle sich Moeser mal keine Sorgen machen. Naja, und dass sich die Presse gleich darauf stürze, sei doch klar, das sei schließlich ein gefundenes Fressen.
Er sei sich da nicht so sicher, beunruhigt ihn der Beamte, in diesem Falle sei das etwas anderes, und der Herr Staatssekretär solle doch nur einmal einen Blick auf die steigende Zahl der Mitglieder werfen.
Die sei in der Tat beeindruckend, erwidert der Ministerielle und betrachtet den Ausdruck, den ihm der Verfassungsschutzbeamte gereicht hat. Das sei quasi die Einwohnerzahl einer deutschen Großstadt, sagt Militzki. Und das sei lediglich das Ergebnis weniger Tage, antwortet der Verfassungsschützer, und ob er sich vorstellen könne, was passiere, wenn diese Dynamik anhielte.
Der Staatssekretär reibt sich nachdenklich das Kinn. Als ihn der Innenminister am Wochenende mit diesem Thema betraute, hatte er gedacht, die Sache in wenigen Tagen abhandeln zu können. Eine kurze Pressemitteilung, dieses Monarchiedingens sei das Werk eines Spinners oder Nerds, und in der Woche darauf würde keiner mehr davon reden. Da ist er sich nach den aktuellen Zahlen nicht mehr ganz so sicher.
Ob man denn bereits wisse, wer hinter dieser Gruppe stecke, will er wissen, ob sich dahinter womöglich eine radikale Bewegung verberge? Dieser Name, Monarchos, das erinnere ihn an Anarchos.
Das sei mit Sicherheit so gewollt, erhält er zur Antwort, und man sei bereits dabei, den Administrator zu überprüfen. Der Gründer der Gruppe sei ein gewisser Robert Greiffenberg aus Frankfurt am Main, ein bislang unbeschriebenes Blatt. Siebenundzwanzig Jahre alt, Mitarbeiter einer Werbeagentur, wohnhaft ebenfalls in Frankfurt, in Lebensgemeinschaft mit der ein Jahr älteren Natalie Penzke, Krankenschwester auf einer Frankfurter Gynäkologiestation. Soweit man bislang wisse, habe keiner der beiden Kontakt zu extremistischen Kreisen oder gehöre einer radikalen Partei an. Sonst irgendwelche Auffälligkeiten, hakt Militzki nach, Mitgliedschaften in Burschenschaften, Militariensammler, komische Freunde, fragwürdige Auslandsaufenthalte? Moeser schüttelt den Kopf. Langweilig, antwortet er, die beiden seien eigentlich stinklangweilig. Keinerlei Mitgliedschaften, nicht einmal im Autoclub oder beim Tierschutz, keine Abonnements, nichts, rein gar nichts.
Na, so viel Normalität, das sei ja fast schon wieder auffällig und er solle auf jeden Fall ein Auge darauf haben, bittet Militzki, und dass er über alle Entwicklungen zeitnah informiert werden wolle. Vorerst gebe er dem Innenminister Entwarnung, zudem werde er als offizielle Sprachregelung vorschlagen, von einer harmlosen und nicht ganz ernst gemeinten Adelsverehrung zu sprechen, und dass das nicht viel anders sei, als im Wartezimmer die Klatschspalten durchzublättern.
Sein Wort in Gottes Ohr, entgegnet der Mann vom Verfassungsschutz ernst, und er hoffe, dass der Herr Staatssekretär recht behalte.