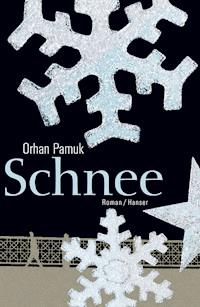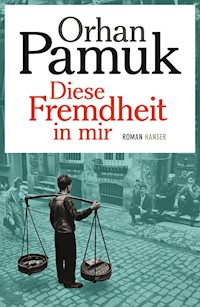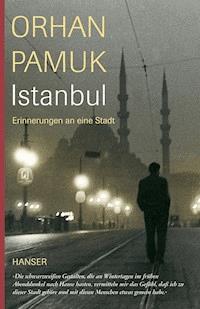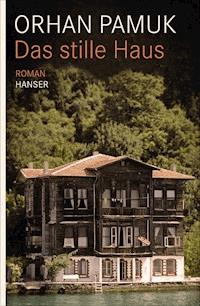Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Kann eine alles erschütternde Katastrophe die Menschen einen? Der neue große Roman des Nobelpreisträgers Orhan Pamuk Als im Jahre 1901 auf Minger die Pest ausbricht, beschuldigen sich Muslime und Christen gegenseitig. Ob nun die Pilger aus Mekka den Erreger eingeschleppt haben oder die Händler aus Alexandrien, auf der Insel herrschen chaotische Zustände. Als schließlich der Sultan Abdülhamit II. sowie England und Frankreich die Insel mit Kriegsschiffen blockieren lassen, um die weitere Ausbreitung der Pest zu verhindern, sind die Menschen auf Minger auf sich allein gestellt. Orhan Pamuks neues Buch ist einzigartiger Abgesang auf das von Nationalismus und Aberglaube gefährdete Osmanische Reich sowie ein großer historischer Roman, in dem sich Phantasie und Wirklichkeit, Vergangenheit und Gegenwart, Ost und West raffiniert verbinden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 999
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Über das Buch
Kann eine alles erschütternde Katastrophe die Menschen einen? Der neue große Roman des Nobelpreisträgers Orhan PamukAls im Jahre 1901 auf Minger die Pest ausbricht, beschuldigen sich Muslime und Christen gegenseitig. Ob nun die Pilger aus Mekka den Erreger eingeschleppt haben oder die Händler aus Alexandrien, auf der Insel herrschen chaotische Zustände. Als schließlich der Sultan Abdülhamit II. sowie England und Frankreich die Insel mit Kriegsschiffen blockieren lassen, um die weitere Ausbreitung der Pest zu verhindern, sind die Menschen auf Minger auf sich allein gestellt. Orhan Pamuks neues Buch ist einzigartiger Abgesang auf das von Nationalismus und Aberglaube gefährdete Osmanische Reich sowie ein großer historischer Roman, in dem sich Phantasie und Wirklichkeit, Vergangenheit und Gegenwart, Ost und West raffiniert verbinden.
Orhan Pamuk
Die Nächte der Pest
Roman
Aus dem Türkischen von Gerhard Meier
Hanser
Beim Nahen einer Gefahr sprechen immer zwei Stimmen gleich stark in der Seele des Menschen: die eine sagt ganz vernünftig, der Mensch solle die Art der Gefahr und die Mittel zur Rettung davor genau bedenken; die andere sagt noch vernünftiger, es sei viel zu schwer und quälend, über die Gefahr nachzudenken, wo es doch nicht in des Menschen Macht steht, alles vorauszusehen und sich vom allgemeinen Gang der Dinge zu retten, und deshalb sei es besser, sich von all dem Schweren abzuwenden, solange es nicht eingetroffen ist, und an Angenehmes zu denken.
Lew Tolstoi, Krieg und Frieden
Kein Autor späterer Zeiten hat sich vorgenommen, diese Berichte zu prüfen und zu vergleichen, um aus ihnen eine zusammenhängende Reihe von Ereignissen zu gewinnen und eine Geschichte jener Pest zu schreiben.
Alessandro Manzoni, Die Brautleute
Aufmerksamen Leserinnen und Lesern wird nicht entgehen, dass auf dem Umschlag die Stadt Arkaz vom Regierungsplatz aus abgebildet ist, jedoch im Hintergrund Burg und Stadt erneut zu sehen sind. Ich danke sowohl dem Maler Ahmet Işıkçı, der mich mit seiner anhaltenden Faszination für die Fernansicht der Burg Arkaz zu diesem optischen Widerspruch bewog, als auch meinem Freund, dem Historiker Edhem Eldem, der mich in der Endphase des Romans mit Vorschlägen und Korrekturen begleitet hat. O. Pamuk
EINLEITUNG
Das Vorliegende ist sowohl ein historischer Roman als auch ein Geschichtsbuch in Romanform. Eingebettet in einen historischen Rahmen werden die erschütterndsten sechs Monate geschildert, die meine geliebte Heimat, die Insel Minger, die Perle des östlichen Mittelmeers, je erlebt hat.
Bei der Untersuchung der Ereignisse während des Pestausbruchs auf der Insel im Jahr 1901 kam ich zu der Auffassung, dass die Geschichtswissenschaft nicht ausreiche, um zu begreifen, wie die Handelnden in dieser kurzen, dramatischen Zeitspanne zu ihren Entscheidungen gelangten, sodass ich auch die Kunst des Romans zu Hilfe zog und versuchte, die beiden Ansätze zu verquicken.
Die Leserinnen und Leser mögen daher nicht davon ausgehen, zu Beginn meines Unterfangens hätten hochliterarische Überlegungen gestanden. Es war vielmehr so, dass mir zuerst jene Briefe in die Hände fielen, deren ganzen Reichtum ich in diesem Buch wiederzugeben suche. Ich war gebeten worden, die 113 Briefe, die Pakize Sultan, die dritte Tochter des 33. osmanischen Sultans Murat V., zwischen 1901 und 1913 an ihre Schwester Hatice Sultan geschrieben hatte, in einer kommentierten Ausgabe zu veröffentlichen. Der Anfang dieses Buches war ursprünglich nur als »Vorwort der Herausgeberin« gedacht.
Das Vorwort weitete sich immer mehr aus, wurde durch eigene Forschungen angereichert, und so entstand schließlich dieser Band. Von Anfang an faszinierten mich Stil und Klugheit der hochempfindsamen, charmanten Pakize Sultan. Sie verfügte über eine Erzählerleidenschaft, eine Detailfreude und eine Beschreibungskraft, wie sie nur wenigen Historikern oder auch Schriftstellern gegeben sind. Ich hatte Jahre damit verbracht, in britischen und französischen Archiven von Diplomaten verfasste Berichte über die Küstenstädte des Osmanischen Reichs zu studieren, und mit akademischen Arbeiten darüber habe ich auch promoviert. Nie hat ein Konsul mit solcher Anschaulichkeit ähnliche Fälle von Cholera- oder Pestausbrüchen geschildert, und aus jenen Berichten ist auch nie herauszuspüren, wie es in einer solchen Küstenstadt duftet, wie auf dem Markt die Farben leuchten und wie es sich anhört, wenn die Möwen schreien und über das Pflaster ein Pferdewagen holpert. Die Inspiration, ein Vorwort in einen ganzen Roman zu verwandeln, mag ich aus der unheimlich lebendigen, sensiblen Art bezogen haben, in der Pakize Sultan an die Menschen, die Dinge und die Ereignisse heranging.
Beim Lesen der Briefe fragte ich mich, ob Pakize Sultans Schilderungen wohl deshalb bunter und detailfreudiger waren als die der Historiker und Diplomaten, weil sie nun mal eine Frau war? Wir dürfen nicht vergessen, dass sie ihr Zimmer im Gästehaus des Regierungsgebäudes während des Seuchenausbruchs so gut wie nie verließ und von den Geschehnissen in der Stadt nur erfuhr, was ihr Mann, der Arzt, ihr davon erzählte! Sie beschrieb, was in der Männerwelt aus Politikern, Bürokraten und Ärzten vorging, indem sie sich erfolgreich in sie hineinversetzte. Ich wiederum habe mich bemüht, in meinem historischen Roman jene Welt auf meine Weise zum Leben zu erwecken. Wobei es natürlich schwer ist, so anschaulich, so brillant und so lebendig zu sein wie Pakize Sultan.
Die Briefe, die in einer Gesamtausgabe mindestens 600 Seiten umfassen, faszinieren mich nicht zuletzt deshalb, weil ich selbst von Minger stamme. Ob in Schulbüchern, in Zeitungsartikeln oder vor allem in den einheimischen Kinderzeitschriften (Wir und unsere Insel, Unsere Geschichte) stieß ich schon als Kind immer wieder auf Pakize Sultan und hatte viel für sie übrig. So wie die Insel Minger für viele ein legendärer, ja märchenhafter Ort ist, war Pakize Sultan für mich eine Märchenfigur. Durch diese Briefe auf einmal mit ihren Alltagssorgen, ihren wahren Gefühlen und vor allen Dingen mit ihrer starken Persönlichkeit und ihrem aufrichtigen Wesen in Berührung zu kommen, verzauberte mich geradezu. Der geduldige Leser wird am Schluss des Buches von meiner persönlichen Begegnung mit ihr erfahren.
Über die geschichtlichen Tatsachen wusste ich aus Archiven in Istanbul, auf Minger, in Großbritannien und Frankreich sowie aus zahlreichen Memoirenschriften Bescheid, doch beim Verfassen des Romans konnte ich nicht anders, als mich immer wieder mit Pakize Sultan zu identifizieren, als schriebe ich meine eigene Geschichte nieder.
Die Kunst des Romans liegt ja in der Fähigkeit, unser eigenes Leben so zu erzählen, als wäre es die Geschichte einer fremden Person, und die Geschichten Fremder so, als hätten wir sie selbst erlebt. Mich beim Schreiben wie die Tochter eines Sultans zu fühlen, erscheint mir daher durchaus einer Schriftstellerin würdig. Viel schwerer fiel mir, mich in die an der Macht stehenden Männer hineinzuversetzen, die Paschas und Ärzte, die den schweren Kampf gegen die Pest führten.
Damit ein Roman von Charakter und Form her nicht so sehr eine persönliche Geschichte, sondern Geschichte an sich darstellt, ist es bestimmt von Vorteil, wenn er aus mehreren Perspektiven erzählt wird. Dennoch teile ich die Auffassung des großen Henry James, des femininsten aller männlichen Autoren, laut dem es für die Glaubwürdigkeit eines Romans am besten sei, alle Details würden aus der Perspektive einer einzigen Figur geschildert.
Da es sich hier aber auch um ein Geschichtsbuch handelt, habe ich mich an die Regel der einzigen Perspektive nicht immer gehalten. An den innigsten Stellen habe ich den Leser mit Fakten und Zahlen versorgt oder die Geschichte einer Institution erzählt. Oder bin ohne Scheu von den intimsten Gefühlsschilderungen einer Figur zu den Gedanken einer anderen Figur übergegangen, von denen die erste nichts wissen konnte. Und obwohl ich der festen Überzeugung bin, dass Sultan Abdülaziz nach seiner Entmachtung ermordet wurde, habe ich erwähnt, dass manche seinen Tod für einen Selbstmord halten. Aus der in Pakize Sultans Briefen geschilderten bunten Welt habe ich weitere Zeitzeugen auftreten lassen, um dem Buch etwas mehr historische Glaubwürdigkeit zu verleihen.
Seit Jahren werde ich gefragt, wie ich an die Briefe gelangt bin, wie ernst ich die Kriminalgeschichte darin nehme oder warum ich die Briefe nicht schon früher veröffentlich habe, und zwei dieser Fragen möchte ich hier beantworten. Unterstützung für die Romanidee bekam ich aus akademischen Kreisen, denen ich von den Verbrechen, die in den Briefen erwähnt werden, und von Abdülhamits Faible für Romane und insbesondere Krimis berichtet hatte. Auch war ich von dem Interesse angespornt, das ein angesehenes Verlagshaus wie Cambrigde University Press sowohl dem Kriminalistischen als auch der Geschichte der kleinen Insel Minger entgegenbrachte. Dass ich jahrelang unermüdlich den Geheimnissen dieser Wunderwelt und ihrem Sinn auf der Spur war, ist selbstverständlich von tieferer Bedeutung als die bloße Frage nach dem Mörder. Dessen Identität kann höchstens als ein Zeichen gedeutet werden. Angefangen mit dieser Einleitung und dem Zitat Tolstois, des großartigsten Autors historischer Romane, soll durch die Neugierde am kriminellen Geschehen dieses Buch zu einem Meer an Indizien werden.
Mir ist vorgeworfen worden, ich hätte mich mit einigen namhaften Historikern (deren Namen allerdings nichts zur Sache tun) allzu sehr angelegt. Das mag durchaus stimmen, doch waren die Auseinandersetzungen nötig, da ich populärwissenschaftliche Geschichtsbücher nun mal ernst nehme.
Im Vorwort zu Büchern über die Geschichte des Orients und der Levante bzw. des östlichen Mittelmeers wird oft auf Fragen der Transliteration eingegangen, also darauf, wie andere Schriften ins lateinische Alphabet übertragen werden sollen. Ich bin jedoch froh, nicht auch so ein langweiliges Buch geschrieben zu haben. Ohnehin sind Sprache und Alphabet von Minger unvergleichlich! Ortsnamen habe ich teils buchstabengetreu wiedergegeben, teils so, wie sie eigentlich ausgesprochen werden. Dass es in Georgien eine Stadt gibt, deren Name so ähnlich geschrieben wird, ist purer Zufall. Nicht Zufall, sondern Absicht ist dagegen, dass in meinem Buch den Leserinnen und Lesern so manches vertraut vorkommen wird wie eine allmählich verblassende Erinnerung.
Mîna Mingerli, Istanbul, 2017
KAPITEL 1
Wenn 1901 ein in Istanbul ablegendes Dampfschiff vier Tage lang schwarze Kohlenschwaden hinter sich lassend Kurs auf Süden nahm und in den gefährlichen, stürmischen Gewässern hinter Rhodos noch einen halben Tag in Richtung Alexandria weiterfuhr, konnten die Passagiere die eleganten Türme der Burg Arkaz auf Minger sehen. Da die Insel auf der Schiffslinie Istanbul-Alexandria lag, kamen recht viele Reisende in den Genuss, auf die geheimnisumwitterte, umschattete Silhouette neugierige, bewundernde Blicke zu werfen. Sobald der erhabene Bau — von Homer in der Ilias als »grüner Diamant aus rosafarbenem Stein« gewürdigt — am Horizont sichtbar wurde, lud so mancher feinfühlige Kapitän seine Passagiere an Deck, damit sie sich an dem überwältigenden Anblick erfreuen konnten, und in den Orient ziehende Maler bildeten die romantische Szenerie eifrig ab und reicherten sie mit dunklen Gewitterwolken an.
Nur wenige Schiffe legten auf Minger an, denn es gab damals nur drei Dampfer, die regelmäßig einmal in der Woche die Insel ansteuerten: zwei von der Schifffahrtsgesellschaft Messageries Maritimes, nämlich die Saghalien, die jedermann in Arkaz an ihrer grellen Sirene erkannte, die Equateur mit ihrem tieferen Ton und die nur selten und sehr kurz pfeifende, elegante Zeus der griechischen Reederei Pantaleon. Dass am 22. April 1901, an dem unsere Geschichte beginnt, zwei Stunden vor Mitternacht ein außerfahrplanmäßiges Schiff auf die Insel Minger zufuhr, ließ demnach auf ein besonderes Ereignis schließen.
Bei dem Dampfer, der sich still und leise wie ein Spionageschiff näherte, handelte es sich um die unter osmanischer Flagge fahrende Aziziye mit ihrem schmalen weißen Schornstein und dem spitzen Bug. Auf Anordnung von Sultan Abdülhamit II. war sie in besonderer Mission unterwegs, um eine hochkarätige osmanische Delegation nach China zu befördern. Zu den siebzehn Fes, Turban oder Hut tragenden Militärs, religiösen Würdenträgern, Dolmetschern und Bürokraten waren im letzten Moment noch Abdülhamits Nichte Pakize Sultan und ihr Gatte Damat Doktor Nuri Bey dazubeordert worden. Das jungvermählte Paar war glücklich und sehr aufgeregt, wunderte sich aber, was es als Teil der China-Delegation eigentlich sollte.
Pakize Sultan konnte genau wie ihre Schwestern ihren Onkel Abdülhamit nicht ausstehen und war sich gewiss, jener habe sie und ihren Gatten aus reiner Bosheit mitgeschickt, nur wusste sie nicht, worin genau diese Bosheit bestand. Bei Hof kursierte damals das Gerücht, der Sultan habe das junge Paar aus Istanbul entfernen lassen, auf dass es irgendwo in Asien an Gelbfieber oder in der Wüste Arabiens an Cholera zugrunde gehe, während andere darauf verwiesen, beim Sultan wisse man immer erst im Nachhinein, was seine finstere Absicht gewesen sei. Damat Doktor Nuri Bey — den Titel »Damat«, »Schwiegersohn«, trug er seit seiner Hochzeit mit einem Mitglied des Herrscherhauses — war etwas zuversichtlicher. Er war ein achtunddreißigjähriger, enorm fleißiger und erfolgreicher Quarantänearzt und hatte das Osmanische Reich bereits auf mehreren internationalen Hygienekongressen vertreten. Dadurch hatte er die Aufmerksamkeit Abdülhamits auf sich gezogen, diesen persönlich kennengelernt und festgestellt, was viele Quarantäneärzte schon wussten, nämlich dass der Sultan sich ebenso sehr für die Fortschritte der westlichen Medizin interessierte wie — das war allgemein bekannt — für Kriminalromane. Er ließ sich über Entwicklungen im Bereich Bakterienforschung, Labors und Impfstoffe informieren und wollte jeweils die letzten medizintechnischen Errungenschaften nach Istanbul und in die osmanischen Gebiete holen. Desgleichen war er im Bilde darüber, welche Seuchengefahr Europa aus Asien und China drohte, und ließ gegenüber Doktor Nuri durchblicken, wie sehr er darüber in Sorge war.
Da im östlichen Mittelmeer Windstille herrschte, kam die Aziziye, des Sultans Promenadenschiff, schneller voran als erwartet. Sie ging auch in Izmir vor Anker, obgleich die Stadt nicht auf ihrer Route lag. Als sie in deren nebelverhangenen Hafen einlief, erfuhren die Delegationsteilnehmer, die ab und an die schmale Treppe zur Kommandobrücke hinaufstiegen, um beim Kapitän Erläuterungen einzuholen, dass in Izmir ein geheimnisvoller Passagier an Bord gehen werde. Der russische Kapitän versicherte, selbst er wisse nicht, um wen es sich dabei handle.
Nun, es war der namhafte Chemiker und Apotheker Bonkowski Pascha, der Generalinspektor für das Gesundheitswesen des Osmanischen Reiches. Der mit seinen sechzig Jahren etwas müde gewordene, aber immer noch sehr aktive Mann war der Chefchemiker des Sultans und der Begründer der modernen osmanischen Pharmazie. Früher war er auch als mittelmäßig erfolgreicher Unternehmer und Besitzer diverser Firmen in Erscheinung getreten, die Rosenwasser und andere Düfte herstellten, Mineralwasser abfüllten und Arzneimittel produzierten. Seit zehn Jahren übte er nur noch das Amt des Generalinspektors aus, verfasste an den Sultan Berichte über Cholera- und Pestfälle und war von Seuche zu Seuche unterwegs, von Hafen zu Hafen, von Stadt zu Stadt, um dort jeweils im Namen des Sultans die Hygiene- und Quarantänemaßnahmen zu prüfen.
Bonkowski Pascha, der ebenfalls auf internationalen Kongressen auftrat, hatte vier Jahre zuvor ein Konzept darüber erstellt, was im Falle einer aus Asien drohenden Pestseuche im Osmanischen Reich für Vorkehrungen getroffen werden sollten. Als nun in den Vierteln der Griechen von Izmir die Pest ausgebrochen war, hatte man ihn sofort dorthin entsandt. Nach einigen Choleraausbrüchen war also der neue Pestbazillus, dessen Gefährlichkeit, also »Virulenz«, wie Fachleute das nannten, mal höher, mal niedriger lag, nunmehr auch ins Osmanische Reich gelangt!
In Izmir, der größten osmanischen Hafenstadt im östlichen Mittelmeer, hatte es Bonkowski Pascha innerhalb von sechs Wochen geschafft, die Pestepidemie zu besiegen. Gelungen war das dadurch, dass die Bevölkerung die Ausgangssperren und anderen Beschränkungen willig hinnahm und sich zusammen mit Polizei und Stadtverwaltung an der Jagd auf Ratten beteiligte. Unter eifriger Beteiligung der Volksfeuerwehr wurden in der ganzen Stadt Desinfektionsmittel versprüht. Nicht nur Izmirer Zeitungen wie Ahenk und Amaltheia oder Istanbuler Gazetten wie Tercüman-ı Hakikat oder İkdam, sondern auch französische und englische Blätter, in denen die Ausbreitung der Pest von Hafen zu Hafen aufmerksam verfolgt wurde, berichteten ausführlich über die Erfolge der osmanischen Quarantäneorganisation. Der polnischstämmige, aber in Istanbul geborene Bonkowski Pascha galt dort als Europäer und stand in hohem Ansehen. Beim Pestausbruch in Izmir waren lediglich siebzehn Menschen gestorben, und inzwischen waren sowohl der Hafen als auch der Zoll, die Läden und Märkte sowie die Schulen wieder geöffnet.
Als die erlesenen Passagiere der Aziziye aus ihren Kabinenfenstern oder von Deck aus beobachteten, wie Bonkowski und sein Assistent an Bord gingen, waren sie über den Erfolg der Quarantänepolitik schon informiert. Der Ehrentitel Pascha war Bonkowski fünf Jahre zuvor von Sultan Abdülhamit verliehen worden. Beim Besteigen des Schiffes trug Stanislaw Bonkowski einen Ölmantel, dessen Farbe im Dunkel nicht auszumachen war, ein Jackett, das seinen langen Hals und seinen leichten Buckel noch mehr zur Geltung brachte, und in der Hand die bleigraue Tasche, die er so beständig bei sich führte, dass sie seinen Studenten seit dreißig Jahren ein Begriff war. Sein Assistent Doktor Ilias wiederum schleppte den Laborkoffer, mithilfe dessen sein Chef jedenorts Cholera- oder Pestbazillen untersuchte, Trinkwasser von verunreinigtem Wasser unterschied und so in den Genuss kam, im gesamten osmanischen Reich das Wasser zu probieren. Ohne ihre Reisegefährten auf der Aziziye zu grüßen, zogen Bonkowski und sein Assistent sich auf ihre Kabinen zurück.
Mit diesem distanzierten Verhalten zogen die beiden neuen Mitreisenden erst recht die Neugier der Delegierten auf sich. Was verbarg sich hinter dieser Heimlichtuerei? Warum sandte Seine Hoheit mit demselben Schiff gleich zwei der bedeutendsten Pest- und Seuchenspezialisten des Osmanischen Reichs nach China? Bald aber erfuhren die Männer, dass Bonkowski Pascha und sein Assistent gar nicht nach China unterwegs waren, sondern auf der Insel Minger von Bord gehen würden, und sie wandten sich wieder ihren eigenen Angelegenheiten zu. Sie hatten noch drei Wochen Zeit, um darüber zu beratschlagen, wie sie den chinesischen Muslimen ihre Auffassung vom Islam nahelegen sollten.
Dass Bonkowski Pascha an Bord war, erfuhr Damat Doktor Nuri Pascha von seiner Frau. Die beiden hatten den Mann unabhängig voneinander kennengelernt und mochten ihn. Zuletzt hatte Doktor Nuri mit dem über zwanzig Jahre älteren Bonkowski gemeinsam an einem Hygienekongress in Venedig teilgenommen. Außerdem war Bonkowski an der medizinischen Fakultät in der früheren Demirkapı-Kaserne in Sirkeci Nuris Chemieprofessor gewesen. Wie die meisten Studenten hatte Nuri den in Paris ausgebildeten Bonkowski Bey bewundert und an seinen Laborkursen sowie seinen Vorlesungen in organischer und anorganischer Chemie teilgenommen. Bonkowski scherzte im Unterricht viel, hatte wie ein Renaissance-Mensch weitgefächerte Interessen, und neben seinem umgangssprachlichen Türkisch beherrschte er drei europäische Sprachen wie ein Muttersprachler, was ihm bei den Studenten viel Achtung eintrug. Geboren war er in Istanbul als Sohn eines polnischen Offiziers, der nach der Niederlage gegen die Russen ins Exil gegangen war und sich der osmanischen Armee angeschlossen hatte.
Pakize Sultan erinnerte sich, wie sie ihn kennengelernt hatte. In den Frauengemächern des Palasts, in dem sie eingesperrt lebte, hatten im Sommer vor elf Jahren ihre Mutter und andere Frauen mit Fieber daniedergelegen. Abdülhamit war zu dem Schluss gekommen, es müsse da eine Bakterie am Werk sein, und hatte seinen obersten Chemiker angewiesen, er solle sich eine Probe davon besorgen. Ein andermal war Bonkowski beauftragt worden, das Trinkwasser Pakize Sultans und ihrer Familie im Çırağan-Palast zu untersuchen. Abdülhamit hielt Murat V. dort zwar gefangen und ließ ihn überwachen, doch im Falle einer Krankheit schickte er ihm die besten Ärzte. Als Kind hatte sie im Palast oft den Leibarzt von Sultan Abdülaziz, den schwarzbärtigen Griechen Marko Pascha, und Abdülhamits eigenen Leibarzt Mavroyeni Pascha gesehen.
»Und in den Yıldız-Palast kam dann wieder Bonkowski Pascha«, sagte sie. »Er analysierte das Wasser und schrieb einen neuen Bericht. Meinen Schwestern und mir lächelte er aber nur noch aus der Ferne zu und scherzte nicht mehr mit uns wie damals, als wir Kinder waren.«
Damat Doktor Nuri Paschas Begegnungen mit Bonkowski waren offiziellerer Natur gewesen. Auf dem Kongress in Venedig, auf dem sie gemeinsam das Osmanische Reich vertreten hatten, war Nuri dem Professor durch seinen Fleiß und seine Erfahrung aufgefallen, und Nuri vermutete, vor allem von Bonkowski sei er anfangs als Quarantänearzt weiterempfohlen worden. Auch später hätten sich ihre Wege noch mehrfach gekreuzt; so hätten sie etwa auf Anweisung von Bürgermeister Blacque Bey hin die Hygienezustände der Schlachthöfe überprüft, die in Istanbul mitten auf der Straße betrieben wurden. Ein andermal habe Bonkowski Pascha einen Bericht über die topografischen und geologischen Eigenschaften des Terkos-Sees und seine Trinkwasserqualität verfasst und dabei die Studenten und jungen Ärzte in seiner Begleitung durch seine Intelligenz, seinen Arbeitseifer und seine Disziplin beeindruckt. So freute sich das junge Paar nun, Bonkowski Pascha wiederzubegegnen.
KAPITEL 2
Damat Doktor Nuri ließ Bonkowski über einen Steward eine Nachricht zukommen, und der Kapitän lud die beiden Ärzte in den sogenannten »Gästesalon« zu einem Abendessen, bei dem allerdings kein Alkohol serviert wurde. Daran nahm auch Pakize Sultan teil, die ansonsten ihre Mahlzeiten in ihrer Kabine aß und sich vor allen Dingen den mitreisenden Mollas nie zeigte. Vergessen wir nicht, dass zu jener Zeit eine Frau, und sei sie eine Prinzessin, nur äußerst selten mit Männern zusammensaß. Sie nahm an einem Tischende Platz, und was sie danach sah und hörte, darüber wissen wir heute Bescheid, da sie hinterher alles ihrer Schwester schrieb.
Bonkowski Pascha hatte ein bleiches Gesicht, eine kleine Nase und riesige Augen, die man nicht leicht vergaß. Sobald er seinen früheren Studenten erblickte, umarmte er ihn. Vor Pakize Sultan verneigte er sich ehrerbietig, als hätte er es mit einer Edeldame in einem europäischen Schloss zu tun, doch ergriff er nicht ihre Hand, um sie nicht in Verlegenheit zu bringen.
Er hatte etwas für europäische Umgangsformen und Etikette übrig und trug am Revers den Sankt-Stanislaus-Orden zweiter Klasse, den er erst kürzlich vom Zaren erhalten hatte, und daneben den goldenen Osmanischen Verdienstorden, den er gern zur Schau stellte.
Damat Doktor Nuri sagte: »Verehrter Professor, darf ich Ihnen meine Bewunderung für Ihren Erfolg in Izmir aussprechen.«
Seit in den Zeitungen darüber berichtet wurde, dass die Pest in Izmir im Abklingen begriffen war, nahm Bonkowski Pascha huldvoll lächelnd Gratulationen entgegen. »Ich darf aber auch Sie beglückwünschen!«, entgegnete er und sah dabei Doktor Nuri tief in die Augen. Der lächelte, ahnte er doch, dass die Gratulation sich nicht auf seine Tätigkeit in den Quarantänestationen im Hedschas oder als Vertreter des Osmanischen Reichs bezog, sondern vielmehr darauf, dass er eine Prinzessin aus dem osmanischen Herrscherhaus, die Tochter eines Sultans, geheiratet hatte. Abdülhamit hatte ihn zwar deshalb mit seiner Nichte verheiratet, weil er ein brillanter, erfolgreicher Arzt war, doch seither war kaum mehr davon die Rede, sondern nur noch von seiner Eigenschaft als »Damat«.
Daran hatte er sich aber schon gewöhnt. Mit seiner Frau war er viel zu glücklich, um in jener Hinsicht empfindlich zu sein. Vor seinem Professor, der stets mit Disziplin und Methodik vorging (die beiden in der türkischen Sprache aus dem Französischen stammenden Begriffe erfreuten sich unter osmanischen Intellektuellen gerade großer Beliebtheit), hatte er außerdem Hochachtung und wollte ihm schmeicheln.
»Dass Sie die Seuche in Izmir so schnell besiegt haben, beweist doch, wie gut das osmanische Quarantäneprogramm funktioniert«, sagte er. »Damit haben Sie all jenen, die vom ›kranken Mann am Bosporus‹ faseln, die gehörige Antwort versetzt. Die Cholera haben wir zwar noch nicht ausrotten können, doch einen ernsthaften Pestausbruch hat es in den osmanischen Ländern seit achtzig Jahren nicht gegeben. Früher hieß es, die zivilisatorische Scheidelinie, die seit zweihundert Jahren Europa vom Osmanischen Reich trenne, sei nicht die Donau, sondern die Pest. Ihnen ist zu verdanken, dass in Medizin und Seuchenbekämpfung diese Linie nicht mehr existiert.«
»Leider ist die Pest aber nun auf Minger aufgetreten«, erwiderte Bonkowski Pascha etwas betreten, als würde er seinen Studenten nur ungern auf einen Fehler hinweisen. »Und die Virulenz ist außergewöhnlich hoch.«
»Tatsächlich?«
»Die Seuche ist in den muslimischen Vierteln ausgebrochen, Damat Pascha. Dass Sie über den Hochzeitsvorbereitungen davon nichts mitbekommen haben, ist nicht weiter verwunderlich, denn die Sache wird verheimlicht. Ihrer Hochzeitseinladung konnte ich übrigens deshalb nicht Folge leisten, weil ich in Izmir war.«
»Ich habe bisher verfolgt, was die Seuche in Hongkong und Bombay angerichtet hat.«
»Die Berichte darüber kommen nicht an die Wirklichkeit heran«, sagte Bonkowski Pascha entschieden. »Für Tausende von Toten in Indien und China ist ein und derselbe Bazillus verantwortlich, ein und dieselbe Seuche. So wie auch in Izmir.«
»Aber in Indien gehen die Menschen zugrunde, Sie jedoch haben in Izmir die Seuche besiegt!«
»Weil ich dort Bevölkerung und Presse auf meiner Seite hatte«, entgegnete Bonkowski Pascha, und nach einer Kunstpause sagte er: »In Izmir ist die Krankheit im Griechenviertel ausgebrochen, und die Leute dort sind aufgeklärt und zivilisiert. Auf Minger sind eher Muslime von der Pest betroffen, und es sind jetzt schon fünfzehn Menschen daran gestorben. Wir werden es dort nicht so leicht haben.«
Aus Erfahrung wusste Doktor Nuri, dass Christen sich eher an Quarantäneregeln hielten als Muslime, doch hatte er genug davon, dass christliche Spezialisten wie Bonkowski Pascha das immer wieder aufs Tapet brachten. Er ging also nicht darauf ein. Als sich ein verlegenes Schweigen breitmachte, fühlte Pakize sich bemüßigt, dem Kapitän eine Erklärung abzuliefern: »Ein ewiges Thema!«
»Sie kennen doch die Geschichte mit dem armen Doktor Jean-Pierre!«, sagte Bonkowski Pascha mit einem lehrerhaften Schmunzeln. »Sowohl vom Palast als auch von Gouverneur Sami Pascha bin ich mehrmals darauf hingewiesen worden, dass Seine Hoheit die Nachricht vom Pestausbruch auf Minger für politisch motiviert hält und ich daher den Grund meines Besuchs dort verheimlichen soll. Den Gouverneur kenne ich ja noch aus der Zeit, als er Landrat und später Provinzstatthalter war.«
»Fünfzehn Tote, das ist viel für so eine kleine Insel«, sagte Doktor Nuri.
»Nicht mal mit Ihnen darf ich darüber sprechen, Pascha!«, rief Bonkowski und tat eine spöttische Handbewegung in Richtung Pakize Sultan, als wollte er andeuten, dass dort eine Spionin säße. Dann verfiel er wieder in den onkelhaften Gestus, mit dem er den verwestlichten Prinzessinnen in ihrer Kindheit begegnet war, bei einer Theatervorstellung im Yıldız-Palast etwa oder beim Staatsbesuch von Kaiser Wilhelm.
»Dass eine Sultanstochter Istanbul verlassen darf, erlebe ich zum ersten Mal!«, rief er mit übertriebener Verwunderung aus. »Das Osmanische Reich gestattet den Frauen mehr Freiheit und tut mal wieder einen Schritt in Richtung Westen!«
Aus den Briefen, die noch veröffentlicht werden sollen, wird zu ersehen sein, dass Pakize Sultan durchaus nicht entging, wie viel Ironie und gar Spott hinter diesen Worten steckten. Sie war ebenso intelligent und empfindsam wie ihr Vater Murat V. »Statt nach China würde ich ja lieber nach Venedig fahren«, sagte sie und lenkte damit das Gespräch auf die Stadt, die die beiden Männer von dem Kongress her kannten. »Stimmt es, dass man dort wie auf dem Bosporus mit dem Boot von Villa zu Villa und fast bis ins Haus hinein fährt?« Dann unterhielten sie sich darüber, wie schnell die Aziziye fuhr, wie viel Leistung sie brachte und wie bequem man es in den Kabinen hatte. Anders als sein Neffe Abdülhamit war dessen Vorvorgänger Sultan Abdülaziz (von dem das Schiff seinen Namen hatte) dreißig Jahre zuvor eine hohe Staatsverschuldung eingegangen, um die osmanische Marine auszubauen, und hatte sich dabei auch jenes prächtige Schiff anfertigen lassen. Die mahagonivertäfelte, mit Goldrahmen und Spiegeln reichlich verzierte Sultanskabine hatte ein Pendant auf der Panzerfregatte Mahmudiye. Der Kapitän erläuterte, das Schiff fasse 150 Passagiere und könne bis zu vierzehn Knoten schnell fahren, doch leider bringe Seine Hoheit nicht einmal die Zeit auf, damit eine Bosporus-Tour zu unternehmen. Alle am Tisch wussten, dass der Sultan sich aus Furcht vor einem Anschlag auf keinerlei Schiff traute, doch vorsichtshalber wurde darüber geschwiegen.
Als der Kapitän verkündete, sie hätten nur noch sechs Stunden Fahrzeit vor sich, fragte Bonkowski Pascha Doktor Nuri, ob er denn schon mal auf Minger gewesen sei.
»Nein, denn bisher ist dort nie eine Seuche ausgebrochen, weder Cholera noch Gelbfieber.«
»Ich war leider auch noch nie dort. Dennoch habe ich über Minger Erkundigungen eingezogen. Plinius der Ältere geht in seiner Naturalis Historia ausführlich auf die einzigartige Flora der Insel ein, auf die Bäume, die Blumen, den steilen Vulkanberg und die Felsbuchten im Norden. Obwohl ich also selbst noch nicht dort war, habe ich vor Jahren Seiner Hoheit einen Bericht über die Möglichkeit einer Rosenzucht auf der Insel verfasst.«
»Und was ist daraufhin geschehen, Pascha?«, fragte Pakize Sultan.
Bonkowski Pascha begnügte sich mit einem nachdenklichen Lächeln. Pakize Sultan schloss daraus, dass selbst der Pascha das furchtsam strafende Gehabe des argwöhnischen Sultans schon hatte zu spüren bekommen, und schweifte lieber auf das Thema ab, über das sie sich mit ihrem Mann schon unterhalten hatte, nämlich ob es Zufall sein könne, dass die beiden renommiertesten Quarantänespezialisten des Osmanischen Reichs eines Mitternachts vor der Küste Kretas auf dem Privatschiff des Sultans aufeinandertrafen?
»Ich kann Ihnen versichern, dass es Zufall ist«, erwiderte Bonkowski Pascha. »Dass ausgerechnet die Aziziye der Insel gerade am nächsten ist, weiß nämlich nicht einmal der Gouverneur von Izmir, Kıbrıslı Kâmil Pascha. Natürlich würde ich gerne mit Ihnen fahren und den chinesischen Muslimen vorpredigen, wie essentiell es ist, sich den Vorgaben der modernen Medizin und der Quarantäne zu fügen. Wer die Quarantäne akzeptiert, nimmt damit ein Stück Verwestlichung in Kauf, und je weiter man in den Orient gelangt, umso schwerer fällt den Menschen das. Seien Sie aber nicht betrübt, denn ich kann Ihnen versichern, dass es auch in China Kanäle wie in Venedig und in Istanbul gibt, und zwar noch viel breitere und längere, und auf sehr eleganten Booten kann man darauf bis in die Häuser und Villen hineinfahren.«
Das junge Paar konnte sich nur wundern, wie viel Bonkowski Pascha auch über China wusste, obwohl er dort genauso wenig gewesen war wie auf Minger. Nach dem Abendessen gingen die beiden in ihre Kabine zurück, die mit ihren aus Frankreich und Italien importierten Tischchen, Uhren, Spiegeln und Lampen wie ein Saal in einem Palast wirkte.
»Etwas betrübt Sie«, sagte Pakize Sultan, »das lese ich Ihnen vom Gesicht ab.«
Doktor Nuri hatte es als Nadelstiche empfunden, dass Bonkowski ihn immer mit »Pascha« angeredet hatte. Den Titel hatte ihm Abdülhamit sofort verliehen, weil dies nach der Hochzeit mit einer Prinzessin nun mal so üblich war, doch Doktor Nuri hatte ihn bisher noch nie verwendet, da es auch nicht nötig gewesen war. Dass nun auch hochrangige, angesehene Militärs, die jenen Titel aus gutem Grund trugen, ihn ebenso damit ansprachen, ließ in ihm das Gefühl aufkommen, er habe ihn nicht wirklich verdient. Doch kamen sie gemeinsam zu dem Schluss, dass bei Bonkowski Pascha dahinter keine böse Absicht stecke.
Seit dreißig Tagen waren sie nunmehr verheiratet. Beide hatten lang davon geträumt, einen angemessenen Ehepartner zu finden, aber die Hoffnung darauf schon fast aufgegeben. Dann hatte Abdülhamit aus einer Eingebung heraus die beiden einander vorgestellt und sie innerhalb von zwei Monaten miteinander verheiratet, und dass sie nun so glücklich waren, lag offensichtlich daran, dass sie am Liebesspiel mehr Gefallen fanden, als sie sich je hätten denken können. Seit sie abgereist waren, hatten sie die meiste Zeit im Bett ihrer Kabine verbracht, und nichts erschien ihnen natürlicher.
Als gegen Morgen das Schiff eine Art Wimmern von sich gab, erwachten sie. Draußen war es noch stockdunkel. An den hohen Eldost-Bergen vorbei, deren spitze Zacken sich von Norden nach Süden erstreckten, fuhr die Aziziye auf Arkaz zu, die größte Stadt und das Verwaltungszentrum von Minger. Sobald mit bloßem Auge der blasse Lichtschein des Arabischen Leuchtturms zu sehen war, hatte der Kapitän das Steuerrad nach Westen gedreht, in Richtung auf den Hafen. Da am Himmel ein riesiger Vollmond stand und das Meer in silbriges Licht getaucht war, konnten die Passagiere aus ihren Kabinen gleich hinter der Burg von Arkaz den wie ein Gespenst aus dem Dunkel emporragenden Weißen Berg sehen, den geheimnisvollsten Vulkan des Mittelmeerraums.
Als Pakize Sultan die spitzen Türme der imposanten Burg ausmachte, gingen sie an Deck, um den Vollmond besser zu genießen. Die Luft war feucht und mild. Vom Meer stieg ein Duft nach Iod, Algen und Mandeln auf. Da wie so mancher osmanische Küstenort Arkaz nicht über eine größere Anlegestelle verfügte, wartete der Kapitän auf Höhe der Burg draußen ab.
Es kam eine tiefe, merkwürdige Stille auf. Die beiden Jungvermählten erschauderten unter dem Zauber der üppigen Landschaft. Von den mondbeschienenen Bergen und der geheimnisvollen Lautlosigkeit ging eine imponierende Tiefe aus. Es war, als ob es neben dem silbrigen Mondenschein noch eine Lichtquelle gäbe und sie entrückt danach suchten. Eine Weile genossen sie den herrlich schimmernden Anblick, als läge darin der eigentliche Grund für ihr Glück. Da sahen sie aus dem Dunkel eine Bootslaterne auftauchen, dann die weit ausholenden Ruderer. Auf dem Unterdeck standen am Fallreep Bonkowski Pascha und sein Assistent, fern wie in einem Traum. Als das vom Gouverneur gesandte Boot die Aziziye erreichte, hörten sie Gesprächsfetzen auf Griechisch und auf Mingerisch, dann Schritte. Das Boot nahm Bonkowski Pascha und seinen Assistenten an Bord und verschwand wieder in der Dunkelheit.
Wie auch andere Passagiere auf Kommandobrücke und Deck blickten die beiden noch eine Weile auf die Burg und die wie aus einem Märchen emportauchenden prachtvollen Berge, die schon so manchen romantischen Reiseschriftsteller ins Schwärmen versetzt hatten. Hätten sie genauer auf das Fenster eines der südwestlichen Türme geachtet, wäre ihnen aufgefallen, dass dort eine Laterne brannte. Nach den Kreuzfahrern hatten Venezianer, Byzantiner, Araber und Osmanen die Burg mit diversen Anbauten angereichert, und ein Teil davon wurde seit Jahrhunderten als Kerker genutzt. Zwei Stockwerk unter dem Zimmer, in dem die Laterne brannte, lag in einer leeren Zelle eine wichtige Persönlichkeit dieses Kerkers, der Wärter Bayram Efendi, und rang mit dem Tode.
KAPITEL 3
Als Bayram Efendi fünf Tage zuvor die ersten Anzeichen der Krankheit verspürt hatte, wollte er sie nicht ernst nehmen. Er hatte Fieber, sein Herz pochte, und es überliefen ihn kalte Schauer. Musste er sich am Morgen eben in den windigen Türmen und Höfen erkältet haben! Am folgenden Nachmittag kamen zum Fieber Erschöpfung und Appetitlosigkeit hinzu, und einmal ließ er sich im Hof auf den Steinboden sinken, streckte sich aus, sah zum Himmel empor und meinte schon, er würde sterben. Als ob da jemand in seine Stirn Nägel einschlüge.
Seit fünfundzwanzig Jahren war er im Kerker der berühmten Burg von Arkaz als Wächter tätig. Er hatte miterlebt, wie angeschmiedete Gefangene in ihren Zellen vergessen worden waren, wie Festungshäftlinge im Hof ihre schweren Ketten geschleppt hatten und wie vor fünf Jahren Abdülhamit politische Häftlinge auf die Insel gesandt hatte. Da er den früheren, primitiven Zustand des Kerkers kannte (an dem sich eigentlich kaum was geändert hatte), glaubte er an die modernen Bestrebungen, den Kerker in ein Gefängnis oder gar eine Besserungsanstalt zu verwandeln, und unterstützte sie. Und obwohl er, wenn Istanbul kein Geld schickte, manchmal monatelang keinen Sold bekam, hatte er keine Ruhe, wenn er beim abendlichen Abzählen nicht anwesend war.
Als ihn am folgenden Tag in einem der engen Korridore wieder eine lähmende Schwäche überfiel und ihm das Herz schlug wie wild, ging er nicht nach Hause, sondern legte sich in einer leeren Zelle aufs Stroh und krümmte sich vor Schmerzen. Diesmal zitterte er auch und hatte entsetzliches Kopfweh, ganz besonders an der Stirn. Am liebsten hätte er geschrien, doch biss er die Zähne zusammen, da er glaubte, falls er sich still verhielt, würde der seltsame Schmerz von selbst verschwinden. Es war, als pressten Zwingen und Schraubstöcke seinen Kopf zusammen.
Er blieb in jener Nacht auf der Burg. Mit dem Pferdewagen waren es zehn Minuten bis zu ihm nach Hause, doch seine Frau und seine Tochter Zeynep waren es gewöhnt, dass er wegen Nachtwachen, Streitereien oder kleinen Aufständen manchmal nicht heimkam. Die Hochzeit seiner Tochter stand kurz bevor, und wegen der Vorbereitungen und Feilschereien gab es Abend für Abend Zank und Groll, und entweder Zeynep weinte oder seine Frau.
Als Bayram Efendi am Morgen in der Zelle wach wurde und seinen Körper abtastete, stieß er in der Schamgegend links oben über der Leiste auf eine weißliche Beule von der Größe eines kleinen Fingers. Wie ein Gürkchen sah sie aus. Als er mit seinem dicken Zeigefinger darauf drückte, tat es weh, als wäre Eiter darin, und sobald er den Finger wegnahm, war es wie zuvor. Solange man die Beule nicht anfasste, schmerzte sie also nicht. Irgendwie fühlte Bayram Efendi sich schuldig. Bei nüchterner Betrachtung musste die Beule etwas mit seiner Erschöpfung zu tun haben, mit dem Zittern, dem Delirium.
Was sollte er tun? Christen, Beamte, Militärs und Paschas suchten in solchen Fällen einen Arzt auf oder wenn vorhanden ein Krankenhaus. Manchmal kam es in einer Gemeinschaftszelle zu einer ansteckenden Durchfall- oder Fiebererkrankung, dann wurde die Zelle unter Quarantäne gestellt. Falls sich jemand dagegen auflehnte, beschwerte sich der Stubenälteste, und die renitenten Häftlinge wurden bestraft. Während des Vierteljahrhunderts, das Bayram Efendi in der Burg verbracht hatte, waren zum Teil venezianische Anbauten und Höfe nicht als Kerker, sondern auch als Zollstelle und Quarantänestation benutzt worden, daher waren ihm solche Maßnahmen nicht fremd. Er merkte aber, dass ihm mit einer Quarantäne auch nicht mehr gedient wäre. Er fühlte sich in den Klauen einer seltsamen Macht und verfiel in langen, fiebrigen Schlaf. Dann kam wieder wellenartig der Schmerz, und voller Angst musste er einsehen, dass jene Macht viel stärker war als er.
Am nächsten Tag raffte er sich auf und ging zum Mittagsgebet in die Kör-Mehmet-Pascha-Moschee, wo er zwei Bekannte zum Gruß umarmte. Unter großer Mühe lauschte er der Predigt, bekam aber nicht viel davon mit. Ihm war schwindlig, ihm drehte sich der Magen um, und kaum noch vermochte er sich auf den Beinen zu halten. Der Prediger sprach nicht über Krankheiten, sondern immer nur davon, dass alles von Gott komme. Als die Gläubigen danach auseinandergingen, wollte Bayram Efendi sich auf dem Teppich ausstrecken, um sich ein wenig auszuruhen, da merkte er aber schon, dass er das Bewusstsein verlor. Später weckten Leute ihn auf, da riss er sich zusammen und verheimlichte ihnen, dass er krank war (vielleicht hatten sie es auch schon gemerkt).
Er begriff, dass er sterben würde, und empfand das als Ungerechtigkeit. Warum gerade er, fragte er sich weinend. Er verließ die Moschee und machte sich auf den Weg ins Viertel Germe zu einem Scheich, bei dem man Gebetszettel und Amulette bekam. Der Scheich sprach mit jedermann über Themen wie die Pest und den Tod, doch war der dicke Mann, dessen Namen Bayram Efendi vergessen hatte, gerade nicht da. Statt seiner gab ein junger, freundlicher Mann mit einem schief sitzenden Fes sowohl Bayram Efendi als auch zwei anderen Männern, die wie er aus der Moschee gekommen waren, je ein besprochenes Amulett und einen Zettel mit einem Gebet darauf. Bayram Efendi versuchte, das Gebet zu lesen, doch verschwammen ihm die Zeilen. Wieder kam panikartig das Gefühl in ihm hoch, er sei an seinem Tod selbst schuld.
Als der Scheich kam, fiel Bayram Efendi ein, dass er ihn zuvor schon in der Moschee gesehen hatte. Nicht nur war er dick, sondern er hatte auch lange weiße Haare und einen langen weißen Bart. Aufmunternd lächelte der Scheich Bayram Efendi an und erklärte ihm, wie die Gebetszettel zu lesen seien: Wenn einem in der Nacht der Pestgeist erscheine, solle man dreiunddreißigmal hintereinander drei der Namen Allahs wiederholen, nämlich »Recep«, »Muktedik« und »Baki«. Falls man den Gebetszettel und das Amulett dem Geist entgegenhalte und die Namen neunzehnmal lese, könne man ihn sich ebenso vom Leib halten. Als der Scheich merkte, wie mitgenommen Bayram Efendi von seiner Krankheit schon war, trat er ein wenig zurück, was jenem nicht entging. Wenn man keine Zeit habe, die Namen Allahs aufzuzählen, solle man sich das Amulett um den Hals hängen und es mit dem Zeigefinger der rechten Hand berühren, dann tue es auch seine Wirkung. Wenn die Pestbeule auf der rechten Körperhälfte auftrete, solle man den Zeigefinger der linken Hand benutzen, wenn sie links auftrete, den der rechten Hand. Falls man anfange zu stottern, solle man das Amulett in beide Hände nehmen, sagte der Scheich noch, aber Bayram Efendi war nicht mehr in der Lage, all diese Vorschriften aufzunehmen, und ging nach Hause; er wohnte nicht weit weg. Seine liebe Tochter war nicht da. Als seine Frau merkte, wie krank er war, fing sie an zu weinen. Sie holte die Bettsachen aus dem Wandschrank und richtete ihm das Lager, und Bayram Efendi legte sich zitternd hin. Er wollte noch etwas sagen, doch aus seinem ausgetrockneten Mund kam kein einziges Wort.
In seinem Kopf brach ein Sturm los. Er zuckte mit den Armen, als sei er völlig verschreckt und jemand hinter ihm her. Beim Anblick dieses Fuchtelns weinte seine Frau Emine noch mehr, und da begriff Bayram Efendi, dass er dem Tode nahe war.
Als am Abend Zeynep heimkehrte, kam er ein wenig zu sich. Er sagte, das Amulett um seinen Hals beschütze ihn, dann verfiel er wieder in fiebrigen Schlaf und hatte die seltsamsten Albträume. Darin wogte er auf dem Meer dahin, umgeben von sprechenden Fischen und einer flammenumzüngelten Hundemeute. Das Feuer griff auf Ratten über, und brennende Teufel zermalmten Rosen. Eine Brunnenwinde, eine Mühle und eine offene Tür drehten sich unentwegt auf immer engerem Raum. Von der Sonne tropfte auf sein Gesicht Schweiß herab. Verstört wollte er davonlaufen, mal überschlug sich alles in seinem Kopf, mal stockte es. Und schlimmer noch, die Scharen von Ratten, die vor ein paar Wochen den Kerker, die Burg, ja ganz Minger gepeinigt hatten, über Küchen hergefallen waren, Matten, Stoffe und Bretter zernagt hatten, waren auf einmal in den Verliesen des Kerkers hinter ihm her. Bayram Efendi lief davon, fürchtete er doch, ihnen die falschen Gebete vorzulesen. Um in den letzten Stunden seines Lebens gehört zu werden, schrie er die Dinge in seinem Traum so laut an, wie er nur konnte, brachte aber kaum einen Ton hervor. Zeynep kniete neben ihm und unterdrückte ein Schluchzen.
Wie es bei Pestkranken oft geschieht, kam er noch einmal kurz zu sich. Seine Frau reichte ihm eine Schale mit herrlich duftender, heißer Suppe. Es war Tarhana-Suppe mit roten Paprikaschoten, wie sie in den Dörfern auf Minger oft zubereitet wurde (ein einziges Mal war Bayram Efendi von der Insel weggekommen). Er schlürfte seine Suppe, als wäre sie ein Zaubertrank, dann las er die Gebete, die der dicke Scheich ihm ans Herz gelegt hatte, und fühlte sich gleich besser.
Beim Abzählen im Kerker durfte am Abend kein Fehler unterlaufen; er musste da sofort hin. Er sagte das mehr zu sich selbst, und ohne sich von Frau und Tochter zu verabschieden, ging er das letzte Mal aus dem Haus, als wollte er nur kurz in den Garten oder auf den Abort. Seine Frau und seine Tochter glaubten nicht, dass er genesen sei, und weinten ihm hinterher.
Zur Zeit des Abendgebets ging Bayram Efendi erst zum Ufer hinunter. Vor den Hotels Splendid Palas und Majestik warteten Kutschen, Portiers und Herren mit Hut. Er kam an den Büros der Reedereien vorbei, die Verbindungen nach Izmir, Chania und Istanbul anboten, dann am Zollgebäude. Als er an der Hamidiye-Brücke anlangte, war er so schwach, dass er schon meinte, auf der Stelle sterben zu müssen. Zu dieser buntesten, belebtesten Stunde des Tages, zwischen Palmen und Platanen, sonnigen Straßen und freundlich blickenden Menschen war das Leben eigentlich schön. Unter der Brücke floss paradiesgrün der Fluss Arkaz, dahinter waren die alten Markthallen und gegenüber die Burg, deren Kerker er sein Leben lang bewacht hatte. Still weinte er vor sich hin, bis ihm die Tränen vor lauter Müdigkeit versiegten. Im goldenen Sonnenlicht sah die Burg noch rosafarbener aus als sonst.
Mit letzter Kraft ging er am Telegrafenamt vorbei die staubige Straße bis zum Meeresufer hinunter. Durch die gewundenen Gassen der Altstadt gelangte er an venezianischen Häusern vorbei zur Burg. Laut Augenzeugen habe er in der Gemeinschaftszelle Nummer zwei die Abzählung vorgenommen und danach im Wärterraum einen Lindenblütentee getrunken.
Nach Einbruch der Dunkelheit wurde er von niemandem mehr gesehen. Zu der Zeit, als die Aziziye in den Hafen einlief, vernahm zwar ein junger Wärter aus einer Zelle weiter unten ein Schreien und Weinen, das er in der folgenden Stille jedoch vergaß.
KAPITEL 4
Nachdem Bonkowski Pascha und sein Assistent auf Minger von Bord gegangen waren, steuerte die hochherrschaftliche Aziziye mit voller Kraft auf Alexandria zu. Die Delegation sollte den wütenden Muslimen in China gut zureden und sie davon abhalten, sich am rasch anwachsenden Volksaufstand gegen die westlichen Mächte zu beteiligen.
1894 hatte Japan China angegriffen, und die nach westlichen Maßstäben reformierte japanische Armee hatte dem traditionellen Methoden verhafteten chinesischen Heer in kurzer Zeit eine überraschend deutliche Niederlage beigebracht. Angesichts der Forderungen, die Japan nach dem Sieg stellte, hielt die chinesische Kaiserinwitwe es ebenso wie zwanzig Jahre zuvor Sultan Abdülhamit nach einer ähnlich gearteten Niederlage gegen die moderne russische Armee, nämlich bat sie die westlichen Mächte um Hilfe. Großbritannien, Frankreich und Deutschland verbündeten sich daraufhin, um China vor Japan zu beschützen. Allerdings verschafften sie sich im Gegenzug bedeutende wirtschaftliche und rechtliche Privilegien, teilten das Land allmählich in Kolonialgebiete auf (die Franzosen in Südchina, die Briten in Hongkong und Tibet, die Deutschen im Norden) und gewannen über Missionare immer mehr politischen und geistigen Einfluss.
Im einfachen Volk und insbesondere in konservativen und religiösen Kreisen gärte es. Es kam zu Aufständen gegen die regierenden Manschus und gegen »Fremde«, vor allem Christen und Europäer. Ausländern gehörende Betriebe wurden angezündet, Banken, Postämter, Klubs, Restaurants, Läden, Kirchen. Auf offener Straße wurden Missionare und zum Christentum bekehrte Chinesen getötet. Hinter der wachsenden Rebellion stand eine im Westen als »Boxer« bezeichnete Sekte, die ihre Anziehungskraft aus martialischen Ritualen bezog. Der zwischen konservativen und liberalen Kräften zerrissene chinesische Staat vermochte der Revolte nicht Herr zu werden, teilweise schlug sich die Armee auf die Seite der Aufständischen, und letztendlich tat dies sogar die Kaiserinwitwe. So wurden 1900 die ausländischen Gesandtschaften in Peking von chinesischen Soldaten umstellt, und auf den Straßen wurde Jagd auf Christen und Ausländer gemacht. Bevor die westlichen Verbündeten einschreiten konnten, wurde etwa der deutsche Botschafter Clemens von Ketteler ermordet, der eine aggressive Politik vertreten hatte.
Kaiser Wilhelm II. reagierte darauf mit harter Hand. Er entsandte neue Truppen als Teil eines internationalen Expeditionskorps und hielt bei deren Verabschiedung in Bremerhaven seine berühmte »Hunnenrede«, in der er den Soldaten anordnete, sich wie der Hunnenkönig Etzel »ohne Pardon« zu betragen und keine Gefangenen zu machen. Die westlichen Zeitungen waren voller Berichte darüber, was die aufständischen Boxer und die an ihrer Seite kämpfenden Muslime an barbarischen, primitiven Verbrechen begingen.
Wilhelm II. wandte sich telegrafisch an Abdülhamit und bat ihn um Unterstützung. Die aus der Region Gansu stammenden Soldaten, die den deutschen Botschafter ermordet hatten, waren nämlich Muslime. Dem Kaiser zufolge müsse Sultan Abdülhamit als Kalif und damit geistliches Oberhaupt aller Muslime auf der Welt etwas tun, um solche blinden Angriffe rasender muslimischer Soldaten auf Christen zu unterbinden, indem er etwa selbst mit Truppen zum Expeditionskorps beitrage.
Es fiel Abdülhamit schwer, den Wunsch der Franzosen, die ihm gegen Russland halfen, der Engländer, die zusammen mit jenen in China kämpften, und der Deutschen, deren Kaiser ihn sogar in Istanbul besucht hatte, einfach abzuschlagen. Er wusste nur zu gut, dass die drei Mächte auch koalieren und sich den kranken Mann am Bosporus (der Spruch stammte von Zar Nikolaus) einfach einverleiben und in lauter Kleinstaaten aufteilen konnten, in denen jeweils eine andere Sprache gesprochen würde.
Abdülhamit verfolgte die muslimischen Aufstände gegen die westlichen Großmächte mit gemischten Gefühlen. Soweit er sich aus Berichten ein Bild davon machen konnte, interessierte er sich für die zahllosen muslimischen Rebellionen in China sowie für das Wirken Mirza Ghulam Ahmads in Indien gegen die Briten. Verständnis brachte er für den Widerstand des »Mad Mullahs«, wie die Briten ihn nannten, in Somaliland und für diverse andere islamistische Aufstände in Afrika und Asien auf. Zur Beobachtung bestimmter Rebellionen gegen den Westen und das Christentum entsandte er Militärattachés und ließ manchen Aufständischen ohne Wissen seiner eigenen Bürokratie (es wimmelte ja überall von Spionen) unter der Hand Unterstützung zukommen. Wegen des schleichenden Zerfalls des Osmanischen Reiches speziell auf dem Balkan und den Mittelmeerinseln spielte die orthodoxe Bevölkerung eine immer geringere Rolle, was Abdülhamit dazu bewog, mehr auf den Islam zu setzen (was er eigentlich schon immer tat), um damit die muslimischen Massen diverser Staaten gegen den Westen auf seine Seite zu bringen und den Großmächten ein wenig drohen zu können. Kurz gesagt entdeckte Abdülhamit für sich, was wir heute den »politischen Islam« nennen.
Ein überzeugter und konsequenter Islamist und Glaubenskrieger war der Opern- und Krimiliebhaber Abdülhamit jedoch keineswegs. Während des Aufstands von Urabi Pascha in Ägypten hatte der Sultan von Anfang an begriffen, dass die Rebellion sich im Grunde nicht nur gegen die Briten, sondern gegen Ausländer im Allgemeinen und damit auch gegen die Osmanen richtete, und insgeheim hatte er sich gewünscht, die Briten würden den Aufstand niederschlagen. Den Mahdi-Aufstand im Sudan, der mit dem Tod des unter den Muslimen sehr beliebten, als »Gordon Pascha« bekannten Charles Gordon zu Ende gegangen war, hatte Abdülhamit, nicht zuletzt unter dem Druck des britischen Botschafters in Istanbul, als »Auflehnung des Gesindels« abgetan, womit er sich faktisch auf die Seite der Briten schlug.
Abdülhamit wollte einerseits die europäischen Großmächte nicht gegen sich aufbringen und sich andererseits als Oberhaupt sämtlicher Muslime der Welt gerieren. Um diese widersprüchlichen Ziele einigermaßen in Einklang zu bringen, beschloss er, keine osmanischen Soldaten zur Bekämpfung muslimischer Aufständischer zu entsenden, den chinesischen Muslimen jedoch über eine Delegation zu vermitteln, dass sie gegen die Europäer nicht Krieg führen sollten.
Den Leiter der Delegation, der nunmehr in seiner Kabine keinen Schlaf fand, hatte Abdülhamit selbst ausgewählt und dem erfahrenen Brigadegeneral zwei Hodschas zur Seite gestellt, die er ebenfalls persönlich kannte und schätzte, nämlich einen Lehrer der Islamkunde und einen umsichtigen islamischen Rechtsgelehrten, der eine mit einem schwarzen, der andere mit einem weißen Bart. Die beiden Hodschas saßen den ganzen Tag in der geräumigen Gemeinschaftskabine der Aziziye vor einer an der Wand angebrachten riesigen Karte des Osmanischen Reiches und diskutierten darüber, mit welcher Logik die chinesischen Muslime am ehesten zu überzeugen wären. Der Historiker vertrat die Auffassung, ihre eigentliche Aufgabe bestünde nicht darin, die chinesischen Muslime zu besänftigen, sondern ihnen die Macht des Islams und seines obersten Hüters Abdülhamit vor Augen zu halten. Der bedächtige weißbärtige Rechtsgelehrte gab zu bedenken, dass von einem Heiligen Krieg erst dann die Rede sein könne, wenn der König oder Sultan des betreffenden Landes sich daran beteilige, wogegen die chinesische Kaiserinwitwe den Aufständischen ihre Unterstützung schon versagt habe. Manchmal nahmen an der Diskussion auch andere Mitglieder der Delegation teil, etwa Dolmetscher und Militärs.
Als die Aziziye im Schein des Vollmonds Kurs auf Alexandria nahm, sah Damat Doktor Nuri in seiner Kabine noch Licht und holte daraufhin seine Frau in den großen Salon vor die Wandkarte. Diese stellte die aktuelle Verbreitung des von Pakize Sultans Urahnen sechshundert Jahre zuvor gegründeten Osmanischen Reiches dar. Abdülhamit hatte sie im Herbst 1880 anfertigen lassen, vier Jahre, nachdem er als Vierunddreißigjähriger den Thron bestiegen hatte. Auf dem Berliner Kongress hatte das Reich mithilfe der Briten gerade einen Teil der an die Russen verlorenen Gebiete zurückbekommen. Kaum war Abdülhamit nämlich an die Macht gelangt, war ein Krieg ausgebrochen, durch den die Osmanen große Landesteile eingebüßt hatten (Serbien, Thessalien, Montenegro, Rumänien, Bulgarien, Kars, Ardahan). Nach diesen enormen Verlusten hatte Abdülhamit sich geschworen, damit sei nun Schluss, das Reich werde keine Gebiete mehr abtreten, und aus dieser Einstellung heraus hatte er die Karte erstellen und sie mit Kutschen und Zügen, auf Kamelen und Schiffen bis in die entlegensten Landesteile schaffen lassen, in jede Garnison, jeden Landkreis, jede Botschaft. An vielen Orten des Reiches, das sich von Damaskus bis Janina, von Mossul bis Saloniki und von Istanbul bis in den Hedschas erstreckte, hatten die Delegierten die Karte schon gesehen und waren jedes Mal von der Größe des Reiches beeindruckt gewesen, wenn sie auch einsehen mussten, dass mit der Zeit leider ein sich beschleunigender Schrumpfungsprozess eingetreten war.
Es sei hier von einer Anekdote berichtet, die Pakize Sultan im Yıldız-Palast vernommen und sowohl ihrem Mann erzählt als auch ihrer Schwester brieflich noch mal zum Besten gegeben hatte. Demnach sei Sultan Abdülhamit eines Tages ins Zimmer seines etwa zehnjährigen Sohnes Selim gegangen, den er sehr liebte, und habe sich gefreut, den Jungen mit einer kleineren Ausgabe jener Karte beschäftigt zu sehen. Als der Sultan näher getreten sei, habe er bemerkt, dass manche Landesteile wie in einem Malbuch schwarz ausgemalt waren, und als er noch näher hingesehen habe, sei ihm aufgefallen, dass die schwarz angemalten Gebiete gerade die waren, die er seit seiner Thronbesteigung verloren beziehungsweise unter Wahrung des Gesichtes kampflos übergeben hatte (auch wenn sie auf der Karte noch als osmanisch ausgewiesen waren). Da habe den Sultan auf den missratenen Sohn, der seinen Vater für die Schrumpfung des Reiches verantwortlich machte, eine maßlose Wut gepackt. Pakize Sultan, die auf ihren Onkel Abdülhamit eine ebensolche Wut hatte, schrieb ferner, zehn Jahre darauf habe sich die Wut des Sultans noch gesteigert, als eine junge Haremsfrau, auf die er ein Auge geworfen habe, sich ausgerechnet in seinen Sohn Selim verliebt habe.
Als Kind hatte Pakize Sultan immer wieder von den katastrophalen Gebietsverlusten reden hören, die kurz nach der Absetzung ihres Vaters begonnen hatten. Innerhalb von vierzehn Monaten hatte das Osmanische Reich einen großen Teil der Besitzungen auf dem Balkan verloren, die es vierhundert Jahre lang innegehabt hatte. Russische Soldaten in blaugrünen Uniformen standen im nur vier Stunden von Istanbul entfernten San Stefano, und in Istanbul selbst wurden auf Plätzen und in Parks Armeezelte für die hellhäutigen, grünäugigen Balkan-Muslime aufgebaut, die vor dem russischen Heer geflüchtet waren.
Ohne Tränen zu vergießen, erinnerten die beiden Jungvermählten einander an die anderen Katastrophen, die damals in aller Munde waren. Noch vor dem Ende des Berliner Kongresses 1878 war das östlich von Minger gelegene Zypern mit seinen duftenden Orangengärten, seinen Olivenhainen und Kupferminen unter britische Kontrolle geraten. Ost-Rumelien und Thessalien verblieben unter einem christlichen Gouverneur formell Bestandteil des Osmanischen Reiches, waren jedoch im Gegensatz zu dem, was die Karte anzeigte, genauso wie Ägypten längst nicht mehr osmanischer Boden. Ägypten wurde 1882 von den Briten besetzt, nachdem diese während des antieuropäischen Aufstands von Urabi Pascha die Stadt Alexandria von Kriegsschiffen aus beschossen hatten, weil die dort lebenden Christen angeblich bedroht würden. (Der immer mehr unter Verfolgungswahn leidende Abdülhamit argwöhnte schließlich, die Briten hätten den Aufstand überhaupt erst in Szene gesetzt, um Ägypten an sich zu reißen.) Bereits 1881 hatten die Franzosen Tunesien erobert. Wie der Zar schon vierzig Jahre zuvor geunkt hatte, brauchten die Großmächte sich lediglich zusammenzutun, um das Erbe des »kranken Mannes« unter sich aufzuteilen.
Die Delegierten, die den ganzen Tag vor der veralteten Karte verbrachten, sorgten sich allerdings um etwas, das darauf gar nicht verzeichnet war: Die europäischen Staaten unterstützten die christlichen Minderheiten des Reiches, die sich mit der Zentralmacht immer wieder nationalistisch-separatistische Scharmützel lieferten, doch waren jene Staaten dem Osmanischen Reich nicht nur militärisch überlegen, sondern auch an Wirtschaftskraft, Verwaltungseffizienz und Bevölkerung. 1901 lebten auf dem Boden des riesigen Osmanischen Reiches lediglich neunzehn Millionen Menschen, von denen fünf Millionen keine Muslime waren. Trotz der höheren Steuern, die man jenen abverlangte, wurden sie als Bürger zweiter Klasse behandelt, sodass sie »Gerechtigkeit«, »Gleichheit« und »Reformen« forderten und sich von den europäischen Staaten Schutz erhofften. Russland, mit dem das Reich sich immer wieder bekriegte, hatte siebzig Millionen Einwohner, das freundschaftlich verbundene Deutschland an die fünfundfünfzig Millionen. Die Wirtschaftsleistung der europäischen Länder mit Großbritannien an ihrer Spitze betrug das Fünfundzwanzigfache der kümmerlichen osmanischen Produktion. Die Muslime, die die Hauptlast der Verwaltungs- und Militäraufgaben schulterten, verloren überdies an Einfluss gegenüber der griechischen und armenischen Kaufmannsschicht, die auch in den Provinzen außerhalb Istanbuls immer mehr erstarkte. Die dortigen Statthalter hatten den freiheitlichen Bestrebungen dieser aufsteigenden Bourgeoisie nichts entgegenzusetzen, und das Militär kannte auf die Forderungen der Christen, höchstens so viele Steuern zu bezahlen wie die Muslime und ihre Gebiete selbst zu verwalten, keine andere Antwort, als die regelmäßig aufflammenden Aufstände brutal niederzuschlagen und ihre Anführer zu foltern, zu töten oder in die Verbannung zu schicken.
Als Pakize und Nuri wieder in ihrer Kabine waren, sagte Pakize: »Da ist wieder dieser böse Geist in Sie gefahren! Woran dachten Sie gerade?«
»Wie schön es doch ist, dass wir das alles mal hinter uns lassen und nach China fahren!«
Seine Frau hatte ihm aber angesehen, dass er an Bonkowski Pascha dachte, an die Seuche auf Minger.
KAPITEL 5
In dem für Minger typischen Boot aus Kiefernholz mit spitz zulaufendem Bug fuhren Bonkowski Pascha und sein Assistent Doktor Ilias an den hohen Mauern der Burg entlang. Es war nichts zu hören außer dem Knarzen der Riemen und dem Schwappen der Wellen an die Felsen, auf denen die Burg seit sieben Jahrhunderten ruhte. Nur in ein paar Fenstern brannte Licht, doch im zauberhaften Mondschein wirkte die Hauptstadt von Minger wie eine weißlich-blassrote Fata Morgana. Als Positivist lag Bonkowski Pascha jeglicher Aberglaube fern, doch jenem Anblick schien etwas Verhängnisvolles anzuhaften. Obwohl Sultan Abdülhamit ihm schon vor Jahren das Privileg erteilt hatte, auf der Insel Rosen zu züchten, war dies sein erster Besuch dort. Jahrelang hatte er sich diesen als etwas Fröhliches, Feierliches vorgestellt, und nie wäre ihm in den Sinn gekommen, sich einmal mitten in der Nacht wie ein Dieb in den dunklen Hafen zu schleichen.
Als das Boot eine kleine Bucht erreichte, verlangsamte der Ruderer die Fahrt. Vom Ufer wehte ein feuchter Duft nach Lindenblüten und Algen herüber. Das Boot fuhr nicht zu der Anlegestelle, an der ansonsten Reisende vom Zoll abgefertigt wurden, sondern zum alten Fischerpier am Arabischen Leuchtturm, der aus der Zeit der arabischen Besatzung stammte. Das hatte der Gouverneur Sami Pascha so angeordnet, denn der Ort war nicht nur dunkler und einsamer, sondern auch vom Regierungsgebäude weit entfernt.
Bonkowski Pascha und Ilias reichten zwei schwarzberockten Beamten ihr Gepäck, dann ließen sich von ihnen auf die Anlegestelle helfen. Ungesehen bestiegen sie die vom Gouverneur gesandte Kutsche, einen gepanzerten Landauer, den Sami Pascha für geheime Besucher benutzte, oder wenn er vom Volk unbehelligt sein wollte. Sein Vorgänger, ein fülliger, argwöhnischer Mensch, hatte nicht nur die Drohbriefe romantisch veranlagter griechischer Anarchisten ernst genommen, die die Insel den Osmanen entreißen wollten, sondern auch deren Neigung, tatsächlich Attentate zu verüben, und so hatte er von Köse Kudret, dem angesehensten Schmied von Arkaz, Panzerplatten anfertigen lassen und das Geld dafür dem stets defizitären Regierungsetat entnommen.
Der Kutscher Zekeriya lenkte das Gefährt am Ufer entlang an dunklen Hotels und Zollgebäuden vorbei, fuhr dann aber nicht in den Istanbul-Boulevard weiter, die Prachtstraße der Insel, sondern bog nach links in eine Seitenstraße ab. Durchs Kutschenfenster sogen Bonkowski Pascha und Doktor Ilias den Duft von Geißblatt und Kiefern ein. Im Mondschein sahen sie moosbewachsene alte Steinmauern, Holztüren, Häuserfronten mit rosafarbenen Dachziegeln und geschlossenen Fenstern. Als die Kutsche über gewundene Steilstraßen den Hamidiye-Platz erreichte, erblickten sie den Uhrturm, der zum 31. August, dem fünfundzwanzigsten Jahrestag der Thronbesteigung Abdülhamits, hätte fertig werden sollen, nun aber leider unvollständig emporragte. Vor der griechischen Mittelschule und dem früher als Telegrafenamt bekannten Postamt fielen ihnen brennende Fackeln auf, desgleichen die Wächter, die Sami Pascha nach Aufkommen der Pestgerüchte an diversen Straßenecken hatte aufstellen lassen.
»Sami Pascha ist ein seltsamer Mensch«, sagte Bonkowski, als sie in ihrem Zimmer des Gästehauses alleine waren. »Dennoch hätte ich nicht gedacht, die Stadt in so blühendem, friedlichem Zustand anzutreffen. Falls wir uns im Dunkel nicht versehen haben, ist das alles sein Verdienst.«
Der aus Istanbul stammende griechische Doktor Ilias diente dem Chefchemiker des Sultans seit neun Jahren als Assistent. Gemeinsam hatten sie überall im Reich Seuchen bekämpft und dabei in allen möglichen Hotelzimmern, Garnisonen und Krankenhäusern übernachtet. Vor fünf Jahren hatten sie mit einem per Schiff herangeschafften Desinfektionsmittel ganz Trabzon eingesprüht und damit von der Cholera befreit. Ein andermal, 1895, waren sie zur Bekämpfung der Cholera in der Gegend von Izmit und Bursa von Dorf zu Dorf gezogen und hatten in Armeezelten übernachtet. Doktor Ilias war Bonkowski per Zufall von Istanbul zugewiesen worden, doch mittlerweile hatte der Pascha sich angewöhnt, seinem Assistenten rückhaltloses Vertrauen zu schenken. Wegen ihres immensen Wissens und ihres rastlosen Wirkens in allen Gefilden des Reiches galten sie bei der osmanischen Bürokratie und insbesondere den Gesundheitsbehörden als zwei »gelehrte Retter«.
»Als ich vor zwanzig Jahren von Seiner Hoheit beauftragt wurde, in Dedeağaç eine Choleraepidemie einzudämmen, war Sami Pascha dort Gouverneur. Ich musste damals dem Sultan berichten, Sami Pascha habe mir und meinen Quarantäneärzten gegenüber ein abweisendes Verhalten an den Tag gelegt und somit unsere Maßnahmen verzögert, was zum Verlust von mehr Menschenleben geführt habe. Davon hat er Wind bekommen, und womöglich ist er mir nun feindlich gesinnt.«
Diese Worte äußerte Bonkowski in einem Türkisch, das unserem heutigen ziemlich ähnelt. Da er sein Chemiestudium aber in Paris absolviert und Doktor Ilias ebenfalls in Paris Medizin studiert hatte, unterhielten die beiden sich manchmal auf Französisch. Während sie sich in den Räumlichkeiten, die sie im Dunkeln betreten hatten, zu orientieren versuchten, sagte der sechzigjährige Bonkowski jedenfalls wie im Traum auf Französisch: »Mir schwant hier nichts Gutes.«
Wegen eines beständigen Geräusches, das sie als ein Huschen von Ratten interpretierten, fanden sie kaum Schlaf. Schon in Izmir war der Kampf gegen die Pest gewissermaßen ein Kampf gegen die Ratten gewesen. Sie wunderten sich, dass der Gouverneur in einem unter seiner Verwaltung stehenden Gästehaus keine Rattenfallen aufgestellt hatte. Dass die Pest sich durch Ratten und die auf ihnen nistenden Flöhe übertrug, war schließlich schon in unzähligen Telegrammen an sämtliche Provinzen und Quarantänedirektionen vermeldet worden.
Am Morgen merkten sie, dass nicht Ratten sie wach gehalten hatten, sondern Möwen, die auf das Dach des baufälligen Holzhauses flogen und von dort wieder davonflatterten. Um die beiden vom neugierigen Journalistenvolk der Insel, von den klatschsüchtigen Geschäftsleuten und den niederträchtigen Konsuln erst mal fernzuhalten, hatte Sami Pascha sie nicht im großen Gästehaus des neuen Regierungsgebäudes untergebracht, sondern in dem alten Holzgebäude, das er dazu hatte herrichten und bewachen lassen.