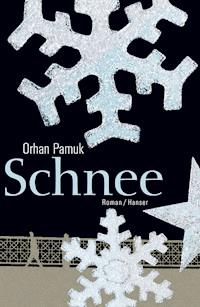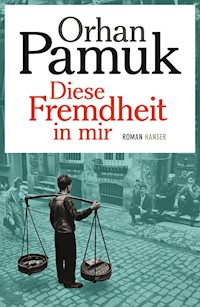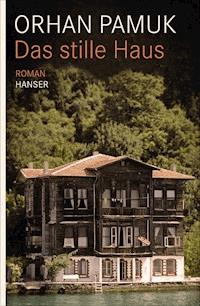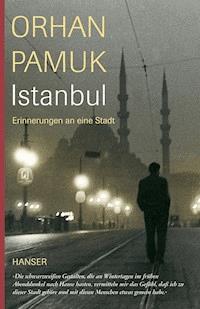
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hanser, Carl
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Orhan Pamuk, der 2006 den Nobelpreis für Literatur erhielt, ergründet in Istanbul die Geheimnisse seiner eigenen Familie und führt uns an die verlorenen Paradiese der sagenhaften Stadt. Er beschreibt die verwunschenen Villen und verwilderten Gärten, die Wasserstraßen des Bosporus und des Goldenen Horns und die melancholischen Gassen der Altstadt. "Istanbul" ist ein Porträt der legendären Stadt an der Schnittstelle zwischen Ost und West und zugleich ein Selbstbildnis des Schriftstellers als junger Mann
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 509
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hanser E-Book
Orhan Pamuk
Istanbul
Erinnerungen an eine Stadt
Aus dem Türkischenvon Gerhard Meier
Carl Hanser Verlag
Die türkische Originalausgabe erschien 2003 unter dem Titel İstanbul bei Yapı Kredi Yayınları in Istanbul.
Die Arbeit des Übersetzers am vorliegenden Text wurde vom Deutschen Übersetzerfonds gefördert.
ISBN 978-3-446-25229-5
© Orhan Pamuk 2003
Alle Rechte der deutschen Ausgabe
© Carl Hanser Verlag München 2006/2016
Schutzumschlag: Peter-Andreas Hassiepen,München, unter Verwendung zweier Fotografien von Ara GülerSatz: Fotosatz Amann, Memmingen
Unser gesamtes lieferbares Programm und viele andere Informationen finden Sie unter www.hanser-literaturverlage.de
Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf www.facebook.com/HanserLiteraturverlage oder folgen Sie uns auf Twitter: www.twitter.com/hanserliteratur
Datenkonvertierung E-Book: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
Inhaltsverzeichnis
1 Ein zweiter Orhan
2 Die Fotos im dunklen Museumshaus
3 »Ich«
4 Die Melancholie verfallener Pascha-Konaks: die Entdeckung der Straße
5 Schwarzweiß
6 Bosporus-Erkundungen
7 Mellings Bosporus-Ansichten
8 Meine Eltern und ihre Abwesenheiten
9 Noch ein Zuhause: Cihangir
10 »Hüzün« – Melancholie – Tristesse
11 Vier einsame, melancholische Schriftsteller
12 Meine Großmutter
13 Schulische Leiden und Freuden
14 Nekcups Nedob Ned Fua Tchin
15 Ahmet Rasim und andere Stadtbriefschreiber
16 Laufen Sie nicht mit offenem Mund durch die Stadt
17 Die Freuden des Zeichnens
18 Reșat Ekrem Koçus Wissens- und Kuriositätensammlung: Die Istanbul-Enzyklopädie
19 Eroberung oder Fall? Die Türkisierung Konstantinopels
20 Religion
21 Die Reichen
22 Den Bosporus durchfahrende Schiffe, Brände, Armut, Umzüge und andere Katastrophen
23 Nerval in Istanbul: Spaziergänge durch Beyoğlu
24 Gautiers melancholische Spaziergänge durch die Vorstadt
25 Unter den Augen des Westens
26 Melancholie des Verfalls: Tanpınar und Yahya Kemal in den Außenbezirken der Stadt
27 Das Pittoreske an den Armenvierteln
28 Ich male Istanbul
29 Malen und Familienglück
30 Schiffsrauch auf dem Bosporus
31 Flaubert in Istanbul: der Osten, der Westen und die Syphilis
32 Geschwisterzank
33 Fremd in einer ausländischen Schule
34 Unglück bedeutet, sich selbst und die Stadt zu verabscheuen
35 Erste Liebe
36 Das Dampfschiff auf dem Goldenen Horn
37 Ein Gespräch mit meiner Mutter: Geduld, Vorsicht, Kunst
Bildnachweis
Register
Meinem Vater Gündüz Pamuk gewidmet(1925–2002)
Die Schönheit der Landschaftliegt in ihrer Melancholie.Ahmet Rasim
1Ein zweiter Orhan
Als Kind wurde ich lange den Gedanken nicht los, irgendwo in Istanbul, in einem Haus wie dem unseren, müsse noch ein zweiter Orhan leben, ein Ebenbild von mir, ein Zwilling, ein zweites Selbst. Wann und wie mich diese Vorstellung zum erstenmal überkam, das weiß ich nicht mehr. Sie hat sich wohl allmählich in mir festgesetzt, durch Spiele, Ängste, Mißverständnisse und Zufälle. Um zu verdeutlichen, was damals in mir vorging, möchte ich einen der ersten Momente schildern, in denen jener Gedanke mir klar vor Augen stand.
Als ich fünf war, kam ich für eine Zeitlang zu einer anderen Familie. Bei meinen Eltern war es nach Streit und Trennung einmal wieder zu einer Versöhnung gekommen, allerdings in Paris, und mein großer Bruder und ich waren inzwischen getrennt untergebracht. Während mein Bruder im »Pamuk Apartmanı«, dem mehrstöckigen Wohnhaus unserer Familie im Stadtviertel Nișantașı, unter der Obhut meiner Großmutter blieb, schickte man mich zu einer Tante in den Stadtteil Cihangir. In deren Haus, in dem ich stets freundlich aufgenommen wurde, hing in einem weißen Rahmen ein kleines Kinderfoto, und immer wieder mal zeigte meine Tante oder mein Onkel darauf und sagte lächelnd zu mir: »Schau, das bist du!«
Irgendwie ähnlich sah mir der drollige Junge auf dem Foto schon, und er trug auch so eine Mütze, wie ich selbst sie oft aufhatte. Dennoch wußte ich, daß das nicht wirklich ein Foto von mir war. (Es handelte sich wohl um ein kitschiges europäisches Kalenderfoto.) War vielleicht das jener zweite Orhan, der in einer anderen Wohnung lebte und mir nicht aus dem Kopf ging?
Aber nun war ich ja selbst in einer anderen Wohnung, und das war quasi die Voraussetzung gewesen, um den anderen Orhan zu treffen. Mir war jedoch diese Begegnung gar nicht recht, ich wollte zurück in mein eigentliches Zuhause, in das Pamuk Apartmanı. Wenn mir gesagt wurde, der Junge auf dem Foto sei ich, geriet mir alles ein wenig durcheinander, mein eigenes Foto und das des Jungen, ich selbst und mein Ebenbild, dazu noch meine Visionen von einer anderen Wohnung, und dann wollte ich nur noch zu Hause sein, im trauten Kreis unserer großen Familie.
Dieser Wunsch ging in Erfüllung, denn bald darauf wurde ich ins Pamuk Apartmanı zurückgeholt. Die faszinierende Vorstellung von dem zweiten Orhan ließ mich jedoch nicht los, sondern spukte mir die ganze Kindheit und Jugend über im Kopf herum. Wenn ich an Winterabenden in den Straßen Istanbuls an Häusern vorbeikam, aus denen warmes gelbes Licht schien, und ich mir vorstellte, was die Menschen dort drinnen wohl für ein glückliches, behagliches Leben führten, und wenn ich versuchte, davon auch einen Blick zu erhaschen, dann durchfuhr mich der Gedanke, es lebe dort der zweite Orhan. Mit fortschreitendem Alter wurde mir diese Vorstellung zum immer reicheren Phantasiegebilde und ging in meine Träume ein. Dort traf ich in immer wieder anderen Häusern mit Orhan zusammen und wachte manchmal schreiend aus Alpträumen auf, in denen er und ich uns lange stumm und eiskalt angeblickt hatten. Dann klammerte ich mich im Halbschlaf noch fester an mein Kopfkissen, mein Haus, meine Straße. Wenn ich mich unglücklich fühlte, stellte ich mir gerne vor, daß ich in ein anderes Haus, ein anderes Leben gehen würde, eben dorthin, wo jener Orhan wohnte, und dann freundete ich mich mit dem Gedanken an, ich selbst sei dieser Orhan, und weidete mich an seinem Glück. Das richtete mich so sehr auf, daß ein tatsächlicher Ortswechsel gar nicht mehr nötig war.
Seit meiner Geburt bin ich den Wohnungen, den Straßen und den Vierteln, in denen ich gelebt habe, stets treu geblieben. Daß ich trotz mehrerer Umzüge innerhalb Istanbuls nach fünfzig Jahren heute wieder im Pamuk Apartmanı wohne, wo einst meine Mutter mich auf den Arm nahm und mir zum erstenmal die Welt zeigte und auch die ersten Fotos von mir gemacht wurden, hat gewiß auch mit der tröstlichen Vorstellung von jenem zweiten Orhan zu tun. In einer migrationsfreudigen Zeit, die Mobilität als Zeichen von Dynamik ansieht, fünfzig Jahre lang in der gleichen Stadt zu wohnen, ja sogar ins gleiche Haus zurückzukehren, ist so untypisch für Istanbul, wie es typisch für mich ist. »Geh doch mal raus, fahr irgendwohin, mach eine Reise«, so lauteten die Standardseufzer meiner Mutter.
Es gibt Schriftsteller wie Joseph Conrad, Nabokov oder Naipaul, die den Wechsel in andere Sprachen, Völker, Länder, Kontinente, ja Zivilisationen erfolgreich bewältigt haben. So wie sie aus Exil und Emigration eine Stärkung ihrer schöpferischen Identität bezogen, so hat es mein eigenes Selbstverständnis geprägt, über die Jahre hinweg auf das gleiche Haus, die gleiche Straße, den gleichen Ausblick, die gleiche Stadt fixiert zu sein.
Als Flaubert hundertzwei Jahre vor meiner Geburt nach Istanbul kam, war er von dem Menschengewoge und dem ganz eigenen Gepräge der Stadt so beeindruckt, daß er in einem Brief die Vermutung äußerte, Konstantinopel werde in hundert Jahren die Hauptstadt der Welt sein. Nun, durch den Zusammenbruch des Osmanischen Reiches ist so ziemlich das Gegenteil von dem eingetreten, was Flaubert vorausgesagt hatte. Als ich auf die Welt kam, war Istanbul so heruntergekommen, geschwächt und isoliert wie nie zuvor in seiner zweitausendjährigen Geschichte. Seit ich denken kann, ist die Stadt von Armut gekennzeichnet, von Untröstlichkeit über den Verfall des Reiches, von der Melancholie, die von den Überresten aus großer Zeit ausgeht. So bin ich seit jeher damit beschäftigt, diese Melancholie zu bekämpfen oder mich dann doch, wie alle Istanbuler, ihr endlich hinzugeben.
Wer sich auch nur einigermaßen mit Sinnfragen beschäftigt, der wird wenigstens einmal im Leben darüber nachdenken, warum er gerade in diese Zeit und diesen Ort hineingeboren ist. Sind wir gut genug weggekommen mit dieser Familie, dieser Stadt, diesem Land, die uns quasi per Los zugefallen sind und die wir nun lieben sollen (was uns schließlich auch gelingt)? Daß ich in einem Istanbul geboren wurde, das unter der Asche und den Trümmern eines zerfallenen Reiches arm und schwermütig vor sich hin altert und verblaßt, empfinde ich manchmal als Pech. (Eine innere Stimme sagt mir aber, daß es eigentlich ein Segen ist.) Was das Materielle angeht, kann ich von Glück reden, in eine wohlhabende Familie geraten zu sein (doch habe ich auch damit schon gehadert). Meist aber ist mir klar, daß meine Geburts- und Lebensstadt Istanbul mir unentrinnbares Schicksal ist, so wie ich mir auch mit Erfolg einrede, daß ich mich über meinen Körper nicht beklagen darf (obwohl ich ruhig ein bißchen besser aussehend und kräftiger gebaut sein könnte) oder über mein Geschlecht (ob ich als Frau wohl weniger Probleme mit der Sexualität hätte?). Von Istanbul als meinem Schicksal handelt nun dieses Buch.
Ich bin am 7. Juni 1952 kurz nach Mitternacht in einer kleinen Privatklinik im Stadtteil Moda zur Welt gekommen. Es war eine ruhige Nacht, in den Gängen der Klinik ebenso wie im Rest der Welt. Abgesehen von der Aktivität des Stromboli, der zwei Tage zuvor plötzlich angefangen hatte, Feuer zu speien, tat sich auf unserem Planeten nichts Erschütterndes. In den Zeitungen war von unseren Soldaten die Rede, die im Koreakrieg kämpften, und von amerikanischen Gerüchten, laut denen die Nordkoreaner den Einsatz von biologischen Waffen planten. Wie die meisten Istanbuler las aber meine Mutter in den Stunden vor meiner Geburt vor allem Nachrichten über »unsere Stadt«, und ganz besonders aufmerksam die folgende: Ein Textilhändler identifizierte die Leiche eines vorbestraften Einbrechers und erkannte darin den Mann, der im Vorjahr am hellichten Tag seinen Laden in Harbiye überfallen und ausgeraubt hatte. Der Einbrecher hatte in der Nacht zuvor versucht, mit einer furchterregenden Maske durch das Toilettenfenster in ein Haus in Langa einzubrechen, war ertappt und von Nachtwächtern und den »tapferen« Bewohnern eines Studentenwohnheims verfolgt und schließlich in einem Holzlager in die Enge getrieben worden, wo er seine Verfolger noch wüst beschimpft und dann Selbstmord begangen hatte. Meine Mutter las diese Nachrichten im Krankenhaus allein, denn wie sie mir Jahre später gekränkt berichtete, war meinem Vater das Warten zu lang geworden, so daß er die Klinik verlassen und sich mit Freunden getroffen hatte. Im Entbindungssaal leistete ihr dann nur ihre Schwester Beistand, die es spätabends lediglich dadurch in die Klinik schaffte, daß sie kurzerhand über die Gartenmauer kletterte. Als meine Mutter mich zum erstenmal sah, fand sie mich sogleich zarter und schmächtiger als meinen zwei Jahre älteren Bruder.
Es gibt im Türkischen eine von mir sehr geschätzte spezielle Vergangenheitsform für alles, was in Träumen und Märchen geschieht oder wir nicht direkt miterlebt haben, und im Grunde genommen ist das auch das geeignete Tempus, um alles wiederzugeben, was wir in der Wiege erleben, im Kinderwagen oder bei unseren ersten wackeligen Schritten. Unsere ersten Lebenserfahrungen werden uns ja später von unseren Eltern vermittelt, und wir hören dann gerührt die Geschichte unserer Gehversuche und unseres ersten Gestammels, als sei gar nicht von uns selbst die Rede. Dieses süße Gefühl, das in etwa dem Vergnügen ähnelt, im Traum sich selbst zu sehen, wird mit der Zeit aber eher zu einem Handicap, das wir unser Leben lang nicht mehr loswerden: Wir gewöhnen uns nämlich daran, alles Erlebte – und selbst die höchsten Genüsse – danach zu bewerten, wie andere es sehen. Genau wie unsere ersten »Erinnerungen« aus der Babyzeit, die wir von anderen so oft erzählt bekommen, bis sie ganz zu unseren eigenen geworden sind, so daß wir schließlich meinen, uns wirklich daran erinnern zu können, und sie gutgläubig weitererzählen, so wird auch im späteren Leben oft das, was andere über unser Tun und Lassen denken, uns nicht nur zum eigenen Gedankengut, sondern auch zu einer Erinnerung, die uns wichtiger als das Erlebte selbst ist. Und was für unser Leben zutrifft, gilt auch für unsere Stadt: Deren wahre Bedeutung erfahren wir von anderen.
Wenn ich mir als Erinnerung zu eigen mache, was andere über mich oder über Istanbul erzählt haben, dann würde ich meinen Bericht am liebsten in diesem Ton formulieren: »Es war einmal ein Orhan, der in Istanbul geboren wurde und aufwuchs, ein aufgeweckter, nicht immer ganz braver Junge, der Bilder malte und mit Zweiundzwanzig plötzlich anfing, Romane zu schreiben.« Mein Leben würde somit dargestellt, als hätte ein anderer es gelebt, oder als sei es ein süßer Traum, in dem des Menschen Stimme und Wille kaum zur Geltung kommen. Doch letztlich scheint mir der liebliche Märchenton nicht angemessen zu sein, da er dieses Leben nur als Vorbereitung auf ein zweites, wahrhaftigeres und verheißungsvolleres Leben zeigt, in das man wie aus einem Traum heraus aufwacht. Dabei ist das zweite Leben, das jemand wie ich noch leben kann, nichts anderes als das Buch in deiner Hand, lieber Leser. Und was es damit auf sich hat, sei deinem Ermessen anheimgestellt. Ich will dir gegenüber Ehrlichkeit an den Tag legen, erweise du mir Wohlwollen.
2Die Fotos im dunklen Museumshaus
Meine Eltern, mein Bruder, meine Großmutter, meine Onkel und Tanten, wir alle wohnten auf die Etagen eines fünfstöckigen Wohnhauses verteilt. Ein Jahr vor meiner Geburt hatte die Familie den großen steinernen Konak, in dem sie bis dahin wie eine osmanische Großfamilie zusammengelebt hatte, an eine Grundschule vermietet und war in das 1951 auf dem Nachbargrundstück entstandene und – damaligem Gebrauch entsprechend – mit der stolzen Aufschrift »Pamuk Apt.« versehene moderne Haus gezogen, in dem wir den vierten Stock bewohnten. Auf jeder der Etagen, die meine Mutter mich als Kleinkind hinauf- und hinuntertrug, standen ein oder sogar zwei Klaviere. Einer meiner Onkel, den ich nur immer zeitunglesend vor mir sehe, hatte gerade geheiratet und mit seiner Frau und seinem Klavier den ersten Stock bezogen, aus dem er fortan ein halbes Jahrhundert lang Tag für Tag aus dem Fenster hinaussehen sollte. Mich indessen stimmte wehmütig, daß auf all den Klavieren nie jemand spielte.
Nicht nur wegen der unberührten Klaviere, sondern auch, weil die mit Porzellantassen, Silbergeschirr, Zucker- und Schnupftabaksdosen, Kristallgläsern, Rosenwasserfläschchen, Tellern, Räuchergefäßen (und einem irgendwann mal hineingeschmuggelten Spielzeugauto) vollgestopften Vitrinen allesamt abgesperrt waren; weil die mit Perlmutt eingelegten Lesepulte und die Turbanhalter an der Wand nie benutzt wurden; weil sich hinter den von Jugendstil und japanischen Einflüssen geprägten Wandschirmen nichts verbarg und weil die Glastüren der Bibliothek, in der seit zwanzig Jahren die Medizinbücher meines nach Amerika ausgewanderten Onkels verstaubten, nie geöffnet wurden, kam in mir der Eindruck auf, daß all die Sachen, mit denen auf jedem Stockwerk die Wohnzimmer vollgestellt waren, nicht dem Leben dienen sollten, sondern dem Tod. (Dennoch konnte es geschehen, daß ein Hocker oder eine geschnitzte Truhe plötzlich auf geheimnisvolle Weise von einer Etage in die andere gelangte.)
Wenn wir uns gedankenlos in einen der mit Perlmutt und Silbernaht verzierten Sessel plumpsen ließen, wurden wir von der Großmutter ermahnt, uns doch gefälligst ordentlich hinzusetzen. Wohnzimmer waren nicht darauf ausgerichtet, den Familienmitgliedern eine gemütliche Umgebung zu bieten, sondern sollten vielmehr durch ihren betont musealen Charakter ständig für etwaige Besuche bereitstehen, und dahinter steckte zweifellos der Drang nach westlicher Lebensart. Umgeben von Büfetts und Klavieren, konnte man den Ramadan als Nichtfastender mit weniger Gewissensbissen überstehen als im Schneidersitz auf einem Kissen. Einen anderen Sinn, als den Menschen von der Last der religiösen Pflichten zu befreien, vermochte man in der Europäisierung ohnehin nicht recht zu erkennen, und so erfaßte der Trend, Wohnzimmer in elegischer und manchmal gar poetischer Manier als Ausstellungen kaum in Frage gestellter Symbole von Wohlstand und Westlichkeit zu gestalten, von Istanbul ausgehend innerhalb von fünfzig Jahren die gesamte Türkei, bis er in den siebziger Jahren mit dem Aufkommen des Fernsehens allmählich in Vergessenheit geriet. Doch selbst in jener Zeit, in der es zum allgemeinen Zeitvertreib wurde, sich vor dem Fernsehgerät zu versammeln und unter Schwatzen und Lachen Filme oder Nachrichten zu sehen, so daß die Wohnzimmer sich aus Museen in Kinos verwandelten, kann ich mich an Familien erinnern, die den Fernseher lieber in einem gesonderten Raum aufstellten und ihr Museumswohnzimmer nach wie vor lediglich an Feiertagen oder für ganz besondere Gäste aufschlossen.
Da zwischen den Etagen, ähnlich wie zwischen den Flügeln eines großen Familienkonaks, ein reges Kommen und Gehen herrschte, standen die Wohnungstüren des Pamuk Apartmanı meistens offen. Als mein Bruder eingeschult wurde, ging ich morgens oft allein oder mit meiner Mutter in das Stockwerk über uns zu meiner Großmutter, die dann noch im Bett lag, und in ihrem Wohnzimmer, das mit den zugezogenen Vorhängen und wegen des allzu nahen Nachbarhauses wie ein dämmeriges Antiquitätengeschäft wirkte, spielte ich dann auf den großen, schweren Teppichen meine Spiele. Ich reihte die Spielzeugautos, die man mir aus Europa mitgebracht hatte, in ganz bestimmter Weise auf und spielte mit ihnen »Garage«, oder ich stellte mir vor, die bis auf die Gänge hinausreichenden Teppiche seien das Meer und die Sessel und Tische bildeten Inseln darin, die ich nacheinander alle erreichen mußte, ohne je den Boden zu berühren (ähnlich wie Calvinos Baron auf den Bäumen, der sich immer nur von Baum zu Baum fortbewegt), oder aber ich dachte an die Pferdewagen, die ich auf der Insel Heybeliada gesehen hatte, und ritt auf einer Sessellehne, und wenn ich von alldem erschöpft war und auch die Methode versagte, mit der ich mir seit jeher über Langeweile hinweghelfe, indem ich mir vorstelle, ich sei nicht in diesem Zimmer (diesem Klassenraum, diesem Kasernenschlafsaal, diesem Krankenzimmer, dieser Amtsstube), sondern irgendwo anders, dann blieb mir nichts übrig, als in der Hoffnung auf irgendeine Ablenkung die überall herumstehenden Fotos zu betrachten.
Da auch in den unteren Stockwerken die Klaviere mit gerahmten Fotos vollgestellt waren, hielt ich dies damals quasi für die normale Funktion eines Klaviers. Im Wohnzimmer und im Salon meiner Großmutter war außerdem jede verfügbare horizontale Fläche mit kleineren und größeren Fotos bedeckt. Den Ehrenplatz über dem nie benützten offenen Kamin nahmen zwei riesige kolorierte Fotos ein, die die Großmutter und meinen 1934 verstorbenen Großvater zeigten. Aus der Stellung ihrer Fotos und dem Blick, den sie in die Kamera warfen (einander leicht zugewandt wie die Königspaare, die ich von europäischen Briefmarken her kannte), vermochte jeder, der das Salonmuseum betrat, unschwer zu ersehen, daß sie es waren, mit denen die Geschichte ihren Anfang nahm.
Sie stammten beide aus dem Städtchen Gördes in der Nähe von Manisa, aus einer Familie, die man wegen ihrer auffallend hellen Haut- und Haarfarbe als die Pamuks bezeichnete, die Baumwoll-Familie. In den Adern meiner Großmutter floß Tscherkessenblut, und Tscherkessien war genau die Region, aus der der Osmanenharem sich jahrhundertelang mit großgewachsenen, schönen Mädchen versorgte. Der Vater meiner Großmutter war während des Osmanisch-Russischen Krieges von 1877 bis 1878 nach Anatolien eingewandert und hatte sich schließlich mit seiner Familie in Izmir niedergelassen (von dem später leerstehenden Haus in Izmir war im Familienkreis des öfteren die Rede). Nach einer Weile war man nach Istanbul weitergezogen, wo mein Großvater Bauwesen studierte. Als in den dreißiger Jahren die junge Türkische Republik große Summen in den Eisenbahnbau investierte, kam mein Großvater dadurch zu einigem Wohlstand und gründete an dem Flüßchen Göksu, das in den Bosporus mündet, eine Fabrik, die von Schnüren bis hin zu dicken Tauen alles herstellte, was man zum Trocknen von Tabak benötigt, so daß er 1934, als er mit zweiundfünfzig Jahren verstarb, ein Vermögen angehäuft hatte, das mein Vater und mein Onkel später nicht einmal dadurch aufbrauchen konnten, daß sie eine Unternehmung nach der anderen in den Sand setzten.
An den Wänden des Büros neben dem Salon waren in schöner Symmetrie die Bilder der darauffolgenden Generation aneinandergereiht, die anscheinend der gleiche retuschierfreudige Fotograf pastellfarben getönt hatte. Von rundlicher, gesunder Erscheinung war mein Onkel Özhan, der nach dem Medizinstudium nach Amerika ausgewandert war und wegen seines nicht abgeleisteten Wehrdienstes nicht mehr in die Türkei einreisen konnte, was meiner Großmutter gestattete, fortwährend mit Trauermiene durchs Leben zu wandeln. Mein etwas jüngerer Onkel Aydın, der im untersten Geschoß wohnte, trug eine Brille und hatte wie mein Vater Bauwesen studiert und sich in jungen Jahren auf Bauvorhaben eingelassen, die eine Nummer zu groß für ihn waren. Meine Tante, die nach jahrelangem, zuletzt in Paris absolviertem Klavierstudium geheiratet und das Klavierspielen aufgegeben hatte, wohnte mit ihrem Mann, der an der juristischen Fakultät als Assistent beschäftigt war, in der Dachwohnung, in die Jahre später ich einziehen sollte und in der ich nun auch dieses Buch schreibe.
Wenn ich vom Büro in den Salon hinüberging, dem die Kristalllüster ein noch melancholischeres Gepräge verliehen, brachte eine Menge unretuschierter kleiner Schwarzweißfotografien etwas mehr Bewegung ins Leben. Es standen und hingen dort Verlobungs- und Hochzeitsfotos sämtlicher Geschwister, zu besonderen Anlässen von einem Fotografen aufgenommene Bilder, erste Farbfotos von meinem Onkel in Amerika und noch viele andere Fotos, die uns in den Istanbuler Parks zeigten, am Bosporus-Ufer, am Taksim-Platz bei einem Feiertagsessen, meine Eltern, meinen Bruder und mich bei einer Hochzeit, den Garten des alten Hauses, die Autos, die mein Großvater und mein Onkel besessen hatten, den Eingang zu unserem neuen Haus. Von einigen Ausnahmen abgesehen, wenn etwa das Foto der ersten Frau meines Onkels in Amerika durch das Foto der zweiten ersetzt wurde, nahm man an der museumshaft unverrückbaren Anordnung der Aufnahmen keine Änderungen vor, doch wenn ich sie auch schon Hunderte von Malen gesehen hatte, betrachtete ich sie jedesmal, wenn ich das Zimmer betrat, wieder von neuem.
Dabei wurde mir immer wieder bewußt, wie wichtig diese besonderen Momente sind, die aus dem Leben herausgenommen, vor dem Lauf der Zeit geschützt und durch einen Rahmen besonders hervorgehoben werden. Wenn ich zusah, wie mein Onkel Mathematik mit meinem Bruder lernte, und dabei zugleich auf ein dreißig Jahre altes Foto von ihm schielte, oder wenn ich meinen Vater beobachtete, wie er scheinbar in seiner Zeitung blätterte, aber – an seinem Lächeln deutlich erkennbar – eigentlich bei dem Lachen und Scherzen war, das den Raum erfüllte, und ihn dabei gleichzeitig auf dem Foto sah, auf dem er als Fünfjähriger lange Haare wie ein Mädchen trug, dann kam es mir vor, als sei das Leben nur die Gelegenheit, Augenblicke zu erleben, die man später einmal einrahmen konnte. Wenn meine Großmutter manchmal von meinem so jung verstorbenen Großvater sprach wie von einem Staatengründer und dabei auf die Fotos an den Wänden und auf den Tischen deutete, trat die Kluft zwischen gewöhnlichem Leben und außerordentlichem Moment deutlich zutage. Demütig nahm ich die Bedeutung dieser dem Zahn der Zeit widerstehenden und in schützender Umrahmung verharrenden besonderen Momente in mich auf, was aber nicht verhindern konnte, daß sie mich manchmal auch langweilten.
Als kleiner Junge liebte ich jegliche Art von Familienzusammenkünften wie etwa allein schon die Abendessen, bei denen alle scherzend zusammensaßen, die gemeinsamen Mittagessen beim Zucker- und beim Opferfest oder die Silvesterabende, an denen nach dem Essen unweigerlich eine Tombola veranstaltet wurde und ich mir in späteren Jahren jedesmal schwor, das nächstemal nicht mehr zu kommen, und es dann doch wieder tat. Diese Essen in großer Runde, bei denen einer meiner Onkel durch den Genuß von Raki oder Wodka und meine Großmutter schon durch ein paar Schluck Bier zu Heiterkeitsausbrüchen veranlaßt wurden, vermittelten mir das Gefühl, daß der nichtgerahmte Teil des Lebens eigentlich der bei weitem lustigere sei, und gaukelten mir vor, das Glück dieser Welt bestünde darin, in vertrautem Kreise gemeinsam zu lachen und sich wohl und geborgen zu fühlen. Andererseits mußte ich schon sehr früh erleben, wie schnell in meiner Familie bei einem fröhlichen Festessen, das sich in die Länge zog, die Stimmung umschlagen konnte, wenn wieder einmal Streit über Vermögensangelegenheiten ausbrach und plötzlich sehr häßliche Töne angeschlagen wurden. Wenn wir unter uns waren, sagte meine Mutter spitz »eure Tante«, »euer Onkel« oder »eure Großmutter« und erzählte meinem Bruder und mir empört, durch wen uns wieder einmal ein Unrecht widerfahren war. Die Familie konnte sich nicht einigen, wie bestimmte Vermögenswerte wie etwa Anteilscheine an der Seilfabrik oder eine Etage des Wohnhauses aufzuteilen seien, und das führte zu lang anhaltenden Auseinandersetzungen und Verstimmungen. Diese dunklen Geschichten, die wie die Risse anmuteten, die sich über das dünne Glas der vielen Aufnahmen von Glücksmomenten zogen, vermochte ich zwar über den Scherzen, die im Stockwerk meiner Großmutter gemacht wurden, eine Weile zu vergessen, doch schon als kleiner Junge spürte ich sehr wohl, daß sich hinter diesen Scherzen Anspielungen auf insgeheime Abrechnungen verbargen. Selbst die in den verschiedenen Haushalten tätigen Dienstboten (wie unsere Esma oder die bei meiner Tante angestellte Ikbal) fühlten sich bemüßigt, in dem gleichen Geiste herumzuzanken wie ihre Herrschaften.
»Hast du gehört, was Aydın gesagt hat?« ereiferte sich dann meine Mutter am nächsten Morgen beim Frühstück.
»Nein, was denn?« antwortete mein Vater zunächst neugierig, aber wenn er die Geschichte dann gehört hatte, winkte er nur müde ab und verkroch sich wieder hinter seiner Zeitung.
Selbst wenn ich aus diesem Gezänk noch nicht hätte folgern können, daß unsere traditionelle Großfamilie allmählich zerbrach, so wäre mir die Lage dadurch klargeworden, daß mein Vater und mein Onkel, kaum hatten sie ein neues Geschäft angefangen, gleich immer wieder Konkurs anmeldeten und daß mein Vater allmählich immer seltener zu Hause war. Hin und wieder nahm meine Mutter uns Kinder zu unserer Großmutter mütterlicherseits in das gespenstisch wirkende Haus im Stadtteil Șișli mit, wo wir dann spielen sollten, während meine Mutter über ihr Schicksal klagte. Die Großmutter aber riet lediglich zu Geduld und ließ uns im übrigen spüren, daß es für uns kein Zuckerschlecken sein werde, falls unsere Mutter es sich einfallen ließe, mit uns in das verstaubte dreistöckige Haus zu ziehen, in dem die Großmutter alleine lebte.
Mein Vater war abgesehen von kleineren Wutanfällen ein mit sich selbst und seinem Leben, mit seinem Aussehen und seiner Intelligenz, kurz mit seinem Glück zufriedener Mann, und in seiner kindlich-unbekümmerten Art, die er nie verlor, hielt er mit diesem Glück auch nicht hinter dem Berg. Er pfiff zu Hause gern vor sich hin, sah sich wohlgefällig im Spiegel an und träufelte sich Zitronensaft in die Handfläche, den er sich dann ins Haar schmierte wie Brillantine. Es machte ihm Spaß, Witze zu reißen und Wortspiele zu machen, Leute zu verblüffen, Gedichte auswendig vorzutragen, seine Intelligenz unter Beweis zu stellen und in der Weltgeschichte herumzufliegen. Ein schimpfender, strafender, Verbote aussprechender Vater war er nicht. Vor allem wenn ich als ganz kleiner Junge mit ihm unterwegs war wie mit einem Freund, vermittelte er mir das Gefühl, die Welt sei ein Ort, an den der Mensch komme, um glücklich zu sein.
Während mein Vater jeder Art von Schlechtigkeit, Bosheit oder einfach nur Mühsal still und leise aus dem Weg ging, versuchte meine Mutter uns gegen solche Gefahren zu wappnen, stellte Verbote auf und ergriff mit gerunzelter Stirn Gegenmaßnahmen, um die Klippen des Lebens zu umschiffen. So war sie zwar weniger lustig als mein Vater, doch da sie viel mehr Zeit mit uns verbrachte als unser Erzeuger, der sich bei jeder Gelegenheit aus dem Staub machte, war ich auf ihre liebevolle Zuneigung sehr angewiesen. Daß ich dabei in meinem Bruder einen Nebenbuhler hatte, war die grundlegendste Lektion, die ich damals lernen mußte.
Was ich durch den heftigen Kampf um die Liebe meiner Mutter alles mitmachte, ersetzte bei weitem, was mein Vater an seelischen Schäden bei mir hätte anrichten können, hätte er mich Stärke und Autorität spüren lassen. Damals empfand ich das natürlich noch nicht so. Der Konkurrenzkampf mit meinem Bruder trat anfangs noch nicht offen zutage, sondern wurde als Teil eines Spiels begriffen, in dem wir beide jeweils eine Rolle spielten. Wir traten nicht als Orhan und Șevket gegeneinander an, sondern als die Fußballspieler oder sonstigen Helden, mit denen wir uns gerade identifizierten. So kam es, daß die Spiele und Streitereien, in die wir unsere echten und imaginären Helden verwickelten, zwar regelmäßig in Blut und Tränen endeten, wir aber so sehr bei der Sache waren, daß wir gar nicht einmal merkten, daß wir Brüder es waren, die sich da stritten und verletzten und quälten. Und wie mein Bruder – auch noch als Erwachsener detailfreudiger Anhänger von Erfolgsstatistiken – Jahre später einmal vermerkte, ging aus neunzig Prozent unserer Kämpfe und Spiele er als Sieger hervor.
Wenn ich mich unglücklich fühlte oder mir einfach langweilig war, schlich ich mich aus unserer Wohnung und ging entweder hinunter zu meinem Cousin oder – was öfter der Fall war – hinauf zu meiner Großmutter. (»Als du klein warst, hast du nie wie andere Kinder gejammert, daß dir langweilig ist«, sagte mir meine Mutter später einmal.) Obwohl die verschiedenen Etagen sich sehr ähnelten und vom Geschirr über die Zuckerdosen und die Sessel bis hin zu den Aschenbechern oft die gleichen Utensilien enthielten, kam mir doch jede Wohnung wie eine andere Welt vor, wie ein anderes Land. Obwohl oder gerade weil der Salon meiner Großmutter auf so düstere Weise mit Möbeln vollgestellt war, spielte und träumte ich dort so gerne und stellte mir im Schatten der Vasen, Fotorahmen und Hocker vor, ich sei an einem anderen Ort.
Wenn wir am Abend im Schein der Lampe dort alle beisammensaßen, wurde die Wohnung meiner Großmutter in meiner Phantasie zur Kapitänskajüte eines riesigen Schiffes. Wir waren auf dem im Sturm dahinjagenden Gefährt sowohl der Kapitän als auch die Besatzung und die Passagiere und entsetzten uns über die sich zu Bergen türmenden Wellen. Diese Vorstellung rührte von den Nächten her, in denen ich im Bett lag und die klagenden Hörner der großen, durch den Bosporus gleitenden Schiffe vernahm, und am meisten gefiel mir daran der stolze Gedanke, unser aller Schicksal und das des ganzen Schiffes hänge einzig und allein von mir ab.
Aber trotz dieses Traumgebildes, das eher an die Helden aus den Comic-Heften meines Bruders erinnerte, spürte ich wohl – genauso übrigens, wie wenn ich an Gott dachte –, daß ganz einfach deshalb, weil wir reich waren, unser Schicksal sich mit dem der gewöhnlichen Bewohner der Stadt nicht deckte. Als jedoch in den folgenden Jahren durch die Pleiten meines Vaters und meines Onkels, die Aufteilung des Familienbesitzes und die fortwährenden Streitereien meiner Eltern sowohl unsere Groß- als auch unsere Kleinfamilie sich an allen Ecken und Enden aufzulösen begann, wurde ich bei jedem Besuch in der Wohnung meiner Großmutter melancholischer. Die Betrübnis, der Verlust und die Schwermut, die der Zerfall des Osmanischen Reiches über Istanbul gebracht hatte, war – wenn auch unter anderen Vorzeichen und mit ein wenig Verzögerung – schließlich auch über uns hereingebrochen.
3»Ich«
In glücklichen Momenten – von denen es in meiner Kindheit zuhauf gab – nahm ich nicht so sehr mein eigenes Dasein wahr, sondern empfand vielmehr, daß die Welt gut, schön, angenehm und sonnig war. Ein schlechtes Essen, ein übler Geschmack, der Laufstall, in den ich gesperrt wurde, bis ich vor Wut ins Gitter biß, oder auch mein schlimmstes Kindheitserlebnis, nämlich der Tag, an dem ich mir im Auto meines Onkels den Finger in der Tür quetschte und auch beim Röntgenarzt immer noch herzzerreißend weinte, all das klärte mich nicht über mein eigenes Ich auf, sondern über Gemeinheiten und Schmerzen, denen es aus dem Weg zu gehen galt. Und doch begann sich aus dem Wirrwarr meines Bewußtseins allmählich ein Gespür für mein eigenes Ich herauszuschälen, das auch gleich mit einem Schuldgefühl einherging.
Als mein Bruder eingeschult wurde, bedeutete das für mich, daß ich vom vierten bis zum sechsten Lebensjahr ohne die Kameradschaft auskommen mußte, die sich zwischen ihm und mir herausgebildet hatte. Da ich zugleich seine Überlegenheit nicht mehr fürchten mußte und einen Gutteil des Tages sowohl das Pamuk Apartmanı als auch die Fürsorge meiner Mutter zu meiner alleinigen Verfügung hatte, waren diese zwei Jahre eine angenehme Zeit für mich, in der ich lernte, für mich allein zu bleiben, aber auch die ersten einschneidenden Erlebnisse hatte.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!