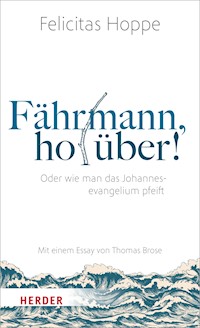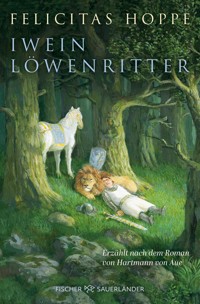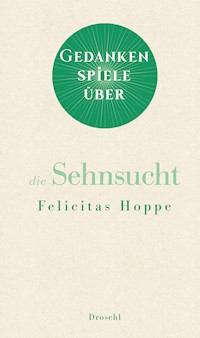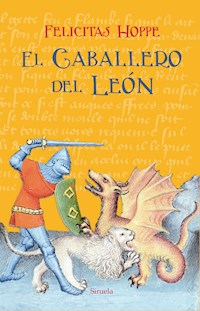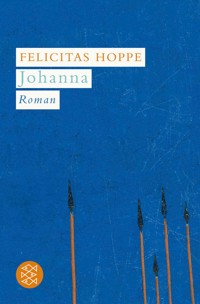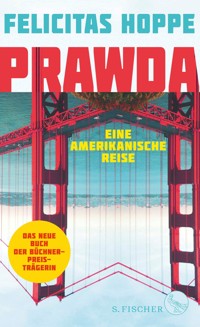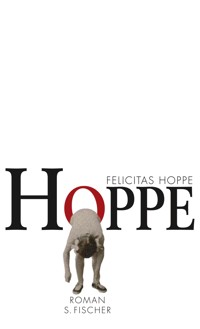12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Der Stoff ist unschlagbar: ein Bad in Blut, eine schöne Frau, Gold und ein Mord, der grausam gerächt wird. So klingt das Lied der Nibelungen, die Sage von Siegfried, dem Strahlenden, seinem düsteren Gegenspieler Hagen und der schönen Kriemhild. Aber ist das die wahre Geschichte dieser europäischen Helden, die in Island oder Norwegen beginnt, am Rhein entlang spielt, die Donau runter erzählt wird und schließlich im Schwarzen Meer mündet? Niemand weiß, wie es wirklich war, meint Hoppe und erfindet die Wahrheit: hell und schnell, poetisch und politisch. Felicitas Hoppes Roman »Die Nibelungen« ist das erste gesamteuropäische Heldenepos der Gegenwart.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 294
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Felicitas Hoppe
Die Nibelungen
Ein deutscher Stummfilm
Prosa
Über dieses Buch
Der Stoff ist unschlagbar: ein Bad in Blut, eine schöne Frau, Gold und ein Mord, der grausam gerächt wird. So klingt das Lied der Nibelungen, die Sage von Siegfried, dem Strahlenden, seinem düsteren Gegenspieler Hagen und der schönen Kriemhild. Aber ist das die wahre Geschichte dieser europäischen Helden, die in Island oder Norwegen beginnt, am Rhein entlang spielt, die Donau runter erzählt wird und schließlich im Schwarzen Meer mündet? Niemand weiß, wie es wirklich war, meint Hoppe und erfindet die Wahrheit: hell und schnell, poetisch und politisch, wie nicht mal Tarantino es kann. Hoppes Nibelungen: das erste gesamteuropäische Heldenepos der Gegenwart.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Felicitas Hoppe, geb. 1960 in Hameln, lebt als Schriftstellerin in Berlin. 1996 erschien ihr Debüt ›Picknick der Friseure‹, 1999, nach einer Weltreise auf einem Frachtschiff, folgte der Roman ›Pigafetta‹, 2003 ›Paradiese, Übersee‹, 2004 ›Verbrecher und Versager‹, 2006 ›Johanna‹, 2008 ›Iwein Löwenritter‹, 2009 ›Sieben Schätze‹ und die Erzählung ›Der beste Platz der Welt‹, 2010 ›Abenteuer – was ist das?‹, 2011 ›Grünes Ei mit Speck‹, eine Übersetzung von Texten des amerikanischen Kinderbuchautors Dr. Seuss, 2012 der Roman ›Hoppe‹ und zuletzt 2018 der Roman ›Prawda. Eine amerikanische Reise‹. Für ihr Werk wurde Felicitas Hoppe mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, u.a. mit dem aspekte-Literaturpreis, dem Bremer Literaturpreis, dem Roswitha-Preis der Stadt Bad Gandersheim, dem Rattenfänger-Literaturpreis, dem Georg-Büchner-Preis und dem Erich Kästner Preis für Literatur. Felicitas Hoppe ist die erste Preisträgerin des Großen Preises des Deutschen Literaturfonds. Außerdem Poetikdozenturen und Gastprofessuren in Wiesbaden, Mainz, Augsburg, Göttingen, am Dartmouth College in Hanover, New Hampshire, an der Georgetown University, Washington D.C., in Hamburg, Heidelberg und Köln.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Eigenlizenz
Erschienen bei FISCHER E-Books
© 2021 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: Simone Andjelković
Coverabbildung: akg-images, Kupferstich, um 1650, von Matthäus Merian (Ausschnitt)
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-401615-3
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
[Widmung]
[Motto]
Der Rhein
Wie sich die Schätze zu Worms am Rhein versammeln
Wie Siegfried am Hof zu Worms erscheint
Wie Siegfried den doppelten Hochzeitseiner besteigt
Wie der Laie aus Worms das Publikum zum Schunkeln bringt
Zwillinge aus einem Ei
Wie Siegfried seinen Zorn häutet
Wie Brunhild ihre wahre Gestalt zeigt und das Publikum seinen Drachen vermisst
Fragen
Wormser Doppelhochzeit
Zu Tisch
Kopf oder Brot
Licht aus
Bataille Royale
Frühstück vor Dom
Brunhild rutscht aus
Mundwerk statt Handwerk
Das letzte Kreuz
Wie Siegfried verdurstet
Pause
DIE DONAU
Dreizehn Jahre später
RVP
An der schönen blauen Donau
Flussfahrt mit Sängern
Kriemhild schreibt einen Brief
Rumolt rät ab
Wie Hagen mit seinen Träumen verkehrt und sich die Burgunder in die Nibelungen verwandeln
Wie Hagen am anderen Rheinufer mit dem Laien aus Worms am Feuer sitzt
Hagen geht baden
Wie der angelnde Fährmann nicht seinen Kopf, sondern bloss sein Leben verliert
Wie an der Donau auf Zuruf ein Wunder geschieht
Wie Hagen die Fähre in Stücke schlägt
Wie Volker von Alzey die Führung übernimmt
Wie Giselher auf tödliche Brautschau geht
Wie der Schatz hinter dem Rücken der Nibelungen von Worms über Pöchlarn nach Esztergom kommt
Wie Kriemhild in der Nibelungenwerkstatt Tischkarten beschriftet
Groß und Klein
Wie die Nibelungen in Esztergom landen und Giselher seine Schwester gen Himmel schickt
Wie Siegfrieds Schatten nach einem Glas Wein verlangt und Rumolt zum zweiten Mal abrät
Kriemhild schneidet den Schatz an und hält eine Rede
Wie Hagen in die Bütt steigt und um den dreizehnten Platz kämpft
Wie Hagen dem letzten Schatz aus der Torte hilft
Pause
DIE KLAGE
Wie Siegfrieds Schatten im Beiboot mit seinem schlechten Gewissen kämpft
Applaus
Ein König räumt auf
Wie König Etzel versucht, seinen Verstand zu retten, indem er den Zeugen aus dem Beiboot befragt
Wie Etzel sein letztes Urteil spricht und der Zeuge im Beiboot es annimmt
Frauen
Wie Pilgrim die Chronik in Auftrag gibt
Wie der Bote den Hof zu Worms erreicht und Rumolt ihm aus den Steigbügeln hilft
Hier endet der Bericht des Zeitzeugen im Beiboot
Abspann/Credits
Für Uwe Johnson
Nur Helden fürchten sich nie, deshalb schreiben sie keine Bücher
Der Rhein
Wie sich die Schätze zu Worms am Rhein versammeln
Sicher ist nur: Es gab eine Zeit, da gehörten alle Schätze der Welt einer Frau. Bis sie sich, ihrer überdrüssig, eines Tages auf und davon machten, sich an verschiedenen Orten versteckten und die Zauberer aller Länder bezahlten, um verzaubert und nicht gefunden zu werden. Wird der Zauber aber eines Tages gelöst, verwandelt sich der Schatz in natürliches Gold und kann nach Hause getragen werden.
Dort allerdings muss er gefüttert werden, sonst zerfällt er zu Asche oder wird jedenfalls krank oder entwischt und stellt sich am Wegrand auf, um sich seine Nahrung selbst zu erbetteln. Oder wird Söldner, zieht in den Krieg, verliert ein Bein und erscheint hässlich hinkend auf der nächstbesten Hochzeit, versetzt Braut und Gäste in Angst und Schrecken, trinkt, bis er ziemlich redselig wird und verrät, er sei in Wahrheit ein Schatz und seine Knochen aus purem Gold.
Der Bräutigam, in der Regel ein Offizier zweiter Klasse, schlägt ihm entschlossen den Kopf ab: Zwischen Kopf und Hals stecken drei goldene Münzen, heute kleinster Teil einer größeren Sammlung, die sich inzwischen im Museum für Gegenwartskunst in Basel befindet und für Besucher nicht zugänglich ist. Allerdings, so verriet mir einer der Wärter vertraulich, wäre es wohl besser gewesen, man hätte den Söldner lebendig gemästet, um ihn später, vor Publikum, festlich zu schlachten: Dann wäre er Rheingold gewesen.
Aber das Schatzwesen ist unberechenbar, mit eigenem Willen und Gedächtnis begabt, flüchtig und wechselhaft. Der Schatz spielt nämlich gern die dreizehnte Fee, lässt sich gern bitten, kommt nicht auf Bestellung, und bittet man ihn, kommt er immer zu spät, immer erst dann, wenn die Köpfe der Gäste schon auf der Tischplatte liegen. Denn der Schatz hat seinen eigenen Kopf und seine eigene Art, Geschäfte zu machen, mit der man nur mühsam ins Gespräch kommt. Und leider die Neigung, sich ständig zu trennen, sich unablässig weiter zu teilen, um überall und nirgends zu sein.
Früher sei das noch anders gewesen, die Schätze hätten sich nicht so herumgetrieben, seien einfach zu Hause geblieben. Nur einmal im Jahr, meistens im Sommer, sagte der Wärter, wenn die Tage länger und die Nächte schlafloser werden, bekamen sie Heimweh nach den anderen Schätzen, brachen aus allen Ländern der Welt auf und trafen sich alle an einem Ort, den keiner von ihnen preisgeben durfte. Sicher ist nur, es zog sie zum Rhein, in die Nähe von Worms, wo sie Jahr für Jahr, völlig unbehelligt, immer dasselbe Stück zur Aufführung brachten, immer wieder von vorn.
Zuschauer waren nicht zugelassen. Unermüdlich selbstbegeistert spielten die Schätze nur das, was sie waren, nicht, was andere sind. Nicht Könige, sondern Kronen, nicht Köpfe, sondern Helme, nicht Ritter, sondern Schwerter und Rüstung, nicht Finger, sondern Ringe, nicht den Hals, sondern seine Ketten, nicht Trinker, sondern den letzten Becher, nicht Fischer, sondern Angeln und Netze, nicht Schneider, sondern Schere und Nadel, nicht Baumeister, sondern Treppen und Brücken, nicht Priester, sondern Weihrauchfässer, nicht Präsidenten, sondern deren letzte Verfassung, nicht den Tod, sondern seine Sensen und Gärten.
Andere hatten sich ganz auf die Kleidung verlegt, auf Kostüme, Anzüge, Mäntel und Stiefel, auf Hauben und Bischofsmützen in Rot, auf verspätete Kragen mit Pelzbesatz (Marke Guillotine), auf Richterroben mit Beffchen, Uniformen mit seidenen Schleifen und Orden aller Klassen, goldene Fransen, die jeden Teppich zum Fliegen bringen. Wieder andere gaben Hausrat und Möbel, Throne und Betten unter Decken aus Samt, hohe Eichentische, durch die längst der Wurm und der Wind geht, unter Tüchern aus Leinen, auf denen schwere Bestecke liegen, Löffel aus angelaufenem Silber, Gabeln und Messer, die besonders schwierig zu spielen sind, weil unklar ist, welchem Zweck sie dienen: dem Essen oder dem Töten?
Am liebsten aber geben sie Wörter. Sätze dagegen nie, denn die Schätze, sagte der Wärter, sind durch und durch lyrisch gestimmt und unablässig damit beschäftigt, ihr Geheimnis immer vollkommener und ihre Auffindung damit völlig unmöglich zu machen. Nur sei ihr Erfindungsgeist gefährlich, denn möglich ist, dass sie sich eines Tages in eine rationale Zahl verwandeln oder womöglich in ein Gedicht, in ein einziges Wort, in eine einzige Silbe, die reine Formel, immer kleiner und kleiner, bis sie am Ende niemand mehr sieht und niemand versteht, nicht einmal sie selbst.
Weshalb eines Tages einer von ihnen, vermutlich der Algorithmus mit dem Spitznamen Goldene Dreizehn, das Spiel plötzlich satthatte, vielleicht weil er Angst hatte, ganz zu verschwinden. Möglich ist aber auch, dass er bloß neugierig war. Und so stahl er sich von der Truppe weg und machte sich, als Tourist verkleidet, auf den Weg nach Worms, um dort den Dom zu besichtigen; und wäre wohl unerkannt geblieben, hätte es nicht zu regnen begonnen und sein Leichtsinn ihn dazu verführt, vor dem Portal, auf der Treppe zum Dom, vor Publikum seinen Schirm aufzuspannen, und der war innen ganz mit Gold ausgeschlagen.
Das konnte natürlich nicht unentdeckt bleiben. Erst einer, dann zwei, dann fünf, dann zehn, die Menge wuchs, wurde groß und bedrohlich, der Kreis immer enger, bis der Schatz sich vollkommen eingekeilt fand. Für einen Schatz eine entsetzliche Lage, sagte der Wärter. Denn bestechen ließ sich die Menge nicht; schließlich war sie nicht auf den Schirm aus, sondern auf sein Geheimnis. Und so nahmen sie ihn entschlossen gefangen, sperrten ihn in einen Käfig und stellten ihn neben dem Domportal aus.
So steht er jetzt da, der letzte Ketzer im Käfig, drei Tage, drei Nächte, im strömenden Regen und ganz ohne Schirm; denn den Schirm hatten die Wormser ihm weggenommen, um ihn gewinnbringend zu versteigern, was ihnen aber kein Geld einbrachte, denn unter dem Hammer des höchsten Gebots zerfiel er zu Asche, weil ihn vorher niemand gefüttert hatte. Was die Goldene Dreizehn betrifft, so schwieg sie in ihrem Käfig beharrlich und gab keinen der Brüder und Schwestern preis. Weder die Formel noch den heimlichen Ort ihres Spiels.
Kein einziges Wort kam ihr über die Lippen. Und so darf man wohl sagen, dass sie als Held starb und nicht als Verräter, wie man bis heute fälschlich behauptet. Vielleicht starb sie auch gar nicht, sondern magerte einfach bloß ab und schlüpfte im Morgengrauen des vierten Tages, als es endlich aufgehört hatte zu regnen, dünn wie sie jetzt war, durch die Käfiggitter, um sich fortan ihre Nahrung am Wegrand selbst zu erbetteln. Denn um Söldner zu werden, war sie zu schwach, man hätte sie umgehend ausgemustert.
Den leeren Käfig aber kann man noch heute auf dem Domplatz zu Worms bewundern, wo er längst Teil eines Stückes geworden ist, das sich inzwischen wieder großer Beliebtheit erfreut. Alle Plätze im Voraus verkauft, unbezahlbar bis in die hinteren Ränge, noch die Stehplätze werden heftig umkämpft. Sicher ist nur, dass niemand weiß, wer die Darsteller sind, weil Schätze begnadete Falschmünzer sind und ihre Zuschauer gern aus der Ferne foppen, indem sie Münzen mit Kronen in Umlauf bringen, deren Könige niemals an die Macht kommen werden.
Das Programmbuch behauptet das Gegenteil, allein durch sein Gewicht. Denn es wird jedes Jahr dicker, unaufhörlich dehnt es sich aus und wächst, bis es kaum noch zu bändigen ist; weshalb am Ende des Stückes, wenn alle tot sind und auf der Bühne nicht Sieger, nur deren Köpfe noch liegen, der Regisseur an die Rampe tritt und mit großer Geste unter Applaus das Buch in den Rhein wirft. So treibt es jetzt langsam von Worms rheinabwärts, bis die kräftigen Mündungsarme des Flusses in den Niederlanden die Nordsee erreichen, wo sich das Buch, kurz hinter Isenstein, für immer aus unseren Augen verliert, um sich im Land der Nibelungen, endlich erschöpft, zum Schlafen zu legen.
Wie Siegfried am Hof zu Worms erscheint
Und jetzt darf endlich der Held auf die Bühne, den das Publikum auf Jahre im Voraus gebucht hat. Der Jubel ist groß, denn man erkennt Siegfried sofort, obwohl er dunkelhaarig und klein ist. Man sieht ihm förmlich beim Wachsen zu und wie sein Haar dabei immer heller wird, bis es sich, jetzt schon beinahe blond, vor lauter Eifer und Tatkraft, Stufe für Stufe zum Dom hinauf, in steile goldene Locken legt. Dazu passend die Augen: Drachenaugen, tiefblau das eine, hellgrün das andere, fast so grün wie sein Jagdkostüm. Eindeutig Sohn eines Königs aus Xanten, der selbst niemals ein König sein wird, weil er die Jagd dem Regieren vorzieht, immer Angriff und Schwert. Der Jäger wächst, und die Könige schrumpfen.
Höchste Zeit also, dass ihm jemand zu tun gibt. Nur wer? Und was? Ist nicht schon alles getan? Hat er nicht längst den Drachen erschlagen, ihm die Augen genommen, in seinem Blut gebadet, mit einem Lindenblatt sein Schicksal besiegelt, zwei Könige, vierzehn Riesen erschlagen und Hunderte von den Nibelungen? Nicht zu reden von einem Zwerg namens Zorn, den er eigenhändig gehäutet hat, um sich unter der geliehenen Haut kurzfristig zum Verschwinden zu bringen.
Wenn die Bühne sich dreht, und sie dreht sich andauernd, erscheint eine Höhle, wo, trotz der Hitze in ein Schaffell gehüllt und den Kopf unter einer roten Mütze, die, mehr Sack als Mütze, kaum die Augen frei gibt, Zwerg Zorn für die nächsten vier bis fünf Stunden (je nachdem, wie lange das Stück sich noch hinzieht) damit beschäftigt sein wird, im Schein seiner beweglichen Bergmannslaterne Münzen auf kleine Haufen zu schichten und immer wieder von vorn zu polieren. Dabei murmelt er Zahlen, vielleicht auch Wörter, leise gekrächzt, womöglich gereimt, Buchhaltung wahrscheinlich, die niemand versteht, nicht einmal die in den vorderen Reihen. Nur hin und wieder, wenn er den Kopf hebt und die Mütze nach oben schiebt, um sich über die Augen zu wischen, denn die Arbeit ist mühsam (ein deutsches Gewitter liegt in der Luft), schnappt man hier und da ein paar Reimwörter auf: Mütze und schütze, Gold auf rollt, Drachen und wachen, Herd auf Schwert, Not auf Tod und Sage auf Klage.
Wer ein Opernglas hat, kann im Hintergrund, also dort, wo das bloße Auge nicht hinreicht, auf einer Stange einen graubraunen Falken entdecken, der mit knapper Not einem Albtraum entronnen ist: Das Gefieder gerupft und die Augen trüb, wirkt der Falke leblos, wie ausgestopft. Aber hin und wieder erhebt sich Zwerg Zorn und wirft ihm unter scharfen Kommandos ein paar Münzen zu. Der Vogel versucht, sie mit dem Schnabel zu haschen, aber das Kunststück gelingt nicht, immer fallen die Münzen daneben. Fluchend erhebt sich der Zwerg, sammelt sie auf und beginnt, sie wieder von vorn zu polieren.
Auf den Falken kommen wir später zurück. Denn bevor uns jetzt dieser heulende Zorn in eine Erzählung verschlägt, die nicht Teil der Heldenerzählung ist, sondern Teil der Geschichte der Bergarbeiter und Söldner, der Schatzgräber und ärmlichen Knochenverwalter, einer Geschichte, die sicher ergreifend wäre, aber nicht dem Charakter des Abends entspricht, dreht sich die Drehbühne weiter, um den Widersacher ins Spiel zu bringen, den die Zuschauer mit großem Applaus empfangen, denn heute Abend sieht Hagen besonders schön aus.
Nicht dass er sich etwa verändert hätte, er ist ganz der Alte, denn er hat gar kein Alter. Nur sein Haar wird jedes Jahr dünner und seine Stirn etwas höher. Übrigens eine schöne Stirn, die hohe Stirn eines alterslosen Bestatters mit sehr viel Erfahrung, der seine Lehrjahre irgendwo im europäischen Ausland verbracht hat; eine Stirn, hinter der nicht gegrübelt wird, weil Hagen sich auskennt und weiß, was zu tun ist, wenn alle anderen noch mit Klagen beschäftigt sind. Weshalb diese Stirn fast Zuversicht ausstrahlt, einen unaufdringlichen Glanz, in dem sich das Publikum gerne spiegelt, weil der Widersacher ihm seit Jahren treu bleibt.
Die verlässlichste Figur in der ganzen Geschichte, ein Mann wie ein Pfosten: nicht zu ermüden, nicht zu betrügen, lässt sich nicht täuschen, zu nichts überreden, ist nicht zu bestechen, unmöglich zu rühren, dient nur sich selbst und jener Kraft, die ihm erlaubt, jederzeit ohne Schlaf auszukommen. Der hat keinen Schlaf, keine Träume, hat nichts zu besprechen, nichts zu bereden, schmiedet Tag und Nacht Pläne und schreitet zur Tat.
Kein Zweifel, das Publikum liebt ihn. Denn nicht der Töter des Drachens, nicht der Bärenjäger und Zwergenhäuter, nicht der Besitzer des größten Schatzes der Welt, den niemand jemals zu heben imstande sein wird, sondern sein Mörder, der Schatzvernichter, ist sein heimlicher Held, der jetzt so lässig nach vorn an die Rampe tritt. Er muss nicht einmal die Stimme heben, denn der Widersacher wird niemals laut, er wird grundsätzlich leiser; fast flüstert er schon, doch man versteht jedes Wort. Noch auf den hinteren Rängen begreift man sofort, dass dieser Mann einen Auftrag hat.
Und es wird still. Sogar Siegfried verstummt. Während Hagen sich langsam umdreht, die drei gastlich schrumpfenden Könige Gunther, Gernot und Giselher (die übrigens Kellnerkostüme tragen) so entschieden wie sanft auf die Seite schiebt, um endlich den Jäger zu begrüßen, indem er flüchtig, wie nebenbei, die linke Hand hebt. Eine Art leises Winken, aus einer anderen Zeit, in eine andere Welt, bevor er leise und freundlich, fast nachsichtig sagt: Gebt dem Jungen ein Schiff!
Wie Siegfried den doppelten Hochzeitseiner besteigt
Ja, gebt mir ein Schiff! Am besten den doppelten Hochzeitseiner, um für uns beide auf einmal zu werben: um Brunhild für Gunther und um Kriemhild für mich. Lasst mich in Siegfrieds Drachenhaut schlüpfen, damit ich unterwegs endlich wachsen kann, damit ich mich endlich ins Ruder lege, um mich der Truppe noch anzuschließen, anstatt mich einfach so treiben zu lassen, flussabwärts von Basel in Richtung Worms. Doch vermutlich bin ich spät dran, denn die Truppe ist längst unterwegs, längst vorbei an den Niederlanden, auf dem Weg in die Nordsee und von dort aus weiter nach Isenstein, weil König Gunther sich das so in den Kopf gesetzt hat.
Fährmann, bring mich nach Worms! Aber kein Fährmann in Sicht. Der Fluss ist die Fähre, und ich bin der Fährmann, obwohl ich die Hand nicht vor Augen sehe. Ich lausche den leisen Schlägen der Ruder, die ich ins trübe Rheinwasser tauche; ein Wasser, das dunkle Befehle erteilt und ungeteilten Gehorsam verlangt: Ruder links, Ruder rechts, die Hand an die Riemen, die Schmerzen vergessen, die schwieligen Finger, das taube Herz, den Kater von gestern, den steifen Hals und das klopfende Knie.
Vergiss das Museum für Gegenwartskunst! Vergiss deinen Hunger und, weit schlimmer, den Durst. Auf deinen Durst kommen wir in der Pause zurück. Bis dahin leg dir einen Stein unter die Zunge, der führt auch Wasser. Aber hörst du mir überhaupt zu? Ja, Vater Rhein, ich höre dir zu, nur kann ich in kein Gespräch mit dir eintreten, weil ich die Königin sonst aus Augen verlöre, die Einzige, die mich am Leben erhält, weil sie mir, dem Nichtschwimmer, alles zugleich ist: Schutz und Schirm gegen Wind und Wetter, die Einzige, die mir sagen kann, wohin ich tatsächlich unterwegs bin.
Denn unsere Herzen schlagen im selben Takt, obwohl ich sie nie gesehen habe, während du jeden Tag die Ehre hast, an ihren hohen Fenstern vorbeizufließen. Für den Fall, dass sie einmal ans Fenster tritt, winkt sie dir vielleicht sogar zu, von oben nach unten, aus einer anderen Zeit, aus einer anderen Welt. Wärst du kein Fluss, sondern ein See, dann könntest du sie in Ruhe betrachten. Auch sie könnte dich in Ruhe betrachten, ihr könntet euch gegenseitig betrachten und dabei langsam in ein Gedicht verwandeln. Aber weil du ein Fluss bist und weitermusst, hast du die Königin vermutlich niemals gesehen, du weißt also gar nicht, wie schön sie ist. Denn in Wahrheit interessiert sie dich gar nicht, weil du ins Meer münden willst, um zu einer anderen Königin überzusetzen, die Gunther sich in den Kopf gesetzt hat.
Ich dagegen will einfach nach Worms, um Kriemhild mit eigenen Augen zu sehen. Sie sitzt in der Nibelungenwerkstatt und näht: In der Linken die Elle, in der Rechten ein Stück schimmernder Schneiderkreide, misst sie die prächtigen Stoffe aus und hat dabei einen Mann vor Augen, der ein hellgrünes Jagdkostüm trägt. Obwohl sie ihn nie gesehen hat, kennt sie seine Maße genau. Und um sie herum an die dreißig Frauen, die dasselbe tun wie die Königin: messen, zeichnen, falten und schneiden, vier mal vier Kleider für einmal vier Männer, die unter dem Fenster damit beschäftigt sind, ihre Reise nach Isenstein zu planen.
Enttäuschtes Murmeln auf allen Rängen. Den Auftritt hat man sich anders gewünscht, mehr Pomp und Posaune, mehr Licht unterm Fenster. Stattdessen Zwielicht, lautlose Dämmerung. Die Königin ist nämlich beschäftigt, nicht bei sich, sondern ganz bei der Sache. Und wenn wirklich wahr ist, was man erzählt, dass also, von jetzt an gerechnet, dreißig Frauen und eine Königin, bevor sie vier Männer nach Isenstein schicken, damit sie dort Schrecken durch Schönheit verbreiten, sieben mal sieben Tage lang mit nichts anderem als damit beschäftigt sein werden, Kleider zu nähen, Gewänder aus weißer arabischer Seide, Mäntel aus grüner Zazamankseide, unterfüttert mit Fischhäuten aus dem Ausland, besetzt mit Krägen aus Hermelin und mit Mantelaufschlägen aus kohlschwarzem Samt (unbezahlbar, wie mir der Wächter in Basel verriet), von den Knöpfen und Stickkanten ganz zu schweigen, dann muss ich mir keine Sorgen machen, ob ich noch rechtzeitig ankommen werde.
Denn in sieben Wochen kann ich es schaffen, selbst wenn ich beide Ruder verlöre. Nur dass es mir völlig unmöglich ist, sieben Wochen zu warten. Königin, hol mich nach Worms, damit ich dir endlich zu Füßen sitze, um dir Stoffe und Kreide zu reichen, Bandmaß und Elle, Schere, Nadel und Faden, bis ich endlich selbst der Faden werde, den du durch deine Nadel ziehst. Aber bevor du mich einnähst, in einen Mantel aus grüner Zazamankseide (weil Grün die Farbe der Hoffnung ist), halte mich kurz ins Zwielicht der Werkstatt, liebevoll wie eine kurzsichtige Frau, die umso zärtlicher liebt, was sie nicht sieht.
Tatsächlich, jetzt hat sie sich umgedreht, sie hat mich gehört und sofort begriffen, dass ich gar nicht nach Isenstein will, sondern dass ich seit Jahren davon träume, endlich sesshaft zu werden, dass ich davon träume, mich in einen See zu verwandeln, um sie für immer zu betrachten und für den kurzen Rest meines Lebens endlos um ihre Hand anzuhalten. Weil jeder Held weiß: Nicht die Fahrt ist gefährlich, sondern die Ankunft, nicht der Fluss, sondern sein Ufer, nicht das Meer, sondern die Küste.
Denn auf der Fahrt zu sterben, im Rhein zu ertrinken, wäre ein Leichtes, nichts würde dabei verloren gehen, nicht der Traum noch der Zwerg noch der Falke, weder Hand noch Gesicht noch der Traum meiner Königin; nur ihr Gesichtsausdruck würde sich leicht verändern, sobald sie erführe, dass ich untergegangen bin, bevor wir uns überhaupt kennenlernten. Aber das wäre kein Unglück, ich ginge glücklich auf Grund, käme endlich zum Stillstand und würde mich irgendwo in der Nähe von Worms auf dem Boden des Rheins in ein Gedicht verwandeln.
Wäre ich ernsthaft meiner Königin treu, dann würde ich hier auf der Stelle, zwischen Basel und Worms, einfach ins Wasser springen, um der Geschichte entschieden ein Ende zu machen, um meinen Zorn zu befreien und den Falken wieder zum Fliegen zu bringen. Doch ich kann beim besten Willen nicht springen, meine Sehnsucht ist einfach zu groß; ich hänge am Leben und an meinem lachhaften Ehrgeiz, unterwegs die Goldene Dreizehn zu finden. Und so treibe ich weiter, während die Nibelungenwerkstatt sich dreht, dreißig Frauen und eine Königin, die langsam und feierlich unter leiser Musik in einem dichten Nebel verschwinden. Dunkelheit. Stille. Danach eine Windmaschine und Rauschen.
Wie der Laie aus Worms das Publikum zum Schunkeln bringt
Kein Zweifel, das Meer, auf das das Publikum jedes Jahr sehnsüchtig wartet. Denn erst auf dem Meer kommt das Drama so richtig in Gang. Nichts gegen Seen und Gedichte und das süße Antlitz der Königin, nichts gegen den Fluss, der fahrende Ritter auf Linie bringt; aber erst im Meer entscheidet sich wirklich, wer schwimmen kann und wer untergeht. Werft also endlich Licht auf die Bühne, damit uns oben ein graublauer Himmel erscheint und unten grünschwarzes Wasser.
Der Jubel ist groß, man erkennt die Nordsee sofort, weil sie sehr hohe Wellen schlägt, steile Kronen aus gelbem Schaum, die jede Nacht neue Opfer fordern, erst gestern sind wieder zwei Sänger ertrunken. Was den Männern nichts ausmacht; schließlich haben sie sich auf den Weg gemacht, um sich ganz der Gefahr hinzugeben. Nur die Pferde sind unruhig, weil sie keinen Sinn für Seereisen haben, sie fürchten den Abgrund unter den Wellen, und ihre Furcht ist berechtigt.
Nervös, eng aneinandergeschmiegt, so stehen sie jetzt da, vier mal vier goldene Hufe am Heck, unter der Last ihres rotgoldenen Zaumzeugs, in das silberne Glöckchen eingenäht sind, die die ganze Fahrt über leise klingeln (Wir kommen, wir kommen!), während die Männer sich schwer in die Ruder legen, die gleichfalls aus Gold sind. Eine kleine schwere Galeere aus Gold. Fast meint man, die Männer singen zu hören, nur versteht man nicht, was, weil der Wind sich andauernd dreht.
Fährmann, bring uns nach Isenstein! Aber wer kann ernsthaft nach Isenstein wollen? Sie müssen ja wollen, weil Gunther es will, denn Gunther ist König, und sein Wunsch ist Befehl, darauf aus, eine große Geschichte zu schreiben, der selbst Siegfried sich beugen muss, weil Siegfried die Schwester des Königs will. Selbst wenn man dem König ein Opernglas gäbe oder kurzfristig Hagens Weitsicht liehe, damit der König schon aus der Ferne sieht, was in der Ferne auf ihn zukommt, kein Traum, sondern eine kahle Insel, ohne Farbe und Landschaft, reine, nackte Natur, mit einer steil in den Himmel ragenden Burg, deren Zinnen mit Königsköpfen geschmückt sind, lauter Köpfe, die längst keine Kronen mehr tragen, leblos wie ausgestopfte Falken, ohne Waffen und Flügel, wäre von Umkehr keine Rede.
Im Gegenteil. Der Tod seiner Vorgänger spornt ihn nur an, ihr Schicksal reizt und beflügelt ihn, lässt das Blut in seinen Adern noch schneller fließen und lauter rauschen und taucht Brunhild, deren Namen sein Schiff trägt, in ein umso helleres Licht. Nur ist hell gar kein Ausdruck, weit besser: strahlend! Seht genau hin, sie steht schon am Ufer, von oben bis unten in Weiß gehüllt, völlig unbewaffnet, ganz Unschuld und Sehnsucht. Jetzt winkt sie sogar, die Botschaft ist einfach, sie kann ihren Werber kaum noch erwarten.
In Wahrheit ist allerdings gar nichts zu sehen, nur das Meer und in der Ferne die Insel, eine uneinnehmbare Festung. Kein Zweifel, dass hier ein König rudert, der zu viel Phantasie hat, sich folglich zu viel aus Frauen macht und sich kurzfristig für unsterblich hält; und solange er sich für unsterblich hält, lässt der Tod ihn nur umso kräftiger rudern. Übrigens ein sportlicher Tod, ein fairer Tod, der sich genau an die Regeln hält, der das Spielfeld und seine Grenzen kennt.
Unter Wasser sähe er vermutlich anders aus, weil er ein Unterwassertod wäre. Aber hier an Bord ist er einer von ihnen, einer von uns; er könnte sogar einer der Zuschauer sein, ein uns unbekannter mutiger Mann, eine mutige Frau aus dem Publikum, den oder die (eine Idee der Regie) man kurzfristig auf die Bühne bittet, gleich nach vorn an den Bug, mitten hinein in die Wasserarena. Auf den ersten Blick eine Herausforderung, auf den zweiten eine einfache Übung; denn den Tod zu spielen ist keine Kunst, eine Anfängerrolle, reines Schülertheater. Schüler und Laien, so lehrt die Erfahrung, spielen den Tod seit jeher am besten, selten, dass einer von ihnen versagt. Sie sind einfach unbefangener, eifriger, unvorbelastet. Frei von jeder Rollenerfahrung, tauchen sie tiefer und gehen immer auf Grund. Der Profi dagegen stellt sich den Tod bloß vor, anstatt ihn ernsthaft zu spielen.
Genau genommen spielt er ihn nie, weil sein Schauspielerehrgeiz ihn daran hindert, die Sache selbst auf die Bühne zu bringen, während der Laie ganz bei der Sache ist, weil er am wirklichen Leben hängt. Der Tod ist nämlich ein Laie aus Worms, in einem billigen Trainingsanzug von Woolworth, aus der Fußgängerzone von nebenan, burgundisch nachempfundene Farben, die, sobald er ins Wasser fällt, für immer verblassen. Aber er wird nicht fallen, und fiele er, dann könnte er schwimmen, schließlich hat er den Jugendschwimmer, und auf das alte Abzeichen ist noch immer Verlass.
So sitzt er jetzt da, der geliehene Spieler, vorne am Bug, und spielt den besten Tod aller Zeiten, einen untrainierten, freundlichen Tod, der nicht glänzen will, sondern unaufdringlich Kommandos gibt, ohne jemals die Stimme zu heben. Er muss weder schreien noch brüllen, weder den Wind noch die Wellen besiegen; denn der Tod ist kein Held, sondern bloß sein Souffleur, der an einem kurzen Abend auf der Bühne in Worms lediglich darauf achten muss, nicht aus dem Takt der Geschichte zu kommen. Bis es, kurz vor der Ankunft auf Isenstein, plötzlich zu regnen beginnt und das Publikum nach Schirmen verlangt.
Also gebt ihnen Schirme, damit sie den Tod möglichst trocken betrachten, damit auch die in den hinteren Reihen hinter dem Vorhang aus Regen sehen, wie Hagen unter den Todeskommandos im traumhaft biegsamen Schatten von Siegfried, der so unbesiegbar wie sterblich ist, deutlich langsamer als die anderen drei rudert, irgendwie lustloser, träger, obwohl ihm nicht das Geringste entgeht. Keine Frage, dass der diplomierte Bestatter jeden Abend von neuem versucht, dem Tod von der Schippe zu springen; aber Dankwart, sein Bruder, rudert für zwei, Gunther für drei und Siegfried für zwölf.
Wie schön sie rudern, im strömenden Regen, im Heulen des Windes, unter der leisen, freundlichen Stimme des Todes, mehr Lob als Kommando, beinahe alle im selben Takt. So schön, dass auch das Publikum mitrudern will; fast beginnt es schon unter den Schirmen zu schunkeln, als wären Hagen von Tronje, der Tod und der Teufel, der Held und sein König nichts als Karnevalisten und das Meer keine Nordsee, sondern Väterchen Rhein, und das schwankende Boot nur ein Ausflugsdampfer; und die Brautwerbung eine Kaffeefahrt, ziemlich nass, aber lustig.
Und jetzt schunkelt es wirklich, das Publikum, standfest und rheinisch, neigt sich erst langsam nach vorn, dann wieder nach hinten, dann nach links, dann nach rechts, leiht dem Nachbarn freundlich den Ellenbogen und dem Chor auf der Bühne die Stimme des Volkes: Fährmann, bring uns nach Isenstein! Selbst die in den hinteren Rängen und die auf den Stehplätzen haben sich ganz dem Fahrtwind und den Wellen verschrieben. Und längst einer anderen Königin. Einer Königin, die nicht die Nadel führt, sondern das Schwert.
Zwillinge aus einem Ei
Denn es gab eine Zeit, da gehörten alle Köpfe der Welt einer Frau, die sich bis heute in Worms nicht besetzen lässt. Brunhilds Waffen sind einfach zu schwer, völlig unmöglich, sie auf die Bühne zu bringen: den maßlosen Schild, den drei Männer kaum tragen, die Harpune aus Gold, die hundert nicht heben, und den riesigen Stein, den selbst Siegfried ohne Zorn nicht vom Fleck bringen kann. Doch wirklich untragbar ist nur ihre Schönheit, weshalb die Bühne plötzlich aus den Angeln gerät – ein leises Knirschen, nicht mehr als ein Seufzer, bevor sie aufhört, sich weiterzudrehen. Sie steht einfach still.
Die Bühne steht still, die Zeit steht still, die ganze Geschichte steht still. Sogar die Nordsee steht still, während der obere Rhein anfängt, Eis auszubilden. Auch mein Boot füllt sich langsam mit eiskaltem Wasser, denn der Wärter hat mich schlecht ausgestattet: leckes Holz, morsche Ruder, keine Strömung und keine Windmaschine. Und aus dem Publikum nicht das leiseste Flüstern vor dieser großen Kulisse aus Stille und Eis; selbst die auf den Stehplätzen fangen an zu frösteln, weil sie begreifen, dass es kein Entrinnen mehr gibt, weil jetzt die eiskalte Königin kommt.
Aber es ist nicht Brunhild, es ist nur ihr Schatten, der sich langsam hinter der Bühne erhebt, der wächst und sich ausdehnt, immer höher und breiter, bis er schließlich auch die oberen Ränge erreicht und von dort aus den ganzen Himmel ausfüllt. Man sieht ihren Locken beim Wachsen zu, höher und prächtiger als jede Krone, eine wachsende Kathedrale aus Haar. Wie gut, dass man nur ihren Schatten sieht und nicht ihre Augen, denn wer einmal in diese Augen geblickt hat, für deren Farbe kein Dichter zuständig ist (was nur die Dichter behaupten), hat aus einem Brunnen getrunken, der menschlichen Durst niemals stillen kann, sondern ihn nur umso stärker entfacht.
Je mehr der Held trinkt, umso durstiger wird er, bis er sich so tief über den Brunnenrand beugt, dass er unweigerlich abstürzen muss. Aber wen jagen diese Augen tatsächlich? In Wahrheit jagt Brunhild nur einen einzigen Gegner, ihren eigenen Schatten; nicht den Mann, den sie liebt, sondern den Doppelgänger, den grünen Verräter, der unter der Tarnkappe in den Schatten eines anderen tritt, der Siegfrieds Zorn noch nicht kennt, seine zweite Haut und sein zweites Gesicht.
Ach! Was für herrliche Zeiten das waren, als es noch keine Schatten gab, keine Brautwerber und keine doppelten Hochzeitseiner, als Brunhild und Siegfried noch Kinder waren, alles in allem: nicht Mann noch Frau, weder Feinde noch Werber, nur das Brüderchen und sein Schwesterchen, Brunhild die Schwester und Siegfried das Reh. Wild entschlossen, niemals erwachsen zu werden, spielten sie nichts als sich selbst, immer wieder von vorn, immer ein und dasselbe Lied: Kinder, wie schön ist Isenstein!
Man sieht sie durch Feuer und Wasser reiten, durch eisige Landschaften voller Vulkane. Hitze und Kälte sind ihnen fremd, gleich stark und gleich mächtig, gleich groß und gleich prächtig, immer zusammen und immer allein, im selben Bett, doch nichts als Geschwister, Zwillinge aus ein und demselben Ei, die sich flüsternd die alten Geschichten erzählen, in denen die Zeit nicht vergeht und die Botschaft lautet: Versprich mir, dass du mich niemals verlässt.
Zuschauer waren nicht zugelassen, Besuche von auswärts sind nicht erwünscht. Die Zeit steht still, die Nordsee steht still, kein Widersacher, der den Zwillingsschlaf stört, kein Schwert, das die alten Drachen weckt. Ein reines Leben aus Unschuld und Sehnsucht, das nicht auf die Bühne zu bringen ist. Bis eines Tages der Zauber gelöst wird und die Bühne sich wieder zu drehen beginnt, weil sich der Held überraschend nach auswärts verliebt hat. Denn Siegfried hat seinen eigenen Kopf und zum Unglück die Neigung, sich ständig zu trennen. Die Liebe verwandelt ihn in natürliches Gold, er kann endlich nach Hause getragen werden, an den Hof von Worms, wo eine Frau sitzt, die seine Maße kennt, obwohl sie ihn nie gesehen hat.