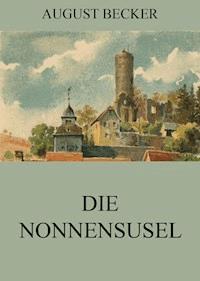
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein historischer Bauernroman aus dem Pfälzischen Wasgau.
Das E-Book Die Nonnensusel wird angeboten von Jazzybee Verlag und wurde mit folgenden Begriffen kategorisiert:
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 591
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Nonnensusel
Ein Bauernroman aus dem Pfälzischen Wasgau
August Becker
Inhalt:
August Becker – Biographie und Bibliographie
Die Nonnensusel
Einleitung - Das stille Dorf
1 - Frau Juliane
2 - Die Schwieger
3 - Der Herr Pfarrer
4 - Am Herd
5 - Bas Marlis
6 - Pfarrstunden
7 - Im Gefilde
8 - Übergänge
9 - Im Lenz
10 - Im Hochsommer
11 - Im Spätjahr
12 - Gehen und Kommen
13 - Es wurde Nacht
14 - Letztes Geläute
15 - Der Schnurres
16 - Es geht um
17 - Auf Beschau
18 - Ein Kirchweihgang
19 - Leviten
20 - Von Münster
21 - Der Purzelmarkt
22 - Marktschluß
23 - Der scheele Hannes
24 - Rüstungen
25 - Der Kampf
26 - Advent
27 - Andreasabend
28 - Der Borich
29 - Familienrat
30 - Es gärt
31 - Am Vorabend
32 - Die Trauung
33 - An der Hochzeitstafel
34 - Ein Hochzeitsmaien
35 - Heimfahrt
36 - Nachwehen
37 - Schorsch
38 - Auf dem Heerweg
39 - Heimsuchungen
40 - Amy
41 - Neuer Kampf
42 - Eine Wendung
43 - Stille Ernte
44 - Schluß
Die Nonnensusel, A. Becker
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN:9783849614485
www.jazzybee-verlag.de
www.facebook.com/jazzybeeverlag
August Becker – Biographie und Bibliographie
Deutscher Dichter u. Schriftsteller, geb. 27. April 1828 zu Klingenmünster in der Pfalz, gest. 23. März 1891 in Eisenach, studierte 1847–50 zu München Philosophie und Geschichte und widmete sich dann der Literatur. Von 1859 bis Juli 1864 gab er die »Isar-Zeitung« heraus, das Organ der großdeutschen Partei. Nachdem er schon früher eine Sammlung »Novellen« (Pest 1856) veröffentlicht, erschienen jetzt die Romane: »Des Rabbi Vermächtnis« (Berl. 1866–67, 6 Bde.; 2. verbesserte Aufl. 1884, 3 Bde.); »Hedwig« (das. 1868, 2 Bde.) und »Vervehmt« (das. 1868, 4 Bde.), welch letzteres Werk B. viele Anfechtungen zuzog, weil man lebende Persönlichkeiten des bayrischen Hofes darin geschildert glaubte. B. siedelte bald darauf nach Eisenach über, sammelte frühere Novellen: »Aus Dorf und Stadt« (Berl. 1869), und veröffentlichte an neuen Romanen: »Der Karfunkel« (das. 1870); »Der Nixenfischer« (das. 1871, 2 Bde.); »Das Turmkätherlein« (Leipz. 1872, 4 Bde.); »Meine Schwester« (Wismar 1876, 4 Bde.); »Maler Schönbart, eine Geschichte aus der Mark Brandenburg« (3. Aufl., Kassel 1878); »Auf Waldwegen« (Stuttg. 1881); »Der Küster von Horst« (Jena 1889); »Die graue Jette« (das. 1890); »Vor hundert Jahren«, zwei Novellen (Stuttg. 1891) u. a.
Die Nonnensusel
Einleitung - Das stille Dorf
Weniger bekannt als das goldene Weinland an der Haardt ist dessen südliche Fortsetzung gegen das Elsaß hin, die Landschaft an der Grenze von Landau bis Weißenburg. In den Chroniken des späten Mittelalters wird sie als »Niederer Wasgau« bezeichnet: Den Pfälzern gilt sie als das Oberland, die »Alte Welt«, wo sich noch viel ursprüngliches Volkstum bewahrt hat. Aus der Rheinebene zwischen Queich und Lauter zum Wasgenwald hinansteigend, schloß die Landschaft das frühere Gebiet der am Fuß der Vogesen vom fränkisch-austrasischen König Dagobert gestifteten Abteien Klingenmünster und Weißenburg ein.
Es ist eine schöne Landschaft, reich gesegnet vom Rheinstrom bis zum Saum des Gebirges, dessen vorderer Kamm die tiefen Forsten der Weißenburger Mundat und des Abtswaldes von Klingenmünster trägt.
Von Kastanienbäumen umrauscht, von Reben umsponnen, rückt der alte Vogesus etwas weiter in die Rheinebene vor. Hohe angebaute Hügelwellen bilden von klaren Bächen bewässerte Gründe, die ihren Talcharakter bis in die Nähe des Stromes bewahren. Hier ist jedes Dorf in der grünen Bergwiege eine kleine idyllische Welt für sich; die üppigen Weinlauben, die mächtigen Kronen der Walnußbäume und Edelkastanien geben ihr einen fast südlichen Charakter.
Am anmutigsten entfaltet sich die Mitte dieser Landschaft, das Klingbachtal, durch das von der Hauptbahn aus ein Postomnibus bis in meinen Geburtsort führt. Wer aber eine besondere Fußwanderung antreten will, steige in Bergzabern aus dem Zuge der hier endenden Zweigbahn, und wandere hügelauf, hügelab nordwärts nach dem von den Ruinen Landeck, Madenburg und Neukastel überragten Flecken Klingenmünster. Es ist nur eine Stunde Weges durch Weinberge, kastanienumschattete Hohlwege, Fruchtfelder und Wiesengründe.
Viel tausendmal bin ich diese Straße hin und her gewandert; in jungen Jahren täglich zweimal mit dem Schulränzel auf dem Rücken, um in der Heimat des kräuterkundigen Tabernaemontanus, wo schon die Römer ihre Bergschenken hatten, in das Idiom Cäsars und Xenophons eingeweiht zu werden. Von jeder Höhe, über welche die Straße führt, hatte ich den Anblick des blauen Schwarzwaldes, der, aus dem dunklen Grenzforst der Rheinebene aufsteigend, den Horizont als hohe Gebirgsmauer abschließt. Die Goldammern auf den Schlehdornzweigen, die schnurrende Wachtel am Wiesengraben, der schmetternde Buchfink auf dem Mandelbaum, der oft schon unter Schneeflocken seine Blütenpracht in den kahlen Reben entfaltete, waren mir vertraute Erscheinungen. Kaum bückte ich mich mehr nach den Walnüssen im Straßenstaub, oder im falben Herbstlaub der Hohlwege nach den geplatzten Stachelhülsen der Edelkastanien, die man hier »Kästen« heißt.
Im übrigen waren mir alle Obstbäume am Wege alte Bekannte; insbesondere ein schöner Apfelbaum, der mir schon beim Durchschreiten der langen Dorfgasse von Pleisweiler von ferne gastlich entgegenwinkte. Dieser Apfelbaum, der mich so oft durch seinen Schatten und seine Frucht erquickt hat, stand bei der steinernen Ruhebank zwischen den einander benachbarten Dörfern Pleisweiler und Oberhofen, die politisch und kirchlich eine Gemeinde bilden, in der Nähe eines zertrümmerten Kruzifixes auf einer dornumrankten, moosgrauen Weinbergsmauer, aus deren Spalten mich jedesmal eine goldgrüne Eidechse geheimnisvoll anäugte, wenn ich den gefallenen Sommerapfel von der Straße aufhob. Zuleide konnte ich dem zutraulichen Tierchen nichts tun: denn der Kindermund wußte davon zu erzählen, daß Eidechsen dem Menschen gegen böse Schlangen warnend und helfend beistehen. Scheu zog sich das Geschöpf mit den Märchenaugen nur dann völlig zurück, wenn ich der Gastlichkeit des Apfelbaumes durch einen gutgezielten Steinwurf zu Hilfe kam; darin hatte ich viel Übung, aus bloßer Hand und mit der Schleuder, die ich stets mit mir führte.
*
Es war ein heißer Nachmittag im Spätsommer. Kein Lüftchen regte sich. Schon aus einiger Entfernung hatte ich bemerkt, daß kein Apfel von »meinem« Baum im Staub der Straße lag. Die lange Gasse des Winzerdorfes Pleisweiler lag bereits hinter mir und das kleinere Nachbardorf Oberhofen, still und wie ausgestorben, kaum hundert Schritte seitwärts vor mir. Dennoch konnte mich das Dorf, an dem ich täglich vorüberkam, ohne es jemals zu betreten, in meinem Vorhaben, nach dem Wipfel des Baumes zu zielen, nicht abhalten. Denn niemand war weit und breit zu sehen, und mein jugendliches Gewissen noch weich und biegsam. Ein Steinhaufen am Straßenrand lieferte das Geschoß, das ich, kurz besonnen, in die Baumkrone schleuderte, wo die Äpfel am dichtesten hingen.
Als ich jedoch hinzueilte, um Ernte zu halten –, wie erschrak ich, einem Blick zu begegnen, der sich fest auf mich richtete. Es waren nicht die goldgeränderten Märchenaugen der grünen Eidechse, auch nicht die Argusaugen des gefürchteten Flurschützen; es war das blaue Augenpaar eines jungen Weibes, das aus der Wingertsfurche herausgekommen war. Ihr blasses Antlitz drückte Schmerz und kaum verhaltenen Unmut aus. Aus dem kleinen Weidenkorb, der ihr halb entglitten war, fielen Äpfel und Weintrauben in die Brombeerhecke. Ihre linke Hand griff nach dem rechten Oberarm, wo der rückprallende Stein getroffen haben mochte.
Im Grunde noch mehr erschrocken als sie selbst, verharrte ich, rot wie ein Blutfleck. Indes hatte sie sich soweit erholt, um vollends die Stufen herunterzukommen und neben dem halbversunkenen Kreuzsteinsockel stehenzubleiben. Sie war ländlich, sommerlich gekleidet, wie die Frauen der besseren Klasse jener Gegend. Der mir halb zugekehrte hübsche Frauenkopf mit einer helmartigen blütenweißen Haube ragte aus einer frischen Halskrause von der Form des Maria-Stuart-Kragens. Von ihrem braunen Haar waren außer dem Flechtenbund im Nacken nur das anmutig gewundene Seitenlöckchen an der Schläfe und die vorderen Scheitelsträhnen sichtbar, die sie jetzt mit dem Finger unter die Haube zurückstrich, indem sie sich noch mit dem weißen Schürzenzipfel leicht über die Stirn fuhr, um sich mir dann ganz zuzuwenden. Noch zögerte sie mit der Ansprache, wohl überlegend, was sie mit mir beginnen sollte.
Mir selbst wurde dabei immer beklommener zumut. Seltsamerweise fiel es mir diesmal nicht ein, zu entwischen. Ihrem Blick ausweichend, versuchte ich, mich nach den Äpfeln und Frühschwarzen zu bücken, um die entfallenen Früchte ihr wieder zurückzugeben.
»Hast du geworfen, Kleiner?« fragte sie. Ich nickte ein Eingeständnis.
»Darf man denn das?« fuhr sie im Dialekt der Gegend fort, merklich milder, wie mir schien, da sie meine Bestürzung wahrnahm. »Wart', ich werd' es deinem Vater sagen, was du für Sachen anstellst. Aber, wo bist du denn her, und wem gehörst du denn?« Verschüchtert gab ich die verlangte Auskunft.
»So, von Münster«, wiederholte sie, und ein eigentümliches, fast wehmütiges Lächeln kräuselte ihre Lippen. »Was meinst, Lieber, wenn's der Schütz gesehen hätte? Du bekämst ja ein Protokoll!« fügte sie mit wohlwollend schreckhafter Mahnung hinzu.
Indes hatte ich mich beeilt, die aus ihrem Körbchen gefallenen Früchte wieder aufzulesen.
»Gelt, bei so schwülem Wetter kriegt man Lust auf Obst. Nun, behalt' nur die Äpfel und Trauben, wirf aber nicht mehr in den Apfelbaum, wenn Leute um den Weg sind, und – grüß' mir auch deine Mutter schön!«
Damit strich sie mir die Wange, nickte mir freundlich zu und begab sich, ohne sich umzusehen, auf dem abzweigenden Seitenweg nach dem stillen Dorf, während ich, mit einer neuen Erfahrung und der Errungenschaft an erquicklichen Dingen, nachdenklich meines Weges ging. War doch die Begegnung merkwürdig genug. Denn Schädigung des Eigentums oder gar körperliche Verletzung so ruhig hinzunehmen, ist sonst dort nicht Gepflogenheit. Als ich kurz vorher eine bissige Gans, die mich anzischte, ein wenig flügellahm geschlagen hatte, waren mir die racheschnaubenden Frauen in der langen Dorfgasse kreischend und zeternd nachgelaufen, um mir die Haare auszureißen, die Augen auszukratzen, wenn sie mich kriegten. Und auch die Leute in dem stillen Nachbardorf standen keineswegs im Ruf besonderer Liebenswürdigkeit. Um so seltsamer erschien mir der Umstand, daß sich die gute Frau dahin gewandt hatte, als sei sie dort zu Hause.
Es hatte mit diesem Orte überhaupt seine eigene Bewandtnis. Viel tausendmal war ich schon, wie gesagt, an ihm vorüber, aber noch nie hineingekommen. Kein Kirchturm überragte die Hausfirsten, keine Glocke schlug zeitverkündend herüber, kein Brunnenrauschen unterbrach das Schweigen. Tiefe ungewöhnliche Stille lag über dem Ort. Man würde kaum geahnt haben, daß hinter den Bäumen auch Leute wohnen, wenn nicht zufällig ein Hahnenkrähen, das Brüllen einer Kuh, oder das Gekläff eines Spitzes von menschlichen Wohnungen Kunde gegeben hätten. Dann und wann kamen auch schweigsame Menschen den Feldpfad herauf, nach den Wingerten an der Straße. Und hin und wieder stieß man auch auf die im Weinland seltene Erscheinung einer eingepferchten Herde des Schäfers von Oberhofen. Da stand der Patriarch im breitrandigen Hut und weißen Rock, mit Hund und Schippe neben seinem Schlafkarren in einem Brachfeld, oder er zog drüben mit seiner Herde im Sonnenschein über die Höhen – stets eine ebenso befremdliche wie anziehende Erscheinung.
Wie ihr Schäfer in dem geheimnisvollen Rufe stand, er könne mehr als Brot essen, so galten die Bewohner des Ortes überhaupt als besonders »aparte« Leute, und man sagte ihnen nach, sie hielten sich selbst dafür. Daß sie sich gern abschlossen, war offenkundig. Nahm ihr Dorf auch noch Teil am Segen des Weinlandes, so zählte es doch keineswegs zu den eigentlichen Winzerorten, sondern mehr zu den Gäudörfern rechts von der Straße, deren Wohlstand auf dem Ertrag der weiten Gemarkung, auf der eigentlichen Landwirtschaft beruhte. Der kleine Ort galt als der reichste der Umgegend; seine Bewohner als fleißige, tüchtige Landwirte, haushälterische, nüchterne Leute, die »nichts draufgehen lassen« und aus jeder Scholle noch einen Extrataler drücken möchten. Man warf ihnen Bauernstolz vor, ein einbildnerisches Selbstgenügen, ja eine gewisse Selbstbespiegelung, wovon ihr Spitznamen »Spiegelgucker« herrühren mochte, gegen den sie jedoch viel Empfindlichkeit zeigten. Andere meinten, sie hießen nicht bloß so ob ihrer bäuerlichen Eitelkeit, sondern auch deswegen, weil sich hinter jeder Fensterscheibe – dortzulande ebenfalls Spiegel genannt – neugierige Gesichter zeigten, sobald ein fremder Schritt auf dem Pflaster dröhnte, wenn es auch nur ein Holzschuh- oder Besenhändler oder ein nach Kälbern suchender Metzger war.
Überall am Alten hängend, wenn ihr Vorteil es mit sich brachte, waren die Spiegelgucker von Oberhofen mitten in der gemischten Bevölkerung des Weinlandes ausnahmslos Protestanten, als frühere Reformierte der presbyterianischen Verfassung zugetan und – ohne pietistische Anwandlungen – mit einem Stich ins Puritanische, womit ihr republikanisch unabhängiger Sinn, der gelegentlich hervorbrach, sich wohl vertrug. Nur Bauern wohnten in dem Dorf, nicht einmal der Lehrer. Der kleine Ort hatte nicht Raum für Schulhaus und Kirche, die am Eingang des Nachbardorfes standen. Es war mit diesem und den links von der Straße, an den Bergen gelegenen Winzerorten Gleishorbach, Gleiszellen meiner Heimat Klingenmünster eingepfarrt, wogegen sich das Selbstgefühl der Oberhofener Bauern innerlich ebenso sträubte, wie gegen den Umstand, daß die Bürgermeisterwahl zuweilen auf einen Bewohner von Pleisweiler fiel. Wenn sie die Berührung mit den Schwestergemeinden möglichst mieden und sie ihre Heiraten am liebsten unter sich schlossen, mußten sie sich dennoch gefallen lassen, daß ihre Kinder gemeinschaftlich mit den anderen in der Mutterkirche zu »Münster« konfirmiert wurden.
*
Einmal, an einem schulfreien Nachmittag, hatte mich mein Vater in Bergzabern abgeholt. Durch Pleisweiler zur Ruhebank gekommen, wo bei dem steinernen Kreuzstrunk der Weg nach Oberhofen abzweigt, schlug er vor, »einmal durch den Ort zu gehen.«
Ich entsinne mich nicht, daß mir – außer den Ziehbrunnen mit Rad und Eimer statt der gewohnten laufenden Brunnenstöcke – in der sauber gepflasterten, menschenleeren Gasse etwas Besonderes aufgefallen wäre. Die tiefe Ruhe hatte nichts Überraschendes, weil sie vorausgesetzt werden konnte. (So ungewöhnliche Stille habe ich dann erst viele Jahre später im wendischen »Hansjochenwinkel« der Altmark und in den Flecken und Dörfern der Lüneburger Heide, seitwärts von Ülzen, wieder gefunden, wo die strohgedeckten Einzelhöfe nur die »Diele« der Straße oder dem Dorfplatz, ihre Fenster aber rückwärts dem Baumgarten zukehren.)
Hier in Oberhofen standen die Häuser – im Charakter des Übergangs rheinfränkischer Bauart zur alemannischen Form – wie allenthalben am Oberrhein in geschlossener Reihe mit hellblinkenden Fenstern, Giebel an Giebel die Gasse entlang; die geringeren mit offenem Hofraum, die übrigen stattlich überm Keller auf steinernem Unterstock, das Fachwerk in weißem Kalkanstrich, das Gebälk in seiner Naturfarbe, hoch darüber die zurückweichende Stirn der Dachwalbe, kleinere Schutzdächer über den Fensterreihen und dem großen Flügeltor, das, zwischen Hauptbau und Nebenhaus in steinernen Pfeilern hängend, den von Ökonomiegebäuden umschlossenen Hof nach außen sperrt: Jedes Haus eine feste Burg bäuerlich-behaglichen Familiensinnes.
Während wir hallenden Schrittes die öden Gassen entlang gingen, unterbrach mein Vater das waltende Schweigen mit gedämpfter Stimme: »Sieh dir das Haus an.«
»Welches Haus, Vater?«
»An dem wir jetzt vorüberkommen.«
Es war eines der stattlichsten und wohnlichsten in der Reihe, mit hellen Scheiben unterm Fenstersturz, mächtigen Torsäulen aus Quadern; daneben das »Nadelöhr«, die zum Plattenpfad des Hofraums und zum eigentlichen Hauseingang führende äußere Pforte. Das Ganze in seiner Abgeschlossenheit ein Bild ländlichen Wohlstandes und sauberster Wohnlichkeit.
Ich fragte, wer da wohne.
»Wenn ich die Zeit biete, tue ebenfalls dein Käppchen herunter«, sagte mein Vater, ohne meine Frage zu beachten.
Als er nun nach einem der Fenster hingrüßte und ich meine Mütze zog, bemerkte ich das von einem weißen Vorhang halbverdeckte Gesicht einer Frau, die freundlich nickend den unvermuteten Gruß erwiderte.
Lebhaft fragte ich, da ich meine Unbekannte von der Ruhebank erkannte, wer die blasse Frau sei. Mein Vater winkte ab; ich sollte schweigen. Erst draußen im Hohlweg bei den »Hanflöchern« sagte er: »Hast du bemerkt, daß jemand die Nebelkappe an der Fensterscheibe zerdrückte, um uns nachzusehen? Nein! Niemand nimmt sich Zeit dazu, alles ist bei der Arbeit daheim oder auf dem Felde. Man schafft ohne viel Lärm. Da heißt es nicht: viel Geschrei und wenig Wolle. Es sind keine Manschettenbauern, sondern jedermann greift rechtschaffen mit an. Trübselig sind sie deswegen noch lange nicht, hat doch Oberhofen seine Musikanten, die sich während der Winterruhe einüben. Tüchtige Leute, solider Wohlstand, weil selbstverdient durch richtigen landwirtschaftlichen Betrieb. Haushälter ja, aber keine Hungerleider. Werden ihre Kinder konfirmiert, springen die Kronentaler dem Herrn Pfarrer nur so in die Tasche. Freilich machen sie auch kein Hehl daraus, wenn er sie einmal zu lange auf den Beginn des Gottesdienstes warten läßt. Daß sie gern unter sich heiraten, nun, das Vermögen bleibt in der Familie. Guck einmal die Fruchtäcker hier: den Weizen, den Raps, die Spelz und Gerste, den Hanf, den Klee, das Korn! Und so in der ganzen Gemark!«
Mein Vater beschrieb mit dem Spazierstock einen weiten Kreis in der Luft, als wir mit dem kleinen Bach die Wiesen entlang ostwärts wanderten, und er sich über die Oberhofener viel günstiger aussprach, als ich es zu hören gewohnt war. Vielleicht hielt er so große Stücke auf die »Spiegelgucker«, weil er selbst einer echten Bauernfamilie entstammte. Solche allgemeine Bemerkungen genügten jedoch meiner erwachten Neugierde nicht. Während bereits ein anderes Dorf, Niederhorbach, vor uns auftauchte, von dem er ebenfalls Rühmliches aus gleichen Gründen zu sagen wußte, fragte ich ihn direkt, wer die Frau am Fenster gewesen war.
»Die Nonnensusel«, antwortete er nach einigem Zaudern. »Es ist die Nonnensusel«, wiederholte er mit achtungsvollem Nachdruck.
Nonnensusel? Welch' seltsamer Namen!
»Das ist nicht ihr Familiennamen«, fuhr er erläuternd fort, »nur ein Beinamen; jeder führt in diesen Orten einen solchen.«
»Aber woher hat sie den Namen, Vater?«
»Das ist eben ihre Geschichte«, antwortete er.
Da war ich nun so klug wie vorher. Daß es in der Gegend keine Klöster, also auch keine Nonnen gab, war mir bekannt. Überdies war Oberhofen streng protestantisch. Sollte diese Frau die einzige Katholikin und etwa in einem Kloster gewesen sein?
»Man heißt Frauenzimmer, die lieber ledig bleiben als heiraten wollen, auch Nonnen«, sagte mein Vater, als hätte er meine Gedanken erraten.
Verwundert schaute ich zu ihm auf. Daß Frauenzimmer, die unverheiratet bleiben wollen, in der Pfalz so selten sind wie wirkliche Nonnen, wußte ich. Jedermann heiratet, wenn sich Gelegenheit gibt. Und daß Ledige ihre eigene Haushaltung führen, wie es hier der Fall schien, war mir unbekannt.
»Das Haus gehört ihr, und sie ist noch ledig?« erkundigte ich mich.
»Ledig – dafür kann man sie doch nicht recht ausgeben«, bemerkte der Vater stockend, so daß mir seine Zurückhaltung auffiel. »Eine charaktervolle Person und – eine merkwürdige, eine sehr merkwürdige Geschichte.«
Mehr wollte mein Vater offenbar nicht verraten, und es war auch, wie ich ihn kannte, nichts aus ihm herauszubringen, wenn er sich nicht anders besann. Er konnte überhaupt – von Haus aus jedem Geplauder über andere abhold – ebenso vorsichtig wie rücksichtsvoll sein. Nie habe ich ihn bei einer üblen Nachrede ertappt.
Indes waren wir bei vorgerückter Stunde dem anderen reichen Gäudorf Niederhorbach so nahe gekommen, daß ich annahm, der Vater wollte hier noch seinen geschätzten Kollegen besuchen. Eben schlug die Turmuhr von dort herüber, als mein Vater beim letzten Schlag stehenblieb und, indem er die Spitze seines Stockes in den Acker am Weg stieß, sich plötzlich zu mir wandte. »Hierher wollte ich dich führen«, sagte er bedeutungsvoll.
Doch ich konnte nichts Auffälliges wahrnehmen. Es war ein sogenannter Spitzacker, bei dem wir standen.
»Hier stand einst die Kirche eines blühenden Dorfes, Weier hieß es, das gleich bei Beginn des Dreißigjährigen Krieges durch Brand und Pest zugrunde ging. Dieser Acker war der Kirchhof. Noch vor kurzem standen die Grundmauern des Kirchturms, und in einer Nische stieß man unter anderem auf eine große Bilderbibel, die wohl noch in Oberhofen oder Niederhorbach zu finden sein wird.«
Das war es nicht, was ich eigentlich zu hören erhoffte. Noch immer erwartete ich, den Platz in Beziehung zur Nonnensusel gebracht zu sehen. Allein es war eine Täuschung.
»Es wird schon Abend«, sagte dann mein Vater und schwenkte links ein. »Der Weg hier kommt von Weißenburg herunter; er führt nordwärts über den Kreuzstein nach Klingenmünster, heim zur Mutter. Es ist der alte Heerweg.«
Dieser Heerweg war mir seither nur aus unheimlichen Sagen bekannt. Ich hoffte nun, der alte Heerweg werde dem Vater Anlaß geben, auf die Nonnensusel zurückzukommen und mit weiteren Aufschlüssen herauszurücken. Aber nichts dergleichen; statt dessen wurde ich darüber aufgeklärt, daß der langhaarige Merowinger Dagobert, der rheinfränkische Bauernkönig, auf diesem Heerweg nach seiner Residenz Landeck zu reiten pflegte. Dann deutete mein Vater, indes sich der Abend über den Bergen und den hochgelegenen Winzerorten entzündete und der Dämmerschein die weite Flur verklärte, über die Kastanienbüsche der Kreuzsteinhänge nach dem Turm jener Burgruine hin, die in späteren Zeiten wohl dem schönsten, von der Wasigenfirst bis zum Rheinstrom reichenden, kurpfälzischen Amte den Namen gegeben hat.
Daß es den Vater reute, die Nonnensusel erwähnt zu haben, hätte mir auffallen müssen, als wir so im dunkelnden Abend über baumleere Feldhöhen und an verrufenen Stellen vorbei dem Heerweg folgten. Vor uns setzte Reineke Fuchs auf der Hasenjagd über den Einschnitt. Gespenstig, im weißen Rock auf seine Schippe gelehnt, stand einsam der Schäfer am Hochrand des Hohlwegs. In dessen Tiefe spukten seltsame Schatten. Kam da nicht Prinz Walter von Aquitanien, mit Prinzessin Hiltgunde hinter sich im Sattel, dahergetrabt auf seiner Flucht nach dem Wasgenstein? Doch war es nur ein quer auf seinem Gaul heimreitender Ackerknecht. Welche Erinnerungen weckte der Heerweg! Seine historische Bedeutung war jedoch für mich an diesem Abend nicht vorhanden; meine Gedanken kehrten immer wieder zu der Frau in dem stillen Dorf zurück, bis wir oben beim Friedhof auf der Kreuzsteinhöhe der Ruine Landeck gegenüberstanden, und die heimatlichen Lichter im Tal erblickten.
Meines Vaters Mitteilungen über das verschwundene Dorf haben mich später zu der Erzählung »Die Pestjungfer« angeregt. Die Nonnensusel schien einen noch dankbareren Stoff zu bieten. Doch der Vater wich auch später allen Fragen über sie und ihre Lebensgeschichte aus.
*
Andere waren weniger zurückhaltend. Ich kam allmählich dahinter, welche Leidenschaften und Schicksale die so ruhige und doch durchsichtige Oberfläche ländlichen Daseins zuweilen verdeckt. Sooft ich von München wieder nach den heimatlichen Bergen kam, forschte ich dem Geheimnis jener Frauenseele nach. So manchen Gang über Feld machte ich zu diesem Behufe, und nach langer vergeblicher Mühe auch die Bekanntschaft des damaligen Schäfers von Oberhofen. Auf der Deichsel seines Schäferkarrens sitzend, wenn die Schatten der weißen Herbstwolken vom Gebirge her über das weite Land flogen, lauschte ich dem Erzähler, der nüchtern berichtete, zuweilen aber auch fragmentarisch dunkel orakelte.
Mein guter Vater sah dieses Treiben mit ungünstigen Augen.
Einmal fragte er mich, warum ich meinen Stoff nicht in vornehmerer Gesellschaft suche. Was er darunter verstand, konnte ich mir wohl vorstellen, ihm aber nicht sagen, wie unendlich gleichgültig mir dergleichen Leute längst geworden waren; ich fragte nur, ob er je gehört hätte, daß Künstler und Poeten sich von Präsidenten und Räten angeregt fühlen, für Friedensrichter und Landkommissäre sich begeistern und für Notare schwärmen.
»Von der Nonnensusel und den Spiegelguckern will ich erzählen«, sagte ich ihm.
Er machte ein bedenkliches Gesicht. »Warte wenigstens damit, bis ich nicht mehr da bin!« meinte er.
*
Seit vielen Jahren ruhen nun Vater und Mutter auf der Höhe des heimatlichen Friedhofs über den steilen Hohlwegen des breiten Kreuzsteinrückens. Lange habe ich die Hoffnung gehegt, diese und manche andere Erzählung aus den Erinnerungen meiner Jugend einmal an Ort und Stelle, im lebendigen Eindruck der umgebenden Natur schreiben zu können. Doch auch dieser Traum ist ausgeträumt! Aller Wahrscheinlichkeit nach werde ich überhaupt meine Heimat nicht wiedersehen, und wenn diese Erzählungen noch vollendet werden sollen, muß ich mich beeilen, sie zu beginnen.
1 - Frau Juliane
Mehrere Jahre nach der Gründung der unierten pfälzischen Kirche durch die Vereinigung der Reformierten und Lutheraner hatte es an einem heiteren Herbstsonntag bereits zweimal zum Gottesdienst geläutet. Im dunklen Feiertagsstaat, mit dem neuen Gesangbuch unterm Arm, kamen die Leute schon die Gasse herauf, um in ernster Sammlung und Haltung, gemessenen Schrittes, gruppenweise oder einzeln, die kleine Wegstrecke bis zur Kirche am Eingang des Nachbardorfes zurückzulegen. Dort war noch die Ankunft des Geistlichen abzuwarten, der jeden Sonntagmorgen von Klingenmünster her zur Besorgung seiner Filialen über die Höhen und Rebhügel wanderte.
In der mit weißem Sand bestreuten Stube eines der besten Häuser des stillen Dorfes stand eine stattliche Frau mit ihrem heranwachsenden Töchterchen am breiten Renaissancetisch aus Eichenholz. Sie war im Begriff, eine dampfende Weinsuppe nebst Weckschnitten anzurichten, als eine junge Magd hastig hereintrat. »Bas, ich möcht' auch in die Kirche! Es wird bald zusammenläuten, der Herr Pfarrer wird gleich über den Berg kommen; und der Vetter ist auch schon fort.«
Juliane Groß, die eben aus einem großen, massiv aus Nußbaumholz verfertigten Wandschrank ein zierliches Porzellangeschirr nahm, drehte sich bei der letzten Bemerkung langsam um.
»Was geht dich der Vetter an?« fragte sie barsch, daß die dralle Magd bis unter die schwarzbraunen Scheitelhaare errötete. »Als Presbyter muß mein Mann in die Kirche, nicht ich oder du. Hättest übrigens schon gestern fragen können, Nettl. Du bist ja eine ganz eifrige Kirchgängerin! Abhalten will ich dich nicht«, sagte sie weniger hart. »Setz' aber vorher noch das Rindfleisch bei, das Sauerkraut mit Dörrfleisch über, und vergiß nicht, die Kästen abzubrühen. Dann, Nettl, kannst du meiner Eve gleich die Kindbettsuppe mitbringen, verstehst?«
»Ja, Bas!« Und die Magd schlüpfte zur Tür hinaus, um dem Auftrag nachzukommen und sich vollends anzuziehen, während die Hausfrau mit ihrem Töchterchen die Speisen für die junge Wöchnerin in einem Körbchen unterbrachte. »Du bist Tante geworden, Susel«, sagte Juliane, »mußt jetzt deiner Mutter unter die Arme greifen lernen, mein Augapfel. Wir müssen zusammenhalten, Kind, und was gewonnen wird, ist dir gewonnen, kommt dir zugut. Guck, da draußen wartet Vetter Balzers Hannes auch mit seinem Gesangbuch«, fügte sie durch das Fenster sehend hinzu, ohne daß der Hinweis jedoch des Mädchens Aufmerksamkeit dahin wandte.
Nacheinander kamen jetzt die Hausbewohner, um ihren Kirchgang anzuzeigen: Zuerst Hanjerg, der verheiratete Knecht, der nach dem Gottesdienst noch seine »Alte« aufsuchen wollte. Er möge seine Käthrine grüßen, sagte die Hausfrau zu dem Getreuen. Kaum war er draußen, streckte eine alte Magd, auf dem ergrauten Haarwulst ein altertümliches, rundanliegendes, schwarzgetüpfeltes Nebelkäppchen, den Kopf herein und kreischte mit starrem Lächeln: »Juliane, möcht' ein bissel beten geh'n, – kann's auch brauchen.«
»Hab' nichts dagegen!« winkte die Hausfrau ab, um sich dann wieder ihrem Töchterchen zuzuwenden: »Was nur die taube Aplone in der Kirche tut! Daß wir nicht mehr reformiert, sondern uniert sind, weiß sie kaum. Sie schleppt noch das alte Gesangbuch mit dem Resedenzweig darin mit, wie in jungen Jahren. Wenn sie mir nur nicht wieder mitten in der Predigt ihren Psalm anstimmt!«
Susel drückte den Deckel des Körbchens zu, und ein etwas ungeschlachter Bursche mit unangenehm derben Gesichtszügen stolperte herein, um sein Gesangbuch vom Wandschrank herunterzuholen. Man hätte ihn für den zweiten Knecht halten können, wenn er sich nicht so ungezwungen, vielmehr ungehobelt benommen hätte. Denn er nahm seine Marderpelzmütze nicht ab, und als Juliane bemerkte: »Auch du, Stoffel, gehst in die Kirche? Deine Mutter kann ja zusehen, wie sie daheim zurechtkommt«, gab er zur Antwort, was er denn vom Daheimbleiben hätte, worauf Frau Juliane mit entsprechender Handbewegung äußerte: »Ab von der Schippe – ihr könnt alle abkommen!«
Während nun Stoffel, der wie seine verheiratete Schwester Eve aus erster Ehe der Mutter stammte, sich zu seinem draußen wartenden Freund Hannes gesellte, sagte Juliane zu ihrem jüngsten und einzigen Kind aus zweiter Ehe: »Ja, wir bleiben aufeinander angewiesen, mein Herz!« Aber die Anwandlung von Zärtlichkeit wich rasch einem abweisenden Blick, als die junge Magd, zum Kirchgang gerüstet, wieder hereinkam. Deren Kleid scharf musternd, äußerte sich die Gebieterin etwas ungnädig: »Hast dich ja recht herausgeputzt, Nettl. Ist das blaue Seidentüchel ein Kirwestück?«
»Ja, Bas«, antwortete die Magd, um nicht zu widersprechen und rasch hinauszukommen; sie nahm das Körbchen, die Hausfrau rief ihr noch nach: »Besorg's gut, sag', ich käme bald selber nach, und guck' mir in der Kirch nicht so nach den Mannsleuten. Hörst du!«
»Ja, Bas, will's ausrichten«, sagte Nettl, und schon war sie draußen auf der Gasse.
Mit »Vetter« und »Base« werden nach schöner patriarchalischer Sitte jener Gegend Herr und Frau des Hauses vom Gesinde unbeschadet des Respektes angeredet, und diese Benennung bleibt fürs ganze Leben, auch wenn das Dienstverhältnis längst aufgehört hat. Dementsprechend sind Knecht und Magd gehalten; sie essen mit am Familientisch und gelten den Kindern, mit denen sie der Hausordnung unterworfen sind, als gewissermaßen zur »Freundschaft« gehörig. Denn »Freunde«, »Befreundete« heißen die Verwandten, so daß Franz von Sickingens Todesklage: »Unsere Freunde sind unsere ärgsten Feinde!« zuweilen noch jetzt zur Geltung gelangt. Nur gute Freunde brauchen keine Verwandte zu sein.
Da Taglöhner stets zu haben sind, werden nur wenig Dienstboten gehalten. Kleinere Leute, deren Feldbetrieb nicht ihre volle Zeit in Anspruch nimmt, arbeiten willig und gern im Taglohn, zudem schaffen Söhne und Töchter tüchtig mit. Sah Stoffel wie ein Knecht aus, so arbeitete er auch als solcher; entzog sich, obwohl ihm sein Vermögensanteil bereits ausbezahlt war, so wenig einer Aufgabe wie Hanjerg, der langjährige Acker- und Pferdeknecht.
Neben dem lebenden Erbstück, der alten Aplone, die das Kleinvieh versorgte und im übrigen der im Vorbehalt wohnenden Großmutter zur Verfügung stand, hielt Juliane, da ein Kindermädchen nicht mehr nötig und für den Winter eine eigene Spinnfrau leicht zu haben war, nur noch eine Magd für die Melkkühe und die Küche. Seit Weihnachten war es Nettl vom Gleiszeller Berg.
Ja, diese Nettl! Weil sie in Münster gedient und dort zwei Jahre ausgehalten hatte, mußte etwas an ihr sein, und so war Nettl anderen vorgezogen und gedungen worden. Droben am Waldrand des Hatzelberges, wo die Füchse und Hasen einander gute Nacht sagen, hoch über den Münsterer Steinbrüchen, lebte ihre Mutter in einem Stübchen jener Häusergruppe, die, noch bedeutend höher über dem an sich schon hoch gelegenen Winzerdorf Gleiszellen, die höchsten Wohnsitze am ganzen Gebirg in sich vereinigt. Das arme Weib hatte nach mütterlicher Gepflogenheit bei der Verdingung ihrer Tochter der neuen »Base« strengste Überwachung auf die Seele gebunden. Und kam sie seitdem einmal, um sich umzusehen, fand sie immer eine offene Hand; denn Hartherzigkeit war Julianes Fehler nicht. Und Nettl, die Tochter dieser Bedürftigen, fing nun an, sich so auffallend zu putzen!
Etwas nachdenklicher hatte sich Juliane, während ihr Töchterchen sich in die Küche begeben hatte, mit einem Gesangbuch ans Fenster gesetzt; ohne rechte Andacht blätterte sie darin, und zwischendurch warf sie einen Blick auf die verödete Gasse. Eben war nur noch, als letzte Kirchgängerin, die alte Bärbel aus dem Häuschen beim Hanfloch mit wackelndem Kopf und Rockwulst vorübergekommen und hatte, zum Fenster aufblickend, gemurmelt: »Die Juliane braucht nicht in die Kirche zu gehen, Gottes Segen fließt ihr doch zu. Wo viel ist, fällt viel hin – und wer das Glück hat, dem kalbt der Sägbock. Ach Gott, mein Herr und Tröster!«
Nun lag noch tiefere Stille als sonst, eine feierliche Sonntagsruhe über dem Dorf, über Haus und Hof der Beneideten. Dieser aber schien die rechte Ruhe zu fehlen. Lange in keine Kirche mehr gekommen, las sie einen Liedvers, dachte jedoch an anderes. Ohne die nötige Sammlung blieb auch die Andacht aus.
Diese Nettl! Die Magd war im Grunde nicht übel: gutmütig, flink und unverdrossen bei der Arbeit. Früh bei der Hecke, ging ihr alles von der Schipp', wie man in der Pfalz von tüchtigen Dienstboten zu sagen pflegt. Dabei war sie ein sauberes Ding, ohne Ansatz von Kropf, der auf den Gleiszeller Kalkhängen oft die hübschesten Mädchen verunstaltet. Draußen stets guter Laune, gern lachend und singend – beim Füttern im Stall, beim Grasen im Felde hörte man ihre helle Stimme –, war sie in der Stube vor »Bas« und »Vetter« zumeist still, schüchtern, bescheiden, als könne sie nicht bis drei zählen. Kurz, es gab nicht viel an ihr auszusetzen, als daß sie mit einem Male anfing, sich zu putzen – für wen? – und schönzumachen, statt ihre Mutter zu unterstützen. Wie kam sie zu dem Staate? Hing sie ihren Lohn daran? Das erregte Bedenken. Indes hatte die Hausfrau doch auch noch andere Sorgen.
»Ich werde ihr gelegentlich den Kopf zwischen die Ohren setzen!« sagte Juliane. Sie stand auf und begab sich in die Küche. Doch auch hier litt sie es nicht lange. Ihr Töchterchen ermahnend, das Abschäumen der Fleischbrühe nicht zu versäumen, stieg sie die Treppe hinan, wuchtigen Schritts, um in der Oberstube herumzustöbern. Als sie wieder herunterkam, ließ sie die Blicke nochmals flüchtig umhergehen und begab sich dann über die Schwelle in den Hof.
Dieser war sauber gekehrt, der zu den Ställen führende Plattengang blank gewaschen, das Hoftor verschlossen. Den Riegel der kleinen Eingangspforte daneben schob Juliane selbst vor, warf einen hastigen Blick nach den von Vorhängen dicht verhüllten Fenstern des »Altenteils«, und begann ihren Umgang. Soweit war alles in Ordnung. Wedelnd kam der treue Spitz, um die Herrin zu begleiten. Der Haushahn krähte inmitten seines scharrenden Volkes am hochgeschichteten Dunghaufen; neben dem leeren Schafstall grunzten die Speckschweine vergnüglich hinterm Trog. Sauber gestriegelt und wohlgefüttert stampften die Gäule in ihren Ständen; behaglich wiederkäuend lag im Kuhstall das Melkvieh vor der Krippe.
Überall sah Juliane nach – in der Scheuer und Spreukammer, im Kartoffelkeller, Schuppen, Wasch- und Kelterhaus, bald flüchtig, bald schärfer prüfend, mit Gemurmel oder laut hervorbrechendem Tadel, da etwas aufhebend, dort zurechtrückend, jetzt bedächtig, dann emsig weiterschreitend, um plötzlich ein Hindernis wegzuräumen und eine dunkle Ecke genauer zu untersuchen, in seltsamer Anwandlung alles beiseite schiebend, mit eigener Hand in einen Winkel, in eine Nische, in ein spinnwebiges Mauerloch zu greifen.
Vorsichtig, ja ängstlich sah sie sich zuweilen um, ob sie in dem nach außen völlig abgeschlossenen Hof nicht bei ihrem Tun beobachtet werde, stets darauf bedacht, den Schein der Nachforschung zu vermeiden und ihre Unbefangenheit zu bewahren. Die Unruhe, von der sie umhergetrieben wurde, mußte neben der gebotenen Umsicht der sorglichen Hausfrau noch einen besonderen, geheimen Grund haben. Vielleicht schloß ihr Töchterchen, wie eine lauernde Nachbarin hätte schließen können: die Mutter forsche nach verlegten Eiern der Haushühner. Denn daß sie nach einem Versteck suchte, war klar.
Nur der Weinkeller blieb von ihren Nachforschungen frei. Denn dort waren schon jeder Stein, jede Fuge, jede Schwelle so genau und so oft untersucht worden, daß es völlig unnütze Mühe gewesen wäre. Zudem scheute sie sich, allein den dunklen Raum zu betreten. Ihr erster Mann und dessen Vater hatten sich, wie so viele andere im Weinland, dort den Tod geholt durch heimliches »Petzen«, wie man in der Pfalz das Kneipen und damit auch das Trinken nennt. Die Dienstboten wollten seitdem bald den verstorbenen Mann, bald den Großvater in Kniehosen, Wadenstrümpfen und weißer Zipfelhaube im Hause umgehen, besonders am Faßspund drunten im Keller gesehen haben. Glaubte auch Juliane nicht an den Spuk, so war ihr doch der unterirdische Keller unheimlich; sie mied ihn und beschränkte ihre Untersuchungen auf jene Räume, die über der Erde lagen.
Teils mit zerfahrenem Entdeckungseifer, teils mit einem Anflug gelassenen Verzichts, wurde endlich auch das Backhaus besichtigt, dessen Ofen, vom gestrigen Kuchenbacken noch warm, Hürden voll Backobst enthielt. Da sich auch hier nichts Besonderes vorfand, wurde damit der sonntägliche Umgang beschlossen.
Juliane ging mit einer Gebärde, als wollte sie Antrieb und Zweck ihres wunderlichen Trachtens als eitle Grille und unnütze Quälerei von sich abschütteln, in den freien Hofraum zurück und fand, nach den Fenstern des Nebenbaues emporblickend, zu ihrer Beruhigung, daß dieselben geschlossen und wie gewöhnlich dicht verhängt waren. Während sie den Hund zurückscheuchte, schickte sie sich mit ernster Fassung an, in diesem Nebengebäude, das seinen Gipfel ebenfalls der Gasse zukehrte, zum Oberstock zu gelangen, wobei es galt, eine unangenehm knarrende Treppe möglichst leise hinanzusteigen.
Oben angelangt, verhielt sie sich ein wenig ruhig. Sie vernahm hinter einer Türe ein schwaches Hüsteln und Ächzen. Dann pochte sie an, und trat in eine freundliche, weißgetünchte, saubere Stube mit Alkoven und Gardinenbett, in dem eine alte Frau anscheinend schwer krank lag.
2 - Die Schwieger
»Großmutter, wie geht's?« fragte Juliane teilnehmend am Lager der Mutter ihres ersten Mannes, die hier im Vorbehalt wohnte. Mit »Oh!« und »Ach!« und »o Jerres« klagte sie, daß sich keine Seele um sie kümmere, niemand nach ihr, der armen Todkranken, gucke. Da Juliane das Aussehen der Schwiegermutter keineswegs schlimm fand, warf sie ein, daß Evens Kindbett viel Zeit beanspruche, und sie erwartete, der Hinweis auf die Geburt des Urenkels werde einen beschwichtigenden Eindruck hervorbringen. Aber weit gefehlt.
»O Gott, ich kann ja verhungern, oh!« fuhr die Alte fort und fügte kläglich seufzend hinzu: »So, du bist da, Juliane«, als gewahre sie deren Anwesenheit erst jetzt.
Mit einem Blick auf die Tasse, die leere Kaffeekanne und die über Teller und Tisch zerstreuten Bröseln, erwiderte Juliane: »Aber Großmutter, die Aplone hat Euch doch versorgt und es scheint, Ihr habt außer dem Zimmetkuchen auch den Zwetschen-, Apfel- und Traubenkuchen versucht.«
»Versucht? Ach ja!« winselte die Alte geringschätzig. »Wenn der Bissen nur vergönnt war!«
»Gott gesegn' es Euch! Wenn's nur geschmeckt hat.«
Nun hob eine neue Klage an. Ihr armer Magen! Da liege es wie ein Eisklumpen, gerade so; alsdann ziehe es herum, ganz herum, und nun sei es, als ob etwas drinnen zersprungen wäre, gerade so und zwar da! Da! »Ich leb' auch gar zu lange, gelt, Juliane?«
Die Schwiegertochter mahnte, solche Reden nicht zu führen. Vorwürfe seien unverdient. Man lasse ihr nichts abgehen, tue, was man ihr an den Augen absehe. Wer könne dafür, wenn sie dem Kuchen mehr zugesprochen habe, als ihr gut tue! Hätte man ihr zu wenig vorgesetzt, dann wollte man sie erst klagen hören!
Hierauf erfolgte als Antwort wieder Ächzen und Seufzen, dann die Aufzählung: eine alte, kranke Frau ohne guten Zahn im Munde könne nicht klappern – sie sagte übrigens »knäwre« – wie eine junge. »Meinem schwachen Magen, o Jerres, tuen Weinsuppen und Weckschnitten auch besser. Das aber meiner Sohnsfrau zuzumuten, der liebe Gott bewahr' mich!«
Verblüfft sah Juliane auf die Alte. Wußte sie auch hiervon? Sonderbar: monatelang kam sie nicht ans dem Bett und war dennoch von allem, was im Hause vorging, so genau unterrichtet wie vordem, als sie noch frisch wie eine Ente in Haus und Hof umherstrich. Seit ihrer »Krankheit« waren ihre Fenstervorhänge immer dicht geschlossen. Zum Aushorchen des Gesindes fehlte ihr die Gelegenheit, da sie mit Ausnahme der alten, tauben Aplone, deren Treue Juliane kannte, mit den Leuten nicht in Berührung kam. Ihr Enkel Stoffel aber nahm sich keine Zeit, um ihr Dinge zu hinterbringen, die sie schon besser wußte.
Wie kam sie nun dahinter? Der Umstand erschien nachgerade unheimlich, wollte man sich nicht mit der Annahme begnügen, sie wittere alles.
Es sei wahr, erklärte Juliane, während sie einen Stuhl abräumte, um sich zu setzen: der Eve sei eine Kindbettsuppe geschickt worden, und weil die Großmutter schon Kaffee getrunken und bald Fleischbrühe bekomme, habe man deren Anteil an Weckschnitten für den Fall aufgehoben, daß sie etwa zu Mittag das Familienessen verschmähe. Nach einigem Bedenken schien sich die Alte auch zufriedenzugeben, meinte aber so nebenbei: »Susel hat wohl schon ihren Teil; so ein Kind, das Herzenskind, kann man nicht warten lassen.«
»Nicht so viel hat sie davon gekriegt«, berichtete Juliane mit einigem Eifer. »Nicht so viel! Ich erzieh' mir keine Schleckerin!«
Auf diese Anzüglichkeit hin folgte eine kleine Pause. Vielleicht fühlte die Alte sich nicht einmal sehr getroffen, da sie sich bewußt war, gute Dinge zumeist aus dem Grunde gern zu essen, damit andere sie nicht bekämen. Ihre Mißgunst überwog noch ihre Lüsternheit.
Da Juliane das Bedürfnis fühlte, die Schwiegermutter zu beschwichtigen, wollte sie sich eben mit begütigenden Worten an sie wenden, als die alte Frau anfing: »Wenn du so red'st, Juliane, darf ich nicht mehr an die Persching' denken.« Sie meinte die Pfirsiche im Weinberg gegenüber der Kirche. »Hab' mich so darauf gefreut; das einzige Obst, das mir gut tut. Mein Adam, dein erster, hat nie versäumt, seiner Mutter die Persching' heimzubringen. Jetzt hat sie – der Kuckuck weiß.«
Juliane meinte nicht, daß die Perschinge schon fort seien.
»Hm«, warf die Alte hin. »Die Nettl trägt ja Taschen in ihren neuen Schürzen.«
Juliane wurde aufmerksam. »Ja, Schürzentaschen trägt sie. Aber was soll's damit?«
»Nichts weiter«, versetzte die alte Frau, »nichts, als daß sie sich sonntags aufdonnert und dahergeht, als sei sie's! Wo sie's nur her hat?«
»Wo wird sie's her haben! Ihren Lohn hängt das Gackohrle an den Staat!« bemerkte Frau Juliane etwas gereizt. »Aber wart', ich will ihr die Flügel schon stutzen! Und was nun das betrifft, glaubt Ihr, Großmutter, meint Ihr gar, daß – Ihr versteht mich, he?«
Während die alte Frau sich aufrecht setzte, – denn sie hatte sich während des Plauderns von ihrer Schwäche gar sehr erholt, – sah sie ihre Schwiegertochter mit einem lauernden Seitenblick an und dann etwas bedenklich drein, enthielt sich aber jeder Äußerung. Sie wiegte nur leise das graue Haupt, bis Juliane sich bestimmter erkundigte: »Großmutter, ist etwa wieder was gefunden worden?«
»Was?«
»Ein Strumpf!« betonte Juliane vertraulich.
»Versteh dich nicht!« entgegnete die Alte, die unruhig an ihrer Bettdecke zupfte. Und als Juliane bemerkte, sie solle doch nicht tun, als wisse sie von nichts, fragte die alte Frau, nochmals die Bettdecke gegen die Wand hin niederdrückend: »Was meinst du? Ich habe nichts gefunden, such' auch nicht danach. Ich nicht. Du, freilich, am Suchen läßt du's nicht fehlen, Juliane.«
Diese gestand, daß ihr allerdings, der Kinder wegen, der Gedanke alle Ruhe nehme, daß hierin etwas versäumt werden könnte; es wären doch Errungenschaften.
»Und wenn,« fiel die Alte, in Unruhe geraten, ein, »doch nicht von dir und deinem Heinrich errungen, Juliane, doch in schwerer Zeit nur von mir und meinem David selig und von meinem Adam, deinem ersten Mann, errungen, der so früh hat sterben müssen, und zwei Kinder hinterlassen hat. Soll denn alles für deine Susel sein?«
»Na, wißt Ihr, Schwieger«, entgegnete Juliane, »was das betrifft, da fühl' ich mich rein. Weder Eve noch Stoffel – es sind ja doch meine Kinder – sollen um einen Kreuzer verkürzt werden. Damit müßt Ihr mir nicht kommen. Was mir in die Hand fällt, wird nicht verhehlt!«
»Verhehl ebbe ich?« fuhr die Schwiegermutter in ihrem Bett auf. »So wahr ich da sitze, meine Lebtage keinen roten Heller!« beteuerte sie mit einem fast beängstigenden Eifer. Sie drückte die Decke zwischen Bett und Wand so krampfhaft nieder, als habe sie dennoch etwas zu verbergen. Wäre Juliane argwöhnisch gewesen, hätte es ihren Verdacht erregen müssen; so aber fiel es ihr nicht auf, während die Alte heftig fortfuhr: »Nichts habe ich gefunden, gar nichts, als den Dr.. bald hätte ich etwas gesagt!« unterbrach sie sich, nach einer Wandnische deutend, in der eine alte Schachtel und neben anderem kleinen Gerümpel ein altes, abgegriffenes Buch lag. »Guck dir den Schatz nur an, hol' ihn nur herunter, Juliane, gib mir aber auch meine Hornbrille und das Gebetbuch her. Ich will doch auch meinen Sonntag haben«, setzte sie mit weinerlichem Vorwurf hinzu.
Juliane kannte die Schachtel, auf deren Inhalt sie schon oft in ähnlicher Art verwiesen worden war, genau. Sie nahm sie mit allem übrigen herunter, um nicht noch einmal dazu aufgefordert zu werden. Hunderte von Scheinen waren da angehäuft, Papiergeld in Bündeln, wie sie sich damals noch allerorts in verstaubten Schubladen und Hauswinkeln als Erinnerung an schwere Tage vorfanden.
»Weiß ja«, meinte Juliane beschwichtigend, als sie die Schachtel wieder an ihren Ort brachte, »keine rote Bohne sind sie wert. Regt Euch nur nicht so auf, Großmutter. Handelt sich's doch um Schwereres, als um lumpiges Papiergeld!« Und damit schickte sie sich an, das in Unordnung gebrachte Bett zurechtzumachen, Decke und Kissen auszuklopfen und die unruhige Alte bequemer zu legen. dagegen diese jedoch sich so ängstlich, ja heftig und nachdrücklich wehrte, daß ihre Schwiegertochter notgedrungen einhielt und wieder auf ihren Stuhl zurücksank.
»Au!« schrie die alte Frau, als ob man ihr weh tue, »mach' mein Bett schon selber. Wenn du ebbe noch bleiben willst, Juliane«, fuhr sie dann fort, »so setz' dich wieder, und ich möcht' dich fragen: Meinst du, Vetter Jokeb gibt unserm Stoffel einmal die Gretel?«
Juliane nahm das auf die leichte Schulter. Gretel gehe mit Susel noch in die Schule, Stoffel denke nicht daran, und es sei noch lange Zeit für die »Krotten«, – wie sie als Pfälzerin für Kröten sagte, aber nicht als Schimpf-, sondern mehr als Kosenamen für junge Mädchen.
»Er wird wohl nicht daran denken!« versetzte die Alte verschmitzt. »Der Stoffel ist nicht so da. Meinst du, er bleibt euch zulieb' ledig und schindet sich ab wie ein Knecht?«
Allerdings war Juliane der Ansicht, daß er sich vorderhand gut genug befinde; er habe sein Essen und Trinken, könne in den Keller, wenn's ihn dürste, – ihr »Henrich« halte ihn nicht zu kurz. Stoffel lebe als Kind im Haus, habe für nichts zu sorgen, brauche seine Zinsen nicht anzugreifen und schlage sie zum Kapital.
»Ja, ja«, stimmte die Großmutter jetzt zufrieden bei, »jeden Kreuzer dreht er in der Hand um und gibt ihn dann erst recht nicht aus.«
»Er schlägt nicht aus der Art,« dachte Juliane laut.
»Ein Vertuer ist er nicht«, sagte die Alte, »aber doch nur Knecht!«
»Im Haus seiner Mutter?«
»Das Haus, Juliane, stammt von unserer Seite her«, mahnte die Schwiegermutter. »Er schafft für euch; und alle Errungenschaften in jetzigen besseren Zeiten kommen nicht ihm und unserer Eve, sondern deiner Susel zugut.«
»Natürlich. Es ist so ausgemacht – vor dem Notar.«
»Aber es ist nicht recht.«
»So, auch noch!« Juliane erhob sich. »Das geht mir doch übers Bohnenlied! Wer hat denn darauf gedrungen? Wer hat dem Vormund Tag für Tag in den Ohren gelegen? Wer hat steif darauf bestanden, daß den Kindern aus erster Ehe ihr Anteil ausbezahlt werde? Ihr und Eure Leute!«
»Versteht sich, du hast dich wieder verheiraten wollen!«
»Und ihr alle seid gegen die Heirat gewesen.«
»Ja, ja! Weiß wohl, Juliane.«
»Und wer hat denn darauf geschworen, daß es mit mir ganz zurückgehe, daß ich arm werde und an den Bettelstab gerate?« fragte Juliane. »Ihr und wieder Ihr. Und wär' ich zugrund gegangen, wär' ich in Armut und Elend versunken, und wär' ich hungernd und bettelnd zu Euch gekommen: Kein Stück Brot hättet Ihr mir gereicht, Schwieger. Aber es ist anders gekommen. Wir haben's uns sauer werden lassen! Mein Mann hat Zugebrachtes bar drangegeben, wir haben Geld aufgenommen, wir haben's geleistet, – ich und mein Henrich! Wir haben uns gerührt! Er hat Euch gezeigt, daß wieder ein Mann im Hause war, und was für einer! Die unschuldigen Kinder haben wir bei uns behalten, sie erzogen, Eve ist eine brave Frau geworden, Stoffel hat schaffen gelernt. Die Schulden sind bezahlt, die Äcker, Wiesen, Wingerte noch unser. Ich bin heut' nicht ärmer, ich bin reicher als vor der Abschichtung! Und mein Susele, mein Susele ist – da beißt keine Maus einen Faden ab – das reichste Mädel im ganzen Dorf!«
»Da wird ja Vetter Balzers Hannes wohl auf dein Susele warten«, warf die alte Frau mit äußerem Gleichmut hin.
»Glaub' selber«, bestätigte Juliane triumphierend, denn dieser Hannes war der einzige Sohn eines der ersten Bauern im Ort. »Ja, ja, so steht es. Und daß ich es so weit gebracht habe, das dank' ich neben dem lieben Gott und mir selber meinem Mann, meinem Henrich.
»Na, na!« ließ sich die Alte mit wackelndem Kopf vernehmen. »Wenn man dich hört, sollte man denken, ihr wäret ein Herz und eine Seele.«
»Sind wir es nicht?!«
»Im wichtigsten uneins.«
»Uneins?« wiederholte Juliane mit finsterer Miene, die sich aber sofort wieder aufhellte. »Ich kann mir denken, worauf Ihr stichelt, Schwieger. Daß er als Presbyter in die Kirche geht, ist seine Sach'; daß ich daheim bleib, ist meine Sach'. Deswegen sind wir noch lange nicht uneins. Es geht niemand was an, wenn ich ihn seine Wege gehen lasse.«
»Das ist wahr«, bemerkte die Alte »und wären's Nebenwege.«
Merklich zuckte Juliane zusammen und schaute, sich verfärbend, der Schwiegermutter gerade ins Gesicht. Dann aber faßte sie sich, um nur noch gleichmütig mit den Achseln zu zucken.
»Da lach' ich, Schwieger«, sagte sie. »Das ist zum Lachen. Mein Henrich? Zum Lachen.«
Dennoch lachte sie nicht, sondern hörte, anfänglich zerstreut, erst aufmerksam zu, als die Schwiegermutter in ihrer Weise jetzt fortfuhr: »Steht es so mit dir, wie du sagst, kannst du auch lachen, Juliane. Daß es aber so steht, na, dazu hat doch mein David selig den Grund gelegt und auch mein Adam, dein erster, sein redlich Teil beigetragen, vielleicht mehr als man weiß. Die Hälfte des Vermögens ist dir gerichtlich zugesprochen worden.«
»Versteht sich. Zusammen übrigens noch nicht so viel, als ich in die Ehe gebracht hab«, erwiderte Juliane, während sie mit verschränkten Armen in dem kleinen Gemach hin und her ging. »Errungenschaften? Zurückgekommen sind wir damals. Ein heimlicher »Petzer«, wie sein Vater, hat er ihm auch die andere Verrücktheit abgelernt. Wie die Katze ihre Jungen, hat er das bißchen Geld verschleppt. Sind das nicht Narrenstreiche sondergleichen? Gott verzeih' mir meine Sünden. Aber nach seinem Tode – der liebe Gott hab' ihn selig! – seid Ihr zu mir gekommen, Schwieger, um nach der Hinterlassenschaft an barem Geld zu forschen. Als ob die arme Witfrau es weggeschafft hätte! Bei all der schweren Last auch noch das Kreuz! Und ich hab' den Verdacht auf mir liegen lassen müssen, lange Zeit. Aber was geschieht? Da bringt einmal die Aplone einen alten Strumpf, ganz vollgestopft, aus dem Taubenschlag, dann der Hanjerg einen anderen Strumpf aus dem Strohbarren, und wieder die Aplone einen aus einem Rattenloch im Waschhaus und einen ganzen Hafen von Sechsbätznern vom Katzenlauf herunter, und wegen ihrer glücklichen Hand habt ihr dann die alte taube Person zur Bedienung verlangt. Die rote Käthel, die in selbiger Zeit bei mir gedient hat, soll jetzt auch in guten Verhältnissen leben. Und wer weiß, wieviel noch verschleppt worden ist oder noch versteckt liegt im Haus, – wer weiß!«
»Ah«, machte die Alte geringschätzig, »was soll denn noch versteckt liegen?!«
»Meint Ihr?« sagte Juliane und ging einen Schritt gegen das Bett zu, daß die Alte wieder ängstlich die Bettdecke an der Wand niederdrückte. »Wißt Ihr das gewiß, Großmutter? Ich wäre in den Tod froh. Eine wahre Last wäre mir von der Seele genommen. Man hätte doch einmal seine Ruhe. Solange man aber noch merkt, daß der Stoffel durch's Sparrenwerk krattelt...«
»Ach«, sagte die Alte und schaute zur Seite, »es kratteln noch andere über die Balken!«
Juliane suchte einen Augenblick nach dem Sinn dieser Worte und fragte dann: »Ihr glaubt also nicht, daß Nettl einen Strumpf...«
»Ah pah! Aus einem Strumpf kommt ihr Staat nicht.«
»Woher dann, habt Ihr schon etwas bemerkt, Großmutter, haltet Ihr sie für unehrlich?«
»Warum fragst du mich, das fünfte Rad am Wagen? Weißt du, Juliane, so ein Dienstbote kann auf verschiedene Weise untreu werden. Und ein Mann kann auf verschiedene Weise Geld anbringen. Der eine verleiht's, der andere vertut's, der eine steckt's in einen Strumpf, der andere in eine Schürzentasche...«
»Ich weiß nicht«, sagte Juliane nach einer Pause, »worauf das abzielt. Ihr redet in letzter Zeit so herum, Schwieger. Es wäre mir lieb, Ihr ginget mehr aus Euch heraus.«
»Ich will dir was sagen, Juliane«, antwortete die alte Frau aufrichtig, »du bist nun einmal meine Sohnsfrau gewesen, wenn dir auch der Henrich und die Susel mehr ins Herz gewachsen sind, als ich, Stoffel und Eve. Du hast damals meinen Adam genommen um seines Geldes wegen. Mehr brauch ich nicht zu sagen.«
»Es wäre mir aber lieb, Ihr ginget jetzt mehr aus Euch heraus«, wiederholte Juliane.
»Kein Wort sag' ich mehr, kein Wort.«
»Auf halbem Weg bleibt man nicht stehen, Schwieger!«
»Ich weiß nicht, was du willst, Juliane! Wie kommst du mir denn vor?!« Die Alte schlug einen anderen Ton an. »Ganz matt bin ich, förmlich krank von dem vielen Reden. Nicht wahr, Juliane, du bist so gut und schickst mir gleich die Fleischbrühe. Vergiß' auch die Weinsuppe nicht; mir wird schwach, und auch die Weckschnitte nicht. Auch die Persching, – sie haben mir immer so gut getan. Sag' unserer Eve, sie soll sich nur halten, wenn auch das Kleine kreischt, als ob's am Spieß stecke, – das tun alle Kinder. Sag' auch, es tät mir leid, daß ich nicht selber kommen kann. O Gott! Komm ja nicht einmal mehr in die Kirche!« Ächzend war sie in das Bett zurückgesunken und kehrte ihr Gesicht der Wand zu.
Juliane betrachtete, noch kurz verweilend, die Alte. Sollte sie dieselbe nochmals auffordern? Vergebliches Bemühen. Sie wußte, daß nichts aus ihr herauszubringen war.
Mit einem Stachel im Herzen verließ sie das kleine Gemach, begab sich die knarrende Treppe hinunter, über den Hof in die Küche, von da in den Oberstock, um dann frisch geschürzt und mit einer neuen Haube auf dem Kopf durch die Scheuer das Haus zu verlassen. Durch die Gärten ging sie zur Wohnung ihrer im Kindbett liegenden Tochter Eve. Dort fand sie alles in bestem Befinden. Und dann ging sie zum Dorf hinaus zur nahen Ruhebank.
Eben scholl von der Kirche ein Choral herauf. Juliane kannte Wort und Weise. Sie hätte mitsingen können, aber es war ihr nicht darum.
Mit dem katholischen Gotteshaus drinnen im Dorf konnte sich das innen und außen schmucklose protestantische Gotteshaus, das am Dorfeingange stand, nicht messen. Aber mit seltsam gemischten Gefühlen sah Juliane nach dem schlichten Kirchlein, dessen Glocke bereits Gebet und Segen verkündete. Nun wurde noch ein Schlußvers gesungen. Wie rasch war der Gottesdienst zu Ende! Wenn sie sich nicht eilte, träfe sie mit den heimkehrenden Kirchgängern zusammen. Das wollte sie vermeiden.
Noch sah sie mit gespannter Aufmerksamkeit hinunter. Dann aber brach sie hastig die schönsten und reifsten Früchte vom Baum; die »Persching« durften nicht vergessen werden! Dann machte sie sich eilig auf den Heimweg.
3 - Der Herr Pfarrer
Der Gottesdienst war zu Ende. In weihevollem Abstand kamen zuerst die Frauen aus dem Portal und unter die bereits vergilbende junge Linde; die Ledigen barhäuptig, die jungen Frauen mit gestärkten, duftig weißen »Nebelkappen« und Ziehhauben, die älteren in schwarz punktierten Hauben, rund und eng anliegend. Dann erst folgten, in strenger Ordnung, die Knaben und älteren Burschen, und zuletzt die Männer in langen, dunklen, mit breiten Metallknöpfen besetzten, kragenlosen Röcken und dreieckigen Hüten. Diese Ordnung löste sich auch nicht auf, als sich die Hälfte der Kirchgänger links in die Dorfgasse von Pleisweiler hineinwandte, während die andere auf der Landstraße die Richtung nach Oberhofen einschlug.
Den Schluß machte eine Gruppe ernster Männer, zumeist Presbyter, mit dem Geistlichen, den der schwarze Frack, die weißen Bäffchen unterm Kinn und das tiefschwarze Genfer Flormäntelchen, ein faltiger Merinostreifen auf dem Rücken, kenntlich machte, da damals der weite lutherische Chorrock noch nicht eingeführt war. Auch der Herr Schulmeister, der die Orgel geschlagen und mit der Kreide die Choralnummer angeschrieben hatte, gesellte sich zu ihnen, leicht von den andern zu unterscheiden durch den stahlblauen Rock mit hohen Achselwulsten, den schmal zulaufenden, hohen Hut, die kreidigen Hände und den weißen Nasengiebel.
»Nun, Jerg«, wandte sich der Geistliche an einen jungen Mann mit derben Zügen und von vierschrötiger Gestalt, der ebenfalls unter der Linde verharrte, und dessen rotes Gesicht vor Freude und Genugtuung glänzte. Er bringe den Mund nicht mehr zusammen, meinte einer der Kirchenvorstände. »Nun, Jerg«, sagte also der Geistliche, »der liebe Gott hat euer junges Hauswesen gesegnet? Was hat er euch denn beschert?«
»Ein Pfannenstielchen oder ein Bohnenblättchen?« erkundigte sich auch der Herr Schulmeister, während die anderen ruhig umherstanden.
»Hö, hö, hö, ein Pfannenstielchen«, lachte der junge Bauer. »Und heut' über drei Wochen soll die Taufe sein, Herr Pfarrer, wenn Sie so gut sein möchten.«
»Gern, wie soll es denn heißen?«
»Poppel, hö, hö, hö! Poppel wie der Vetter Jokeb da«, war die lachende Antwort des Glücklichen, indem er auf einen breitschulterigen, stattlichen Mann zeigte, der neben dem Pfarrer stand.
»Also auf den Namen Jakob soll es getauft werden«, sagte der Geistliche. »Mutter und Kind sind wohlauf? Nun, Jerg, da wünsche ich Glück. Der Kleine macht euch wohl Freude?«
»Ah«, fing der glückliche Vater an, »so ist noch nichts dagewesen. Schon so gescheit, so vernünftig! So was gibt's nicht wieder. So lieb!«
»Alle kleinen Kinder sind lieb!« bemerkte der stattliche Vetter Jokeb.
»Ja, aber nicht so!« wandte der junge Vater ein. »So ist noch keines auf die Welt gekommen! Wie das schon schnullt und an meinem kleinen Finger zieht und suggelt; es kriegt aber nichts raus und fängt auch gleich an zu heulen, wie ein Alter.«
»Gut, in drei Wochen wollen wir es taufen, und nun Gott befohlen!« bemerkte der Geistliche, der weiter drängte, da er noch eine Filiale zu versehen hatte.
Jetzt erst fanden die Männer Zeit, ihm ihren Dank für die schöne Predigt auszusprechen, worauf er diejenigen von Pleisweiler mit einem »Guten Appetit« entließ und in Begleitung der Presbyter die Landstraße entlang, unter den Nußbäumen hin, mit Gesprächen über die Angelegenheiten der Kirchengemeinde und über die Aussichten der Weinlese zurückwanderte.
An der Ruhebank, wo der steinerne Kreuzsockel halb versunken an der Weinbergterrasse steht und der Weg rechts nach dem stillen Dorf abzweigt, verabschiedete sich der Geistliche auch von den Männern von Oberhofen, während er einen von ihnen noch mit den Worten zurückhielt: »Seid so gut, Groß, ich habe mit Euch zu reden.«
Der, ein schlanker, junger Mann, trat an des Geistlichen Seite, um ihm mit dem Schulmeister noch das Geleit zu geben. Er war von gerader, stracker, hoher Gestalt und stolzer, stattlicher Haltung, wie man es öfters bei jenen Bauern trifft. Wie ein Freiherr trug er den Kopf in einem stehenden Kragen. Vor vierzehn Jahren hatte er als Fremder in das Dorf geheiratet, wurde hier aber, auch von der Verwandtschaft seiner Frau, als Eindringling angesehen; die reichen Bauern ließen ihn beiseite. Mißgünstig erwartete man von seiner »Lebesucht« einreißende Unordnung und Rückgang der Vermögensverhältnisse seiner Frau. Als man aber seine Tätigkeit erkannte, Haus und Feld unter ihm sichtlich gedieh, lernte man ihn anders beurteilen. Und jetzt saß der verhältnismäßig noch junge Mann bereits im Presbyterium und im Gemeinderat.
Von der Ruhebank führte die Straße durch Weingärten sanft bergan. Man kam flüchtig auf den glücklichen Vater zu sprechen, der eine Stieftochter von Groß zur Frau hatte, und meinte, nach reichlicherem Kindersegen werde Jerg sein Glück gelassener tragen. Darauf wandte sich der Geistliche plötzlich an seinen Begleiter.
»Groß, als Kirchenvorstand steht Ihr doch fest zur Union?«
»Versteht sich, Herr Pfarrer, gewiß.«
»Wie kommt's denn, daß man weder Eure Frau, noch Euer Töchterchen in der Kirche sieht? Wollt Ihr denn das Kind nicht konfirmieren lassen?«
»Ich schon, Herr Pfarrer.«
»Aber sie leidt's nicht!« ergänzte der rechts gehende Schulmeister, während er seinen auffällig weiten Nasenöffnungen geräuschvolle Prisen zuführte.
»Wie?« fuhr der Geistliche auf. »Ihr seid doch der Mann, Groß, um dafür zu sorgen, daß aus dem Hause eines Presbyters kein Ärgernis und böses Beispiel kommt.«
»Herr Pfarrer«, entgegnete der junge Kirchenälteste, »ich halt' es, wie in unserer unierten Kirche, auch in meinem Hause mit der Gewissensfreiheit, die uns durch die Unionsurkunde von Anno 1818 verbürgt ist.«
»Gewissensfreiheit ist recht schön«, versetzte der Geistliche bedenklich. »Nur darf sie nicht bis zur Gleichgültigkeit in Kirchensachen gehen.«
»Lassen wir's gut sein, Herr Pfarrer«, bemerkte Groß gelassen. »Kommt Zeit, kommt Rat. Einstweilen weich' ich gern dem Zwist im Hause aus. Mit Widersprechen kommt's leicht zum Brechen. Um es dazu kommen zu lassen, ist doch eine Ursache, ein richtiger Grund nötig.«
»Ist denn Frau Groß so unzulänglich?« fragte der Geistliche.
»Ja, sie ist ihres Kopfs!« war die lächelnde Antwort.
»Nun, ich will doch einmal mit ihr selbst sprechen, wenn sich bei der Taufe ihres Enkels Gelegenheit dazu gibt. Ich denke nicht, daß es besondere Schwierigkeiten machen wird.«
»Na, Herr Pfarrer, da werden sie die Bas Juliane kennenlernen«, sagte der Schulmeister, und wollte noch etwas hinzufügen, aber verstummte verblüfft.
Denn unerwartet trat eine stattliche Frau im halben Sonntagsstaat links aus den Reben, und mit einem etwas trockenen: »Guten Morgen, Herr Pfarrer«, gesellte sie sich der kleinen Gesellschaft bei.
»Du hast wohl gewußt, Henrich, daß ich in den Wingerten bin, und willst mich heimholen?« fragte sie Heinrich Groß.
»Nein, Frau Groß«, nahm der Geistliche das Wort, »ich forderte Ihren Mann auf, mich zu begleiten, weil ich wegen der Konfirmation Ihrer Tochter mit ihm reden wollte. Die Pfarrstunden beginnen bald. Sie wollen doch Ihre Tochter konfirmieren lassen?«
»Ja«, sagte Juliane, »meine Susel soll, wie ihre Eltern und Großeltern, im angestammten reformierten Glauben konfirmiert werden!«
»Dann ist ja alles in Ordnung, und Susanne wird mit den anderen Kindern die Pfarrstunden in Münster besuchen.«
»Das habe ich nicht gesagt, Herr Pfarrer«, sagte die Frau ruhig. »Da hab' ich noch gar manche Bedenken. Warum denn in Münster?«
»Ei, weil's der Pfarrort ist.«
»Warum ist's aber der Pfarrort?«





























